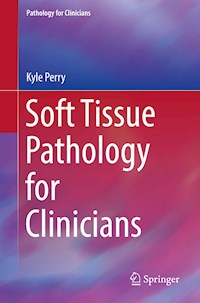12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Atrium Verlag AG
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
An der dramatischen Küste der Tasmanischen Halbinsel wird ein Junge angespült, übersät mit blauen Flecken und gebrandmarkt mit einem rätselhaften Tattoo, das ihn als Forest Dempsey identifiziert, jenen 13-jährigen Jungen, der vor sieben Jahren spurlos verschwand und seitdem für tot gehalten wurde. Was ist passiert? Da Forest hartnäckig schweigt, machen sich die Cousins Mackerel und Ahab Dempsey auf die Suche nach Antworten. Unerbittlich werden sie dabei zurück in den Strudel der verbrecherischen Machenschaften ihrer Familie gezogen, den sie eigentlich verlassen hatten. Und es wird immer schwieriger, zwischen richtig und falsch, zwischen Moral und Loyalität zu unterscheiden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 628
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Kyle Perry
Der Rausch der Tiefe
Thriller
Aus dem Englischen von Sabine Längsfeld
Diese Übersetzung wurde mit der finanziellen Unterstützung des Förderungs- und Beratungsgremiums für Kunst des Australia Council for the Arts der australischen Regierung veröffentlicht.
© Arche Atrium AG, Zürich, 2022
Alle Rechte vorbehalten
Die Originalausgabe erschien 2021 unter dem Titel The Deep bei Penguin Random House Australia Pty Ltd. Diese Ausgabe wurde in Vereinbarung mit Penguin Random House Australia Pty Ltd via Michael Meller Literary Agency GmbH, München veröffentlicht.
© Kyle Perry, 2021
Aus dem Englischen von Sabine Längsfeld
Covergestaltung: Sund Design nach einem Entwurf von Adam Laszczuk © Penguin Random House Australia Pty Ltd.
Coverillustration: © Getty Images/Sirachai Arunrugstichai, © Shutterstock/Maximillian Cabinet
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
ISBN978-3-03792-205-7
www.atrium-verlag.com
www.facebook.com/atriumverlag
www.instagram.com/atriumverlag
Ryan Barber,
ohne dich hätte ich das nicht geschafft
Ich zolle den traditionellen Hütern des Landes Respekt, den Paredarerme, Hütern von Teralina und Turrakana – auch bekannt als Eaglehawk Neck und Tasman-Halbinsel. Ich zolle den Ältesten der Vergangenheit, der Gegenwart, der Zukunft Respekt.
Ich würdige die gegenwärtige Aboriginal-Gemeinde auf ganz Lutruwita, sie sind die Hüter dieser Insel. Ich würdige ihre immerwährende Verbindung zum Land, zu den Gewässern und zur Kultur.
Zieht morgens schwarzer Wind heran,
rette sich vom Meer, wer kann.
Zieht schwarzer Wind des Abends auf,
nehmen Tod und Sterben ihren Lauf.
Seemannsspruch von der Tasman-Halbinsel
Die Sirenen der Tasman-Halbinsel gelten als
bösartige Geschöpfe, welche Seeleute in den
sicheren Tod locken … Ihre Gesänge, so heißt es,
seien betörend und wunderschön und hätten
schon viele Seelen in die Tiefe gerissen …
Aus Tasmanische Sagen von Cheryl Stirling
Der Sirenen Lockgesang
ereilte mich auf See.
Ihr Blick so heiß, die Gier so groß,
und ich voll Ach und Weh,
floh feige heim und brachte mich
in trügerische Sicherheit.
Doch schickten sie fernab vom Meer
den schwarzen Wind mir hinterher,
auf dass ich nimmer fliehen kann
der Sirenen Lockgesang.
Dr. William Ashbury, um 1850
Prolog
Pirates Bay, Tasmanien
Der Junge schnappte nach Luft, den Mund voll nasser Haare, dann schleuderte ihn die nächste Welle zurück auf den Grund. Er überschlug sich, um ihn herum schäumende Gischt.
Wieder kam er an die Oberfläche. Der nächste verzweifelte Atemzug. Brennende Augen suchten das Ufer. Im ersten Morgengrauen war das Meer nur aufgewühltes Grau, die dunklen Eukalyptusbäume zum Greifen nahe.
Die nächste Welle riss ihn wieder von den Füßen, lange Tangfäden griffen nach seinen Gliedern. Als der Sog der Brandung ihn zurück ins Meer zu zerren drohte, klammerte er sich daran fest. Seine Hände waren taub vor Kälte; er bekam den Seetang nicht richtig zu fassen, aber er schaffte es, sich dicke Stränge um die Handgelenke zu schlingen, angetrieben von Adrenalin und Angst.
Die Brandung zog sich schäumend zurück, und einen Augenblick lang blieben Kopf und Oberkörper über Wasser.
»Hilfe!«, schrie er heiser.
Wieder schlug tosend eine Welle über ihm zusammen, wieder war der Junge unter Wasser. Der Tang um seine Handgelenke verhinderte, dass er mitgerissen wurde, und er hielt die Luft an, bis die Brandungswelle zurückgewichen war.
Ein Hund bellte über den Lärm von Wind und Wellen hinweg.
Der Junge zog sich vorwärts. Er spürte Sand unter den Füßen.
Als die nächste Welle kam, ließ er sich in einem Wirbel aus Gischt, Sand und Schlick in Richtung Strand tragen. Wieder und wieder wurde er herumgeschleudert, bis er nicht mehr wusste, wo oben und unten war. Die Arme im Tang verfangen, die Stirn aufgeschürft an schartigem Fels.
Während sich das Wasser zurückzog, rollte er sich weiter bis zu einer Spalte in den zerklüfteten Uferfelsen. Er schnappte nach Luft. Neben ihm brachen tosend die Brandungswellen. Noch hatte er es nicht geschafft. Er robbte bäuchlings vorwärts. Die Beine hatten keine Kraft mehr, eisiger Wind schnitt in seinen nackten Rücken.
Dann tauchte in dem Gezeitentümpel neben ihm ein Schäferhund auf, bellte, stieß ihm die Schnauze in die Armbeuge.
Bei der nächsten Welle krallte sich der Junge mit blutenden Fingern an den Felsen, neben ihm der jaulende Hund.
Plötzlich wurde er grob unter den Achseln gepackt und hochgezerrt.
»Ich hab ihn!«, rief eine Männerstimme. »Hier! Er atmet noch!«
Der Hund schüttelte sich das Wasser aus dem Fell und leckte dem Jungen die aufgeschürften Schienbeine. In sein Jaulen mischten sich Stimmen. Schon scharten sich Leute um den Jungen, trugen ihn über die Felsen zum Sandstrand hinauf. Der Mann, der ihn gefunden hatte, legte ihn auf den Rücken und drückte ein Ohr an seine Brust.
Der Junge schlug die sandverklebten Augen auf.
»Er lebt«, sagte eine Frau. »Gott sei Dank, er lebt.«
Ihr Gesicht war direkt vor seinem. Er wich panisch zurück, krabbelte mit letzter Kraft seitwärts weg von ihr, drängte sich an den hechelnden Hund. Der Geruch von nassem Fell und Seetang beruhigte ihn etwas.
Die Leute standen immer noch dicht um ihn geschart. »He, Junge, ganz ruhig«, sagte der Mann, der ihn gefunden hatte.
Die Schürfwunden brannten, ihm tat alles weh. Er zitterte vor Kälte, sein Herz raste. Er musste fliehen …
Doch der Anblick des trockenen Handtuchs, das die Frau ihm hinhielt, milderte seine Panik, und ein neuer Gedanke schaffte es an die Oberfläche seines Bewusstseins.
Die sind gekommen, um dich zu retten.
Du brauchst ihre Hilfe.
Er bezwang seinen keuchenden Atem und beruhigte sich etwas.
»Danke«, krächzte er. Kehle und Nase brannten, er war heiser vom Salzwasser.
Er drehte sich zu dem Hund um und vergrub das Gesicht im nassen Fell. »Danke, Zeus«, flüsterte er. »Du hast es geschafft.«
»Verfluchte Scheiße«, sagte der Mann. »Was ist das denn?«
Dem Jungen war klar, wie erbärmlich er aussehen musste. Klein, dürr, wirre blonde Haare. Alles voll mit Sand und Tang. Nichts am Leib außer Surfshorts, die Gänsehaut übersät mit Abschürfungen und Schnitten und runzligen Narben.
»Nein, das kann nicht sein!«, keuchte die Frau. »Nach sieben Jahren?«
Quer über dem knochigen Schulterblatt, von dem noch immer eiskaltes Meerwasser perlte, prangte eine schlampig gestochene Tätowierung:
DAS IST FOREST DEMPSEY
PASS AUF WAS DU DIR WÜNSCHST
Kapitel eins
AHAB
Ahab Stark durchbrach mit der Harpune in der Hand die Wasseroberfläche und sog gierig die Luft ein. An seinem Handgelenk baumelte eine Unterwassertaschenlampe. Er zog sich die Tauchmaske unters Kinn und hustete. In dem grau melierten Bart hingen kalte Wassertropfen, die eisblauen Augen hatten sich längst an das brennende Salzwasser gewöhnt. Er bleckte grinsend die Zähne: Diesmal hatte er’s mit dem Tauchgang fast zu weit getrieben.
Am frühen Morgenhimmel standen ein paar letzte blasse Sterne. Wolken waren nirgendwo zu sehen, aber er hatte unter Wasser das vibrierende Brummen gehört, die Gegenströmung gespürt. Hier, zwischen den einzelnen Riffs, die verstreut in der Bucht lagen, war sie leicht zu fühlen. Und er hatte einen Schwarm Lachsbarsche in tiefere Gewässer fliehen sehen.
Der schwarze Wind kam auf.
Ahab legte sich auf den Rücken und überließ sich der trügerischen Stille, die den kommenden Sturm ankündigte. Natürlich war der Ozean niemals wirklich still, aber trotzdem empfand Ahab all dies als die wahre Stille. Nur Geräusche der Natur, um ihn herum nichts als die ewige Bewegung des Wassers – Warten mit angehaltenem Atem. Gelöst ließ er sich treiben und sah zum hell werdenden Himmel hinauf.
»Die Zeit nehme ich mir«, sagte er nach oben gewandt.
Als ihm Kälte und Wind schließlich bis in die Knochen drangen, paddelte er mit ein paar Schlägen seiner mattschwarzen Flossen hinüber zu dem vor Anker liegenden Schlauchboot. Triefend kletterte er die Leiter hoch. In einem Beutesack an seiner Hüfte steckten die erlegten Fische – genug King Flathead, um in seinem Pub als Fang des Tages auf die Karte zu kommen. Er legte Maske und Schnorchel ab, dann Harpune und Taschenlampe und zog sich die Flossen aus.
Sein Tauchpartner Ned ließ sich auf der anderen Seite des Boots auf dem Wasser treiben. Im Gegensatz zu Ahab trug Ned einen bunten Neoprenanzug – dem Jüngeren war das Wasser sogar im Hochsommer zu kalt. »Die Fische sind alle verschwunden, Ahab«, rief Ned. »Glaubst du, er kommt? Der schwarze Wind?«
»Definitiv«, rief Ahab zurück.
Ned kletterte ins Boot und schälte sich zitternd aus dem Anzug, ohne sich seiner Nacktheit zu schämen. Er frottierte sich die langen Haare und prüfte das Ergebnis mithilfe seiner Handykamera, ehe er den Rest seines schlaksigen Körpers trockenrubbelte.
»Lass uns abhauen«, sagte Ahab, sobald sie beide angezogen waren.
»Schau mal«, sagte Ned und zog sich den Reißverschluss der dicken Jacke zu. »Da drüben sind noch welche.«
Zwischen dem Auf und Ab der Wellen kam immer wieder ein Schiff in Sicht.
»Alles okay«, sagte Ahab. »Die werden die Zeichen schon lesen.«
Er musterte den Himmel – er war noch immer fast wolkenlos, nur ein paar feine, hohe Federwolken wurden von den ersten Strahlen der aufgehenden Sonne in ein blasses Rot getaucht. Ahab musste sich eingestehen, dass es eigentlich noch keine eindeutigen Anzeichen gab. Der schwarze Wind tauchte oft wie aus dem Nichts auf, fast ohne jede Vorwarnung. Und hier waren ständig irgendwelche Typen von auswärts unterwegs.
Ahab stieß einen Seufzer aus. »Okay. Wir fahren besser mal rüber.«
Er warf den Motor an und hielt auf das andere Boot zu. Der Bug durchpflügte dunkle, ineinanderfließende Wellen, während sich das erste Morgenrot auf die flüssigen Kronen legte.
Als sie näher kamen, drosselte Ahab abrupt die Geschwindigkeit. Er kannte das Boot. Es war die Absconder, das Abalone-Mutterschiff, ein 18-Meter-Westcoaster mit Flybridge, Tanks für lebende Abalonen und einem Kran auf dem hinteren Deck. Das Schiff gehörte dem Boss von Dempsey Abalone – Davey Dempsey, seinem Cousin.
Ahab ging längsseits und machte sein Schlauchboot an der Absconder fest.
»Ich bleib hier, oder?«, fragte Ned.
»Halt dich bereit, vielleicht muss es schnell gehen«, raunte Ahab, hievte sich durch die Tauchklappe und stieg an Deck.
Am Heck stand Davey mit Chips, seiner Assistentin und rechten Hand. Sobald er hörte, dass jemand an Bord seines Schiffes ging, fuhr er herum. Davey war eine beeindruckende Erscheinung, dunkelhaarig und muskulös; die hochgekrempelten Ärmel seines Hemds entblößten unverwechselbare Tribal-Tattoos. Sein raues Gesicht war, wie Ahab Ned irgendwann mal voller Neid hatte sagen hören, »ungerecht attraktiv«.
Er schenkte Ahab ein säuerliches Lächeln. »Ach was, Verwandtschaft. Willkommen an Bord.«
Chips trug eine warme Weste in Signalfarbe, die mehr für Bequemlichkeit als für Stilbewusstsein sprach, und hatte ihre langen, sandblonden Haare unter einer blauen Baseball-Cap zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden. Sie grüßte Ahab mit einem respektvollen Nicken. Er hatte ihr damals, als sie vor ewigen Zeiten die Highschool geschmissen hatte, ihren ersten Job gegeben und sie irgendwann für die »Firma« empfohlen.
Sie war ihm heute noch dankbar dafür. Ahab hingegen wünschte, er könnte es ungeschehen machen.
»Was verschafft uns die Ehre?«, fragte Davey, an die Reling gelehnt. Es gab gute Gründe für sein Misstrauen gegen Ahab, doch er versuchte trotzdem, sich nichts anmerken zu lassen.
»Der schwarze Wind kommt auf.«
Davey zog eine Grimasse. »Wie lange noch?«
»Eine Stunde. Vielleicht zwei.«
Davey saugte an der Unterlippe, ging nach vorn zum Bug und sah hinaus aufs Meer. Ahab folgte seinem Blick. Ein paar Alu-Außenborder dümpelten in Sichtweite. »Eine Stunde, hm …«
Abalonen-Fischerei war ein eigenartiges Geschäft. Die Meeresschnecken, auch als Seeohren bekannt, wurden von den Tauchern abgesammelt, die gerade jetzt da unten waren. Die dicke Innenschicht des ohrmuschelförmigen Schneckengehäuses bestand aus schillerndem, farbenprächtigem Perlmutt, doch es war das Fleisch, das die Tiere so wertvoll machte – roh oder gekocht eine Delikatesse, war es in Asien so begehrt wie Gold. Tasmanien lieferte etwa ein Viertel der weltweiten jährlichen Abalonen-Ernte.
Die kleinen Boote, die rund um die Absconder verstreut lagen, waren mit Helfern bemannt, die das Boot direkt über den betreffenden Tauchern hielten. Die Taucher wiederum klaubten die auf Felsen sitzenden Abalonen ab und schickten sie in Beutesäcken an die Oberfläche. Kleine Schirme gaben den an Leinen befestigten Beuteln Auftrieb, indem die Taucher sie mit Luft aus dem Atemregler befüllten.
Beutesäcke voll mit Abalonen und anderem, wie Ahab nur zu gut wusste. Zeug, das von Lieferanten hier draußen deponiert wurde, um von Davey eingesammelt, zurück an Land gebracht und verkauft zu werden, am Gesetz vorbei und direkt unter der Nase der Polizei.
»Die sind später auch noch da«, sagte Ahab.
»Ja, im Meer ist immer mehr als genug«, stimmte Davey ihm zu. »Aber wir haben trotzdem eine Fangquote. Dem Geschäft ist der Wind egal. Ich geb den Tauchern nachher Signal.«
»Willst du das wirklich riskieren?«
Davey richtete sich auf. »Vergiss nicht, mit wem du sprichst.«
»Ich weiß sehr gut, mit wem ich spreche.«
Chips verlagerte das Gewicht und ließ ihren Blick nervös zwischen den zwei Männern hin- und herschweifen.
Davey lachte die Anspannung weg. »Keine Angst, Chips. Wir hegen Respekt vor den Ältesten, die uns den Weg geebnet haben.«
Vielleicht war es tatsächlich respektvoll gemeint, doch Ahab zog sich trotzdem die Brust zusammen. Die Vergangenheit ließ sich nun mal nicht mehr ändern.
Er grüßte stumm zum Abschied und kletterte in sein Boot zurück. Ned wendete, gab Gas und fuhr zurück in Richtung Shacktown.
Irgendwann würde er der Polizei von der Firma erzählen müssen, dachte Ahab. Aber konnte er das wirklich tun? Daveys Leben ruinieren, das von Chips, das von so vielen anderen?
Doch was war mit den Menschen, deren Leben sie ruinierten?
Verärgert schob er den Gedanken beiseite. Wie schon so oft.
Ihm waren die Hände gebunden – noch. Sosehr es ihn quälen mochte, ihn manchmal bis an den Rand des Wahnsinns trieb, Ahab stand zu seinem Wort.
Trotzdem. Auch seine Selbstbeherrschung hatte Grenzen. Irgendwann würde er einen Grund finden, sein Versprechen zu brechen.
Als sie sich den Klippen näherten, stieg aus Devils Kitchen Dunst auf wie rosaroter Rauch. Devils Kitchen war ein riesiger, tiefer Spalt in den Klippen von Pirates Bay, ein von Wasser, Wind und Zeit gefurchter Abgrund, in dem ein lebensgefährlicher Strudel wilder Wellen zu Hause war. Dieser Wirbel verwandelte die Dünungen des riesigen südlichen Ozeans in einen brodelnden Hexenkessel. Devils Kitchen war gigantisch, überwältigend und höllisch gefährlich. Doch der Name stammte woandersher: Frühe europäische Siedler hatten an dieser Stelle Dunst aufsteigen sehen und behauptet, dort unten würde der Teufel seinen Fleischkessel anheizen.
Dann kamen die Häuser von Shacktown in Sicht. Sie waren über die bewaldeten Hügel verstreut, bis an den Rand der steilen Klippen und die Strände der Bucht. Ahab ließ den Blick über den Ort schweifen, über die herrschaftlichen Strandvillen, die schlichten Ferienhütten und all die anderen Häuser, die versteckt zwischen Banksiasträuchern, Kasuarinenbäumen und Sand lagen.
Als sie die Landspitze umfahren hatten und auf das Labyrinth der hölzernen Anleger zuhielten, sahen sie in der Ferne, drüben am Nordstrand, die blau-roten Signalleuchten von Einsatzfahrzeugen blinken, eindeutig Polizei- und Rettungswagen.
»Was ist denn da los?«, rief Ned über den Motorenlärm hinweg.
»Das werden wir sicher gleich erfahren«, antwortete Ahab.
Die Bewohner von Shacktown liebten Tratsch und Klatsch, und im Hafen war trotz der frühen Uhrzeit ziemlich was los.
Ned steuerte ihren Anleger an und machte das Boot fest, während Ahab seinen Beutesack nahm und leichtfüßig auf den glitschigen Holzsteg sprang.
Er ging auf eine ins Gespräch vertiefte Gruppe Fischer in wasserfester Ausrüstung zu.
»Ho!«, rief Ahab. »Heute geht gar nichts, Jungs! Der schwarze Wind ist im Anmarsch …«
»Ahab!«, sagte einer der Männer. »Hast du’s schon gehört?«
»Was ist denn passiert?«
»Sie haben Forest gefunden. Forest Dempsey!«
Ahab ließ den Beutel fallen.
Die Fischer wichen zurück, als sie den Ausdruck in seinen Augen sahen.
Kapitel zwei
MACKEREL
Mackerel Dempsey zog an seiner E-Zigarette. Er stand gerade so weit vom Eingang zur Polizeistation von Shacktown entfernt, wie es die Höflichkeit verlangte. Der Traubengeschmack des Liquids füllte seinen Mund und brannte in der Kehle. Es schmeckte nach Lolli. Die Dampfwolke blieb einen Augenblick lang vor seinem Gesicht in der Luft hängen und löste sich dann in der Brise auf. Das Polizeirevier war renoviert worden; stilisierte Meeresvögel umschwirrten die Fenster. Es sollte freundlich und einladend wirken, damit die Touristen sich sicher fühlten.
Der erste Bus des Tages rumpelte vorbei, ein roter Doppeldecker mit offenem Oberdeck. Es wimmelte von breitkrempigen Hüten und Kameras. Eine Frau mit sonnenverbranntem Gesicht winkte Mack fröhlich zu. Auf dem Bus stand der Slogan: MEHR TASMANIEN? TASMANIENS MEER!
Mack winkte zurück und nahm noch einen Zug. Er zögerte seinen täglichen Besuch auf dem Revier so lange wie möglich hinaus.
Eaglehawk Neck war eine schmale Landzunge etwa fünfzig Kilometer östlich von Hobart und teilte die Tasman-Halbinsel ziemlich genau in der Mitte. Shacktown hatte diesen malerischen Landstrich erobert und verschlungen wie Sonnenschirme einen überlaufenen Strand. Die Gegend hatte atemberaubende Ausblicke zu bieten, eine geologisch einzigartige Landschaft, die höchsten Meeresklippen Australiens und einige der größten erforschten Unterwasserhöhlen – sowie jede Menge unerforschte obendrein. Es gab grüne Parks und weiße Strände, Geschäfte und Cafés, Nervenkitzel und Folklore. Shacktown bot etwas für jeden Geschmack. Der Ort war definitiv eine Reise wert.
Die Bewohner von Shacktown hatten mit ihrer freundlichen, aufgeschlossenen Art Touristen gegenüber an diesem Reiz einen wesentlichen Anteil. Bereitwillig öffneten sie ihnen über Airbnb ihre Häuser, luden Wildfremde am Strand auf ein Mittagessen in ihre Cafés ein, drängten Urlauber dazu, sich in ihre Gästebücher einzutragen, oder bestanden, wenn diese gerade nicht zur Hand waren, auf einer Ansichtskarte vom nächsten Reiseziel oder zumindest einer Freundschaftsanfrage auf Facebook.
Hinter alldem, für kaum jemanden erkennbar, hielt die kriminelle Dempsey-Dynastie die Fäden in der Hand. Und Mackenzie Dempsey, von den meisten nur Mackerel – Makrele – genannt, war das schwarze Schaf der Familie. Er hatte eine schiefe Nase, war tätowiert und besaß eine höchst imposante Figur, die eigentlich automatisch Respekt einflößen sollte. Trotzdem war er irgendwie immer und überall nur die Witzfigur. Sein Vater hatte einmal gesagt, er würde es regelrecht ausdünsten – als würde er darum betteln, schikaniert zu werden.
Die automatische Schiebetür zur Polizeistation glitt auf, und ein alter Mann in zerrissenem Steppanorak und fleckiger Arbeiterhose trat auf die Straße. Er nickte Mackerel zu und kam auf einen kurzen Schwatz zu ihm rüber, die Zigarette schon in der Hand. »Hey, Mack. Na, alles gut heute?«
Sie begegneten sich jeden Tag – jeden beschissenen Tag. Beide unterlagen der Auflage, sich täglich auf dem Revier zu melden, und hatten jeweils beschlossen, es gleich morgens hinter sich zu bringen. Der Alte roch ungewaschen, war grundsätzlich besoffen, und niemand blieb je stehen, um sich mit ihm zu unterhalten – weswegen Mackerel sich besondere Mühe gab.
»Gut, so weit«, sagte Mack. »Will gleich mit dem Boot raus. Hab endlich mal wieder ein paar Stunden Arbeit. Und bei dir?«
»Tut mir ja echt leid für dich, Buddy, aber der schwarze Wind soll bald aufkommen.«
»Nein …«
Mackerel konnte sich nicht noch einen Tag ohne das mickrige Einkommen leisten, das er bei dem einzigen Fischer im Ort verdiente, der ihm noch Arbeit gab – und der gleichzeitig sein bester Freund war.
»Na komm. Geh lieber nach Hause und besauf dich«, sagte der Alte und streckte den Rücken durch. »Komische Stimmung da drin. Ich glaub, da ist irgendeine Megakacke am Dampfen. Kann nur hoffen, dass du nicht mit drinsteckst, Mann.« Er zog an seiner Zigarette und ging lässig winkend davon, während eine Brise den Rauch davontrug.
Eine Brise, die sich draußen auf dem Meer schon bald zu einem dröhnenden Wind auswachsen würde. Der schwarze Wind. Mackerel war ein einziges Mal in seinem Leben auf See vom schwarzen Wind erwischt worden, und die Erinnerung daran jagte ihm noch heute Schauer über den Rücken. Der Sturm zog und zerrte an den Wellen wie ein Zyklon. Dieser ungebändigte Zorn, dieses Chaos, dieses Gefühl, weniger als einen Mäuseschiss vom Tod entfernt zu sein und nichts tun zu können, als sich irgendwo festzuklammern und zu beten.
Mackerel schaltete die E-Zigarette aus und schob sie in die Tasche. Schon als er den Empfangsbereich des Reviers betrat, begann automatisch sein Programm abzulaufen. Unbewusst korrigierte er Haltung und Gang, um möglichst wenig bedrohlich zu wirken. Mackerel hatte ein offenes Gesicht, große, blaue Augen und ein nettes Lächeln, wie jemand ihm irgendwann mal gesagt hatte. Ein bisschen trottelig vielleicht, aber einigermaßen gewinnend. In seiner Lage brauchte er jedes Fitzelchen Liebenswürdigkeit, das er aufbringen konnte.
Auch auf dem Revier musste er auf Zack bleiben. Alle wussten, dass Mackerel vor fünf Jahren aus der Stadt gejagt worden war – aus sehr gutem Grund – und nicht hätte zurückkehren sollen. Auch wenn nur jemand mit Verbindungen zur örtlichen Unterwelt den wahren Grund dafür kannte.
»Guten Morgen, Constable Linda.«
»Ja, Morgen, Mack«, sagte Linda. Sie holte das Kautionsauflagenregister hervor, trug seinen Namen ein, setzte Datum und Uhrzeit daneben und drehte das Buch zu ihm um, damit er unterschreiben konnte. In der Bewegung lag eine gewisse Forschheit, und Mack sank der Mut. Das hieß normalerweise, es war mal wieder Zeit für eine Befragung.
Wie geht es Ihnen gesundheitlich? Wie ist die Stimmung?
Was macht die Arbeitssuche? Wie läuft es beim Psychologen? Mit wem haben Sie sich getroffen? Was haben Sie getrieben? Irgendwelche illegalen Aktivitäten? Na los, Mackerel, raus mit der Sprache … Was haben Sie getrieben?
Irgendwas, das Sie mir lieber gleich beichten? Ich finde es sowieso raus.
Der tagtägliche Gang zum Revier war die demütigende Erinnerung an alles, was er verloren hatte. Seine Würde, den Respekt sämtlicher Leute, die er kannte, die Möglichkeit, jemals länger als zwölf Stunden aus Shacktown wegzubleiben oder je wieder in seinem alten Job zu arbeiten. Als tasmanischer Fischer brauchte man einen tadellosen Leumund, und als Mackerel in den Knast wanderte, verlor er damit automatisch seine Fischereilizenz zum Abalonen-Tauchen. Was hieß, dass er nicht mal mehr tauchen durfte, um seinen Lebensunterhalt zu bestreiten – das Einzige, was er wirklich konnte.
Linda hob den Blick vom Bildschirm, erstaunt, dass Mack immer noch da war. »Haben Sie sonst nichts zu tun?«
Sie wirkte abgelenkt. Ihm fiel jetzt erst auf, dass außer ihr niemand da war. Wo steckten die alle?
»Doch, Ma’am.« Mackerel drehte sich um und verschwand, so schnell er konnte.
Keine Befragung!
Das war ein gutes Zeichen.
Aber jetzt waren seine Gedanken natürlich wieder bei der bevorstehenden Gerichtsverhandlung. Bei seiner Rehabilitierung. Und der Frage, wie er die Sache wieder in Ordnung bringen konnte.
Ich könnte in die Kirche gehen … Nein, viel zu durchsichtig. Vielleicht eine Freundin, die zur Kirche geht? Das würde doch gut aussehen.
Aber während er immer noch mit einem Bein im Gefängnis stand? Wer würde sich schon auf so jemanden einlassen?
Nur eine Frau, die unbedingt einen hoffnungslosen Fall retten wollte.
Mack hatte Angst. Wenn er zurück ins Gefängnis musste – und das war der wahrscheinlichste Ausgang des bevorstehenden Verfahrens –, wäre er wieder allein. Er wollte nicht wieder allein sein.
Missmutig humpelte er zur Apotheke rüber, während über ihm die Möwen kreischten. Von dem mobilen Kaffeestand in dem kleinen Park zog ihm der Duft von frisch gebrühtem Kaffee in die Nase. Fröhliche Kinder tobten ausgelassen auf dem Spielplatz. Die Sonne strahlte. Ohne die geriffelten Wolken, die sich am Horizont sammelten und langsam näher kamen, hätte niemand geahnt, dass der schwarze Wind auf dem Weg war.
Ein paar Männer sahen Mack vorbeihumpeln und spuckten verächtlich aus. Diese Verachtung war der Grund, warum niemand sonst im Ort ihm einen Job geben wollte. Er versuchte, sich nichts daraus zu machen. Zum Glück konnte er wenigstens ab und zu als Helfer auf dem Boot von Big Mane arbeiten, zumindest immer dann, wenn sein bester Freund Arbeit für ihn hatte.
»Morgen, Mackenzie«, sagte die Apothekerin, als die Glocke über der Tür bimmelte. Von der Decke baumelten künstliche Köder und Blinker und reflektierten das Licht. Sie öffnete den Tresor, holte seine Tablettenbox heraus und gab ihm zwei Pillen und eine Sublingualtablette in die Hand. Er musste beides direkt vor ihren Augen einnehmen.
»Ein Glas Wasser dazu, Darling?«
Er mochte die Apothekerin aus vielen Gründen, vor allem aber, weil sie immer nett zu ihm war.
»Nein danke, Ma’am, heute nicht.«
Ein Antidepressivum. Ein Schmerzmittel. Ein Substitutionsmittel namens Suboxone – er war im Gefängnis danach süchtig geworden. Na ja, er war derjenige gewesen, der das Zeug im Knast vertickt hatte, aber trotzdem.
»Wie geht’s?«, fragte er.
»Gut, danke, Mackenzie. Sie gehen aber heute nicht aufs Boot, oder? Haben Sie schon die Wettervorhersage gehört?«
»Ja, Ma’am. Heute wird nicht rausgefahren.«
»Oh, gut!« Sie nickte, eine kleine Sorgenfalte zwischen den Augenbrauen. »Ich weiß, dass Sie das Risiko lieben.«
Wie das Risiko, mit Drogen zu dealen.
Wie das Risiko, trotz der eindeutigen Warnungen nach Shacktown zurückzukehren.
Wie das Risiko, das in der Hoffnung verborgen lag, eines Tages doch wieder ein normales Leben führen zu können.
Er lachte. »Das ist vorbei. Ich habe genug Risiken für ein ganzes Leben auf mich genommen. Hat sich nicht gelohnt.«
Er meinte es ernst.
Er hoffte, dass es auch so rüberkam.
Er lächelte und humpelte zur Tür. Die Schmerzen in seinem Knie schienen in letzter Zeit schlimmer zu werden, aber der Aufwand, sich eine höhere Dosis zu besorgen, war für jemanden wie ihn zu groß. Er bekam seine tägliche Ration ausschließlich in der Apotheke – seine Medikamente waren unter Verschluss, wurden strengstens reguliert, und er durfte nichts davon mit nach Hause nehmen.
»Einen schönen Tag noch, Mackenzie«, rief ihm die Apothekerin nach.
»Danke, Ma’am, Ihnen auch. Und falls ich irgendwas für Sie besorgen kann …« Sie lachten beide. Es war ein mieser Witz. Ein Dealerwitz. Der vor Gericht garantiert ganz schlecht rüberkommen würde.
Sobald er wieder auf der Straße stand, zog er eine schmerzliche Grimasse. Es tat weh, derart auf dem Trockenen zu sitzen – der alte Mack hätte jede Menge Quellen für viel bessere Schmerzmittel parat gehabt.
Nicht dran denken. Kopf hoch, Buddy.
Er musterte den Himmel. Die geriffelten Wolken breiteten sich schnell aus. Ein fernes Dröhnen lag in der Luft, ein unheimliches Geräusch, das ihm unter die Haut ging und dafür sorgte, dass sich ihm die Nackenhaare aufstellten.
Sein Morgenritual war beendet, und er hatte bis zu seiner Ausgangssperre um acht Uhr abends nichts mehr zu tun. Er könnte nach Hause gehen, raus aus dem Wind. Er machte sich auf den Weg und wich einer Schar Touristen mit großen Sonnenhüten aus, die den Eingang zum Surfshop belagerten.
Wenn er doch nur einen Job hätte, der nicht von Big Mane und seinem Boot abhing.
Vor Macks innerem Auge tauchte ein ganzer Schwall Ideen und Möglichkeiten auf. Was er alles auf die Beine stellen könnte, wenn er das nötige Geld hätte und ein paar Leute, die für ihn arbeiteten!
Er verdrängte die Gedanken. Versuchte es zumindest. Doch sein Verstand kam nie wirklich zur Ruhe. Ängste und posttraumatischer Stress. Und prätraumatischer Stress. Er bereute, was er getan hatte, er versuchte, sich zu rehabilitieren, er wollte nicht wieder ins Gefängnis, dieser Lärm dort und die Intrigen und die …
Er wünschte sich vom Leben nicht mehr als ein eigenes Dach über dem Kopf, eine Frau und vielleicht noch einen Hund. Er wollte wieder tauchen dürfen und gutes, auf ehrliche Weise verdientes Geld nach Hause bringen. Keine Schrottkarre aus dritter Hand mehr fahren, die fast so alt war wie er und es in Shacktown kaum die Hügel raufschaffte. Nicht mehr von Opioid-Ersatz abhängig sein, nur um den Tag durchzustehen, oder von Schmerzmitteln, gegen die er längst eine Toleranz entwickelt hatte.
Wen wollte er hier eigentlich verarschen? Es hatte keinen Sinn, irgendwelche Zukunftspläne zu schmieden. Bis zu seiner Verhandlung konnte er gar nichts tun. Bis er höchstwahrscheinlich wieder in den Knast wanderte. Und dann würde er bis zu seiner Entlassung warten müssen. Ein halbes Jahr oder sieben. Das hing allein von der Laune des Richters ab. Mackerel konnte nicht darauf zählen, dass irgendjemand aus seiner Familie ein gutes Wort für ihn einlegte.
Abgesehen davon hatte die Staatsanwaltschaft bereits durchblicken lassen, dass man es auf ein möglichst hohes Strafmaß anlegte.
Schluss. Sei still. Sei dankbar für das, was du jetzt hast.
Obwohl niemand in der Nähe war, der es hätte sehen können, zwang Mack sich zu einem Lächeln. Strahlend. Verbindlich. Echt.
Einnehmend. Er war Mackerel Dempsey, und er hatte sich verändert.
Mit hocherhobenem Kopf ging er auf Big Manes Haus zu, auch wenn niemand da war, der in seine Richtung sah.
Big Mane wohnte in einem gedrungenen, von Koniferen umstandenen Flachbau aus schmutzig roten Ziegeln. Rechts und links davon erhoben sich schlanke, A-förmige Strandhäuser, die im Vergleich neu und sauber wirkten, aber gerade diese Mischung machte Shacktown aus. Reich und Arm und alles dazwischen, in Shacktown war jeder willkommen.
Abgesehen von den Villen oben in den Hügeln ließen sich die Ortsteile nicht wirklich kategorisieren. Der Ort war aus einer Ansammlung von Hütten entstanden, und die alten Hüttenbesitzer wachten eifersüchtig über ihr Eigentum – auch als die Stadt um sie herum immer größer wurde und die Grundstückspreise stetig weiter stiegen.
Die Hügel der Halbinsel sorgten für reichlich Meerblick, trotzdem gab es an bestimmten Stellen in der Stadt besonders reizvolle Fleckchen – wahre Postkartenidyllen mit Ausblick auf Land und Meer und Strand. Anstatt sich nur auf eine Ecke zu konzentrieren, verteilten sich die wohlhabenden Aussteiger, die sich auf der Jagd nach den Filetstücken des Grundstücksmarkts in Shacktown niederließen, über den gesamten Ort.
Inzwischen waren die meisten der alten Ferienhütten zu ganzjährig nutzbaren Wohnhäusern umgebaut worden, manche so kunstvoll und einladend, dass sie es zu einer eigenen Instagram-Fangemeinde und wahren Airbnb-Pilgerstätten gebracht hatten.
Mackerel betrat das Haus durch die Hintertür. Irgendwo hörte er Big Mane an seiner Xbox.
»Ich bin wieder da«, rief Mack.
»Hast du den Wetterbericht mitgekriegt?«, erklang dröhnend Big Manes Stimme.
»Ja«, antwortete Mack. »Ist egal.«
»He! Das ist doch Schwachsinn«, rief Big Mane. »Ich geb dir so bald wie möglich wieder was zu tun, versprochen.«
»Danke, Bro.« Mack betrat sein winziges Zimmer. Winzig, aber aufgeräumt.
»Danke, Bro«, wiederholte er leise für sich.
Er würde Big Mane auf ewig dankbar sein. Dafür, dass er die Kaution gestellt hatte, dass er ihn beherbergte und ihm ein eigenes Zimmer gab … Gut, es war eng, und die Möbel waren uralt. Mackerel schlief in einem alten Stockbett, das eigentlich für Big Manes Neffen da war, die hin und wieder zu Besuch kamen, und das knarzte, wenn er sich nachts hin und her wälzte. Aber trotzdem. Hier war es sicher und sauber und still.
Er bemühte sich, im Haus so wenig Dreck wie möglich zu machen, und versuchte, seine Dankbarkeit zu zeigen, indem er weit mehr als seinen Anteil an der Hausarbeit erledigte. Er wusch, kochte, putzte und mähte den Rasen. Okay, das Bad hatte dringend mal wieder eine gründliche Reinigung nötig, und der Staubsauger war auch schon seit längerem kaputt. Und Macks Kochkünste beschränkten sich, ehrlich gesagt, auf Steak, Gemüse und Fisch, und mehrmals die Woche bestellte Big Mane abends Pizza …
Denk positiv. Du musst positiv denken.
Mackerel legte sich aufs untere Bett und starrte nach oben.
Er wischte sich über die Augen und zwang ein Lächeln auf die Lippen.
Als ich noch im Gefängnis war, hatte ich wenigstens die Kontrolle. Ich war zwar eingesperrt wie ein Hund im Zwinger, aber ich hatte alles, was ich wollte. Jeder respektierte mich, ich hatte Geld …
Jetzt bin ich immer noch ein Hund im Zwinger, nur, dass ich nichts mehr vorzuweisen habe.
Er lächelte so gezwungen, dass es wehtat. Aus dem Augenwinkel löste sich eine einzelne Träne.
Ich gebe mir Mühe. Kann denn niemand sehen, welche Mühe ich mir gebe?
Plötzlich erklangen draußen auf dem Flur laute Schritte. Big Mane kam auf seine Tür zugepoltert und stürmte ins Zimmer, ohne anzuklopfen. Sein wettergegerbtes Fischergesicht leuchtete vor Aufregung. So hatte Mack ihn noch nie erlebt. Er hielt sein Telefon in der Hand.
»Du glaubst nicht, was passiert ist, Buddy! Sie haben deinen Neffen gefunden! Forest ist wieder aufgetaucht!«
Kapitel drei
AHAB
Ahab saß auf dem Balkon seiner Wohnung über dem Mermaid’s Darling, seinem Pub mit dazugehörigem Guesthouse. Vom Strand zog heulend der schwarze Wind zu ihm rauf und brachte das ganze Gebäude zum Knarzen. Der Himmel war inzwischen völlig mit geriffelten Wolken überzogen. Der Wind zerrte an seinem Bart, befeuchtete seine Wangen. Hier im Freien war seine Wucht voll zu spüren. Ahab sah hinaus auf die Wellen mit ihren weißen Schaumkronen in der Pirates Bay, auf den mit roten Bojen gesprenkelten wilden Ozean. Schon bald würden die roten Punkte unter den Kreuzwellen verschwunden sein.
Am Strand herrschte reger Betrieb. In Jacken und Decken gehüllte Touristen standen neben den Einheimischen, in Erwartung der quadratischen Wellenmuster, die sich bald bilden würden. Es war, als würden sie auf ein Feuerwerk warten.
Er fragte sich, wer von diesen Fremden wohl von Forest Dempseys Auftauchen wusste oder sich auch nur dafür interessierte.
In der Wohnung, direkt hinter der Balkontür, klingelte das Telefon. Ein Festnetzapparat, altmodisch, rot lackiert. Bei Ahab gab’s kein Mobiltelefon.
Er lehnte sich rücklings vom Balkon nach drinnen und angelte, geschickt auf zwei Stuhlbeinen balancierend, den Hörer von der Gabel. »Mermaid’s Darling«, sagte er, den Blick abwesend aufs Meer gerichtet.
»Tut mir leid, aber ich kann dich nicht zu ihm lassen«, sagte Constable Linda.
»Du weißt, dass ich ihn sehen muss.«
»Das ist nicht so einfach, Ahab«, entgegnete sie. »Da hat sie die Hand drauf.«
»Klar hat sie das«, sagte Ahab zähneknirschend. »Dann erzähl mir wenigstens, was Forest sagt.«
»Nichts Neues. Im Grunde sagt er gar nichts. Aber eines steht fest: Der Junge hat eine Scheißangst.«
»Wir stehen uns nahe, wir sind verwandt. Mit mir spricht er bestimmt«, sagte Ahab.
»Sie ist auch mit ihm verwandt.«
»Und was ist mit Alexandra? Mit Jesse?«
»Von seinen Eltern immer noch keine Spur. Wir suchen überall, aber bis jetzt ohne Erfolg. Bei dem Wind ist eine Suche auf dem Wasser erst mal ausgeschlossen.«
»Und Forest hat nichts über sie gesagt? Keinen Ton?«
»Forest ist ein traumatisierter Teenager, der sieben Jahre lang verschwunden war«, sagte Linda übertrieben betont, als hätte sie es mit einem Kleinkind zu tun. Sie gehörte zu den wenigen Menschen in der Stadt, die mit Ahab redeten, ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen.
»Was muss ich tun, um eine Chance zu haben, ihn zu sehen?«, fragte er.
»Rechtlich gesehen hat Davey die Vormundschaft …« Linda saugte hörbar an der Unterlippe. »Tja, und das bedeutet in der Praxis, du musst …«
»… mit ihr sprechen.« Ahab packte den Hörer fester. »Ich kümmere mich drum.«
»Viel Glück.« Linda legte auf.
Den Blick nach draußen auf die Bucht gerichtet, tippte Ahab sich nachdenklich mit dem Hörer ans Kinn. Das Meer hatte inzwischen eine graublaue Färbung angenommen, und langsam wurde das weiße Kreuzmuster erkennbar, welches nur bei schwarzem Wind auftrat. Das Phänomen war als Kreuzsee bekannt und höllisch gefährlich. Ein erheblicher Prozentsatz weltweiter Schiffsunglücke ließ sich auf Kreuzsee zurückführen – ein Schiff nahm die Wellen am besten von vorn, doch das war bei Kreuzsee unmöglich, weil der Rumpf immer auch seitwärts getroffen wurde, egal, wohin er sich ausrichtete.
Und hier, in Pirates Bay, verursachte der schwarze Wind die heftigste örtlich gebundene Kreuzsee der Welt. Am Fuß der fernen Felsvorsprünge bildeten sich weiße Schaumkronen. Wer näher dran war, dem jagte das saugende Schmatzen der von den Kreuzwellen erzeugten Strudel eisige Schauer über den Rücken. Das galt selbst für hartgesottene Seeleute.
Das Meer war grundsätzlich unbeständig und unberechenbar, das lag in seiner Natur. Die Kreuzsee jedoch beleidigte Ahabs Verständnis von Fair Play.
Während er das Wasser im Blick behielt, arbeitete Ahabs Verstand auf Hochtouren.
Was sollte er wegen ihr nur tun?
Es klopfte an der Tür. »Ahab?«, erklang Neds Stimme.
Ahab legte den Hörer zurück auf die Gabel. Er tätschelte kurz Keegan, seinen Hund, der nur träge mit dem Schwanz gegen die Sonnenliege schlug, stand auf, durchquerte die kleine Wohnung und ging an die Zwischentür zu den darunterliegenden Gästezimmern. Hätte der Hund Neds Stimme nicht erkannt, hätte er entschieden anders reagiert.
»Von Jesse oder Alexandra keine Spur, aber Forest wurde nach Hobart ins Royal Hospital gebracht«, berichtete Ned.
»Danke, Buddy.«
»Wie lautet der Plan?«
»Ich muss mit ihr sprechen.«
Ned zuckte zusammen. »Willst du … ich meine, soll ich mitkommen?«
Ahab wusste seinen Mut zu schätzen.
»Alles gut, Buddy.« Er griff zu seiner Jacke und machte sich auf den Weg nach unten.
»Roger!«, rief Ned ihm erleichtert hinterher.
Ahab war in Gedanken schon wieder bei ihr.
Ivy Dempsey.
Tante Ivy.
Sie war die Mutter von Jesse, Davey und Mackenzie Dempsey. Sie war die reichste Frau der Stadt und die korrupteste. Sie war so gefährlich wie die Gezeiten. Wenn er ehrlich war, schätzte Ahab die Chancen, die Kreuzsee zu überleben, höher ein als eine Begegnung mit Ivy.
Ahab ging den Fußweg zum Tessellated Pavement hinunter, ebenfalls eine beliebte Touristenattraktion. Es handelte sich um eine ins Meer hineinragende, flache Felsformation, die von einem rechteckigen Muster aus tiefen Rillen durchzogen war, geometrisch derart präzise, dass sie wie von Menschenhand gemacht wirkte. Dabei war sie sirenengemacht – wenn man den Sagen Glauben schenkte.
Hier unten, direkt am Wasser, erzeugte der schwarze Wind ein tiefes Dröhnen. Die Wellen krachten tosend auf den mit Baumrinde und Steinen übersäten Strand und zogen in ihrem Sog alles mit sich zurück ins Meer. Der Wind wehte heftig, die pralle Sonne brannte vom Himmel, und es wimmelte von Menschen. Irgendwo lief Musik, aber sie ging in den lärmenden Geräuschen unter, im pfeifenden Wind in den Bäumen, im Rattern an den Gebäuden ein Stück weiter oben und im Tosen der Wellen, die sich gegen die Klippen warfen. Eine kleine Menschentraube sah fasziniert einer Sturmschwalbe bei ihrem Spiel mit den Böen zu. Vögel liebten den schwarzen Wind.
Ahab lief an der Felsplatte entlang und von dort aus runter auf den Strand. Unter seinen Schuhsohlen knirschten Muschelschalen, Tintenfischschulpe und Eukalyptusfrüchte. Er lenkte den Blick an der Sturmschwalbe vorbei dorthin, wo sich der Himmel über der Bucht weitete und die verwitterten Klippen und Hügel unter sich zu verspotten schien.
Verwittert. Vom Wetter geformt. Ahab wusste, dass jede Küste, die gesamte Ökologie des Küstenlebens nur dank der Erosion überhaupt existierte, dank der Urgewalten von Wind und Meer. Und hier in Shacktown fiel das Wetter heftiger über die Küstenlinie her als an jedem anderen Ort, den er kannte. Er fühlte sich heute selbst wie erodiert – er kam sich vor, als hätte ihn der Ort endgültig mürbe gemacht. Wie sonst ließ sich erklären, dass er ernsthaft glaubte, bei einem Gespräch mit Ivy könne irgendetwas Gutes herauskommen.
Ihr Haus lag jetzt direkt über ihm. Eine herrschaftliche Strandvilla auf einem gepflegten, von jeglichem Gestrüpp befreiten Grundstück, eingerahmt von Eukalyptusbäumen und in unbezahlbarer Nähe zum Meer. Die Vorderseite ging auf eine ruhige Straße hinaus, und hinter dem Haus führte eine ausgetretene Holztreppe über den steilen Hügel zum Strand hinunter.
Ahab stieg die aus Eukalyptuswurzeln und Treibholz gebauten Stufen hinauf bis zu einem aus Altholz gezimmerten Gartentor. Das Tor war mit einem schimmernden Mosaik aus Meerglas verziert. Am Pfosten prangte ein Schild mit dem Hausnamen – Safe Harbour –, und die rot-weißen Rettungsringe entlang des dahinterliegenden Sandwegs unterstrichen die Idee des sicheren Hafens. Die Hintertür war erstaunlich schlicht und wirkte fast zu klein für ihren Rahmen. Sie wurde von riesigen, raumhohen Fenstern flankiert, die sich leicht nach hinten neigten wie der Bug eines Schiffes.
Wie viele Häuser in Shacktown hatte auch Safe Harbour einst als schlichte Hütte seinen Anfang genommen – eine der vielen in den Vierziger- und Fünfzigerjahren von ihren Besitzern ohne große Architekturkenntnisse zusammengezimmerten Behausungen, die im Grunde nicht viel mehr waren als bessere Zelte, errichtet, um besitzloses Land zu beanspruchen. In Tasmanien wurde der Begriff »Shack« immer schon mit einem schlichten Lebensstil und mit Stadtflucht assoziiert – einstige Hüttenansiedlungen vergrößerten sich im Laufe der Zeit zu Feriendörfern, die im Sommer überrannt wurden und sich im Winter in wahre Geisterstädte verwandelten. An diesem Ort konnte eine Chefärztin ohne Weiteres in direkter Nachbarschaft zu einem Hafenarbeiter wohnen und der wiederum neben einer Arzthelferin, und alle genossen sie hier ihre Freizeit, saßen gemeinsam am Lagerfeuer, tranken Alkohol und bildeten Gemeinschaften, wie sie der normale Alltag sonst niemals erschaffen könnte. Shacktown war einst aus diesem Ideal geboren worden und hielt bis heute störrisch daran fest.
Was Ivy Dempsey betraf, so war sie die Matriarchin jener kriminellen Dynastie, die sich als Shacktowns Schutzmacht begriff.
Vor dem Gartentor zu Safe Harbour blieb Ahab stehen. Ihm war auf unmissverständliche Weise klargemacht worden, was passieren würde, sollte er es noch einmal wagen, dieses Grundstück ungebeten zu betreten.
Angst hatte er keine, das nicht. Aber er war auch nicht blöd.
»Ivy!«, rief er.
Hinter den Fenstern bewegte sich etwas. Die Tür ging auf, und eine Frau trat heraus. Sie klopfte sich die Hände an der mehlbestäubten Schürze ab. Es war seltsam, dass diese grauhaarige, ältere Dame mit dem rundlichen Gesicht und ihrem karierten Kleid auf Ahab bedrohlicher wirkte als ein weißer Hai.
»Ahab.« Ivy kam auf ihn zu. Sie blieb ein paar Schritte hinter dem Tor stehen und tippte ungeduldig mit dem Fuß auf den Sand. »Ich habe was im Backofen. Was hast du gehört?«
»Dasselbe wie du«, antwortete er, um einen neutralen Tonfall bemüht. »Forest sagt nicht, was mit ihm passiert ist. Von Jesse und Alexandra keine Spur.«
Ivy nickte und zog einen hölzernen Kochlöffel aus der Schürzentasche. Ahab konnte nicht mit Sicherheit sagen, ob es nur eine Requisite war, denn es klebte tatsächlich Teig daran, trotzdem misstraute er der Sache. Was im Backofen? Das konnte genauso gut eins von ihren Spielchen sein.
Ivy war zehn Jahre älter als er. Seine früh verstorbene Mutter Miriam Dempsey hatte einen Stark geheiratet, während Ivy ihrerseits in die Dempsey-Dynastie eingeheiratet hatte. Als ihr ältester Sohn Jesse vor sieben Jahren verschwand, war das mehrere Millionen schwere Familienunternehmen auf ihren zweitgeborenen Sohn Davey übergegangen.
Doch falls Jesse Dempsey jemals zurückkehrte – und das schien auf einmal durchaus wieder möglich zu sein –, würde er garantiert sowohl seine Stellung an der Spitze von Dempsey Abalone als auch den Chefposten beim Drogenhandel zurückfordern. Alle wussten, wie Jesse zu seinen Besitztümern stand – falls er in Davey eine Bedrohung fürs Geschäft sah, würde er nicht zögern, ihn zu beseitigen, Bruder hin oder her. Und zwar endgültig.
Ivys Blick brachte Ahab auf den Gedanken, dass sie womöglich dasselbe dachte. Sie betrachtete Davey eindeutig als ihren Lieblingssohn; Jesse war ein Psychopath und Mackenzie das Kind, von dem sie wünschte, sie hätte es nie zur Welt gebracht.
Sie musterte ihn, wartete auf seinen nächsten Zug – darauf, dass er sagte, was er wollte. Wenn Ahabs Hirn ein auf Hochtouren laufender Motor war, dann funktionierte ihres wie ein riesiges Schachbrett. Sie klopfte sich mit dem Holzlöffel in die Handfläche, und ein kleines Mehlwölkchen stieg auf. Sie wusste, was er wollte. Und sie wollte es aus seinem Munde hören.
»Ich muss ihn sehen«, sagte er schließlich.
»Ach was? Ach, deshalb bist du hergekommen?« Ivy kicherte verhalten. »Himmel, nein, auf keinen Fall. Halt du dich von ihm fern. Bis Jesse und Alexandra gefunden sind, haben wir die Vormundschaft über ihn.«
»Ivy! Du musst mich mit ihm sprechen lassen.«
»Ich muss?« Sie ließ sich die Worte auf der Zunge zergehen. »Ich muss …«
»Bitte«, sagte Ahab. Er wäre fast an der Bitte erstickt.
»O wie nett. Sieh mal einer an. Das sind ja richtige Manieren.«
Seine Tante drehte ihm den Rücken zu und ging zum Haus zurück.
»Die Vormundschaft über ihn hast nicht du!«, rief Ahab ihr nach.
Sie winkte lässig mit dem Löffel, betrat das Haus und ließ ihn kochend vor Wut zurück. Er angelte sich eine Zigarette aus der Tasche, zündete sie in der hohlen Hand an und starrte zu der geschlossenen Haustür hinauf.
Offiziell war Davey Dempsey Forests Pate. Und damit sein rechtlicher Vormund – nicht Ivy.
Doch das kam im Grunde aufs Gleiche raus; ohne Ivys Zustimmung tat Davey gar nichts.
Es stand mehr auf dem Spiel als nur das Schicksal des Jungen. Ahab aschte über das Gartentor und machte sich auf den Rückweg zum Strand.
Kapitel vier
MACKEREL
Sie war es! Ob er sie ansprechen sollte? Oder lieber so tun, als hätte er sie nicht gesehen?
Das Seaglass Café lag ein Stückchen oberhalb des Strands, neben einem Park mit buschigen Eukalyptusbäumen und einem kleinen Spielplatz mit Holzgeräten. Das Café hatte eine großzügige, edle Veranda, während drinnen die bunt zusammengestellte Einrichtung Gemütlichkeit ausstrahlte. Es sah aus, als wäre für die Dekoration ein Schifffahrtsmuseum geplündert worden: Überall hingen Glasschwimmer, Winkerflaggen und dicke Taue.
Ein abgelegener Tisch in der hinteren Ecke war Mackerels Lieblingsplatz, um dazusitzen und nachzudenken – und angesichts der Neuigkeiten über Forest musste er dringend nachdenken. Er saß auf seinem Stammplatz in dem gemütlichen blauen Sessel, einen Lammfellvorleger unter den Füßen, in der Ecke über sich eine ausgeblichene australische Flagge und, das Beste von allem, mit freier Bahn zum Seitenausgang.
Salvatore, der Besitzer, mochte Mackerel und spendierte ihm meistens den Kaffee. Manchmal versuchte Mackerel zu zahlen, doch dann lehnte Salvatore mit großer Geste ab, bis die Leute auf sie aufmerksam wurden und Mackerel einen Rückzieher machte. Salvatore hatte früher für die Firma Geld gewaschen, aber schon vor Jahren hingeschmissen. Er betrachtete Mackerel als eine Art Seelenverwandten. Zwei Männer, die das Drogenspiel hinter sich gelassen hatten.
Mackerels Kaffee stand vergessen vor ihm auf dem Tisch. Er hatte nur Blicke für die zierliche Frau, die vorn am Tresen stand. Sie hatte blonde krause Haare, trug hohe Absätze und ein elegantes blaues Sommerkleid. Shelby Dempsey. Neben ihr stand ein hochgewachsener, attraktiver Jugendlicher und verzog genervt das Gesicht – ihr Sohn Kane.
Mackerel war derart gelähmt von seiner quälenden Unfähigkeit, eine Entscheidung zu treffen, dass ihm der Schweiß ausbrach und sich sein Magen schmerzhaft verkrampfte.
Shelby bestellte etwas zum Mitnehmen und setzte sich mit Kane in den Wartebereich.
Wenn er rausfinden wollte, was mit Forest passiert war, musste er sie fragen, das war die einzige Möglichkeit. Sein Bruder Davey würde ihm garantiert nichts erzählen. Seine Mutter Ivy würde ihn nicht mal anschauen.
Es bestand durchaus die Chance, dass Shelby mit ihm sprechen würde. Sie war zwar Daveys Frau, aber er hatte weder sie noch Kane seit seiner Rückkehr nach Shacktown wiedergesehen. Es bestand also ein Funken Hoffnung, dass sie ihn nicht hassten. Aber es musste schnell gehen, ehe ihre Bestellung fertig und sie wieder zur Tür raus war.
Das Problem war nur: Falls Davey herausfand, dass Mackerel seine Frau angesprochen hatte, würde er ihn grün und blau schlagen.
Ivy hatte in der Stadt die Geschichte verbreitet, dass Mackerel versucht habe, Davey zu entführen, um Lösegeld zu erpressen. Die wahre Geschichte lautete zwar anders, war aber genauso schlimm: Mack hatte im Drogenrausch versucht, die Kontrolle über die Firma an sich zu reißen.
Davey hätte ihn eigentlich wegen Meuterei umbringen müssen, stattdessen hatte er ihn verbannt. Es war ein Zeichen brüderlicher Zuneigung gewesen, aber für Mackerel trotzdem ein hoher Preis. Die Schmerzen in seinem Bein erinnerten ihn jeden Tag an die Prügel, die er damals kassiert hatte.
Er hätte eigentlich nie wieder nach Shacktown zurückkehren dürfen, aber es war offensichtlich, dass er für niemanden mehr eine Gefahr darstellte – schon gar nicht für Davey. Während seine Mutter dafür gesorgt hatte, dass Mackerel von beinahe allen in der Stadt verachtet wurde, war Davey wenigstens so gnädig gewesen, einzusehen, dass Mackerel heute noch im Gefängnis sitzen würde, wenn er nicht nach Hause zurückgekehrt wäre. Er konnte sonst nirgendwo hin.
Mackerel beobachtete, wie eine Frau auf Shelby zuging und sie umarmte. Shelby erwiderte die Umarmung und nickte angeregt zu allem, was die Frau sagte. Es war klar, dass es um Forest ging. Er leckte sich die rissigen Lippen – so dringend er auch mit ihr sprechen wollte, er wusste, dass er es nicht tun würde.
Er hatte eingewilligt, weder zu Shelby noch zu Kane jemals Kontakt aufzunehmen. Sein Bruder fürchtete, dass Mackerel einen schlechten Einfluss auf seinen Sohn ausüben könnte oder sich Shelby gegenüber hinsichtlich der Firma verplapperte – Daveys Frau hatte vom kriminellen Geschäftszweig der Familie nicht die leiseste Ahnung. Vielleicht befürchtete er auch, Shelby würde eins und eins zusammenzählen und Verdacht schöpfen, wenn sie auch nur in Mackerels Nähe kam. Sein Vorstrafenregister war für jeden einsehbar, der ihn googelte.
Als würde Mackerel jemals irgendwas verraten. Familieninterna blieben intern. Mochte Mackerel auch noch so tief gesunken sein, selbst er hatte Prinzipien. Er folgte immer noch dem Gesetz der Familie. Aus seinem Munde würde Shelby jedenfalls nichts von der Firma erfahren. Nicht mal auf seinem Sterbebett.
Okay, er hatte dieses Gesetz bereits einmal gebrochen, als er versucht hatte, die Firma an sich zu reißen, aber damals war er ein anderer Mensch und definitiv nicht bei Sinnen gewesen.
Hier im Seaglass Café war er Shelby, die immer noch mit ihrer Bekannten sprach, so nahe wie seit Jahren nicht mehr. Aber was sollte er tun, wenn er zu ihr ging und sie das Weite suchte?
Jetzt kam die Kellnerin mit ein paar Papiertüten auf sie zu – sicher Fish and Chips. Er durfte keine Zeit mehr verlieren.
Er sprang auf, stieß dabei versehentlich die Kaffeetasse um, stürmte los. Das schreckte ein paar Touristen auf, und die Kellnerin kam eilig mit einem Putzlappen herüber.
Er hatte keine Zeit, sich zu entschuldigen. Er war jetzt ganz auf diese eine Chance konzentriert.
»Shelby!«, rief er, natürlich viel zu laut.
Sie nahm die Sonnenbrille ab. Ihre braunen Augen wurden weit. »Mackerel? Du lieber Himmel … ich dachte, du bist im Gefängnis?«
Sie hatte nicht mal gewusst, dass er wieder in der Stadt war!
Etwas verspätet schenkte er ihr ein breites Lächeln. »Nein, ich … ich bin auf Kaution wieder draußen. Seit drei Monaten schon.«
»Seit drei Monaten? Weiß Davey davon?«, fragte sie.
»Logo«, antwortete er. »Weiß er. Hör zu …« Verstohlen musterte er die Leute, die neugierig das Theater verfolgten, das er veranstaltete. Wieso nur machte er sich immer derart zum Hampelmann? Schuldbewusst zog er den Kopf ein. »Können wir draußen reden?«
Kane musterte ihn neugierig. Er war inzwischen vierzehn und seinem Vater wie aus dem Gesicht geschnitten. Dieselbe lässige Haltung von Menschen mit Geld und das gesunde Strahlen eines Kindes, das geliebt und umhegt wurde.
Einen Moment lang herrschte betretenes Schweigen. Shelby nestelte an den Tüten herum und trat dann hinaus auf die Veranda. Mackerel folgte ihr in den stürmischen Wind.
»Geht es dir gut?«, platzte es aus ihm heraus. »Wegen Forest, meine ich.«
»Es kommt mir total unwirklich vor«, antwortete sie prompt. »Ich kann einfach nicht …« Sie legte Kane die Hand auf den Hinterkopf und fuhr ihm zärtlich durch die Haare. Er wich ihr unwillig aus. »Forest ist so lange verschwunden gewesen, und die Vorstellung … Er war ein kleiner Junge, und jetzt ist er dreizehn! Niemand kann uns sagen, was los ist, niemand weiß, was eigentlich passiert ist … Es fühlt sich so unwirklich an, Mack. Wie soll es uns denn jetzt gehen? Was sollen wir nur davon halten?«
»Was hält Davey denn davon?«
»Ich weiß es nicht, ich kann ihn nicht erreichen. Kane und ich waren gerade auf dem Weg nach Hobart, als wir davon erfahren haben. Wir sind sofort umgekehrt, aber Davey geht nicht ans Telefon. Ivy glaubt, das liegt daran, dass er sich der Suche nach Jesse und Alexandra angeschlossen hat. Suchmannschaften durchkämmen das Buschland hinter dem Nordstrand. Wir haben uns auf dem Weg zu Ivy nur kurz was zum Mittagessen besorgt. Und du? Hilfst du auch mit suchen?«
Das hätte Mackerel nur zu gerne getan, aber die Suchtrupps bestanden mit Sicherheit aus Einheimischen, und denen traute er durchaus zu, dass sie ihn bei Gelegenheit beiseitenahmen, um ihm eine kleine Abreibung zu verpassen. Das war ihm inzwischen schon ein paar Mal passiert, als er allein unterwegs gewesen war. »Nein, leider nicht.«
Mit einem Blick auf ihre Tüten sagte Shelby: »Na ja, wir müssen los –«
»Danke, Shelby. War echt schön, dich zu treffen«, sagte er hastig. »Wir sehen uns sicher bald.«
»Nein, Mack, warte.« Ihr Blick wurde weich. »Sag, willst du mitkommen?«
»Zu Ivy?«, fragte er fassungslos. »Bist du verrückt?«
Shelby kniff die Augen zusammen. »Das ist heute ein großer Tag für unsere Familie. Ivy würde dich mit Sicherheit dabeihaben wollen. So wie wir alle.«
»Du bist verrückt, Shelby. Auf gar keinen Fall.«
»Bitte?«
Es lag an der Art, wie sie es sagte. Ihre Stimme war plötzlich rau, auch wenn sie schnell hüstelte, um es zu verbergen.
Sie hatte Angst. Aber wovor?
Vor meinem psychopathischen Bruder natürlich!
Daran hatte Mackerel noch gar nicht gedacht. Falls Jesse tatsächlich zurück war, fiel die Kontrolle über Dempsey Abalone automatisch an ihn zurück, und wer wusste, was er dann mit Davey machen würde. Shelby mochte zwar keine Ahnung von der Firma haben, aber sie war lange genug in der Familie, um zu wissen, wozu Jesse fähig war.
Mackerel schauderte. Auf seinen Unterarmen fingen uralte Zigarettenbrandmale an zu brennen.
»Okay«, sagte er. »Ich komme mit dir.«
Kapitel fünf
AHAB
Im Schritttempo näherte sich Ahab der Villa seines Cousins. Er kurbelte das Fenster von seinem Geländewagen hinunter. Der blaugraue Splitt knirschte unter den dicken Reifen, als er in der großen Kehre mit dem Springbrunnen in der Mitte zum Stehen kam.
Daveys Anwesen trug den Namen Homeward und war ein regelrechtes Herrenhaus mit Symbolcharakter. Hoch oben auf dem Hügel platziert, war es mit seinen glitzernden Glasfronten zwischen den manikürten Rasenflächen vom Meer aus schon von Weitem sichtbar. Von hier oben wiederum hatte man einen unvergleichlich malerischen Blick auf den Ozean, die Klippen und die Stadt.
Das Haupthaus mit seinen Sichtholzelementen aus einheimischen Hölzern lag dem Meer zugewandt. Von der Straße aus präsentierte es sich als eher abweisender Kasten aus Holz, Ziegeln und Beton. Doch Shelby hatte die Landschaftsgärtner angewiesen, Haus und Grundstücksmauern mit Kletterpflanzen zu begrünen. Inzwischen gab es einen üppigen Dachgarten, der sich bis über die Kanten ergoss, einen Spielplatz, der jede öffentliche Grünanlage in den Schatten stellte, sowie eine Sammlung regenbogenfarbener Skulpturen im Vorgarten, die einheimischen Fischen und Kraken nachempfunden und von Shelby eigens in Auftrag gegeben worden waren. Jeder Zentimeter dieser unerschrockenen Mischung aus Glaspalast, Festung, Strandkunstgalerie und botanischem Garten schrie den Wohlstand hinaus.
Ahab hasste die Firma, der die Verschönerungen an Haus und Garten zu verdanken waren, aber ihm war klar, dass in dem Anwesen nicht ausschließlich schmutziges Geld steckte. Das Abalonen-Tauchen allein war lukrativ genug, um dieses Haus zu finanzieren – wäre dem nicht so, hätte der Reichtum der Dempseys längst Fragen aufgeworfen. Und so unglaublich es auch war – soweit Ahab wusste, hatte Shelby von den kriminellen Machenschaften ihres Mannes keine Ahnung.
Früher waren die Tauchlizenzen zur Abalonen-Fischerei keinen Pfifferling wert gewesen. »Keiner mag die Dinger. Keiner kauft sie. Und die Ernte ist viel zu mühsam.« Die Leute verscherbelten ihre Lizenzen für einen Kasten Bier. Trotzdem war die Vergabe immer begrenzt geblieben, und neue Lizenzen wurden nicht mehr ausgestellt. Als die Nachfrage der asiatischen Märkte zunehmend stieg und die Tauchtechnik immer besser wurde, waren die Lizenzen plötzlich Millionen wert. Die Geschichte der Abalonen-Taucherei wurde zu einem der seltsamsten Aschenbrödelmärchen aller Zeiten. Frühere Generationen von Dempseys hatten ihre Lizenzen dazu benutzt, die Branche zu dominieren, und so Shacktown den Aufschwung ermöglicht.
Und deshalb wurde Davey, Statthalter des Seeohrenreichs, von allen geliebt. Prince Charming persönlich.
Aber er war Prinz, nicht König. Dieser Titel gebührte nach wie vor dem Herrscher der Dynastie, Jesse Dempsey – sollte er jemals wieder auftauchen, um ihn zurückzufordern.
Und möglicherweise war genau das soeben geschehen.
Lauter als beabsichtigt klopfte Ahab an die schwarze Stahltür, dann drückte er den Klingelknopf.
Niemand antwortete.
Ahabs Geduld hatte heute klare Grenzen.
Erst hob er den Fußabstreifer hoch, dann sah er auf dem Sims über der Haustür nach. Er inspizierte die Ritzen zwischen den Ziegelsteinen und schließlich die Blumentöpfe, die entlang der Hausmauer aufgereiht standen. Einen Topf nach dem anderen hob er an.
Na also: der Ersatzschlüssel.
Er war sich sicher, dass Shelby den Schlüssel dort deponiert hatte. Davey würde ausrasten, wenn er wüsste, dass ein Ersatzschlüssel zu seiner Festung unter einem Blumentopf lag. Das kam davon, wenn man seiner Frau verschwieg, in welch gefährlichen Kreisen man sich in Wirklichkeit bewegte.
Ahab schloss die Haustür auf und betrat das Haus.
»Davey?«
Der Eingangsbereich wirkte wie ein Tunnel aus Regalen und mit Buntglas und Stuck verzierten Nischen. Aufgereiht in einem Regal standen Flaschen mit tasmanischem Pinot. Ahab zog die Stiefel aus und betrat auf Strümpfen die geflieste Küche, die in den riesigen, nach oben offenen Wohn- und Essbereich überging. Der Raum war mindestens zwei Stockwerke hoch und schien sich bis zum Dach zu erstrecken.
»Davey?«, rief er wieder. Seine Stimme hallte von den Hochglanzfronten wider. »Ich bin’s, Ahab. Zweimal an einem Tag! Man könnte meinen, der Fluch der Sirenen hätte sich vorzeitig erfüllt.« Er lachte freudlos. Es roch nach teuren Pinienduftkerzen und Kaffee. »Wir müssen reden.«
Der Wohnbereich bestand aus weißen Hochglanzflächen und weichem Teppichboden. In der Mitte befand sich eine in den Boden versenkte, quadratische Sitzinsel. Riesige Fensterfronten öffneten den Blick hinaus auf die Bucht und das angrenzende Buschland.
Ahab drückte die Fingerkuppen in die Abalone-Muschel, die im Küchentresen eingelassen war. Hätte seine Mutter ihren Verstand nicht den Drogen geopfert, würde er heute vielleicht selbst in so einem Haus leben. Doch eigentlich juckte ihn das nicht, seine Dachgeschosswohnung war ihm lieber. Trotzdem war es unschöne Ironie, dass dieselben Drogen, die seiner Mutter alles genommen hatten, seinem Cousin zu solcher Macht verhalfen.
Sein Tag wird kommen. Der Fluch der Dempseys macht vor keinem Halt.
Doch auch dieser Gedanke hatte nichts Schönes. Ahab hoffte inständig, dass er sich irrte.
Er ließ die Finger über den Tresen gleiten, dann hielt er plötzlich inne. Vor ihm stand eine halb leere Kaffeetasse. Er legte die Finger um den Becher und hob ihn ans Gesicht. Der Kaffee war noch warm und roch nach einem Schuss Whisky.
Blitzschnell drehte Ahab sich um. Den Tresen im Rücken, musterte er noch einmal das Wohnzimmer. Er beruhigte seinen Atem und lauschte.
Nichts.
Vielleicht war er nicht allein.
Er zog ein Messer aus dem Holzblock und machte sich auf den Weg durchs Haus. Küchenmesser waren schlechte Waffen, aber vor Ahabs Ausstieg aus der Firma hatte er genug gelernt, um sich notfalls auch mit einer stumpfen Klinge zu behelfen.
Er erreichte die Holztreppe und ging hinunter in einen großen Hobbyraum. Gemütliche Sofas und zwei riesige Fernseher an der Wand, von denen Kabel zu mehreren Spielkonsolen führten, beherrschten das Zimmer.
Er ging zurück und weiter hinauf ins obere Stockwerk. Das erste Zimmer, das er betrat, war das Elternschlafzimmer, auch dies mit raumhoher Fensterfront und atemberaubendem Ausblick auf die Schönheit der Bucht. Ahab nahm das Messer in die andere Hand, dann sah er sich um. Sofort fiel ihm die Nachricht auf dem Nachtkästchen ins Auge. Ein gefalteter Zettel. Darauf stand »Shelby« geschrieben.
Ahab zögerte. Zwischen Ermittler und Schnüffler bestand ein feiner Unterschied. Trotzdem hob er mit der Messerspitze den Zettel an und faltete ihn auf.
Sag Jesse, es tut mir leid.
Ahab schoss das Blut in den Kopf.
Ich hab’s gewusst …
Er nahm den Zettel vom Nachttisch. Las ihn noch einmal. Drehte ihn um, um zu sehen, ob da noch etwas stand.
Hab ich’s doch gewusst …
Ohne zu merken, was er tat, ging er die Treppe wieder nach unten. Er hatte das Gefühl, in Flammen zu stehen.
Ich hab’s verdammt noch mal gewusst!
Also hatte Davey tatsächlich was mit dem Verschwinden von Jesse, Alexandra und Forest zu tun gehabt.
Ahab würde sich Davey vorknöpfen. So viel stand fest.
In seinen Schritten lag eine neue Entschlusskraft. Nie war er sich des verfluchten Dempsey-Bluts in seinen Adern so bewusst gewesen wie in diesem Moment.
Er war kein Mörder. Aber er kam aus einer Familie von Mördern.
Kapitel sechs
MACKEREL
Angespannt saß Mackerel auf dem Beifahrersitz von Shelbys Jeep. Der Kirschduft des Lufterfrischers verursachte ihm Kopfschmerzen. Das unbehagliche Schweigen, die zusammengebissenen Zähne und das Dröhnen des schwarzen Windes, das mit jeder Sekunde lauter wurde, machten es nicht besser. Die holprige Straße sorgte dafür, dass ihm flau im Magen wurde.
Sie fuhren am dreistöckigen Mermaid’s Darling vorbei, dem Gasthaus seines Cousins Ahab. Vor der Pension standen Touristen versammelt, in Jacken gehüllt. Es hatte inzwischen angefangen zu regnen, und alles wurde nass. Mack fragte sich, wie Ahab die Neuigkeiten aufnehmen mochte. Wahrscheinlich, indem er versuchte, die Situation unter Kontrolle zu bekommen, wie immer.
Sie erreichten Ivys Haus. Safe Harbour. Shelby parkte auf der Straße vor dem Gartentor in der grünen Mauer, das mit roten und flaschengrünen Angelschwimmern geschmückt war.
»Ich gehe kurz vor und rede mit ihr«, sagte Shelby hastig. »Sag ihr Bescheid, dass du mitgekommen bist, damit es nicht so … unerfreulich wird.« Sie stieg aus, und Kane folgte ihr eilig.
Mackerel hätte gern im Auto gewartet, aber das erschien ihm feige. Also stieg er aus und nahm Safe Harbour in Augenschein – zum ersten Mal seit einer Ewigkeit.
Das Zuhause seiner Kindheit hatte sich verändert. Die Kohl-Eukalyptusbäume waren größer und wilder, mit mehr Grau und Weiß in der Rinde. Der Anstrich der Holzfassade war sauberer als früher, Goldmetallic-Effekte verzierten die Fensterrahmen. Und dort, wo einst Dads Schuppen mit dem Angelkrimskrams gestanden hatte, war ein Gemüsegarten angelegt worden.
Und dann war Shelby auch schon wieder zurück, zusammen mit ihr. Ivy, seine Mutter, in eine Strickjacke gehüllt, eine Handtasche über der Schulter. Sie streifte Mackerel mit einem einzigen Blick. »Du hast mir nicht gesagt, dass er derjenige ist, den du mitnehmen willst, Shelby. Nein, meine Liebe. Das geht nicht.«
»Mackerel muss mitkommen«, sagte Shelby bestimmt.