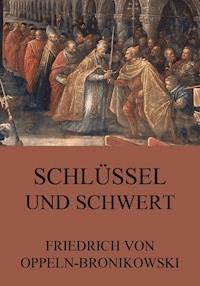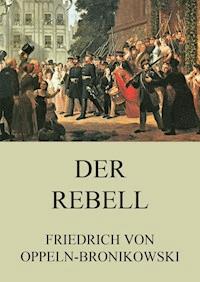
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Roman aus dem Offiziersleben des 19. Jahrhunderts und eine herbe Kritik an der Gesellschaft - aufgezeichnet vom ehemaligen Offizier und lang gedienten Soldaten Oppeln-Bronikowski.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 412
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der Rebell
Friedrich von Oppeln-Bronikowski
Inhalt:
Friedrich von Oppeln-Bronikowski – Biografie und Bibliografie
Der Rebell
Vorwort.
Erster Teil
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Zweiter Teil
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Dritter Teil
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Der Rebell, F. von Oppeln-B.
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
86450 Altenmünster, Loschberg 9
Deutschland
ISBN:9783849632861
www.jazzybee-verlag.de
www.facebook.com/jazzybeeverlag
Friedrich von Oppeln-Bronikowski – Biografie und Bibliografie
Deutscher Schriftsteller und Übersetzer, geboren am 7. April 1873 in Kassel, verstorben am 9. Oktober 1936 in Berlin. Begann in der Tradition seiner Familie eine militärische Ausbildung, die er aber nach einem Reitunfall abbrechen musste. Es folgte von 1896 bis 1899 ein Studium der Philosophie, Romanistik und Archäologie in Berlin sowie Auslandsaufenthalte in Italien und der Schweiz. Nach der Rückkehr nach Berlin 1905 widmete sich B. vollumfänglich dem Schreiben und verfasst hauptsächlich Militärgeschichten geschichtliche Themen.
Wichtige Werke:
Aus dem Sattel geplaudert und Anderes, 1898Antisemitismus ? Eine unparteiische Prüfung, 1920Schlüssel und Schwert. Ein Papstleben aus dem Cinquecento, 1929Gerechtigkeit! Zur Lösung der Judenfrage, 1932Der große König als erster Diener seines Staates, 1934Der alte Dessauer, 1936Der Rebell
Roman aus dem Offiziersleben
»Wenn Bücher auch nicht gut oder schlecht machen, besser oder schlechter machen sie doch!«(Jean Paul)
Vorwort.
Friedrich von Oppeln-Bronikowski wurde 1873 in Cassel geboren, als Sproß einer alten Soldatenfamilie, deren Ahnengesichter in seinem Speisezimmer täglich auf ihn herabsahen. Sein Vater war ein hoher Offizier; ohne seine poetische Neigung hätte Friedrich von Oppeln es vielleicht weit in der Welt gebracht. Das Kadettenkorps verließ er mit Kaisers Belobigung und trat in das Kavallerieregiment seiner Vaterstadt ein. 1892 wurde er Offizier; 1896 mußte er infolge eines schweren Dienstunglücks in der Reitbahn seinen Beruf aufgeben und seine Pensionierung nachsuchen. Die Folgen dieses Unfalls haben ihm noch jahrelang nachgehangen. Unter den erschwerendsten Umständen mußte der Dreiundzwanzigjährige einen neuen Beruf suchen, oder vielmehr zunächst sich wieder auf die Schulbank setzen: er absolvierte post festum das, was ihm am Maturum fehlte, Lateinisch und Griechisch, und studierte sechs Semester in Berlin: Kunstwissenschaft, Romanistik, Altphilologie. Da brach seine erschütterte Gesundheit unter Arbeitslast und Sorgen aller Art zusammen. Nur die jahrelange liebevolle Pflege seiner Frau und dann ein sehr langer Aufenthalt im Süden gab ihm die alte Schaffenslust wieder. Äußere Erfolge traten hinzu, anfangs mehr der Not als dem eignen Trieb gehorchend, später aber mehr und mehr aus Liebe zur Sache, verdeutschte Oppeln-Bronikowski französische Werke ernsten Inhalts und führte Schriften von Maeterlinck, Rodenbach, Rostand, Maupassant, de Regnier, Beyle-Stendhal, den Brüdern Lichtenberger u.a.m. – im ganzen jetzt 25 Bücher – in Deutschland ein. Den ersten großen Erfolg brachte »Monna Vanna« (1902). Seitdem hat der Autor auch viele Vorträge über französische Literatur – insbesondere Maeterlinck – in ganz Deutschland gehalten.
Das Reisen ist seine größte Freude, dann erst kommt die Belehrung durch Bücher. Er hat die Schweiz, Tirol, Italien und Sizilien, Griechenland, Kreta, Kleinasien und Frankreich bereist und zahlreiche Reiseaufsätze geschrieben.
Schöne und wehmütige Erinnerungen an die Soldatenzeit hat der Autor in seinem Erstling »Aus dem Sattel geplaudert« niedergelegt; in »Militaria« (Dresden 1904) das Instrument zu dem hier vorliegenden Roman geschliffen und diesen nach jahrelangen notgedrungenen Pausen erst 1905 veröffentlicht. Die ersten Niederschriften – der Stoff war ursprünglich als Drama gedacht, fand aber des heiklen Themas wegen keine Bühne – stammen von 1896, also lange, ehe die durch Hartlebens »Rosenmontag« inaugurierte »Militärliteratur« emporschoß; Oppelns Roman hat mit dieser nur das Thema und die Koinzidenz gemein und war seinerzeit eine ganz persönliche Schöpfung.
Allmählich ist der Dichter der Neuromantik, der er in diesem Roman wie in seinen Übersetzungen vielfach huldigte, immer mehr entwachsen; der Wert der ordnenden Vernunft ist in seinen Augen noch im Werte gestiegen und er ersehnt mit der Elite der Zeitgenossen eine neue klassische Kunst, die über Naturalismus und Romantik hinausgeht. Darum auch des Autors veränderte Stellung zu seiner ersten Romanschöpfung, die ihm eine damals notwendige, nun aber überwundene Entwicklungsphase bedeutet.
Es sei noch einiges über den Roman »Der Rebell« selbst hinzugefügt. Die Erlebnisse, die ihm teilweise zum Rohstoffe dienten, liegen zwölf bis fünfzehn Jahre zurück. Seit dieser Zeit ist manches von dieser Gesellschaftskritik Gerügte aus dem Heere verschwunden oder im Verschwinden begriffen. Eine derartige Nötigung zum Alkohol z. B., wie sie der Roman darstellt, existiert wohl kaum mehr, und der Offizier, der im Kasino Wasser oder Limonade trinkt, ist – durch Haeselers Erziehung – keine lächerliche Figur mehr. Auch in der Kadettenerziehung hat sich manches zum bessern gewandelt; dem Kadettenabiturienten sind zahlreiche neue Berufsmöglichkeiten erschlossen, und er ist nicht mehr, wie vor 16 und mehr Jahren, ein Paria und weißer Rabe unter seinen Gefährten. Es muß dies betont werden, da der Roman sonst offene Türen einzurennen schiene: er stellt das Milieu dar, wie es in den ersten Zeiten des »neuen Kurses« gewesen ist. Durch nichts würde man den Autor also mehr mißverstehen, als wenn man seinen Roman mit den politischen Tendenzschriften in einen Topf würfe: er ist ein Persönlichkeitsroman mit künstlerischen Tendenzen auf dem militärischen Hintergrund um 1890. Neben einem andren Buche möchten wir ihn lieber genannt sehen: es ist Beyerleins wertvoller Unteroffizier- und Mannschaftsroman »Jena oder Sedan«, der nur da, wo er die Offizierskreise berührt, blaß erscheint und mehr auf Hörensagen als auf eignem Erlebnis beruhen mag. Insofern kann man vielleicht den Roman »Der Rebell« als Ergänzung des Beyerleinschen Buches ansehen, da er vornehmlich in Offizierskreisen spielt.
Allerdings ist die »Wahrheit« dieses Romans in der Hauptsache impressionistisch und pessimistisch. Sie stellt vorwiegend die Schattenseiten dar, die es in allen Berufen gibt, und selten die Lichtseiten. Das ist offenbar eine Einseitigkeit, die aber nachträglich kaum gutzumachen war, da der Roman zu sehr aus der Perspektive der Hauptfigur geschrieben wurde. »Dieses Stück Ich,« schreibt von Oppeln in einem Brief, der dieser Einleitung zugrunde gelegt wurde, »das sich in dem Leutnant von Brieg verkörpert, möchte ich heute, wo es so weit von mir abliegt, nicht verteidigen. Daß die Jugend unzufrieden ist, daß sie sich an den scharfen Ecken der Konvention die Hörner abläuft, ist etwas alltägliches. Aber diese Jugend hat eine romantische Färbung und Überspanntheit, wie die ganze Generation nach dem großen Kriege ... Ein Brieg würde sich in jedem andren regulären praktischen Beruf gleich unglücklich und vereinsamt fühlen. Darum auch ist die Kritik, die er an den Institutionen übt, nur von relativem Wert: er beurteilt alles mit den Nerven, nicht mit dem Kopfe, und das ist das eigentlich Romantische und Irrationale an ihm.«
So subjektiv dieser vom Autor damals geteilte Rebellenstandpunkt ist, so glauben wir doch, daß ihm eine anregende Kraft innewohnt, sobald er nicht negative Geister in ihren Tendenzen bestärkt, sondern positive Geister zur Betrachtung der Kehrseite der Medaille anleitet, wenn er diese Wirkung hat, so erscheint auch seine Tendenz gerechtfertigt.
Soviel von dem politischen Hintergrund dieses Romans.
Künstlerisch wertvoll ist besonders die Deutlichkeit, mit der die einzelnen spannenden Szenen und Phasen gesehen sind, die schärfe der Umrisse, mit denen sie gezeichnet wurden. Und mangelt auch dem nervösen Impressionismus, der über dem Ganzen liegt, die behagliche Gründlichkeit der Romane reinster Gattung, so deutet doch eine Reihe vortrefflicher Naturschilderungen, die retardierend oder belebend mit der Handlung verwoben sind, bereits auf die innere Wendung in der Entwicklung des Dichters hin.
K.
Erster Teil
»Sag mir, was ist der Arbeit Ziel und Preis, Der peinlichen, die mir die Jugend stahl, Das Herz mir öde ließ und unerquickt Den Geist, den keine Bildung noch geschmückt? Denn dieses Lagers lärmendes Gewühl, Der Pferde Wiehern, der Trompeten Schmettern, Des Dienstes immer gleich gestellte Uhr, Die Waffenübung, das Kommandowort – Dem Herzen gibt es nichts, dem lechzenden. Die Seele fehlt dem nichtigen Geschäft – Es gibt ein ander Glück und andre Freuden!«Schiller, »Wallenstein«.
»Die Roheit, mit welcher viele höchst gebildete Männer über das weibliche Geschlecht denken, ist oft nur die Folge davon, daß ihnen die Gelegenheit versagt blieb, tiefere Blicke in das Leben edler weiblicher Gemüte zu werfen«.Eduard von Hartmann.
1.
Die erste steife halbe Stunde des Liebesmahls war glücklich überstanden. Die lange Festtafel, durch eine Reihe von Gästen und eingezogenen Reserveoffizieren reich an Gedecken, prangte im Glanz feingeschliffener Bowlengefäße und blumengeschmückter, schwersilberner Tafelaufsätze, Geschenke fürstlicher Chefs, gesinnungstüchtiger Reserveoffiziere oder reicher scheidender Kameraden; und dieser behagliche Luxus hatte im Verein mit den immer zahlreicher auffahrenden Flaschenbatterien eine frohe Feststimmung erzeugt; und als mit dem Braten der übliche kurze Toast auf die Damen kam, erfolgte ein desto längeres Zutrinken und Anklinken, dessen froher Lärm im Tusch der Musik ertrank. Die Ordonnanzen sprangen als Liebesboten von Stuhl zu Stuhl, um die Toaste und Ulkworte von Mund zu Mund zu befördern; die Junggesellen gedachten der Ehehälften ihrer verheirateten Kameraden, die heute ohne Sekt ihr einsames Mahl einnahmen, und mancher Ehemann freute sich wieder einmal der kurzen Strohwitwerschaft und dachte, nicht ohne Neid auf die noch Ungebundenen, an seine eigene Junggesellenzeit zurück.
Der junge Leutnant von Brieg saß am unteren Tafelende zwischen dem Reserveleutnant Werdeck und dem nur bei großen Gelegenheiten mitspeisenden Oberstabsarzt. Er war bisher versonnen und einsilbig gewesen, aber jetzt ließ auch er die Ordonnanzen springen, um seinem Rittmeister und dem verheirateten Oberleutnant der Schwadron ein Wohl auf ihre Damen zu bestellen, während die andern Junggesellen bereits mit zweideutigem Schmunzeln auf ihre Liebschaften anstießen oder dem ganz zu unterst sitzenden Fahnenjunker zuprosteten, der jedesmal automatisch auf und ab wippte und den Kelch vorschriftsmäßig bis zur Neige leerte.
Leutnant von Brieg wandte sich dann mit seinem Glase verschiedenen älteren Kameraden zu, voran dem Leutnant von Waldburg, der ihn stets ein wenig bemutterte und ihm jetzt mit einem großen Sektglase Bescheid gab, in dem ein mit Gabelstichen durchbohrter Pfirsich auf und ab tanzte. Dann nahm er den Oberleutnant von Meyring, den etwas gefürchteten Adjutanten, aufs Korn, der gerade zum Kommandeur herüberhorchte und ihn kaum beachtete. Durch diesen Mißerfolg nicht entmutigt, trank er auch noch dem Leutnant von Schmitt zu, dem vierschrötigen Sohn eines pommerschen Gutsbesitzers, dessen kupferrotes Gesicht da, wo die Tschapka anfängt, mit scharfem Schnitt in die weiße Stirn überging. Auch Briegs blasse Züge röteten sich durch das Zutrinken rasch; sein verschleierter und verträumter Blick flackerte unstet auf, und wie in plötzlichem Entschluß begann er sich in die Unterhaltung einzumischen.
Zuerst waren es ernste Gespräche, in die er sich mit seinem Nachbar, den Reserveleutnant Werdeck, vertiefte; aber die andern Herren, die sonst nicht viel auf ihn hörten, begannen ihn bald damit aufzuziehen, und Herr von Brieg ging deshalb zu gekünstelten Scherzen über, die ihm in der Weinlaune bisweilen gelangen. Er fand damit sogar leichten Anklang bei den Kameraden und senkte den Blick, halb beschämt, halb erfreut über diesen Erfolg, auf seine linke Hand, die er auf dem Tische liegen hatte. Es war eine feingeschnittene, weiße Aristokratenhand, unter deren Haut das rosige Fleisch und das bläuliche Geäst der Adern hervorschimmerte, während ein dünner Goldreif mit einem altmodisch gefaßten Wappenstein sich um den vierten Finger wand.
Allmählich nahm die Unterhaltung einen etwas stürmischen Charakter an, besonders als die Mahlzeit zu Ende ging. Die Ordonnanzen räumten die Gläser mit dem eingeschliffenen Namenszug des Regiments, das feine Porzellan mit dem aufgemalten Monogramm und das schwere, wappengeschmückte Tafelsilber ab und setzten hohe silberne Spiritusleuchter auf. Aller Augen richteten sich erwartungsvoll auf den Obersten, der schließlich einen der schweren Spitzenabschneider aus Silber und Ebenholz ergriff und seine Zigarre in Brand steckte; und sobald die ersten blauen Rauchringel in die schwüle Sommerluft hinaufquirlten, folgte die ganze Tafelrunde wie auf Kommando seinem Vorbild. Auch Herr von Brieg senkte seine Hand in eine der von den Ordonnanzen herumservierten Zigarettenschachteln und legte ein ganzes Häufchen der kleinen Tabaksrollen neben sich. Dann bestellte er sich noch eine Flasche guten Mosel, obwohl er sich eigentlich vorgenommen hatte, zu sparen, d. h. seine hohe Kasinorechnung auf dem alten Stand zu erhalten. Aber das Beispiel der andern steckte an; der prickelnde Zigarettenrauch, die fröhlichen Weisen der Kapelle, das Lachen und Stimmengewirr ließen das Eis seiner Vorsätze schmelzen, wie die schwüle Wärme die Eisstücke der schwitzenden Sektkühler; und als die Ordonnanz prompt die bestellte Flasche hinstellte, schenkte er sich hastig ein und trank ohne eigentlichen Genuß noch einmal dem Adjudanten zu, der sich aus Tischwein und Soda einen billigen Sekt bereitet hatte. Staub und Verdruß spülen sich ja am besten mit Wein hinunter, und gerade Brieg hatte so viele trübe Gedanken wie Blässe auf der Stirn. Um so tiefer beglückte ihn die zeitweilige Erlösung von ihrem dumpfen Druck; ein weltentrücktes Lächeln schwebte auf seinen Lippen, während er, den Kopf wiegend, dem Takt der Musik lauschte und dichte Rauchwolken vor sich hinblies. Er dachte an nichts mehr; er grämte sich nicht mehr, daß seine Kameraden ihn so links liegen ließen; er plauderte im Gegenteil darauf los, als hätte er ganze Koffer von Neuigkeiten auszupacken. Das unwillkürliche Frösteln, womit er sonst das Kasino betrat, die Ängstlichkeit etwas zu sagen oder zu tun, wodurch er Anstoß erregen konnte, war jetzt verflogen, und bald verstieg er sich aus der Sphäre der Kalauer, in der er sich doch nicht recht heimisch fühlte, in höhere Regionen, obwohl die Zunge schon nicht mehr recht mitwollte und das Gedächtnis zu stocken begann. Einige der Umsitzenden stießen sich bereits mit vielsagendem Lächeln an, und Waldburg, der erst nach der soliden Grundlage des Bratens zu zechen begann, nötigte ihn durch Austrinken des Restes, sein volles Glas hinunterzustürzen. So ging er bald seiner klaren Besinnung ganz verlustig; die flirrenden Lichter im Rauch wurden zu tanzenden Punkten und die sprechenden Lippen bewegten sich lautlos; er hörte nichts mehr ...
Plötzlich stand alles auf und wünschte sich Gesegnete Mahlzeit. Brieg schrak empor und vertraute sich gleichfalls seinen Beinen an. Die ersten Gläser Bier wurden herumgereicht und er griff hastig nach einem, um sich durch den kühlen Trunk wieder aufzufrischen.
»Na, alter Stacheligel, haben Sie sich mal aufgerollt,« nickte ihm der Leutnant von Schmitt zu, und als er vergnügt auf ihn zutrat, schlug er ihm mit einem »Prost, mein Junge!« etwas rüde auf die Schulter und stieß mit ihm an, daß die vollen Gläser überschwappten.
»Aber Sie müssen austrinken; kneifen gilt nicht!« ermahnte er Brieg und goß den braunen Gerstensaft in einem Zuge herunter, daß nur der braune Schaum im Glase kleben blieb. Der junge Herr tat ihm Bescheid, obwohl sein Glas ungleich größer war, und griff dann zu einem neuen, das eine Ordonnanz auf einem großen silbernen Tablett soeben präsentierte.
»Na, Brieg,« mischte sich der Adjutant ein, der sich einen Kognak erwürfelt hatte und mit seinem Raub auf sie zutrat, »was macht denn Ihr Training zum Distanzritt?« Herr von Meyring interessierte sich lebhaft für alle Offizierspferde und ihre Preise. Da er arm war, pflegte er junge Pferde billig aufzukaufen, sie notdürftig anzureiten und dann an einen Infanterieoffizier, einen Reserveleutnant oder einen jungen Kameraden, der sein erstes Pferd brauchte, zu verkaufen.
Brieg gab ihm sehr bereitwillig Auskunft über den Fortschritt des »Training«, wie er nicht ohne Stolz sagte. Diese Distanzritte einzelner Offiziere waren damals gerade in Mode gekommen, und Brieg hatte sich sofort dazu gemeldet, um wenigstens hierin Ehre einzulegen, als Surrogat für das Rennenreiten, das an seiner schmalen Zulage und dem hartnäckigen Nein seines Vaters bisher gescheitert war. Dieser, ein alter Infanterist, hielt Rennen, Spiel und Sektgelage für unzertrennlich, und wünschte vielmehr, daß sein Sohn ein tüchtiger Pflichtmensch würde, als ein lüderlicher Rennreiter.
Heute hatte Brieg seine Rappstute allerdings nicht reiten können. Vormittags war Exerzieren gewesen, und nachmittags hatte er die städtischen Futtermagazine und die Feldbäckerei revidiert.
»Ach so, Sie haben ja Regimentsdienst,« bemerkte der Adjutant mit kaltem Dienstgesicht. »Übrigens,« schloß er wohlwollend, »können Sie Ihr Pferd ja im Stall durchprügeln, wenn Sie's mal nicht reiten können. Ich tue das immer; es ist ein recht guter Ersatz ...«
»Meinen Sie wirklich?« fragte treuherzig der Reserveleutnant Janitschek, der sich etwas unsicher der Gruppe näherte. Die Antwort war ein schallendes Gelächter.
Herr Janitschek war ein etwas ängstlicher Mann, der in seinem Zivilverhältnis Bankier war und wie so viele seinen Stolz darein setzte, sechs Wochen im Jahre für teures Geld die Ulanka zu tragen.
»Sie Bleisoldat,« lachte Schmitt, »wir wollen Sie doch mal taufen.« Damit tat er, als wolle er dessen spärliches Haupthaar mit Bier benetzen.
»Lassen Sie das, Herr von Schmitt,« wehrte er die Neckerei halb scherzend, halb beleidigt ab. »Mit einem alten verheirateten Manne macht man nicht solchen Unsinn.«
»Verheiratet?« platzte Schmitt heraus. »Das ist ja eben das Unkameradschaftliche. Friedrich der Große hat gesagt: Der Soldat soll durch den Säbel und nicht durch die Scheide sein Glück machen!«
Meyring wiegte fein lächelnd den Kopf. »Heiraten ist heute sehr nützlich,« entgegnete er; »'n armer Offizier bringt's zu nichts. Man kann heute das größte Kamel sein, wenn man nur das nötige Kleingeld hat ... Was macht denn übrigens Ihr Gaul?« fragte er Janitschek, dem er kürzlich eine Stute verkauft hatte. »Sie behandeln das Tier doch hoffentlich nach Verdienst?« Janitschek war nicht so begeistert von den Tugenden des Pferdes. Nach seiner Aussage stieg es wie eine Lerche und klebte wie eine Briefmarke, aber Meyring schob die ganze Schuld auf den schlechten Reiter. »Es ist ein lammfrommer Bock und kennt alle Signale auswendig.«
»Bitte, keine Fachsimpelei,« unterbrach ihn Schmitt; »wir haben noch genug von heute vormittag.« Er liebte den Dienst nicht, zumal er bei dem gefürchteten Rittmeister von Degenhart stand, den keiner der Herren ausstehen konnte.
»Am liebsten,« kam Brieg wieder auf seinen »Training« zurück, »ritt' ich heute abend noch nach Grävenitz zu den Dragonern; das wär' doch ein Witz ...«
»So,« sagte der Adjutant gedehnt, »und wenn heute nacht Feuer ausbricht und der Offizier vom Dienst fehlt? ...« Damit wandte er sich ab und trat zu der Gruppe des Kommandeurs, der mit dem Major und dem ältesten Rittmeister gerade über die Nachteile des neuen Armeesattels debattierte.
»Wetten, daß ich heute nach Grävenitz reite und morgen zum Dienst zurück bin?« fragte Brieg unbeirrt und streckte Schmitt die Rechte entgegen.
Aber Schmitt lachte ihn einfach aus: »In dem Zustand kommen sie nicht bis zum Chausseehaus.«
»Wetten,« wiederholte Brieg mit dem leichtfertigen Eigensinn junger Menschen.
»Nein, ich wette nicht.«
»Dann reite ich so.« Damit wollte er zur Tür steuern, obwohl er nicht mehr auf der Ritze gehen konnte. Aber Schmitt sprang hinter ihm her und hielt ihn am Rockzipfel zurück.
»Wenn Sie fortgehen, sage ich es auf der Stelle Meyring, damit der Kommandeur sie zurückhält,« erklärte er barsch.
In diesem Augenblick wurden sie durch Ordonnanzen auseinander gedrängt, welche die lange Tafel zerlegten und fortschafften, die eichenen Stühle mit den wappengeschmückten Stuhllehnen und ledernen Sitzen an die Wand schoben und die Bahn frei machten zum Tanzen. Schon brüllten einige Stimmen zu der versteckten Musikempore »Galopp!« »Polka!« hinauf, und der Regimentstrompeter intonierte flott den ersten Walzer. Ein Reigen schwankender Gestalten walzte alsbald sporenklirrend durch den verräucherten Saal, darunter auch ein paar eingeseifte Gäste, ein Reitlehrer von der Kriegsschule und ein Infanterieoffizier der Garnison, ein alter Gardist, der in die Provinz verschlagen war und sich für seinen früheren feudalen Umgang durch Verkehr mit dem adligen Reiterregiment schadlos hielt.
Denn abgesehen von irgendeinem bürgerlichen Major oder Rittmeister aus einem Dragonerregiment, den die Schicksalslaunen des Militärkabinetts zu den Ulanen versetzte, rollte in den Adern der Herren fast nur blaues Blut, und deß zum Zeichen prangte an den Wänden des Kasinos ein Fries großer Wappenschilde, zu dem auch die Bürgerlichen ihren Beitrag lieferten, selbst wenn ihnen eigens ein Wappen erfunden werden mußte. Gegenwärtig standen drei solcher Konzessionsschulzen im Regiment, ein reicher, verheirateter Oberleutnant Schumann, ein Rittmeister, der, wie man hoffte, nicht lange bleiben würde, übrigens ein guter Diensttuer und ein einfacher, bescheidener Mann, und schließlich der Major beim Stabe, ein gewesener Kommandeur der Lehrschmiede, der bei allen passenden und unpassenden Gelegenheiten sein Wissen auskramte und den Feldschmieden und Roßärzten Konkurrenz machte, wogegen es mit seinen Reitkünsten schwach bestellt war. Die Offiziere machten denn auch gern ihre schnöden Glossen über die Art, wie er die Offiziersreitstunden abhielt oder seine eigenen Pferde in der Reitbahn »arbeitete«, indem er mit verkehrten Hilfen und immer höher steigenden Fäusten Seitengänge ritt, dem Pferde zuredend oder mit der Reitgerte drohend und schließlich in das Eigenlob ausbrechend: »So, nun gehst du mit einem Male!« Augenblicklich hatte er sich etwas angeheitert unter die Tänzer gemischt, und der Oberleutnant Schumann schoß aus den Rauchwolken, die er von sich blies, die Bolzen seines Witzes gegen ihn ab. Er war ein jovialer, lebhafter Rheinländer mit ausgeprägtem Wirklichkeitssinn und anschaulicher Redegabe, deren Treffsicherheit alle belachten. Durch sein selbstsicheres Auftreten hatte er sich vom ersten Tage an Achtung verschafft, und der Bürgerliche ward nicht allein als völlig gleichstehend betrachtet, sondern wegen seiner Energie und seiner losen Zunge noch besonders respektiert, zumal ja ein altes Kaufmannsvermögen und gute Diners dahinterstanden. Er hatte seinen Kameraden sogar einen gewissen Respekt vor dem Berufe des Großkaufmanns beigebracht, indem er ihnen klar machte, daß da oft hunderttausende und Millionen auf dem Spiele stünden, ohne daß der Kaufherr seine Waren selbst zu Gesicht bekäme; gerade dieser Umstand hatte sie überzeugt, daß der Großkaufmann doch ein ganz anständiger Mensch wäre. Übrigens war seine Stellung zu den Vorgesetzten der strikte Beweis dafür, was Meyring von dem Reichtum der Offiziere gesagt hatte; bei ihm wußten die Vorgesetzten: ärgern ließ der sich nicht, dann quittierte er lieber den Dienst; und so war er nicht nur gewissermaßen gefeit, sondern sie hörten auch gern auf das, was der klugblickende Mann ihnen mit verbindlichem Lächeln ins Gesicht sagte, etwas, das kein andrer sich ungestraft herausgenommen hätte.
Ein tanzendes Paar rämpelte eben gegen das Biertablett einer Ordonnanz, so daß eine große Sintflut und Panik entstand, während die Musik droben ruhig weiterspielte. Leutnant von Brieg hatte eine Weile den Tänzern zugeschaut, und der ganze Saal mit Wappenfries, Stuhlreihen und springenden Paaren begann sich im Kreise zu drehen. Das Bierunglück rüttelte ihn wieder auf. Er warf jäh den feinen Langschädel zurück, schloß den halb geöffneten Überrock und murmelte vor sich hin: »Nein, nichts sagen. Aber reiten, reiten!«
Unbemerkt schlüpfte er hinaus, griff nach Mütze und Säbel und eilte in größter Hast die Treppe herunter, denn er hörte ein paar Stimmen sich hinter ihm nahen. Dann strebte er an der Kasernenmauer entlang, hinter der er das Stampfen und Kettenklirren der Pferde wie im Traume vernahm, in leichten Kurven nach dem gegenüberliegenden Eckpavillon des Gebäudes, wo seine Dienstwohnung lag. Die Ulanen waren zum Glück aus oder auf Stallwache: nur auf der schmutzigen Steintreppe huschten in der trüben Petroleumbeleuchtung ein paar Gestalten in der Stalljacke wie Gespenster an ihm vorüber. Er fand richtig seine wie gewöhnlich unverschlossene Tür, ging stracks ins Schlafzimmer und steckte den weinschweren Kopf ins Waschbecken, griff nach Mütze und Reitpeitsche und wollte nach dem Stall hinunter, wo er den Burschen beim Abfuttern glaubte, als dieser gerade eintrat und nach seinen Befehlen fragte. Höchst erstaunt über Briegs Absicht, wagte er eine bescheidene Einwendung. Aber Brieg beharrte: »Betty heute noch nicht trainiert«, und so mußte er schließlich dem Dienstbefehl Folge leisten.
Brieg folgte ihm nach. Trotz der geöffneten Stallfenster herrschte im Stall eine erstickende Schwüle. Die Pferde scharrten unruhig oder webten kettenklirrend vor den Futterkrippen auf und ab; als sie die schweren Wellblechtüren rasseln hörten, drehten alle die Hälse um oder sprangen aus ihrem Strohlager erschrocken auf. Briegs Rappe futterte noch. Der Bursche, der seinen Herrn im Kasino wußte, hatte sich mit dem Futterschütten Zeit genommen und wagte daraufhin noch einmal eine schüchterne Einwendung.
Aber da kam er bei Brieg an den Falschen. »Warum futtern Sie so spät? Vorwärts! Satteln!« stieß er hervor. Er nannte seinen Burschen immer Sie.
Dieser murrte halblaut etwas vor sich hin, nahm aber dem Rappen die weißleuchtende Stallhalfter ab, hob Sattel und Zaumzeug vom Sattelbaum und blickte dabei mehrfach nach seinem Herrn, ob dieser seinen Sinn noch nicht geändert hätte. Da jedoch nichts erfolgte, sagte er schließlich ganz patzig: »Wenn Herr Leutnant die Betty heute niederreiten, können wir keinen Distanzritt machen.« Er betonte das wir, obwohl er natürlich nicht mitreiten sollte.
»Unsinn,« entschied Brieg, mit der Reitpeitsche auf seinen Schenkel klopfend, »Vorwärts zum Teufel!«
»Wo wollen Herr Leutnant denn noch hin?« fragte der Bursche sorgenvoll.
»Nach Grävenitz,« entgegnete Brieg abweisend.
»Nach ... Heute nacht?«
»Ja, was ist dabei?« fragte der Leutnant gelangweilt und nestelte an seiner Uhrkette, um nach der Uhr zu sehen. »Machen Sie nur zu,« befahl er. »Es ist schon nach neun. Ich muß morgen zum Dienst wieder zurück sein.«
Da zog der brave Thüringer das Pferd an den Nüstern von der Krippe fort, zwängte ihm das Gebiß zwischen die kauenden Kiefer, zog mit Händen und Zähnen den Gurt fest, las das Stroh aus den Hufen und zerrte das widerstrebende Tier vor die Stalltür. Hier half er seinem Herrn in den Sattel, drückte ihm die Zügel in die Hand, führte den trägen Rappen ein paar Schritte an und gab ihm schließlich einen Abschiedsklaps auf die Kruppe.
Die zurückgelassenen Gefährten im Stall, durch das Hufgetrappel erschreckt, begannen hinterdrein zu wiehern; die Stute gab Antwort, bäumte auf, daß die Funken stoben, und wollte nicht vom Fleck. Da gab Brieg ihr die Sporen, gottlob stumpfe Gesellschaftssporen, und das Pferd machte einen Satz, so daß er beide Bügel verlor und beinahe herunterflog. »Beim nächsten Mal liegt er unten,« dachte der Bursche im stillen; »dann ist das arme Tier erlöst.« Aber er irrte sich. Brieg hatte die Zähne aufeinandergebissen und drängte das Pferd an den Zügel heran; so fand er seinen Weg durch das offene Kasernentor. Der Posten salutierte verdutzt, und er grüßte vorschriftsmäßig. Die Abendluft strich ihm kühlend über die heißen Schläfen, und er ward sich bewußt, daß er unbemerkt am Kasino vorbeikommen mußte. Der Hufschlag schallte auf dem Pflaster der stillen Straße, aber zum Glück herrschte in dem Festsaal ein solcher Freudenlärm, daß niemand das mindeste merkte. Nur vereinzelte Passanten blickten erstaunt dem späten Reiter nach, um sich dann gaffend vor die halboffenen Kasinofenster zu postieren, aus denen laute Tanzmusik und Stimmenlärm ins Freie drang.
Droben war das angesteckte Fäßchen bereits versiegt, und die Herren mußten sich fluchend mit Flaschenbier weiter behelfen. Schmitt hatte Brieg aus den Augen verloren und sah sich nach einer Weile wieder nach ihm um, da er ihm doch zutraute, er mochte geritten sein. Als er ihn nirgends erblickte, fragte er die Ordonnanzen, ob der Herr Leutnant schon fortgegangen sei, aber keiner hatte ihn gesehen. Sein Säbel und seine Mütze waren bei der Fülle der angehängten Garderobe nicht ausfindig zu machen. Schmitt ging nach den hinteren Kasinoräumen, wo die älteren Herren rauchend beim Bier saßen und die neue Anbringung des Säbels am Sattel und ihre Gefahren bemängelten. An einem Spieltisch wurde unter den Augen des Obersten ein billiger Skat gedroschen, während in dem Billardzimmer die Kugeln knallten. Aber niemand hatte Brieg gesehen. Schmitt bekam es mit der Angst. Daß er fortgeritten wäre, schien ihm zwar unwahrscheinlich, aber vielleicht war er auf die Straße gelaufen und womöglich in irgend einer Spelunke geendigt! Oder rabiaten Arbeitern in die Finger gelaufen, verprügelt und verhöhnt worden, wie das schon einmal einem angekneipten Infanterieoffizier passiert war ... Herrgott, welche Blamage fürs Regiment! ... Er mußte es Meyring sagen, und dieser suchte gleichfalls. Auf seine Erkundigungen bekam er zur Antwort nur die Gegenfrage, wann »Fritzchen« denn eigentlich »Leine zöge?« Das war nämlich der Spitzname des Obersten, weil seine Gattin ihn so zu rufen pflegte. Als dieser schließlich aufbrach, schnallten Schmitt und Waldburg um und klapperten durch die stillen Straßen nach der Ulanenkneipe. Brieg war nicht da. Auch nicht dagewesen. Sie tranken einen Schnitt und zogen in die nächste Kneipe, wo Infanterie und Artillerie verkehrte. Das gleiche Ergebnis. Sie tranken wieder einen Schnitt und zogen fluchend in ein Weinrestaurant, obwohl Waldburg höhnisch erklärte, Brieg wäre in seinem Leben gewiß noch nicht hiergewesen. Schließlich vollendeten sie ihre Wirtshauspatrouille mit einem Schnitt in der vierten Kneipe, und so erfuhr denn noch am Abend die ganze Garnison, daß der Leutnant von Brieg vom Ulanenregiment verschwunden sei. Schließlich kehrten sie schimpfend nach dem Kasino zurück, wo die Ordonnanzen bereits mit dem Schlaf kämpften und nur noch ein kleiner Kreis um den Spieltisch ausharrte.
Beim Anblick der Karten zog Waldburg sofort ein paar Lappen heraus und hatte binnen kurzem die Bank gesprengt. Dann erklärte er sich bereit, die Bank zu halten, worauf ein paar Herren »kalte Beine kriegten«, wie der Kunstausdruck lautet, und sich empfahlen, während der Rest sich noch enger um den Spieltisch scharte und mit unsteten Blicken die Schläge verfolgte. Bald knallten wieder die Sektpfropfen, und Waldburg strich mit eiserner Ruhe die Scheine und Goldstücke ein; nur ein Zucken um die Mundwinkel verriet seine innere Anspannung. Namentlich der Reserveleutnant Janitschek verlor reißend, während Meyring aufmerksam in alle Karten lugte, um zu sehen, wen Fortuna heute besonders bevorzugte. Dann begann er vorsichtig und mit Unterbrechungen ein paar Goldstücke zu setzen und heimste dabei kleine, aber sichere Gewinne ein.
2.
Inzwischen war der verlorne Sohn des Regiments richtig um die Kaserne herumgeritten und dann in die bekannte Straße nach Grävenitz eingebogen, die von Bäumen eingefaßt und lange Zeit von Häusern begleitet war. Die weit auseinanderstehenden Laternen brannten nur umschichtig, da im Kalender Mondschein vermerkt war; doch ließ diese Beleuchtung wegen der tiefhängenden Wolken viel zu wünschen übrig. Hinter den letzten Häusern versagte sie ganz. Einige unheimliche Gestalten drängten sich hier an dem nächtlichen Reiter vorüber, ohne daß er ihrer irgendwie acht hatte. Nur das Pferd machte einen schreckhaften Satz und ging dann von selbst in Trab über; dem Trabenden hätte sich so leicht keiner in den Weg gestellt.
Brieg suchte sich zusammenzunehmen. »Was will ich denn eigentlich?« fragte er sich. Die verflossenen Stunden lagen hinter ihm wie ein wüster Traum, und zwischen dem Anfang des Liebesmahls und seinem jetzigen Aufenthalt klaffte in seinem Gedächtnis eine Lücke, die nur unbestimmte Erinnerungen ausfüllten. Plötzlich befiel ihn ein Todesschreck, er hätte irgend etwas Heilloses gesagt oder getan, vielleicht wieder sogar unbewußt den Kommandeur angeödet, wie schon einmal nach dem Liebesmahl, wo er mit ihm über Marinefragen gestritten hatte, ohne einen Aviso von einem Linienschiff unterscheiden zu können und ohne am nächsten Morgen noch die geringste Ahnung davon zu haben. Erst die Neckereien der Kameraden belehrten ihn, was er da angerichtet hatte, und der Oberst behielt in der Folge eine recht schlechte Meinung von ihm ...
Wie er jetzt die verschwimmende Grenze zwischen Erinnerung und Einbildung abtastete, kam ihm sein heutiger Ritt um nichts überlegter vor; er hielt plötzlich sein Pferd an und wollte wieder heimreiten. Aber sofort fiel ihm ein, daß er die Sache damit nicht ungeschehen machte, und daß er das Schlimmste, den Weg durch die Stadt, schon hinter sich hätte, kaum wußte er, wie. So konnte er sein Vorhaben auch zu Ende führen, und morgen früh, wenn er zurückkäme, wollte er die Kameraden auslachen, die ihm das nicht zugetraut hatten. Ein trotziges Selbstgefühl überkam ihn. Er konnte auch etwas! Aber darum galt es doppelt, auf der Hut zu sein, um mit frischem Pferd wieder einzureiten; das wäre ein Triumph!
Anfangs waren die Häuser und Bäume wirr an ihm vorübergeglitten, und das Pferd schwamm dahin wie im Leeren, von nun an achtete er peinlich auf den Sommerweg, in dem die Pferdehufe tonlos versanken, und gab dem Rappen bisweilen eine Schrittreprise. Von Zeit zu Zeit leuchtete am Wegrain gespenstisch ein Kilometerstein auf, und die Wolken, die anfangs wie die Draperien eines riesigen Betthimmels herabhingen, klärten sich allmählich, aber zu einem schwarzen, gemusterten Spinnennetz, dessen Riesenspinne eine tintenschwarze, vor dem Mond stehende Wolke war.
Von dem Wiesengrund, durch den er jetzt trabte, wehte es ihm grabeskalt entgegen und legte sich beklemmend auf seine Brust. Über Bach und Busch schwann in breiten Flocken der Nebel und ballte sich rechts und links vom Straßendamm zu unbestimmten Gestalten, die sich über seinen Kopf weg die Geisterhand reichten ... Er schauerte leicht zusammen und drehte sich um, als ob jemand hinter ihm herritte, dort war alles totenstill; nur das eintönige Prusten des Pferdes und das Knarren des Sattels unterbrach das nächtliche Schweigen. Um ein Gebüsch oberhalb des Weges tanzten Glühwürmer ihren Funkenreigen. Bisweilen trat auch der Mond aus den Wolken hervor, die er silbern umsäumte, und dann liefen lange, merkwürdige Schatten über die Landschaft hin, während neben ihm links auf der Straße ein kleines, scharfumrissenes, blauschwarzes Reiterbild trabte ...
Ungewollt trat ein Bild aus seiner Kadettenzeit vor sein inneres Auge. Es war an einem Sonntagabend, als er wieder einmal von Urlaub kam und auf dem damals noch unbebauten Wege nach dem Gefängnis seiner Jugend zurückstrebte. Nebel lagen über der sandigen Heide, und der Mond webte magisch darin, ganz wie jetzt ... Er war hinter dem schwatzenden Schwarm der Kameraden zurückgeblieben, um in diesem Elfenzauber zu schwelgen. Er hatte eine romantische Melodie vor sich hingepfiffen und sein Blick hing wie gebannt an dem müden, rätselhaften Licht, während die andern von ihren mitgebrachten Butterstullen und »anständigen« Mittagessen renommierten. Weiter war es nichts gewesen, und es war doch so viel für ihn, etwas, wovon er in der spartanischen Öde der Knabenkaserne noch lange gezehrt hatte, als die Butterbrote der Kameraden längst dahin waren ...
Und er dachte weiter zurück an seine Kindheit auf dem lindenumrauschten Gute des Vaters und an seine früh verstorbene Mutter, die ihn so geliebt hatte, und der er doch schon so früh entrissen wurde, als er mit elf Jahren in die rauhe Zucht des Kadettenkorps kam. Da er Offizier werden sollte, wie der Vater und Großvater, so hatte ihn der alte General von Brieg frühzeitig in den bunten Kittel gesteckt, den er selbst als Knabe getragen hatte, in dasselbe Potsdamer Kadettenhaus, wo auch er vor achtundvierzig Jahren eingetreten war ... Brieg entsann sich unwillkürlich der Schicksalsstunde, wo der Vater mit ihm vor dem Gittertor ankam und sagte: »Hier ist es.« An den Fenstern standen gerade ein paar Kadetten, die sich die Haare scheitelten; das war sein erster Eindruck ... Dann kam der Abend, wo der Vater sich stolz von dem eingekleideten »Krieger« verabschiedete und der Kleine unter lauter fremden Gesichtern, in einem engen, fremden Anzug, zwischen braun gestrichenen Spinden, Stühlen und Inventarverzeichnissen an den getünchten Wänden zum erstenmal den Abendsegen blasen hörte. Da war ihm so weh ums Herz geworden, daß er weinte ... Er hatte dort nie heimisch werden können. Blaß und in sich gekehrt stand er abseits unter den Bäumen des Gartens, wenn die Kameraden ihre wilden Spiele spielten, und ein unauslöschliches Heimweh fraß ihm am Herzen. All die lieblosen, freudlosen Kadettenjahre standen wieder in seiner Seele auf; und er hatte doch gewähnt, daß diese Schmerzen tot wären; er hatte sie hinter sich zu lassen vermeint, als er das Hauptportal zum letztenmal verließ. Wie glänzend hatte er sich die Zukunft ausgemalt! Wie heiß den Tag herbeigesehnt, wo er die Ulanka des Fähnrichs mit dem Offiziersrock vertauschte! Nun mußte das Glück kommen, hatte er gedacht, als Herr von Meyring ihn persönlich in der Kaserne aufsuchte, um ihm als erster zu seiner Beförderung Glück zu wünschen! Er hatte jenen Augenblick noch deutlich in der Erinnerung. Sein Mund wollte sich noch nicht bequemen, den früheren Vorgesetzten jetzt als Kameraden anzusprechen, aber er fühlte doch eine ungeheure Scheidewand plötzlich fallen. Nun mußte er ja glücklich werden, nun war er nicht mehr der stumme Untergebene, sondern der gleichberechtigte Kamerad jener gefürchteten Vorgesetzten ... Und er hatte sich gezwungen, sich glücklich zu fühlen; aber bald merkte er, daß er sich nur selbst betrog ... Immer lag es vor ihm, das Glück, und lockte ihn, wie das liebliche Landschaftsbild drunten, das sich von der nächsten Bodenwelle aus zu seinen Füßen erschloß: eine alte Burgruine auf steilem Hügel, schwarz und flächenhaft wie eine riesige Kulisse, und darunter im Mondlicht sich schlängelnd eine silberne Flußschleife ... Wenn er erst dort war, war der Zauber sicher geschwunden ...
Verknufft, verschüchtert war er aus dem Kadettenkorps gekommen, ohne eine Ahnung von gesellschaftlichen Anforderungen, aber mit der Verpflichtung, von Anfang an der Ulanka Ehre zu machen. Aus dem Kamaschendrill von Lichterfelde sah er sich plötzlich in eine Welt versetzt, wo nur ein Maßstab galt: Reiten können. Sein Rittmeister hatte es gut gemeint und ihn gleich zum Zusehen bei vier Reitabteilungen kommandiert, und er hatte ohne Belehrung und ohne Verständnis alltäglich vier Stunden lang Rekruten und erste Abteilung, junge und alte Remonten durch den Schlamm des Reitplatzes oder den eiskalten Staub der geschlossenen Bahn an sich vorbeischuckeln sehen, bis es ihm schließlich ganz wirr im Kopfe war; und der Herr Fähnrich machte nachher bei den eigenen Reitkünsten keine gute Figur. Nach dieser summarischen Zustutzung hatte er die Kriegsschule bezogen, wo ihm im Dampftempo eine Fülle trockenen, herzdörrenden Lernstoffes eingetrichtert wurde. Er mußte Divisionen führen, Festungen auf dem Papier belagern und sah sich plötzlich vom Rekruten zum Feldherrn befördert ... Man weihte ihn in die Geheimnisse des letzten, inzwischen völlig veränderten Doppelzünders ein, und das bißchen praktischer Dienst war darüber bald vergessen. Dann kehrte der Junker zum Regiment heim, ohne Ahnung von dem, was man hier von ihm verlangte: nämlich Rekruten instruieren, vor dem Zuge reiten, Patrouillen führen und Reitstunden geben! Der Vater kaufte ihm voreilig ein halb rohes Pferd, klein wie ein Ziegenbock, das er im Frühjahr als Zugführer vor der Front reiten sollte. Er dankte Gott, als die viel zu junge Stute nach mancherlei Verdruß und Verweisen vor Überanstrengung niederbrach und er sich den gutgehenden Rappen seines abgehenden Rittmeisters für teures Geld kaufen konnte.
Seine theoretischen Kenntnisse waren freilich viel besser und frischer als die der Kameraden, die ihr bißchen Kriegsschulweisheit längst verschwitzt hatten und sich darum gegebenenfalls gern an ihn hielten, wenn es galt, ein Kroki zu zeichnen oder eine Winterarbeit zu machen. Besonders machte sich dies der Adjutant zunutze, der seine glänzenden Zeugnisse gelesen hatte; aber auch die andern gingen ihn fortwährend um Liebesdienste an, sogar um Ulkverse zu Hochzeiten und Bratengedichte, denn er hatte eine dichterische Ader. So war er das Mädchen für alles, und er wagte keinem etwas auszuschlagen: es war eine Buße, ein Tribut dafür, daß er anders war. schon im Kadettenhaus war er es so gewöhnt gewesen. Dort hatte er vorsagen müssen und andern die Aufsätze machen – als Lösegeld für den Haß, den seine guten Leistungen erweckten ... Aber ihn als Mensch nehmen, ihm Rat und Ansporn sein, wie er sich in die neuen vielseitigen Pflichten und Verhältnisse zu finden habe, das wollte niemand. Sie wollten alle etwas von ihm haben, aber keiner wollte geben. Ausgenommen vielleicht Herr von Waldburg; aber vor dessen Pferdekuren hatte er eine berechtigte Angst. So hatte er ihm einmal sechshundert Mark im Spiel abgenommen, um ihn, wie er sagte, vom Jeu abzuschrecken. Nur sein Rittmeister nahm sich gelegentlich seiner an. Aber der war ein stiller, wortkarger Niederdeutscher, der ganz in seiner Familie aufging und sich um Kameraden und Kasino ebensowenig scherte, wie seine junge Frau, eine Russin, um die Geselligkeit, was ihnen beiden natürlich sehr verargt wurde. Vielleicht war es die Sympathie gleichen Abseitsstehens, die ihn den jungen Herrn öfter in sein Haus laden ließ; aber jedenfalls war er dadurch kein Lehrer für ihn im Sinne der andern.
Ja, die andern ... Um den kleinen Finger wäre er zu wickeln gewesen, wenn sie ihn richtig zu nehmen wußten. Gab er sich nicht die redlichste Mühe, ihnen näher zu kommen, auf ihre Wünsche, ihre Interessen einzugehen? Und wie sauer wurde ihm das doch oft! Aber keiner lohnte es ihm. Sie blieben wie sie waren, spöttisch und voller Ansprüche, die er nicht einmal recht kannte! Auch nicht einen hatte er gefunden, dem er sich geistig verwandt fühlte, mit dem er sich aussprechen, an dessen Freundesbusen er sich ausweinen konnte. Zu Anfang hatte er sich gesagt, der Mensch müsse sich durchfressen, aber es war immer so geblieben, nichts als kalter und passiver Widerstand, nie ein Wort von Herzen, und wenn er aus dem Kasino heimkehrte, hätte er manchmal laut weinen mögen. Dazu verdarb er sich das mühsam errungene bißchen Sympathie meist wieder durch seine Empfindlichkeit, wenn seine feinen Nerven den rohen Anwürfen und Witzen nicht mehr standhielten; und zur Sühne mußte er sich dann erst recht demütigen.
In vieles würde er sich ohnedies nie fügen, so in die Art der Unterhaltung. Weiber und Pferde waren die zwei Hauptthemata der Kameraden, zu denen nach dem Dienst oder bei der Lektüre des Militärwochenblattes noch das über die Vorgesetzten und Beförderungen trat. Aber wenn sie für Pferde stets ein Herz hatten, so besaßen sie allem Weiblichen gegenüber nur Mißachtung und einen vor nichts halt machenden Zynismus, der geschlechtliche Dinge wie Verdauungsvorgänge ansah. Brieg hätte sich manchmal die Ohren verkleben mögen, nur um ihre Zoten nicht mit anhören zu müssen; er hatte sich aus seinen Knabenträumen eine romantische Scheu und Ehrfurcht vor der Frau gewahrt, und sein Herz krampfte sich schmerzhaft zusammen, wenn er nach einem Balle mit den Kameraden im Café saß, die Augen noch geblendet von all den weißen Armen, wogenden Busen und roten Mädchenlippen, und die Anzüglichkeiten der andern sein Ohr verwundeten ... Anfangs hatte er das alles noch nicht so recht verstanden oder beschönigt und ins Harmlose hinübergespielt, um sein Ideal zu retten. Aber als er die Kriegsschule bezog, raubten ihm die Kameraden, die meist als Gymnasiasten schon Blut geleckt hatten, die letzten Illusionen und hänselten den »Kadetten«, dessen Erfahrungen in Dingen der Liebe nicht über das hinausgingen, was man im Kadettenhause von älteren Kameraden erlauscht hatte oder aus dem Lexikon und der Bibel herauslas, wie die Geschichte von Loth und seinen zwei Töchtern. Dennoch dauerte es eine Weile, bis er seinen Widerwillen bezwang und mit ins Bordell kam. ... Nachher schien es ihm, als wäre jener Dunstkreis von Wein, Zigarettenrauch, schlechten Parfüms und odeur de femme ihm durch alle Poren gedrungen, bis in die Seele, als klebte ihm etwas Unreines an, das kein Wasser mehr abwaschen könnte, als müßte jeder ihm seine Schmach vom Gesicht ablesen! – War das die Liebe? ...
Als junger Offizier hatte er dann allerhand Verirrungen mitgemacht, wie er die wüsten Trinksitten der Kriegsschule mitgemacht hatte; doch fühlte er sich bald davon angewidert und suchte seine Rettung in einer Liebschaft mit einer kleinen Nähterin, die ihm treu und ergeben war und nie etwas andres von ihm nahm, als kleine Aufmerksamkeiten und zu Weihnachten eine billige Brosche oder Uhrkette.
Aber trotz dieses für einen Ulanenoffizier bescheidenen Lebens lag er in stetem Konflikt mit seinem Geldbeutel. Wie sollte er monatlich mit hundertfünfzig Mark auskommen – das war die Frage, für die er keine Lösung fand. Erst fünf Mark Zulage als Kadetten-Unteroffizier und dann plötzlich hundertfünfzig Mark im Portemonnaie – ein sinnverwirrender Sprung! Er wußte eine so große Summe anfangs weder zu übersehen noch einzuteilen. Aber bald merkte er, daß es viel zu wenig war, und daß er der Ärmste im Regiment war. Das Kasino mit seinen Liebesmahlen und Verführungen! Das leichte Bestellen auf Borg! Und dann die Abzüge: Kleiderkasse, Silberkasse, Abschiedsgeschenke, Festmahle mit eingeladenen Gästen ... Einmal in seinem Leben hatte er bar Geld von seinem Gehalt gesehen, und zwar, als er Offizier wurde und am nächsten Ersten auch sein Gnadengehalt für den letzten Monat erhielt. Aber zur Feier dieses Tages mußte er eine große Sektbowle stiften, und schon bei der nächsten Abrechnung war sein Konto mit einem Minus behaftet. Und dieses Minus wuchs zusehend. Wie oft hatte er sich schon vorgenommen, mit Apfelwein und billigem Mosel auszukommen, aber immer wieder hatte die Pflicht der Kameradschaft und der Zwang der Verführung gesiegt! Und nun war er auch noch in seinen guten Sachen ausgeritten! Der Schmelz war hin, auch wenn kein Regen kam. Und seine Kleiderrechnung in Berlin betrug ohnedies Hunderte. Woher das Geld nehmen, ohne zu stehlen? Er konnte ja keinen Verdienst suchen. Spielen? Das war ihm schlecht bekommen. Waldburg hatte ihn, zur Abschreckung, wie er sagte, eines Nachts im Kasino um sechshundert Mark »erleichtert«. Vierhundertfünfzig Mark hatte er dem Vater gebeichtet, und den Rest mit einem ganzen Monatsgehalt gedeckt, wodurch er sich abermals in Schulden gestürzt hatte. Und der Vater hatte ihm gedroht, sich im Wiederholungsfalle an den Kommandeur zu wenden! ... Rennen? Aber dazu war einmal Betriebskapital nötig – und Glück, genau wie beim Hasardspiel ... Beim Lotteriespiel hatte er noch weniger Chancen gehabt. Er wünschte, noch all das schöne Geld zu haben, das er nach und nach in Mecklenburger, Braunschweiger, Hamburger und Sächsischen Losen verputzt hatte, lauter verbotene Lotterien, in denen er doch nie etwas gewann ...
Und nun wollte noch sein Vater kommen, wie im Vorjahre, um ihn wieder zu drangsalieren und zur Sparsamkeit anzuhalten und ihm das Leben zur Hölle zu machen. Er würde sich beschweren, daß sein Lohn zu selten bei ihm speiste, und im Kasino würde man ihm wieder vorwerfen, er entzöge sich der Kameradschaft. Dazu seine lastende Kasinoschuld! Selbst wenn er ihm alles beichtete: würde sein Vater es auch nur verstehen? Ein harter, höhnischer Zug legte sich um seinen Mund. Hatte sein Vater ihn je menschlich erfaßt? Seine Gaben und Gefühle berücksichtigt? Nein, er war ihm fremd wie jeder andre. Nur die Liebe zum Soldatenstand verknüpfte ihre Interessen. Er war eine Ziffer in seinen väterlichen Berechnungen, die Hauptziffer sogar, aber auch nichts weiter!
Plötzlich polterten die Pferdehufe auf etwas hohles, wie auf einen Sarg: Er fuhr erschrocken auf und griff in die Zügel, die er dem Rappen hingegeben hatte. Betty scheute vor den weißlich flimmernden Holzgeländern der hohen, dröhnenden Bretterbrücke, die über den Fluß führte.
»Dummes Tier,« stieß er hervor und strich dem Pferd mit der Reitpeitsche über den schönen gebogenen Rabenhals, um es zu beruhigen. Und er liebkoste es länger als nötig. Alles in allem hatte er nichts auf der Welt als das treue Tier, seine Liebschaft und seine Leute, an denen er gleichfalls mit Liebe hing. Er wollte sich in die Notwendigkeit fügen und das unnütze Sehnen lassen. »Wozu all dies Leid, dieser ziellose Drang, der doch keine Befriedigung bringt?« fragte er sich. »Ja, wozu dieser Ritt?«
Und er war abermals nahe daran, umzuwenden und heimzutraben. Doch da blinkten von der nächsten Geländewelle aus schon ein paar spärliche Lichter durch den leichten Dunstschleier, der über dem Tal lag: es mußte Grävenitz sein. Er zog die Uhr. Halb zwölf. Es war im Mondschein ganz deutlich zu sehen. In einer halben Stunde konnte er da sein. Warum so dicht vor dem Ziel abstoppen und doppelt zum Gespött werden? Trab!
Es ging noch einmal bergab und in sanfter Biegung bergan, dann kam eine lange, tiefschattige Allee, und er war da. Der Nachtwind, der durch die duftenden Kornfelder strich, wehte ihm unbestimmte Geräusche zu. Er horchte gespannt hin und unterschied die ferne Melodie eines Froschteichs. Aber je näher er kam, glaubte er noch etwas andres zu hören; es war wie Gesang und fernes Stimmengewirr, als würde dort ein Fest gefeiert und irgend ein Hoch ausgebracht. Schon blinkten im ungewissen Schein die weißen Knöpfe und Helmbeschläge des Dragonerpostens, der vor der Kaserne auf und ab klirrte. Jetzt blitzte auch die Klinge auf und der hellblaue Rock leuchtete intensiv, während der karminrote Kragen schwarz wirkte. Der Posten blickte den Reiter scharf an und präsentierte dann.
Auf Befragen über den Lärm erfuhr er, daß die Herren Offiziere noch im Kasino wären. »Das ist ja famos!« rief er aus: so hatte er doch Zeugen, daß er in Grävenitz gewesen war. Schon unterschied er deutlich Menschenstimmen, Gesang und mißtönige Musik. Breite Lichtwürfel fielen aus den Fenstern in die Dunkelheit. Einer, der im Fenster lehnte, rief ihn an und er gab sich zu erkennen. Sofort erschienen mit Hallo mehrere Köpfe im Fenster.
»Na, hat Ihr Brotherr mal wieder was ausgeheckt, daß er sie nachts über Land schickt? – Wohl 'n kleiner Alarm mit Nachtübung in der Brigade?« schrieen mehrere Stimmen durcheinander.
»Nein,« antwortete Brieg, »ich hab' nur 'ne Wette gemacht. Wir hatten heute Liebesmahl ...«
Mit dem Augenblick, wo Brieg das Licht und die Menschen erblickte, war die Beklommenheit von ihm gewichen. Die unendliche Nacht schrumpfte zusammen und alles kam ihm klein und entzaubert vor. Das Schauspiel freilich, das sich seinen geblendeten Augen im Kasino darbot, hatte er nicht erwartet. Der Tisch mit den Biergläsern war an die Wand geschoben und auf den Rohrstühlen des Dragonerkasinos saßen rittlings, in fünf Reihen aufmarschiert, etwa fünfzehn Offiziere, voran ein baumlanger, der Adjutant, der ein abgebrochenes Stuhlbein als Säbel schwang, und hinter ihm zwei mit Trompeten Bewaffnete, die im Augenblick seines Eintretens einen mißtönenden Tusch bliesen. »Guten Morgen, Exzellenz,« scholl es ihm aus einem Dutzend heiser geschriener Bierkehlen entgegen und Brieg wußte in seiner Verlegenheit kaum, ob dies eine Ovation war oder man sich über ihn lustig machte. Wie er noch stand, schrie plötzlich der Anführer mit wild geschwungener Keule: »Parademarsch im Trabe!« und die ganze Horde setzte sich gröhlend und juckelnd in Bewegung, daß die Wände erbebten, und defilierte vor Brieg, wobei die Trompeten ein abscheuliches Gewimmel von sich gaben. Ein stehender Pauker bearbeitete den Tisch taktmäßig mit einer großen Bierkanne, daß die Gläser tanzten und auf dem mit Asche beschmutzten Tafeltuch große Bierlachen entstanden. Brieg war die Betrunkenheit noch nie so widerwärtig erschienen als an diesem Abend, wo er ihr selbst kaum entronnen war. Der Tabaks- und Bierdunst, der ihm entgegenquoll, ekelte ihn an, und er wäre am liebsten wieder umgedreht und aufgesessen. Da schrie der Vorreiter, mit dem Stuhlbein in der Luft fuchtelnd: »Meine Herren, auf das Wohl des Schwesterregiments und seines anwesenden Vertreters!« Und im Nu stürzte die ganze Schar von den Stühlen auf die herumstehenden Biergläser und schluckte die braune Flut gierig herunter, daß man einen Augenblick nur das Gegluckse der Kehlen hörte, wie an der Pferdetränke. Brieg wollte ebenfalls ein