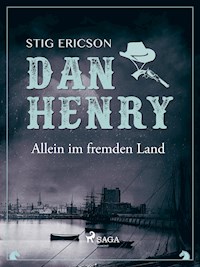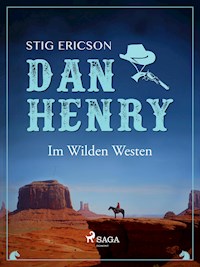Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Nebraska 1890. Jennys Vater ist einer der Siedler, die versuchen, das karge Land für die Landwirtschaft zu nutzen. Jenny bewundert ihren Vater für seinen Willen und sein gutes Gespür. Gleichzeitig leidet sie aber auch unter seiner strengen Erziehung und hat manchmal sogar Angst vor ihm. Als es zu einem Indianeraufstand kommt, geraten Jenny und ihr Vater zwischen die Fronten.AUTORENPORTRÄTStig Ericson, 1929-1989, schwedischer Schriftsteller und Jazzmusiker, studierte auf Lehramt und betrieb nebenbei seinen eigenen Verlag "Två Skrivare". 1970 wurde er mit der Nils-Holgersson-Plakette ausgezeichnet. Die meisten seiner Kinder- und Jugendbücher spielen sich im Wilden Westen ab - hier versucht er, dem Leser das Schicksal und Leben der nordamerikanischen Indianer einfühlsam näherzubringen.-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 187
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Stig Ericson
Der rote Sturm
Aus den Erinnerungen vonJenny M. Lind, Nebraska 1890
Aus dem Schwedischenvon Regine Elsässer
Saga
Mein Vater
Als ich zehn Jahre alt war, schloß mein Vater mich eines Morgens in den Gemüsekeller ein.
Mutter versuchte, ihn zu hindern, aber er stieß sie beiseite, und als er die Tür zudrückte und den Riegel vorschob, hörte ich ihn schreien:
„Kümmere dich um deine Angelegenheiten, Frau. Sonst...“
Ich weiß nicht mehr, was ich angestellt hatte, aber es muß auf jeden Fall irgendwann im Spätherbst gewesen sein, denn die Wühlnattern hatten sich dorthin zurückgezogen, und es kroch und krabbelte überall um mich herum.
Ich stand barfuß in der Dunkelheit und schrie wie eine Wahnsinnige. Wenn ich zwischen den Schreien Luft holte, hörte ich, wie die Schlangen sich bewegten, nicht nur auf dem Boden, sondern auch auf den Regalen und den morschen Brettern unter der Decke. Ich zog mir das Kleid am Hals ganz, ganz fest zu, damit sie nicht an meinen Rücken gelangen konnten, meinen so empfindlichen Rücken, den ich schon damals, so gut es ging, zu schützen versuchte.
Als ich dann wieder herausgelassen wurde, stand die Sonne groß und rot über den Hügeln hinter dem Fluß, das Licht stach wie mit Messern in den Augen, und ich sprach mehrere Tage mit niemandem ein Wort...
So ist es, wenn ich über meine Kindheit und Jugend in der Siedlergemeinde Bluewater erzählen möchte; ich komme auf Ereignisse zu sprechen, die mit Vater zu tun haben; starke, oft schreckliche Erlebnisse, die mich immer noch zu unüberlegtem Handeln veranlassen können.
Er bestimmte mein ganzes Dasein. Meistens haßte ich ihn. Aber gleichzeitig wurde ich von ihm angezogen; es kam häufig vor, daß ich seine Nähe suchte, so wie Motten das Licht.
Mein Bruder Daniel sagte manchmal, ich sei wie mein Vater, und da wollte ich ihn dann immer kratzen und schlagen...
Was ich erzähle, wird nicht nur ein Bericht über den ‚roten Sturm’, die große Indianerfurcht im nordwestlichen Nebraska im Herbst 1890, oder darüber, was die Angst der Menschen, ihre Unwissenheit und ihre Vorurteile vermögen; vieles von dem, was ich erzähle, hat mit meiner Beziehung zu meinem Vater zu tun.
Vielleicht hilft mir das Schreiben, ihn und mich besser zu verstehen.
Mein Vater glich keinem anderen Menschen und wollte es vermutlich auch nicht.
Er hatte die kaputtesten Kleider, den beißendsten Geruch an sich, den wildesten Bart und die schärfste Zunge in der ganzen Gegend.
Jeder, der ihn zwischen den Häusern von Rushville, Chadron, Gordon oder einer der anderen neuerbauten kleinen Ortschaften entlang der Eisenbahn trotten sah, reagierte irgendwie auf ihn.
Die Kinder streckten ihm die Zunge heraus und ahmten seinen merkwürdigen, etwas holprigen Gang nach. Die Frauen traten beiseite und wandten sich ab; er war weit und breit bekannt für seine frechen Grimassen und für seine Verachtung für alles, was Weiberröcke trug. Die Männer schoben sich die Mütze in den Nacken und glotzten ihm nach, entweder mit Wut oder mit widerwilligem Respekt.
Man nannte ihn Onkel Charles.
Das hatte nichts mit seinem Alter zu tun; es gab in der Gegend Männer, die sehr viel älter waren. Aber nach vielen Jahren im Einwandererland war er so etwas wie eine Führerfigur, ein Ratgeber geworden.
An ihn wandte man sich, wenn die Ernte mißlang, wenn wieder Gerüchte umgingen, daß die Indianer oben im Reservat Kriegstänze tanzten, oder wenn die Übergriffe der Viehzüchterbosse gegen die Siedler zu schlimm wurden.
Die Bosse wollten die früher freien Steppen für sich haben. Die Weiden machten sie reich, oder noch reicher. Die meisten hatten viele tausend Tiere. Deshalb versuchten sie auf jede nur mögliche Art, die Neuankömmlinge zu vertreiben. Häuser brannten aus mysteriösen Gründen. Eingewanderte Farmer wurden tot mit Schußwunden im Rücken gefunden. Unbekannte Reiter galoppierten im Schutz der Dunkelheit nach Süden...
Die Gegend um Bluewater war weit weg vom nächsten Sheriff.
Vater behauptete, der einzig gebildete Mensch in der ganzen Gegend zu sein. Das würde man nicht glauben, wenn man ihn sah oder in seinem gebrochenenen Englisch schimpfen und fluchen hörte, aber es kann schon sein, daß etwas dran war an der Behauptung.
Bis zu den schrecklichen Ereignissen oben im Pine-Ridge-Reservat in der Woche nach Weihnachten im Jahr 1890 war er davon überzeugt, daß er und sonst niemand wußte, wie Bluewater in Zukunft aussehen würde.
Es ging um den Anbau. Ums Säen und Pflanzen, Wässern und Beschneiden. Darum, die richtigen Pflanzen in die richtige Erde zu setzen.
„Da, wo wilde Sonnenblumen wachsen, kann man auch Mais säen...“
Das habe ich ihn unendlich oft sagen hören, sowohl zu Neuankömmlingen als auch zu Nachbarn, die Ratschläge haben wollten. Und er hatte meistens recht. Ich wuchs in einem Land auf, das sich wandelte; in meiner Kindheit wurden viele tausend Acres bis dahin unberührtes Prärieland unter den Pflug genommen.
Mein Vater war ein Farmer, ich möchte sogar fast behaupten ein Farmer-Genie. Es kam vor, daß Leute aus Lincoln angereist kamen, um seinen Obstgarten anzuschauen. Er hatte die Fähigkeit, die Kraft des Bodens zu bestimmen, indem er an der Erde roch oder sie zwischen seinen kurzen, immer schmutzigen, aber dennoch merkwürdig empfindsamen Fingern zerkrümelte.
Er liebte den Mais, den Obstgarten und das Gemüse und haßte viele Menschen.
Es war fast nicht möglich, ihn zu verstehen.
Er hieß Charles J. Lind und stammte aus Schweden.
Der Indianerbaum
Viele Gemeinden haben ihre besonders gefährlichen und unheimlichen Orte, wo es angeblich in bestimmten Nächten spukt, wo die Eule bei Vollmond dreimal hintereinander ruft.
Diese Orte haben oft etwas mit Gewalt und Blut und Tod zu tun.
Auch die kleine Siedlergemeinde am Bluewater kam zu einem solchen Ort. Er lag am Fluß, drei oder vier Meilen nach Osten.
Da stand eine riesige, verwachsene Baumwollpappel, deren knorrige Zweige und rissige Rinde die Spuren von vielen Jahrzehnten von Stürmen und Grasbränden trugen. Der Baum wuchs so nah am Fluß, daß die klauenähnlichen Wurzeln bis ins Wasser reichten.
Eines Tages hing da ein Mensch, ein junger Indianer.
Es geschah an einem klaren, sonnigen Herbsttag, ein paar Tage, bevor ich zehn Jahre alt wurde. Ich verstand zuerst gar nicht, was geschehen war.
Ich sah, wie Menschen mit gesenktem Kopf vorüberritten, und als eine der Nachbarsfrauen in die Küche kam, begrüßte sie mich nicht, und Mutter schickte mich hinaus, ehe sie miteinander sprachen. Es lag etwas in der Luft, etwas Schreckliches und Beängstigendes, und hinterher war Mutter ganz anders als sonst. Sie hatte Angst im Gesicht, obwohl Vater nicht zu Hause war. Ich konnte keinen Augenkontakt mit ihr bekommen.
Und ich fragte mich natürlich, was wohl passiert war.
„Laß mich in Ruhe“, zischte sie, wenn ich sie fragte.
„Aber Mutter, Liebe...“
Sie schlug nach mir.
„Ach Kind. Häng mir nicht am Rockzipfel. Raus.“
Mutter kam aus Deutschland und hatte die neue Sprache nicht richtig gelernt. Sie verwendete oft deutsche Wörter.
Raus bedeutete, daß ich verschwinden sollte, daß sie mich nicht sehen wollte...
Irgendwie bekam ich dann doch heraus, daß man an diesem sehr sonnigen Morgen in der Nähe von Bluewater einen Menschen getötet hatte, daß man jemandem einen Strick um den Hals gebunden hatte und ihn an einem Baum hochgezogen hatte, so daß er erdrosselt wurde.
Wenn es niemand sah, band ich mir das Brunnenseil um den Hals und versuchte, mir vorzustellen, wie es sich anfühlte, erhängt zu werden.
Es ging nicht.
Ich erinnere mich auch an etwas, was Vater sagte, als er und Mutter ausnahmsweise miteinander sprachen. Es muß ein paar Tage später gewesen sein.
„Sie waren keine Menschen, als sie es taten“, sagte er. „Sie waren ein Mob.“
Mob.
Das war ein neues Wort, über das ich viel nachdachte.
Vater war dabei, als sie den Indianer hängten, aber er erzählte nicht, was geschehen war. Das erfuhr ich erst viele Jahre später von anderen. Vater erzählte selten oder fast nie etwas.
Es hatte etwas mit gestohlenen Pferden zu tun.
In diesem Sommer waren drei oder vier Pferde von den Höfen in der Gegend verschwunden, und Pferde waren der wertvollste Besitz. Man lieh sich Geld gegen hohe Zinsen, um die Ochsen gegen ein paar Pferde eintauschen zu können.
Die Pferde waren ein Zeichen dafür, daß man auf dem besten Weg war, es zu schaffen, daß man sich durch die ersten Schwierigkeiten hindurchgearbeitet hatte. Wer ein Pferd besaß, mit dem mußte man rechnen.
Eines Morgens war der Schotte McBride früh auf, und da sah er einen Indianer im Pferdegehege. Ich erinnere mich an McBride als einen grobschlächtigen, rothaarigen Mann mit harten Augen und tiefen Falten zwischen Mund und Wangen. Der Indianer rannte davon, trat aber in ein Kaninchenloch und fiel hin. McBride übermannte ihn und rief Leute zusammen, indem er drei Schüsse in die Luft abgab.
Das war die übliche Art, um Hilfe zu rufen.
Als genug Leute beisammen waren, warf man den gefesselten Indianer auf einen offenen Wagen, um ihn zum Sheriff nach Valentine zu bringen. Die Eisenbahn war damals noch nicht weiter gekommen.
Aber nun war es ein ungewöhnlich warmer Morgen, und es war weit bis nach Valentine. Das Korn stand reif auf dem Feld, man war mitten in der Erntearbeit, und für viele war es die erste Ernte in dem neuen Land. Man konnte nie wissen, wie das Wetter am nächsten Tag war. Die Herbstregen kamen sicher bald.
Man sprach darüber, während der Indianer schwieg und der Karren auf dem primitiven Weg vorwärtsknirschte. Man fluchte über die Wärme und darüber, daß ein guter Arbeitstag verloren gehen würde. Konnte McBride diesen Transport denn nicht alleine machen?
Das konnte McBride nicht. Es gab bestimmt noch mehr Rothäute in der Nähe, und er wollte nicht riskieren, von einer Horde mörderischer Wilder überfallen zu werden...
Man verfluchte alle Indianer, dieses Diebes- und Banditenpack, das oben im Reservat gut lebte, das Essen und Kleider bekam, ohne auch nur einen Finger zu rühren, während ehrliche, christliche Leute schufteten, daß ihnen das Blut unter den Nägeln hervortrat. Man schaute sich die schwieligen Hände an, die Sonne stieg immer höher, und ein Wort gab das nächste.
Die gestohlenen Pferde würden nie mehr zu ihren rechtmäßigen Besitzern zurückkommen; die waren wohl oben im Reservat verkauft worden, um Geld für den sündigen Whisky zu bekommen. Sie soffen ja wie die Schweine, die Rothäute. Und wenn sie nicht soffen, dann stahlen sie ehrlichen Leuten die Pferde...
Warum es nicht auf der Stelle erledigen? Er würde ja doch gehängt werden.
Es kann sein, daß es wie ein Scherz anfing, so wie Männer sich gegenseitig zeigen, wie stark sie sind, und sicher haben viele protestiert. Mein Vater muß einer von denen gewesen sein. Er hatte zusammen mit Indianern gejagt und zollte ihnen einen gewissen Respekt. Außerdem konnte er Leute mit vorgefaßten Meinungen nicht ausstehen, obwohl er selbst dazugehörte.
Aber dieses Mal haben nicht viele auf Onkel Charles gehört.
Als man an die Stelle kam, die noch sehr lange Zeit ‚Der Indianerbaum’ genannt wurde, warf jemand ein Seil über den untersten Ast.
Hinterher wollte niemand sagen, wer es war, aber es ging das Gerücht, daß es ein älterer Mann war, der schon 25 Jahre zuvor im Bürgerkrieg gekämpft hatte und ‚Der Korporal’ genannt wurde.
„Die Stelle ist so gut wie jede andere.“
„Ja, los, rauf mit ihm.“
„Dann haben wir es hinter uns.“
„Laßt den Schuft tanzen.“
„Die Familie soll nicht hungern müssen.“
„Es reicht schon mit der gewöhnlichen Plackerei...“
Ungefähr so wird es gewesen sein.
Die gewöhnliche Plackerei, das Gefühl, den Kampf gegen die magere Erde und das Schlechte nicht gewinnen zu können, jahrelang die enttäuschten Augen von Frauen, die von Heiratsannoncen im Omaha Daily Bee und anderen Zeitungen hergelockt worden waren, die ständige Angst vor dem Versagen und Untergang... dies und vieles andere, was sich nicht in Worten ausdrücken läßt, muß hinter dem blinden Haß der folgenden Minuten gelegen haben, dem Haß gegen jemanden, der einer anderen Rasse angehörte, dem man sich überlegen fühlte.
Eine Ansammlung ganz normaler Männer, von denen viele bestimmt jeden Tag in der Bibel lasen, hatte sich in einen Mob verwandelt.
Der Indianer war jung und mager und sprach schlecht englisch. Zuerst hatte er geschwiegen, aber jetzt versuchte er zu erklären, immer wieder. Er wußte nichts von gestohlenen Pferden, er war nur neugierig gewesen...
Als ihm die Augen der Männer sagten, daß er verurteilt war, bespuckte er die, die am nächsten standen, und dann begann er ‚schreckliche und heidnische’ Lieder in seiner eigenen Sprache zu singen.
Man knüpfte eine Schlinge und zog ihn in den Baum hoch – er wand sich und zappelte wie eine Klapperschlange, die man gerade erschlagen hat – und dann verschwand man schnell.
Alle schwiegen. Man vermied es, einander anzuschauen. Einer setzte sich mit dem Kopf zwischen den Knien an den Wegrand...
Der Körper des toten Indianers verschwand schon in der folgenden Nacht.
Die gestohlenen Pferde tauchten unten in Alliance, einen Tagesritt südwärts, wieder auf. Ein paar weiße Cowboys von einer der großen Ranchen hatten versucht, sie zu verkaufen. Sie verschwanden sehr schnell, als sie merkten, daß der Käufer mißtrauisch wurde.
McBride verschwand mit seiner Familie nach dem ersten Herbststurm, und nur ein paar Tage danach brannte sein Haus.
Auf dem Hof fand man einen roten Pfeil.
Für manche Familien begann die Angst vor den Indianern schon jetzt – obwohl es noch viele Jahre dauern sollte, bis die Indianer oben im Reservat um ihre Feuer tanzten.
Und bald ging auch das Gerücht, daß der tote Indianer bei der Baumwollpappel, dem Indianerbaum, spukte, daß er keine Ruhe in seinem unbekannten Grab finden würde, bis er gerächt worden wäre. Besonders gefährlich war es, wenn Vollmond war und die Eule dreimal rief.
Meine erste Lehrerin
Mein Vater kam, wie gesagt, aus Schweden, und so unglaublich das auch klingen mag, er war ‚ein gebildeter Mensch’, wie er selbst immer betonte. Aber er sprach schlecht englisch.
Mutter stammte aus einem Dorf in der Nähe von Bremen, und ihr Englisch war noch schlechter.
Zufälle hatten sie zusammengebracht. Sie brauchten einander, um im Einwandererland überleben zu können.
Aber es gab zwischen ihnen keine Liebe, keine Zuneigung, und ich hörte sie nur selten miteinander sprechen. Sie tauschten allerhöchstens kurze Sätze miteinander in einer Sprache, die für sie beide fremd war.
Die Sprachlosigkeit, in der ich und meine Geschwister aufwuchsen, hatte natürlich auch etwas mit der Landschaft zu tun. Wir lebten an der Grenze zur reinen Wildnis. Die Abstände zwischen den Häusern waren groß, und die Leute schufteten auf ihren Grundstücken so viele Stunden am Tag, wie das Tageslicht es zuließ. Und wenn man ausnahmsweise einmal miteinander sprach, dann wechselte man ein paar Worte übers Wetter oder die Indianer oben im Reservat.
Zweimal in der Woche kam der alte Mr. Huff vorbei. Er brachte die Post aus Rushville. Wir bekamen nie Briefe, aber Vater hatte den Rushville Standard abonniert, oder es kamen Samenkataloge, die Vater bei einer Firma in Lincoln bestellt hatte.
Mutter bot Mr. Huff immer einen Becher Kaffe oder Pflaumenwein in der Küche an, und für mich gab es nichts Schöneres, als in einer Ecke zu sitzen und ihm zuzuhören, wenn er von der Großen Weiten Welt erzählte.
Er erzählte von allen Leuten oben in Rushville, von den neugebauten Häusern und von all den merkwürdigen Dingen, die es in den Geschäften zu kaufen gab. Von der Postkutsche, die nach Pine Ridge fuhr und von sechs Pferden gezogen wurde, und – vom Allerwunderbarsten – der Eisenbahn.
„Sie haben jetzt eine neue Lok bekommen. Sie ist an der Seite grün und hat rote Räder, und sie glänzt heller als die Sonne. Und der Schornstein, der ist so groß, daß man zehn Gören von deiner Sorte hineinstopfen könnte, ohne daß es auffiele. Diese Lok solltest du mal sehen...“
Einmal fragte Mutter, wie es oben im Reservat aussah. Mr. Huff strich sich mit der Hand über die Glatze, schaute auf den Boden und verzog das Gesicht zu seinem schüchternen Lächeln. Tja, so lange die Roten ihre Lebensmittelrationen bekamen, hielten sie Ruhe, aber jetzt sah es damit eher schlecht aus.
„Obwohl sie bei uns in Rushville kein Aufsehen erregen. Man sieht kaum welche. Und egal, wie warm es ist, so haben sie ihre schmutzigen Decken über den Schultern. Es gibt Leute, die behaupten, sie machen es, damit man ihre Waffen nicht sieht, aber das glaube ich nicht. Obwohl man ja auch hin und wieder welche sieht, denen man nicht im Dunklen begegnen möchte. Aber die meisten sitzen vor den Geschäften und starren vor sich hin. Als ob sie auf etwas warten würden.“
Ich fragte, worauf sie warteten.
Mr. Huff nahm seine Mütze und ging zur Tür.
„Ich weiß es nicht. Vielleicht auf bessere Zeiten. Oder darauf, daß etwas passiert...“
Im Sommer 1889 sammelte man Geld für die erste Schule in Bluewater, und im Herbst war das Gebäude fertig. Der Distrikt bekam die Nummer 37. Die Zahl war mit schwarzer Farbe auf ein weißes Brett gemalt worden, das über der Tür des langen Torfhauses angebracht war.
Ich sehnte mich danach, in die Schule gehen zu können, wie man sich überhaupt nach etwas sehnen kann, wenn man gerade vierzehn Jahre alt geworden ist. Ich konnte deshalb nur enttäuscht sein, als ich ankam.
Mein fünf Jahre jüngerer Bruder Daniel und ich bekamen schon am ersten Tag Schwierigkeiten. Die anderen Kinder hänselten uns wegen unserer Kleider, unserer Art zu reden und nicht zuletzt wegen unseres Vaters.
Aber die Enttäuschung legte sich bald, und das war das Verdienst der Lehrerin.
Sie hieß Mary Ryan und hatte meistens ein rotes Kleid an mit rundem Kragen und fünfzehn goldfarbenen Knöpfen, die wie kleine Sonnen strahlten. Ich hatte so ein warmes Rot noch nie gesehen.
Und ich hatte noch nie so gepflegte Hände und so blanke Schuhe gesehen.
Ich saß ganz hinten im Schulhaus auf einer langen Bank, reckte den Hals und glotzte ihre schwarzen Schuhe an. Ich weiß, daß ich auch an ihre Unterwäsche dachte: sie konnte unmöglich aus alten Mehlsäcken gemacht sein wie die von normalen Menschen.
Aber Mrs. Ryan war auch kein normaler Mensch. Sie war eine Offenbarung, ein Lichtschein im Halbdunkel, und sie bedeutete unendlich viel für mich.
Ihr verdanke ich, daß ich Ahnung davon bekam, daß es eine Welt gab hinter den Maisfeldern, dem Fluß und den Sandhügeln, ja sogar hinter Mr. Huffs Rushville.
Ihr verdanke ich, daß ich begriff, daß es eine andere Sprache gab als die abgehackten Sätze, die bei uns zu Hause gewechselt wurden.
Ich verehrte sie, meine erste Lehrerin. Durch sie füllte sich mein inneres Schweigen mit Wörtern. Sie gab mir Material für neue Träume.
Einer der Träume war, daß ich eines Tages so werden würde wie sie. Ich würde sprechen wie sie, so schöne Kleider tragen wie sie, sein wie sie. Das war ein fast unerreichbares Ziel für eine scheue und störrische Farmerstochter, die gerade mal eben lesen gelernt und die Eisenbahn noch nie aus der Nähe gesehen hatte.
Aber Daniel und ich durften nur ein paar Monate in die Schule gehen. Dann gab es für uns keinen Platz mehr; neue Familien, die näher wohnten, hatten sich niedergelassen.
Ich hatte den Verdacht, daß Vater hinter dem Beschluß der Schulleitung steckte; er hatte eine ähnlich niedrige Meinung von amerikanischen Schulen und Lehrerinnen wie von Pfarrern und Wanderpredigern.
Wir bekamen den Beschluß in der Schule mitgeteilt, und auf dem Heimweg saß ich in einer Schneewehe am Weg und haßte meinen Vater.
Ich war untröstlich. Ich wollte die Luft anhalten, bis ich tot war.
Ein paar Tage später bekamen wir abends Besuch von Mrs. Ryan. Vater war nicht zu Hause, und sie kam in die Küche und legte die ersten beiden Bände von Harper Lesebüchern auf den Tisch. Sie sagte, Daniel und ich sollten versuchen, alleine weiterzulesen, und Mutter könnte uns bestimmt helfen, wenn wir mal bei einem Wort nicht weiterkämen.
Dann bat sie mich, sie hinauszubegleiten, und als wir bei ihrem Einspänner waren, holte sie etwas unter der Decke auf dem Sitz hervor.
„Hier...“
Sie reichte mir ein Buch, das in Zeitungspapier eingeschlagen war.
„Es ist eine Bibel“, sagte sie. „Ich wollte sie nicht mit hineinnehmen, weil ich ja nicht wußte, ob Onkel Charles... tja, was er von der Religion hält, weißt du ja sehr viel besser als ich.“
Ich konnte das Paket nicht entgegennehmen. Es brannte im Hals und drückte hinter den Augäpfeln. Ich konnte mit dieser unvermuteten Freundlichkeit, diesem Vertrauen nicht umgehen.
Ich starrte in den sternenhellen Schnee und hörte Mrs. Ryan sagen:
„Nimm sie jetzt. Ich möchte, daß du sie bekommst. Verstehst du? Ich möchte es.“
Sie steckte mir das Paket unter den Arm, streichelte mir leicht über die Wange, stieg auf ihren Einspänner und fuhr davon.
Ich entdeckte später, daß sie mir ihre eigene Bibel geschenkt hatte, die sie wahrscheinlich zur Konfirmation bekommen hatte. Auf dem hellbraunen Papier im Deckel stand mit Tinte geschrieben ihr Mädchenname: Mary Elisabeth Finerty.
Mrs. Ryans Bibel sollte mir sehr viel bedeuten in dem schlimmen Winter, der dann kam.
Sie gab mir Mut und Stärke, als ich glaubte, nach einem schweren Schneesturm blind zu werden. Ich bewahrte sie in einer leeren Blechkiste neben meinem Bett auf, und auch wenn ich sie nicht sehen konnte, so wußte ich doch, daß sie da war, und als ich dann wieder auf einem Auge sehen konnte, gelobte ich mir, jeden Tag in der Bibel zu lesen.a
Und das machte ich auch, ich buchstabierte mich nicht nur durch Texte in der Bibel; ich las den Rushville Standard, Vaters Samenkataloge, ja, eben alles, was ich in die Hände bekam...
Manches verstand ich, aber das meiste natürlich nicht. Ich stolperte über jede Menge Wörter, die völlig neu für mich waren. Ich konnte sie nicht aussprechen und hatte keine Ahnung, was sie bedeuteten. Ich lernte, wie man sie schrieb, und dann probierte ich, wenn ich alleine war, unterschiedliche Aussprachen. Ich versuchte auch zu erraten, was sie bedeuteten.
Ich machte ein Spiel daraus.
Ich versuchte auch, Wörter zu finden, die sich mit den neuen Ausdrücken reimten:
Flechten, hechten, knechten, rechten ...
Die Reimverse drehten sich dann in meinem Kopf, wenn ich meine kleinen Geschwister hüten oder in Vaters Garten Unkraut jäten mußte.
Die Bibel, die ich von Mrs. Ryan geschenkt bekommen hatte, zeigte mir den Weg zu einer funktionierenden Sprache, und nur derjenige, der sich eine Sprache erkämpfen mußte, weiß ihren Wert zu schätzen.
Aber ich zeigte die Bibel nie meinem Vater.
Die andere Mrs. Ryan
Mrs. Ryan war Witwe, und sie wohnte bei ihrem Bruder in einem weißen Holzhaus in der Nähe des Flusses ein bißchen außerhalb des Ortes. Von uns waren es sicher vier Meilen bis dorthin.