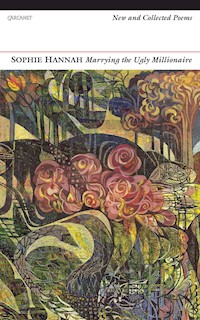9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Als Gaby am Flughafen eine junge Frau kennenlernt, erzählt diese ihr eine merkwürdige Geschichte. Ein Mann hat den Mord an seiner Frau gestanden, ohne jedoch das geringste Motiv anzugeben. Das Ungeheuerliche daran ist: Gaby kennt diesen Mann. Es ist Tim Breary, ihre einstige große Liebe - und der friedlichste Mensch, dem Gaby je begegnet ist. Trotz des Geständnisses glaubt sie an Tims Unschuld und begibt sich auf die Spur eines ebenso rätselhaften wie perfiden Verbrechens ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 734
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über die Autorin
Titel
Impressum
Widmung
Brief
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Danksagung
Über die Autorin
Sophie Hannah ist eine junge britische Autorin, die für ihre Werke bereits zahlreiche Auszeichnungen erhielt. Still, Still, ihr erster Psychothriller, galt in England als einer der besten Romane des Jahres und ist ebenso wie ihre weiteren Romane in 20 Ländern erschienen. Die Autorin lebt mit ihrem Ehemann und zwei Kindern in Cambridge.
Sophie Hannah
DER SANFTEMÖRDER
Psychothriller
Aus dem Englischen vonAnke Angela Grube
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Übersetzung der beiden Gedichte von Adam Johnson und Lachlan Mackinnon: Professor Dr. Werner von Koppenfels, dem hierfür unser herzlichster Dank gilt
Übersetzung des Gedichtes von Robert Frost: Paul Celan
Übersetzung der Passage aus »Moby Dick« von Herman Melville:
Alice und Hans Seiffert, Aufbau Taschenbuch Verlag 2011
Deutsche Erstausgabe
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2013 by Sophie Hannah
Titel der englischen Originalausgabe: »The Carrier«
Originalverlag: Hodder & Stoughton Ltd,
a division of Hodder Headline, London
Für die deutschsprachige Ausgabe:
Copyright © 2016 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Britta Schiller, Eitorf
Titelillustration: © shutterstock/pashabo; © shutterstock/Florian Schott;
© shutterstock/Kostsov; © shutterstock/Oleksandr
Umschlaggestaltung: Massimo Peter
E-Book-Produktion: Urban SatzKonzept, Düsseldorf
ISBN 978-3-7325-1470-0
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
FÜR PETER STRAUS,MEINENWUNDERBAREN LITERATURAGENTEN,DERÜBERMAGISCHE KRÄFTEVERFÜGT.
Asservaten-Nr. 1431B/SK – Abschrift eines handschriftlichen Briefs von Kerry Jose an Francine Beary, Datum: 14. Dezember 2010
Warum bist Du immer noch hier, Francine?
Ich habe immer daran geglaubt, dass Menschen ihren eigenen Tod durch bloße Willenskraft herbeiführen können. Wenn unser Gehirn es schafft, uns genau eine Minute vor dem Klingeln des Weckers aufwachen zu lassen, dann muss es doch auch in der Lage sein, unseren Atem stillstehen zu lassen. Bedenke: Gehirn und Atem sind enger miteinander verbunden als das Gehirn und der Nachttisch. Ein Herz, dem von einem Gehirn befohlen wird, mit dem Schlagen aufzuhören, das kein Nein als Antwort hinnimmt – welche Chance hat es schon? Das habe ich jedenfalls immer gedacht.
Ich kann mir kaum vorstellen, dass Du gern bleiben möchtest. Und selbst wenn – es wird nicht mehr lange in Deiner Macht stehen. Jemand wird Dich umbringen. Schon bald. Jeden Tag ändere ich meine Meinung darüber, wer es tun wird. Ich empfinde keine Notwendigkeit, jemanden davon abzubringen, ich sage es Dir nur. Indem ich Dir die Chance gebe, Dich zu entfernen, Dich außer Reichweite zu bringen, zeige ich mich fair gegenüber allen.
Ich gebe es zu: Ich versuche, Dich zum Sterben zu überreden, weil ich Angst habe, dass Du wieder genesen könntest. Wie kann einem das Unmögliche so absolut möglich erscheinen? Das muss bedeuten, dass ich immer noch Angst vor Dir habe.
Tim nicht. Weißt Du, was er mich einmal gefragt hat, vor Jahren? Wir waren in Deiner Küche im Heron Close, er und ich. Diese weißen Serviettenringe, die mich immer an Halseisen erinnerten, lagen auf dem Tisch. Du hattest sie aus der Schublade geholt, zusammen mit den braunen Servietten mit dem Entenmuster am Rand, und wortlos auf den Tisch geknallt. Tim sollte den Rest erledigen, ob er es nun wichtig fand oder nicht, Leinenservietten in Ringe zu schieben, nur um sie eine Viertelstunde später wieder herauszuziehen. Dan war losgezogen, um uns etwas vom Chinesen zu holen, und Du warst schmollend zum Ende des Gartens marschiert. Tim hatte irgendetwas Gesundes mit Sojasprossen bestellt, das er, wie wir alle wussten, nicht besonders mochte, und Du hattest ihm vorgeworfen, sich aus den falschen Gründen für dieses Gericht entschieden zu haben: um Dir zu gefallen. Ich erinnere mich, wie ich mit den Tränen rang, nachdem ich ihm ungeschickt das Besteck aus der Hand genommen hatte. Es gab nichts, was ich tun konnte, um ihn vor Dir zu retten, aber ich konnte ihm die Mühe abnehmen, den Tisch zu decken, und ich war entschlossen, wenigstens das zu tun. Damals ließ Tim es höchstens zu, dass wir kleine Dinge für ihn erledigten, also taten Dan und ich das, so oft wie möglich, wir wandten so viel Mühe und Sorgfalt darauf, wie wir konnten. Trotzdem brachte ich es nicht über mich, diese elenden Serviettenringe anzufassen.
Als ich sicher war, dass ich nicht weinen würde, drehte ich mich um und sah einen vertrauten Ausdruck auf Tims Gesicht, den, der besagt: »Ich möchte gern, dass du etwas weißt, aber ich bin nicht bereit, es auszusprechen, also werde ich stattdessen ein wenig mit dir spielen.« Dieser Gesichtsausdruck ist schwer vorstellbar, solange man ihn nicht selbst gesehen hat, was du garantiert niemals getan hast. Tim hat schon eine Woche nach Eurer Hochzeit jeden Versuch aufgegeben, mit Dir zu kommunizieren. »Was ist?«, fragte ich.
»Ich muss mich über dich wundern, Kerry«, sagte er mit einer Empörung, der man ruhig anhören sollte, dass sie gespielt war. Er hegte keinerlei Misstrauen gegen mich, das wusste ich, und ich erriet, dass er mir verdeckt etwas über sich selbst mitteilen wollte, wie er es oft tat. Ich fragte ihn, worüber er sich denn wundere, und er antwortete, so laut, als spräche er in einem großen Saal vor einem Publikum, das über mehrere Sitzreihen verteilt war: »Stell dir vor, Francine wäre tot.« Ein Satz, der sofort eine schmerzliche Sehnsucht in meiner Brust auslöste. Genau das wünschte ich mir so sehr, Francine, aber wir hatten Dich am Hals. Vor Deinem Schlaganfall dachte ich, du würdest einhundertzwanzig werden.
»Hättest du dann immer noch Angst vor ihr?«, fragte Tim. Jeder der ihm zugehört hätte, ohne ihn gut zu kennen, hätte angenommen, dass er mich aufzog und es genoss. »Ich glaube ja. Selbst wenn du wüsstest, dass sie tot ist und nicht wiederkommt.«
»Du sagst das, als gäbe es eine Alternative«, bemerkte ich. »Tot sein und wiederkommen.«
»Würdest du dann immer noch ihre Stimme in deinem Kopf hören, die alles das sagte, was sie sagen würde, wenn sie noch lebte? Wärst du dann freier von ihr, als du es jetzt bist? Wenn du sie nirgends sehen könntest, würdest du dir vorstellen, dass sie irgendwo anders sein muss und dich beobachtet?«
»Sei nicht albern, Tim«, sagte ich. »Du bist der am wenigsten abergläubische Mensch, den ich kenne.«
»Aber wir reden hier doch über dich«, entgegnete er mit formvollendeter Unschuld und lenkte so die Aufmerksamkeit wieder auf seine Schauspielerei.
»Nein. Ich hätte keine Angst vor jemandem, der tot ist.«
»Wenn du ebenso viel Angst vor einer toten Francine hättest, würde es nichts bringen, sie umzubringen«, fuhr Tim fort, als hätte ich gar nichts gesagt, »vermutlich abgesehen von einer Gefängnisstrafe.« Er nahm vier Gläser mit klobigen grünen Stielen aus dem Schrank. Die habe ich auch immer gehasst, da es bei ihnen stets wirkte, als habe man schleimigen Bodensatz im Getränk.
»Ich habe nie verstanden, was so interessant daran sein soll, über den Unterschied zwischen Mördern und uns Übrigen zu spekulieren.« Tim holte eine Flasche Weißwein aus dem Kühlschrank. »Wen interessiert es, was einen Menschen bereit und willens macht, zu töten, während ein anderer das nicht ist? Die Antwort liegt doch auf der Hand: Leidensdruck und die Frage, wo man auf der Tapferkeits-Feigheits-Skala steht. Mehr nicht. Es gibt nur einen einzigen Unterschied, der es wert ist, untersucht zu werden: den zwischen denjenigen unter uns, die mit ihrer Gegenwart auf der Welt, mag sie auch noch so glanzlos und chaotisch sein, nicht dazu beitragen, andere zu zerstören und ihnen jede Lebensfreude zu nehmen, und denjenigen, über die das beim besten Willen nicht gesagt werden kann. Jedes Mordopfer ist ein Mensch, der in mindestens einem anderen Menschen den Wunsch ausgelöst hat, es würde ihn nicht geben. Und wir sollen dann Mitgefühl empfinden, wenn es ein schlechtes Ende mit ihm nimmt.« Er gab einen wegwerfenden Laut von sich.
Ich lachte über diese empörende These und fühlte mich dann schuldig, weil ich darauf hereingefallen war. Tim ist nie besser darin, mich aufzuheitern, als wenn er keine Hoffnung auf Trost für sich selbst sieht; ich soll mich glücklicher fühlen und mir vorstellen, dass er sich auf derselben emotionalen Bahn bewegt. »Willst du damit sagen, dass alle Mordopfer es herausgefordert haben?« Ich ließ mich bereitwillig ködern. Wenn Tim über irgendetwas diskutieren will, so absurd es auch sein mag, dann diskutiere ich mit ihm, zu jeder Zeit, bis er findet, dass es genug ist. Dan tut das auch. Es ist eine der vielen tausend Formen, die Liebe annehmen kann. Ich bezweifle, dass Du das verstehen würdest.
»Du gehst fälschlicherweise davon aus, dass das Opfer eines Mordes zwangsläufig immer derjenige sein muss, der umgebracht wurde.« Tim schenkte sich ein Glas Wein ein. Mir bot er nichts an. »Dabei sollte es als schrecklicheres Verbrechen angesehen werden, einem Menschen so viel Ungelegenheiten zu bereiten, dass er willens ist, seine Freiheit zu riskieren und das zu opfern, was noch von seiner Menschlichkeit übrig ist, nur um dich vom Angesicht der Erde zu entfernen. Das wiegt schwerer, als nach einer Pistole oder einem stumpfen Gegenstand zu greifen, um ein Leben auszulöschen.«
Mit Ungelegenheiten meinte er Schmerz. »Du bist voreingenommen«, sagte ich. Dan konnte jeden Moment mit unserem Essen zurückkommen, und ich wollte mich direkter äußern, als ich es normalerweise riskiert hätte. Tim hatte mir ja, fand ich, die stillschweigende Erlaubnis dazu erteilt, indem er dieses bemerkenswerte Gespräch begann. »Wenn du Francine als jemanden siehst, der andere zerstört und ihnen die Lebensfreude raubt, wenn du sie nur deshalb noch nicht ermordet hast, weil du noch mehr Angst vor ihr hättest, wenn sie tot wäre …«, begann ich.
»Ich weiß nicht, wo du das jetzt schon wieder herhast.« Tim grinste. »Hast du mal wieder Dinge gehört, die kein Mensch gesagt hat?« Beide verstanden wir, warum er lächelte: Ich hatte seine Botschaft erhalten und würde sie nicht vergessen. Er wusste sie bei mir sicher aufgehoben. Tim ist nie auf eine Veränderung aus; alles, was er will, ist, die wichtige Information an jemanden weiterzugeben, dem er vertrauen kann. Das habe ich allerdings erst begriffen, als ich ihn schon mehrere Jahre kannte.
»Es wäre leichter, sie zu verlassen, als du denkst«, sagte ich, denn meine Sehnsucht nach einer Veränderung – einer der radikalen, unwiderruflichen Art –, war stark genug für uns beide. »Es bräuchte keine Auseinandersetzung zu geben. Du musst ihr nicht sagen, dass du gehst, und du brauchst keinen Kontakt mehr zu ihr zu haben, wenn du sie verlassen hast. Dan und ich können dir helfen. Lass Francine das Haus behalten. Komm und wohn bei uns.«
»Du kannst nicht helfen«, erklärte Tim entschieden. Er hielt inne, lange genug, damit ich verstand – oder missverstand, wie er beharrlich behaupten würde, wenn ich die Sache aufbauschen sollte –, bevor er hinzufügte: »Weil ich keine Hilfe brauche. Mir geht’s gut.«
1
DONNERSTAG, 10. MÄRZ 2011
Die junge Frau neben mir regt sich mehr auf als ich. Nicht nur das, sie regt sich mehr auf als alle anderen auf dem Flughafen zusammengenommen, und sie will, dass wir alle es wissen. Hinter mir murren die Leute und sagen »Oh nein!«, aber niemand weint oder zittert vor Wut, abgesehen von diesem Mädchen. Es gelingt ihr, das Bodenpersonal von Fly4You wüst zu beschimpfen und gleichzeitig ausgiebig zu heulen. Es beeindruckt mich, dass sie es offenbar nicht nötig hat, ihre Schmährede zwischendurch zu unterbrechen, um zu schlucken und nach Luft zu schnappen, wie schluchzende Leute es normalerweise tun. Zudem scheint ihr im Gegensatz zu normalen Leuten der Unterschied zwischen einer Reiseverzögerung und einem Trauerfall nicht klar zu sein.
Ich empfinde kein Mitgefühl für sie. Vielleicht würde sie mir leidtun, wenn ihre Reaktion weniger extrem wäre. Am meisten tun mir Leute leid, die noch beteuern, dass es ihnen gut geht, wenn ihre inneren Organe rapide von einem fleischfressenden Insekt verzehrt werden. Das wirft vermutlich kein besonders gutes Licht auf mich.
Ich selbst rege mich nicht im Mindesten auf. Wenn ich heute nicht mehr nach Hause komme, dann eben morgen. Das ist früh genug.
»Beantworten Sie meine Frage!«, brüllt das Mädchen den armen, sanftmütigen Deutschen an, der das Pech hat, an Gate B56 postiert zu sein. »Wo ist das Flugzeug jetzt? Ist es noch da? Ist es da unten?« Sie zeigt auf die Faltwände der beweglichen Passagierbrücke, die sich hinter ihm öffnet; vor fünf Minuten hatten wir alle noch gehofft, hindurchgehen zu können und am Ende unser Flugzeug vorzufinden. »Es ist da unten, oder?« Ihr Gesicht ist faltenlos, ohne Pickel und seltsam flach; eine fiese Lumpenpuppe. Sie sieht aus wie höchstens achtzehn. »Jetzt hör mal zu, Kumpel, wir sind mehrere Hundert, und du bist allein. Wir könnten uns an dir vorbeidrängen und in den Flieger stürmen, eine Horde wütender Briten, und uns weigern, wieder auszusteigen, bevor uns jemand nach Hause fliegt! Ich an Ihrer Stelle würde mich nicht mit einer Horde wütender Briten anlegen!« Sie zieht ihre schwarze Lederjacke aus, wie in Vorbereitung auf einen Kampf. Auf den rechten Arm ist in Großbuchstaben das Wort VATER tätowiert, in Blau. Sie trägt enge schwarze Jeans, einen Patronengürtel und zahlreiche Träger auf den Schultern: ein weißer BH, ein rosa Unterhemd und ein rotes, ärmelloses Top.
»Das Flugzeug wird nach Köln umgeleitet«, erklärt der deutsche Fly4You-Mann ihr geduldig zum dritten Mal. Ein Namensschild ist an seiner kastanienbraunen Uniform befestigt: Er heißt Bodo Neudorf. Mir würde es schwerfallen, in diesem scharfen Ton mit jemandem namens Bodo zu sprechen, obwohl ich nicht von anderen erwarte, diesen speziellen Skrupel zu teilen. »Es ist zu gefährlich, wegen der Wetterlage«, sagt er. »Ich kann da gar nichts machen, tut mir leid.« Er appelliert an ihre Vernunft. An seiner Stelle würde ich vermutlich dieselbe Taktik anwenden – nicht, weil es funktionieren wird, sondern weil jemand, der Rationalität besitzt und gewohnt ist, sie regelmäßig einzusetzen, wahrscheinlich so etwas wie ein Fan derselben ist und dazu neigt, ihren potenziellen Nutzen überzubewerten, sogar im Umgang mit einer Person, die es hilfreicher findet, unschuldige Leute zu bezichtigen, Flugzeuge vor ihr zu verstecken.
»Sie sagen ständig, dass es umgeleitet wird! Das heißt doch wohl, dass es noch nirgendwo anders ist, oder?« Sie wischt sich die nassen Wangen ab – so heftig, dass man es mit einer Ohrfeige verwechseln könnte –, und wirbelt herum, um sich an die Menge hinter uns zu wenden. »Er hat es überhaupt noch nicht weggeschickt!«, ruft sie, und die Vibrationen ihrer empörten Stimme gewinnen den Klangkrieg an Boarding Gate B56, übertönen das ständige elektronische Ping, die Ankündigung unmittelbar bevorstehender Aufrufe für andere Flüge, Flüge, die mehr Glück hatten als unserer. »Wie kann er es schon weggeschickt haben? Vor fünf Minuten saßen wir alle hier, bereit, an Bord zu gehen. So schnell kann niemand ein Flugzeug irgendwohin schicken! Ich sage, lassen wir ihn nicht damit durchkommen. Wir sind hier, das Flugzeug muss ebenfalls hier sein, und wir wollen alle nach Hause. Das verdammte Wetter ist uns doch egal! Wer ist dabei?«
Ich würde mich gern umdrehen und feststellen, ob alle ihre Ein-Frau-Show so peinlich zwanghaft finden wie ich, aber ich will nicht, dass unsere Mit-Nichtpassagiere annehmen, dass sie und ich zusammengehören, nur weil wir nebeneinander stehen. Besser, ich stelle klar, dass ich nichts mit ihr zu tun habe. Ich lächle Bodo Neudorf ermutigend an. Er erwidert es mit einem knappen Lächeln, als wolle er sagen: »Ich weiß die Geste und die Unterstützung zu schätzen, aber es wäre töricht anzunehmen, dass irgendetwas, das Sie tun könnten, die Anwesenheit der Monstrosität neben Ihnen kompensieren könnte.«
Glücklicherweise scheint Bodo durch ihre Drohungen nicht übermäßig beunruhigt zu sein. Wahrscheinlich ist ihm nicht entgangen, dass viele der Passagiere von Flug 1221 extrem wohlerzogene Mitglieder eines Mädchen-Kirchenchors sind, etwa zwischen acht und zwölf Jahre alt, die nach ihrem Konzert in Dortmund vorhin noch ihre Chorroben tragen. Ich weiß das, weil sich der Chorleiter und die fünf oder sechs begleitenden Elternteile, während wir aufs Boarding warteten, stolz darüber unterhielten, wie gut die Mädchen ein Stück gesungen hatten, das »Angeli Archangeli« hieß. Sie hörten sich nicht an wie Leute, die schnell bereit wären, das deutsche Bodenpersonal von Fly4You in einer Massenstampede zu Boden zu trampeln oder darauf zu bestehen, ihren hochmusikalischen Nachwuchs einem gefährlichen Sturm auszusetzen, nur um zum erwarteten Zeitpunkt zu Hause anzukommen.
Bodo greift nach einem kleinen schwarzen Gerät, das mit einem gewundenen schwarzen Kabel am Abfertigungsschalter befestigt ist, und spricht hinein, nachdem er den Knopf gedrückt hat, der den Ping-Ton auslöst, der allen Flughafen-Verlautbarungen voranzugehen hat. »Ein Hinweis für die Passagiere von Flug 1221 nach Combingham, England. Dies ist der Fly4You-Flug 1221 nach Combingham, England. Ihre Maschine wird zum Flughafen Köln umgeleitet und wird von dort starten. Wir bitten um Ihr Verständnis. Bitte begeben Sie sich zur Gepäckausgabe und warten Sie dann vor dem Flughafengebäude, direkt vor der Abflughalle. Wir sind bemüht, Busse zu organisieren, die Sie und Ihr Gepäck zum Flughafen Köln bringen werden. Bitte begeben Sie sich so schnell wie möglich zum Sammelpunkt vor der Abflughalle.«
Zu meiner Rechten bemerkt eine schick gekleidete Frau mit briefkastenrotem Haar und amerikanischem Akzent: »Wir brauchen uns nicht zu hetzen, Leute. Das sind hypothetische Busse: die langsamste Art.«
»Wir lange wird der Bus von hier nach Köln brauchen?«, ruft ein Mann.
»Nähere Einzelheiten über den Fahrplan der Busse sind mir noch nicht bekannt«, verkündet Bodo Neudorf. Seine Stimme geht in einer sich ausbreitenden Welle von Gestöhne unter.
Ich bin froh, dass ich auf den Besuch bei der Gepäckausgabe verzichten kann. Beim Gedanken an die anderen Passagiere, die da runterlatschen müssen, um ihr Gepäck wieder abzuholen, für dessen Abgabe sie vor nicht einmal einer Stunde in einer unordentlichen Zick-Zack-Schlange angestanden haben, überkommt mich Erschöpfung. Es ist acht Uhr abends. Eigentlich sollte ich um halb neun in Combingham landen, englische Zeit, und dann wollte ich nach Hause fahren, mir ein Schaumbad einlassen und mich mit einem Glas gekühltem Muskateller in die Wanne legen. Ich bin heute Morgen um fünf aufgestanden, um die Sieben-Uhr-Maschine von Combingham nach Düsseldorf zu erwischen. Ich bin kein Morgenmensch und grolle jedem Tag, der von mir verlangt, früher als sieben aufzuwachen, und dieser Tag zieht sich schon zu lange hin.
»Das soll wohl ein verfickter Witz sein!«, meldet sich die Psychopathen-Lumpenpuppe zu Wort. »Sie wollen mich wohl verarschen!« Falls Bodo sich eingebildet hat, durch elektronische Verstärkung seiner Stimme könnte er seine Nemesis einschüchtern und zu stummem Gehorsam veranlassen, lag er falsch. »Ich werde ganz bestimmt keinen Koffer abholen!«
Ein magerer Kahlkopf in einem grauen Anzug tritt vor und sagt: »In dem Fall werden Sie vermutlich ohne Ihre Reisetasche zu Hause eintreffen. Und ohne alles, was sich darin befindet.« Innerlich rufe ich Hurra; Flug 1221 hat seinen ersten stillen Helden. Er hält eine Zeitung unter den Arm geklemmt, die er mit der anderen Hand umklammert, in Erwartung eines Vergeltungsschlags.
»Halten Sie sich da raus!«, brüllt die Lumpenpuppe ihm ins Gesicht. »Sie halten sich wohl für was Besseres! Ich habe überhaupt keinen Koffer dabei, nur damit Sie’s wissen!« Sie wendet ihre Aufmerksamkeit wieder Bodo zu. »Sie wollen also das ganze Gepäck wieder aus dem Flugzeug ausladen? Was soll das denn bringen? Sagen Sie mir, was für einen Sinn das haben soll. Das ist einfach … tut mir leid, wenn ich fluche, aber das ist einfach nur verfickt dämlich!«
»Oder«, sage ich zu ihr, weil ich nicht zulassen kann, dass der kahlköpfige Held auf weiter Flur alleinsteht und da sonst niemand zu seiner Hilfe herbeizueilen scheint, »Sie sind diejenige, die blöd ist. Wenn Sie keine Reisetasche aufgegeben haben, brauchen Sie selbstredend kein Gepäck abzuholen. Warum sollten Sie auch?«
Sie starrt mich an. Ihr Gesicht ist immer noch tränenüberströmt. »Wenn das Flugzeug jetzt hier wäre und wir alle sicher nach Köln fliegen könnten, würden wir einsteigen und dorthin fliegen, oder?«, sage ich. »Oder nach Hause fliegen, was wir natürlich im Idealfall alle gern täten.« Mist. Warum musste ich unbedingt meine Klappe aufreißen? Es ist nicht meine Aufgabe, das fehlerhafte Denken der jungen Frau zu korrigieren, es ist nicht einmal die von Bodo Neudorf. Der Kahlkopf ist mit seiner Zeitung davongewandert und hat mir die Sache überlassen. Undankbarer Blödmann. »Die Maschine kann wegen des Wetters Düsseldorf nicht anfliegen.« Ich setze meine Mission fort, Frieden und Verständnis zu verbreiten. »Sie war nie hier, sie ist zurzeit nicht hier, und Ihr Koffer, wenn Sie einen hätten, würde sich nicht darin befinden und bräuchte auch nicht wieder ausgeladen zu werden. Die Maschine ist irgendwo in der Luft.« Ich zeige zum Himmel. »Ihr Ziel war Düsseldorf, und jetzt hat sie den Kurs geändert und fliegt nach Köln.«
»Ne-ein«, sagt sie unsicher und mustert mich mit einer Art schockiertem Abscheu, als fände sie es entsetzlich, das Wort an mich richten zu müssen. »Das ist nicht richtig. Wir saßen alle hier.« Sie deutet mit einer Armbewegung auf die Reihen orangefarbener Plastikschalensitze, die auf schwarzen Metallstielen montiert sind. »Wir sollten zum Gate gehen, haben sie gesagt. Das sagen sie nur, wenn das Flugzeug bereitsteht, damit man einsteigen kann.«
»Normalerweise stimmt das, aber nicht heute«, erkläre ich brüsk. Ich kann fast sehen, wie die Rädchen hinter ihren Augen sich drehen, als ihre mentale Maschinerie versucht, einen Gedanken mit einem anderen Gedanken zu verbinden. »Als man uns sagte, wir sollten uns zum Gate begeben, hofften sie noch, dass die Maschine es bis Düsseldorf schaffen würde. Kurz nachdem wir uns hier alle versammelt hatten, wurde klar, dass das nicht möglich war.« Ich schaue Bodo Neudorf an, der halb nickt und halb die Achseln zuckt. Beugt er sich meinem Urteil? Das ist doch verrückt. Er müsste mehr darüber wissen, was bei Fly4You hinter den Kulissen abläuft, als ich.
Das wütende, weinende Mädchen wendet den Blick ab und schüttelt den Kopf. Ich kann ihre stumme Verachtung spüren: Glaub du das doch, wenn du willst, denkt sie sicher. Bodo spricht auf Deutsch in ein Funkgerät. Die Chormädchen erkundigen sich bei ihren Eltern, ob sie heute noch nach Hause kommen werden. Die Eltern antworten, dass sie es nicht wissen. Drei Männer in Fußballtrikots diskutieren darüber, wie viele Bierchen sie wohl zwischen jetzt und unserem Abflug zischen können und überlegen, ob sie die Rechnung bei der Fluggesellschaft einreichen können.
Eine grauhaarige Frau, Ende fünfzig oder Anfang sechzig, erklärt ihrem Mann, dass sie nur noch zehn Euro hat. »Was? Wieso?«, fragt er ungeduldig. »Das wird nicht reichen.«
»Ich hatte nicht damit gerechnet, dass wir noch mehr brauchen würden.« Sie flattert um ihn herum, nimmt die Verantwortung auf sich, hofft auf Gnade.
»Du hast nicht damit gerechnet?«, gibt er scharf zurück. »Und was ist mit Notfällen?«
Ich habe meine ganze Fähigkeit zur Intervention aufgebraucht, sonst würde ich ihn vielleicht fragen, ob er schon mal was von Geldautomaten gehört hat und was er für den Fall zu tun plant, dass seine Frau Opfer einer spontanen Selbstentzündung würde und alle Fremdwährung in ihrer Handtasche in Flammen aufginge. Was ist mit diesem Notfall, du kleiner Haustyrann? Ist deine Frau vielleicht eigentlich erst fünfunddreißig und sieht nur so aus wie sechzig, weil sie die besten Jahre ihres Lebens an dich verschwendet hat?
Nirgends kann man so leicht den Glauben an die Menschheit verlieren wie auf einem Flughafen. Ich entferne mich aus dem Gewühl und gehe an einer Reihe unbesetzter Gates vorbei, ohne eine bestimmte Richtung. Ich kann den Anblick meiner Mitreisenden nicht mehr ertragen, nicht einmal derjenigen, deren Gesichter mir zuvor nicht aufgefallen sind. Nicht einmal den der netten Chormädchen. Ich freue mich nicht darauf, sie alle wiederzusehen – in der hilflosen, hoffnungsvollen Traube, die wir vor der Abflughalle bilden werden, beim stundenlangen Warten bei Wind und Regen oder später im Bus auf der anderen Seite des Gangs und dann zusammengesackt, halb schlafend, in verschiedensten Lokalen am Kölner Flughafen.
Andererseits. Es ist eine Flugzeugverspätung, kein Trauerfall. Ich fliege viel. So etwas passiert ständig. Die Worte »Wir bitten um Ihr Verständnis« habe ich schon so oft gehört, wie ich den strapazierfähigen graugesprenkelten Bodenbelag mit der blaugesprenkelten Umrandung jeder Fliese im Flughafen Combingham gesehen habe. Ich stand so oft unter Informationstafeln und konnte verfolgen, wie kleinere Verspätungen zu Flugstreichungen metastasierten, wie ich die parallelen Linien gesehen habe, aus denen sich die randlosen Rechtecke zusammensetzen, die wiederum das Muster bei einer Million silberner Fluggasttreppen bilden. Einmal habe ich geträumt, dass Wände und Decke meines Schlafzimmers mit strukturierten Aluminium-Stufen ausgekleidet waren.
Das Schlimmste an einer Verspätung ist immer, dass ich Sean anrufen und ihm mitteilen muss, dass ich schon wieder nicht zur angekündigten Zeit zu Hause sein werde. Mir graut vor diesem Anruf. Obwohl … vielleicht wird es diesmal gar nicht so schlimm sein. Vielleicht kann ich dafür sorgen, dass es nicht so schlimm wird.
Ich lächle in mich hinein, als die Idee in meinem Kopf Gestalt annimmt. Dann greife ich in meine Handtasche – im Gehen, ohne hinzusehen –, und schließe die Hand um eine längliche Schachtel: den Schwangerschaftstest, den ich seit zehn Tagen mit mir herumtrage, ohne den richtigen Moment dafür zu finden.
Ich mache mir oft Gedanken über meine Neigung, Dinge hinauszuschieben, weil ich offensichtlich zögere, das Problem anzugehen. In allen beruflichen Belangen war ich nie so und bin es immer noch nicht, aber wenn es sich um etwas Privates handelt, etwas Wichtiges, tue ich mein Bestes, es auf unbestimmte Zeit hinauszuschieben. Das ist sicher auch der Grund dafür, dass ich nicht auf Flughäfen in Tränen ausbreche, wenn mein Flug Verspätung hat; Verzögerung ist mein natürlicher Rhythmus.
Ein Teil von mir ist immer noch nicht bereit, sich dem Test zu stellen, obwohl mir die ganze Prozedur, auf ein Plastikröhrchen zu pinkeln und das Urteil zu erwarten, mit jedem Tag, der vergeht, sinnloser erscheint. Ich bin ganz offensichtlich schwanger. An meiner Kopfhaut ist eine seltsam empfindliche Stelle, die vorher nicht da war, und ich bin müder, als ich es je zuvor war.
Ich werfe einen Blick auf meine Uhr und überlege, ob noch Zeit dafür ist, und dann lache ich über meine eigene Leichtgläubigkeit. Die Amerikanerin hatte recht. Es sind keine real existierenden Busse auf dem Weg, um uns zu retten. Gott weiß, wann es welche geben wird. Bodo hatte keine Ahnung, was los war; es ist ihm nur gelungen, uns allen weiszumachen, er sei über alles informiert, weil er Deutscher ist. Was bedeutet, ich habe noch mindestens eine Viertelstunde Zeit, um den Test zu machen und Sean anzurufen, während die anderen ihr Gepäck wieder abholen. Zum Glück lässt Sean sich leicht ablenken, wie ein kleines Kind. Wenn ich ihm sage, dass ich heute Abend nicht mehr nach Hause komme, wird er anfangen, mir Vorwürfe zu machen. Aber wenn ich ihm sage, dass der Schwangerschaftstest positiv war, wird er so entzückt sein, dass es ihm egal ist, wann ich zurückkomme.
Ich bleibe vor der nächsten Damentoilette stehen und zwinge mich hineinzugehen, wobei ich im Kopf beruhigend auf mich einrede: Das ist nicht beängstigend. Du kennst das Ergebnis bereits. Es wird sich nichts ändern, wenn du ein kleines blaues Kreuz siehst.
Ich öffne die Schachtel, nehme den Test heraus und lasse den Beipackzettel wieder in meine Handtasche fallen. Ich habe das schon mal gemacht – einmal, letztes Jahr, als ich wusste, dass ich nicht schwanger war und den Test nur gemacht habe, weil Sean mein Bauchgefühl nicht gelten lassen wollte.
Kein Kreuz, ein Pluszeichen. Bezeichnen wir es nicht als Kreuz: schlecht für die Moral.
Es dauert nicht lange, bevor etwas sichtbar wird. Schon blitzt etwas blau auf. O Gott. Ich kann das nicht. Ich will nur bedingt ein Baby haben. Glaube ich. Ich weiß es im Grunde überhaupt nicht. Noch mehr blau: zwei Linien, die sich horizontal ausbreiten. Noch kein Pluszeichen, aber das ist nur eine Frage der Zeit.
Sean wird sich freuen. Darauf sollte ich mich konzentrieren. Ich gehöre zu den Leuten, die immer alles in Zweifel ziehen und nie vollkommen glücklich sein können. Seans Reaktion ist verlässlicher als meine, und ich weiß, wie begeistert er sein wird. Es ist doch schön, ein Baby zu bekommen. Wenn ich nicht schwanger werden wollte, hätte ich im letzten Jahr heimlich Mercilon-Antibabypillen geschluckt, und das habe ich nicht getan.
Was ist das denn?
Da ist kein blaues Kreuz im größeren Sichtfenster des Röhrchens. Und nichts wird blauer. Es ist mehr als fünf Minuten her, seit ich den Test gemacht habe. Ich bin keine Expertin, aber ich habe das deutliche Gefühl, dass alle Bläue, die es geben wird, bereits da ist.
Ich bin nicht schwanger. Ich kann nicht schwanger sein.
Plötzlich schießt mir ein Bild durch den Kopf: eine winzige menschliche Gestalt, golden und gesichtslos, die triumphierend die Faust in die Luft reckt. Es ist schon wieder weg, bevor ich es genauer betrachten kann.
Jetzt will ich eindeutig nicht mit Sean sprechen. Ich habe zwei enttäuschende Mitteilungen zu machen, nicht nur eine. Die Aussicht auf den Anruf versetzt mich in Panik. Wenn es schon sein muss, muss ich es gleich hinter mich bringen. Es erscheint mir außerordentlich unfair, dass ich das Problem nicht einfach lösen kann, indem ich so tue, als würde ich niemandem mit dem Namen Sean Hamer kennen, und in ein neues Leben verschwinde. Das wäre so viel einfacher.
Ich verlasse die Damentoilette, kehre in die Abflughalle zurück und ziehe meinen BlackBerry aus der Jackentasche. Sean geht nach dem ersten Klingeln ran. »Hi, Babes«, sagt er. »Wann kommst du zurück?« Wenn ich unterwegs bin, sitzt er abends auf dem Sofa und guckt fern, das Telefon neben sich, damit er keinen meiner Anrufe oder eine SMS versäumt. Ich weiß nicht, ob das ein normales Verhalten für einen liebenden Partner ist. Ich käme mir illoyal vor, wenn ich eine meiner Freundinnen fragen würde, als würde ich sie dadurch ermuntern, über Sean herzuziehen.
»Sean, ich bin nicht schwanger.«
Schweigen. Dann: »Aber du hast doch gesagt, du wärst es. Du hast gesagt, du bräuchtest den Test gar nicht zu machen – du wüsstest, dass du schwanger bist.«
»Du weißt doch, was das bedeutet, oder?«
»Und was?« Er klingt hoffnungsvoll.
»Dass ich eine arroganter Närrin bin, der man nicht trauen kann. Ich habe wirklich, ehrlich gedacht, ich würde ein Kind kriegen, aber … offensichtlich habe ich mich geirrt. Meine Hormone müssen aus irgendeinem anderen Grund verrücktspielen.«
»Vertrau nicht auf einen einzigen Test«, rät Sean. »Überprüf das Ergebnis. Kauf einen anderen Test. Kann man auf Flughäfen welche kriegen?«
»Das ist nicht nötig.« Natürlich kann man auf dem Flughafen einen Schwangerschaftstest kaufen. Sean weiß das nicht, weil er ein Mann ist, versichere ich mir; seine Ahnungslosigkeit ist nicht etwa darauf zurückzuführen, dass er kein Verlangen hat, sich aus unserem Wohnzimmer herauszuwagen, sondern jeden Abend auf dem Sofa verbringt und Sport guckt.
»Wenn du nicht schwanger bist, warum dann die Verspätung?«, fragt er.
Ich würde gern die Wetterbedingungen in Düsseldorf dafür verantwortlich machen, aber ich weiß, dass er das nicht meint. »Keine Ahnung.« Ich seufze. »Da wir gerade von Verspätungen sprechen, mein Flug hat auch Verspätung. Das Flugzeug ist nach Köln umgeleitet worden – wir werden mit dem Bus dorthin kutschiert. Angeblich. Ich hoffe, ich werde morgen irgendwann eintreffen. Vielleicht, wenn wir Glück haben, sehr spät heute Nacht.«
»Ach«, bemerkt Sean angespannt. »Also ist mein Abend mal wieder ruiniert.«
Beschwichtige ihn. Streite nicht mit ihm. »Wäre es nicht zutreffender zu sagen, dass mein Abend wieder einmal ruiniert ist? Ich bin diejenige, welche wahrscheinlich die heutige Nacht stehend in der Passkontroll-Kabine im Kölner Flughafen verbringen wird.« Ich hasse mich selbst, wenn ich Sätze mit »Ich bin diejenige …« beginnen lasse, aber ich habe den starken Drang, darauf hinzuweisen, dass nicht Sean in einem Riesengebäude voller elektronischem Gepiepe festsitzt, in dem die Stimmen fremder Leute widerhallen, und gleich zu einem ähnlichen piepsenden, grau-weißen, mit Neonlicht erhellten Gebäude verfrachtet werden wird. Sean ist nicht derjenige, der gegen das Gefühl ankämpfen muss, langsam auf molekularer Ebene zerlegt zu werden, dass sein ganzes Dasein gepixelt wird und sich erst wieder zu einer Person zusammensetzen wird, wenn er durch die eigene Haustür geht. Wenn er sich je in einer solchen Situation wiederfinden sollte, während ich auf dem Sofa sitze, Bier trinke und meine Lieblingssendung im Fernsehen gucke, würde ich, so hoffe ich, mehr Mitgefühl zeigen.
Und, Schwangerschaftstest hin oder her, ich bin immer noch eine arrogante Närrin, die denkt, dass sie immer recht hat. Ich habe ja versucht, bescheidener zu werden, aber, ganz ehrlich, immer daran zu denken, dass man sich auch irren könnte, ist nicht leicht, wenn die Person, mit der man argumentiert, Sean ist.
»Du hoffst, du wirst morgen irgendwann eintreffen?«, fragt Sean. In den paar Sekunden seit seiner letzten Wortmeldung hat er neuen Treibstoff in Form von Carlsberg in den Kessel seiner Empörung geschüttet. »Willst du damit sagen, dass du vielleicht erst übermorgen kommst?«
»Es mag dir neu sein, Sean, aber ich bin nicht direkt ein großes Tier im Kölner Flughafen. Sie müssen nicht alle Flugpläne von mir genehmigen lassen. Ich bin nur ein machtloser Passagier, genau wie im Flughafen Düsseldorf. Ich habe keine Ahnung, wann genau ich zurück sein werde.«
»Klasse«, fährt er mich an. »Gedenkst du, mich anzurufen, wenn du es weißt?«
Ich widerstehe dem Drang, meinen BlackBerry gegen die Wand zu schmeißen und zu feinem schwarzem Staub zu zermahlen. »Ich nehme an, man wird uns erst eine Information geben, dann eine andere und uns dann etwas völlig anderes erzählen«, sage ich geduldig. »Alles, um uns unter Kontrolle zu halten, während sie verzweifelt einen Plan zusammenschustern, um uns nach Hause zu schaffen und wir vor dem geschlossenen Duty-Free-Shop stehen, am Metallgitter rütteln und flehen, eingelassen zu werden, bevor wir vor Langeweile eingehen.« Vielleicht wird Sean ja doch noch merken, dass ich mich an diesem Abend nicht gerade bestens amüsiere; ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben.
»Du willst doch sicher nicht, dass ich dich jede Stunde anrufe, wenn ich irgendwas Neues erfahre, oder? Warum guckst du nicht bei Flight Tracker nach?«
Ich bleibe in der Nähe von ein paar Leuten stehen, die sich offenbar über ein Café unterhalten, das psychisch Kranken eine Arbeitsmöglichkeit gibt. Ich versuche ihnen mit halbem Ohr zu lauschen, um mich Seans Verhör zu entziehen, doch er gibt mir keine Chance. »Ich bin dir also so egal, dass du keine Lust hast, mich ständig auf den neuesten Stand zu bringen, aber ich soll neben dem Laptop sitzen und –«
»Nein, sollen tust du das nicht. Du könntest auch akzeptieren, dass ich bald zurück sein werde, aber keiner von uns beiden weiß, wann genau das sein wird, und damit umgehen wie ein Erwachsener.«
Sean murmelt irgendwas in sich hinein.
»Was hast du gesagt?« Es widerstrebt mir, eine eventuell ärgerliche Bemerkung ungehört und unbestritten durchgehen zu lassen.
»Ich sagte, mit wem fliegst du?« Gleichzeitig fragt eine Frau aus der diskutierenden Gruppe: »Wer ist der Träger?«
Ich bleibe stehen.
Es ist ein Schock, die Worte so beiläufig hingeworfen zu hören. Sie lassen mich an andere Worte denken, Worte, die immer in meinem Kopf lebendig sein werden, selbst wenn nie wieder jemand sie mir gegenüber laut aussprechen wird.
ich trage dein herz bei mir, ich trage es in meinem herzen …
Ich räuspere mich. »Entschuldige, was hast du gesagt?«
»Verdammt noch mal, Gaby! Mit. Wem. Fliegst. Du.«
Ein Bild von Tim schießt mir durch den Kopf: Er steht im Proszenium oben auf der Leiter, schaut auf mich herab, ein Buch in der rechten Hand, mit der linken hält er sich an der Leiter fest. Er hat mir gerade ein Gedicht vorgelesen. Nicht ich trage dein herz; ein anderes Gedicht. Von einem Lyriker, der jung und tragisch starb und an dessen Namen ich mich nicht mehr erinnere, über …
Meine Haut beginnt zu prickeln, es ist ein so seltsamer Zufall. In dem Gedicht ging es um einen verspäteten Zug. Ich erinnere mich nur noch an die letzten beiden Zeilen: »Unsere Zeit in den Händen anderer, und unsagbar kurz.« Tim billigte das. »Siehst du?«, sagte er. »Wenn ein Dichter etwas Wichtiges zu sagen hat, sagt er es so einfach, wie er kann.«
»Oder eine Dichterin«, sagte ich bockig. »Oder eine Dichterin«, bestätigte Tim. »Aber auch wenn ein Steuerberater etwas Wichtiges zu sagen hat, sagt er es, gleich dem Lyriker, so einfach wie möglich.« Wem außer Tim wäre eine solche Erwiderung so schnell eingefallen?
Tim Breary ist der Träger. Aber das kann die Frau unmöglich meinen.
»Mit welcher Fluggesellschaft ich fliege?«, sage ich zu Sean. »Fly4You.«
»Flugnummer?«, fragt Sean.
»1221.«
»Ich hab’s. Also … Ich sehe dich dann vermutlich, wenn ich dich sehe.«
»Hmm-hm«, murmele ich leichthin und drücke auf den roten Knopf, um das Gespräch zu beenden. Gott sei Dank, das wäre überstanden.
Ich habe mich schon öfters gefragt, ob die Rollsteige auf Flughäfen dazu dienen sollen, uns glauben zu machen, der übrige Fußboden würde sich unter uns nicht rückwärts bewegen. Ich bin immer noch nicht dort, wo ich hinmuss, obwohl ich gefühlt seit Jahren laufe und den vielen Schildern folge, auf denen »Abflug« oder »Departures« steht. Sehr bald wird der Anblick dieser Worte nicht mehr ausreichen, mich bei Laune zu halten. Vielleicht werde ich anfangen zu gackern wie eine durchgedrehte Hexe und mich im Krebsgang seitwärts in die entgegengesetzte Richtung bewegen, nur aus Spaß an der Freude.
Ich biege um eine Ecke und laufe in einen Arm, auf den das Wort »VATER« tätowiert ist. Dessen rotäugige Besitzerin hat aufgehört zu weinen. Sie reißt gerade eine Packung Zigaretten von der Größe eines kleinen Koffers auf.
»Entschuldigung«, murmle ich.
Sie weicht vor mir zurück, als hätte sie Angst, dass ich sie schlagen könnte, stopft die halb ausgepackte Packung Lambert & Butlers wieder in ihre Schultertasche und fängt an, sich in Richtung der Schilder zu bewegen, die auf weitere Schilder hinweisen. Offenbar genießt das tröstliche Gefühl einer Zigarette zwischen den Fingern geringere Priorität als der Wunsch, von mir wegzukommen.
Ist es möglich, dass meine selbstgerechte Standpauke ihr Angst eingejagt hat? Ich beschließe, es zu überprüfen, indem ich meine Schritte beschleunige. Es dauert nicht lange, bis ich auf gleicher Höhe mit ihr bin. Sie wirft mir einen Blick zu und geht schneller. Sie keucht. Das ist doch lächerlich. »Laufen Sie vor mir davon?«, frage ich, in der Hoffnung, dadurch das Unglaubliche leichter glauben zu können. »Was glauben Sie, dass ich Ihnen antun will?«
Sie bleibt stehen und zieht die Schultern hoch, wappnet sich für einen Angriff. Sie sieht mich nicht an, sie bleibt stumm.
Ich helfe ihr aus. »Sie können sich entspannen. Ich bin relativ harmlos. Ich habe Sie mir nur vorgeknöpft, damit Sie aufhören, Bodo fertigzumachen.«
Ihre Lippen bewegen sich. Was immer von diesen Lippen kommt, könnte für mich bestimmt sein. Eine Angehörige einer außerirdischen Spezies, die versucht, mit einem Menschen zu kommunizieren, könnte so aussehen. Ich beuge mich vor, um sie besser hören zu können.
»Ich muss heute Abend noch nach Hause. Ich muss. Ich war noch nie allein im Ausland. Ich will nur noch nach Hause.« Sie schaut zu mir hoch, das Gesicht weiß vor Angst und Verwirrung. »Ich glaube, ich habe gerade eine Panikattacke«, sagt sie.
Gaby, du dämliche Kuh. Du bist hinter diesem Mädchen hergelaufen. Du hast sie angesprochen. Sie wollte dir nur aus dem Weg gehen – was für uns beide vorteilhaft gewesen wäre – und du hast es verbockt.
»Wenn Sie eine Panikattacke hätten, würden Sie nicht sprechen können«, informiere ich sie. »Sie würden hyperventilieren.«
»Das tue ich doch! Hören Sie sich meinen Atem an!« Sie packt mich am Handgelenk, schließt Finger und Daumen darum wie eine Handschelle und zieht mich näher zu sich heran. Ich versuche, sie abzuschütteln, aber sie lässt nicht los.
»Sie sind außer Atem, weil Sie gerannt sind«, erkläre ich und versuche, die Fassung zu bewahren. Wie kann sie es wagen, mich zu packen, als wäre ich irgendein Gegenstand? Ich verbitte mir das. Entschieden. »Zudem sind Sie starke Raucherin. Wenn Sie Ihre Lungenkapazität verbessern wollen, sollten Sie das Rauchen aufgeben.«
Wut flammt in ihren Augen auf. »Sagen Sie mir nicht, was ich tun soll! Sie wissen doch gar nicht, wie viel ich rauche. Sie wissen gar nichts über mich.«
Sie hält immer noch mein Handgelenk umklammert. Ich lache. Was sollte ich sonst tun? Ihre Finger einen nach dem anderen gewaltsam lösen? Notfalls werde ich das wohl tun müssen.
»Könnten Sie mich bitte loslassen? Allein der Erlös aus dem Verkauf der Zigaretten in Ihrer Tasche wird Lambert & Butler gut durch die nächsten zwölf globalen Rezessionen bringen.«
Sie kraust die Stirn und bemüht sich zu begreifen, was ich meine.
»Zu kompliziert für Sie? Wie wär’s damit: Ihre Fingerspitzen sind gelb? Natürlich sind Sie starke Raucherin.«
Endlich lässt sie mich los. »Sie halten sich wohl für was Besseres, oder?«, knurrt sie: dasselbe, was Sie zu dem kahlköpfigen Mann mit der Zeitung gesagt hat. Ob das eine Anschuldigung ist, die sie gegen jeden erhebt, der ihr begegnet? Es fällt auch schwer, sich einen Menschen auszumalen, der bei einer Begegnung mit ihr von qualvollen Minderwertigkeitskomplexen befallen würde.
»Ähm … ja, wahrscheinlich«, sage ich in Beantwortung ihrer Frage. »Schauen Sie, ich habe nur versucht zu helfen – auf eine etwas biestige Weise vielleicht –, aber im Grunde haben Sie recht: Es ist mir vollkommen egal, ob sie weiteratmen oder nicht. Es tut mir leid, wenn ich Sie gekränkt haben sollte, weil ich einen Witz gerissen habe, den Sie nicht in der Lage waren zu verstehen …«
»Eine hochnäsige kleine Zicke, das sind Sie! Ich habe Sie heute Morgen gesehen – Sie waren zu sehr mit sich selbst beschäftigt, um zurückzulächeln, als ich Sie angelächelt habe.«
Kleine Zicke? Um Himmels willen, ich bin achtunddreißig. Sie kann nicht älter sein als achtzehn. Außerdem, wovon redet sie? »Heute Morgen?«, bringe ich heraus. War sie etwa heute in aller Herrgottsfrühe im selben Flieger von Combingham?
»So viel besser als ich, was?«, wiederholt sie bitter. »Klar! Ich wette, Sie würden nie einen unschuldigen Mann wegen Mordes ins Gefängnis gehen lassen!« Bevor ich ganz begreifen kann, was sie da gesagt hat, bricht sie in Tränen aus und wirft sich in meine Arme. »Ich kann das nicht mehr«, schluchzt sie und durchnässt mein T-Shirt. »Ich dreh hier noch durch!«
Bevor mein Gehirn alles aufführen kann, was dagegen spricht, habe ich schon die Arme um sie gelegt.
Und was nun?
2
10. 3. 2011
»Also«, sagte Simon langsam. Er beobachtete Charlie, die seinen Blick nicht erwiderte. Sie starrte auf den Fernseher, ohne viel von dem mitzubekommen, was gerade lief, und versuchte, sich ganz natürlich zu geben. Wie jemand, der nichts geheim halten will. In der Sendung ging es um Prominente, die das Leben in einem afrikanischen Slum ausprobierten. Vermutlich kehrten sie eilends nach Hampstead zurück, sobald die Kameras ausgeschaltet waren.
»Was, also?«, fragte sie. Sie hasste es, Simon etwas zu verschweigen; er hatte sie im Laufe der Jahre erfolgreich indoktriniert und ihr die Überzeugung eingepflanzt, dass es sein gottgegebenes Recht sei, immer alles zu erfahren. Um ihn abzulenken, deutete sie auf den Fernseher. »Sieh dir das mal an – sind deren Lebensbedingungen wirklich so viel schlechter als unsere? Nein, klar, ich weiß, dass sie das sind, aber … wir sollten wirklich mal losgehen und Tapeten kaufen, wenn wir beide einen freien Tag haben – oder zumindest so ein Rolldings und einen Eimer weiße Farbe.« Sie war es satt, die Wohnzimmerwände in einem Mischmasch verblasster Farben zu sehen, die seit Jahren niemand mehr haben wollte: Hier ein gezacktes Stück einer Tapete aus den Siebzigern, dort ragte alter Verputz hervor. Die ungleichmäßig abgerissenen Tapeten mit den sich beißenden Farben wirkten wie die Collage einer psychedelischen Bergkette; manchmal erschien es ihr wie eine Form visueller Folter. »Du starrst mich an«, sagte sie zu Simon.
Er blickte betont auf die Uhr. »Ich frage mich nur, wann du deine Schwester erwartest.«
»Liv?« Sollte sie sich die Mühe machen, es abzustreiten? »Woher weißt du das?«
»Du bist nervös, und du greifst ständig nach deinem Handy.« Er stand auf. Klasse, dachte Charlie. Wieder mal ein nettes, entspanntes Gespräch. »Du wartest ganz offensichtlich auf irgendwas. Ich weiß, dass Liv heute in Spilling ist, ich weiß, dass du dich heute Mittag mit ihr getroffen hast …«
»Sie verspätet sich«, sagte Charlie stirnrunzelnd. »Sie wollte eigentlich zwischen halb neun und neun kommen.«
Simon zog die Vorhänge auf und lehnte sich gegen das Fenster. Trommelte mit den Fingern auf die Fensterbank.
Falls er nach Liv Ausschau halten wollte, befand er sich auf der falschen Seite. Charlie wartete. Sie war sicher, dass ihre Schwester das Letzte war, was ihn beschäftigte, und froh darüber, dass ihr eine Tirade über unerwartete Besucher erspart blieb. Simon sah keinen moralischen Unterschied zwischen einem Familienmitglied, das unerwartet auftauchte, um rasch Hallo zu sagen oder einen Tee zu trinken, und einer Horde Invasoren mit brennenden Fackeln in der Hand, die die Haustür aufbrachen und beabsichtigten, alles dem Erdboden gleichzumachen.
»Warum hast du ihr verziehen?«, fragte er.
»Wem, Liv?«
Er nickte.
»Ich habe ihr nicht direkt verziehen. Also, ich habe ihr nie gesagt, dass ich ihr verziehen habe. Ich bin einfach … wieder in die Gewohnheit zurückgefallen, mich mit ihr zu treffen.« Charlie vergrub das Gesicht im Kragen ihres Lieblings-Herumgammel-Pullis. Er war im Laufe der Jahre so weit geworden, dass man ihn jetzt vermutlich gleichzeitig über die Köpfe von drei oder vier Leuten hätte ziehen können, vorausgesetzt, sie ständen dicht genug beieinander. Besonders der Rollkragen war unförmig nach vorne gefallen. Durch die Wolle hindurch sagte Charlie: »Es wurde keine formale Absolution erteilt.«
»Eben noch hasst du sie, weil sie angefangen hat, sich mit Gibbs zu treffen, und in der nächsten Minute redest du wieder fast jeden Tag mit ihr, als wäre nichts passiert. Dabei trifft sie sich immer noch mit Gibbs. Sogar die Planung ihrer unmittelbar bevorstehenden Hochzeit mit einem anderen Mann hält sie nicht davon ab.«
Charlie spürte, wie ihr Brustkorb und ihre Schultern sich versteiften. »Müssen wir unbedingt darüber reden?«, fragte sie.
»Gibbs ist immer noch verheiratet, wir arbeiten immer noch zusammen. Liv dringt noch immer in dein Territorium ein – so hast du es jedenfalls gesehen, nachdem sie zum ersten Mal zusammen waren. Sie haben immer noch auf unserer Hochzeitsfeier etwas miteinander angefangen, Liv hat sich immer noch einen Tag angeeignet, der ganz uns hätte gehören sollen, und ihn zu ihrem gemacht.«
»Danke für die Erinnerung. Wenn sie auftaucht, spucke ich ihr ins Gesicht. Zufrieden?«
»Ich frage dich, was sich geändert hat.«
»Also, schauen wir mal. Gibbs ist jetzt Vater von zwei kleinen Mädchen, Zwillingen, Frühgeburten. Ebenso süß wie zerbrechlich.«
Simon schaute ungeduldig drein. »Du weißt, was ich meine. Gibbs ist seit einem Monat Vater. Du hast Liv letztes Jahr verziehen.«
»Nein. Habe ich nicht.« Charlie ging zum Fenster, schob ihn zur Seite und zog die Vorhänge wieder zu. »Wenn sie jetzt noch auftaucht, Pech. Chance verpasst. Was du verzeihen nennst, nenne ich den Kopf in den Sand stecken und versuchen, so zu tun, als wäre das alles nie passiert. Als würde es nicht immer noch passieren. Erbärmlich, oder – was ein Mensch zu tun bereit ist, um an seiner Schwester festzuhalten.«
Simon griff nach der Fernbedienung. Er zappte kurz durch die Programme, bevor er den Fernseher ausschaltete. »Du weichst meiner Frage aus«, sagte er. »Plötzlich bist du bereit, den Kopf in den Sand zu stecken und trotz ihrer Fehltritte das Beste aus Liv zu machen, während du es vorher nicht warst. Wie kommt’s?«
»Ich weiß es nicht.«
»Du nicht, aber ich vielleicht.« Er schien zufrieden, als hätte er die ganze Zeit auf dieses Eingeständnis ihrer Unsicherheit gewartet. »War es, weil …« Er unterbrach sich und fing an, in einem kleinen Kreis um sie herumzugehen, wie ein mechanisches Spielzeug, dessen Batterie zur Neige geht. Seine Notfall-Zustände begannen immer auf diese Weise: zuckende, sprunghafte Bewegungen, die abnahmen und zu Reglosigkeit wurden, wenn mehr und mehr Energie in das jagende Gehirn geleitet wurde.
»Simon?«
»Hm?«
»Versuchst du zu erraten, warum ich wieder mit Liv spreche?«
»Nein. Im Gegenteil.«
»Was soll das –?«
»Psst.«
Charlie reichte es. »Deine Schachfigur geht in die Küche, um Alkohol zu sich zu nehmen und dabei die Geschirrspülmaschine einzuräumen«, sagte sie. »Wenn du weiterspielen willst, musst du das Spiel dorthin bringen.«
Simon langte vor ihr an der Wohnzimmertür an, knallte sie zu und hielt Charlie im Raum fest. »Die Geschirrspülmaschine kann warten«, sagte er. »Hast du ihr verziehen, weil dir klar wurde, dass eure Eltern nicht jünger werden und Liv, wenn sie sterben, das Einzige an Familie sein wird, was dir noch bleibt?«
»Nein. Aber vielen Dank, dass du mich an diesen heiteren Umstand erinnerst. Vielleicht werden Liv und Gibbs sich ja beide von ihren Partnern trennen, sie werden einander heiraten, und ich werde die geliebte Tante der zu früh geborenen Zwillinge. Oder zumindest die geduldete Schwester der Schlampe von Stiefmutter, die seine Ehe zerstört hat.«
»Hör auf mit den Ablenkmanövern. Nein? Du sagst also, du hast ihr nicht aus diesem Grund verziehen? Warum dann?«
»Herrgott nochmal, Simon, ich weiß es nicht.«
»War es, weil sie früher mal Krebs hatte? Du hattest Angst, die Krankheit könnte wieder ausbrechen, wenn du zu hart zu ihr bist?«
»Nein! Absolut nicht.«
»Zweimal nein. Gut dann: Warum hast du ihr verziehen?«
Eins, zwei, drei, vier … Das Problem mit dem Bis-zehn-zählen war, dass man immer noch mit Simon Waterhouse verheiratet war, wenn man bei zehn angelangt war. »Gibt es Fälle von Demenz in deiner Familiengeschichte?«, fragte sie.
»Ich weiß, ich bohre immer weiter nach, aber könntest du bitte versuchen nachzudenken? Lass dich nicht so leicht vom Haken.«
»Wenn ich es nicht tue, wer dann? Du bestimmt nicht. Ich könnte mein ganzes Leben damit verschwenden, an deinem Haken zu baumeln. War übrigens keine sexuelle Anspielung.«
»Denk mal angestrengt nach. Es muss einen Grund geben, und tief innen drin musst du wissen, was das für ein Grund ist, oder sonst …« Er hielt inne. Biss sich auf die Lippen. Er hatte mehr verraten als beabsichtigt.
»Oder sonst …« Charlie konzentrierte sich darauf, das Ende seines Satzes zu erraten, anstatt über seine Frage nachzudenken, denn sie war sich so gut wie sicher, dass sein Interesse nicht wirklich ihren Gefühlen gegenüber Olivia galt. Es wäre zu frustrierend, sich das Hirn zu zermartern, um die richtige Antwort zu finden, nur damit er dann den emotionalen Gehalt vollständig ignorierte. »Ah, ich hab’s«, sagte sie. »Es geht nicht um mich und Liv. Es geht um einen deiner Fälle. Lass mich raten: Jemand wurde ermordet. Und … jemand hat gestanden. Aber er behauptet, er wisse nicht, warum er es getan hat. Du dachtest, du hättest das Motiv erkannt, aber als du die Person gefragt hast, hat sie es abgestritten – sie sagte nein, das sei nicht der Grund. Du denkst, wenn dieser Täter weiß, warum er es nicht getan hat, muss das bedeuten, dass er auch weiß, warum er es getan hat. Doch da irrst du dich.«
»Hat deine Schwester dir das erzählt?«, fragte Simon verärgert. »Weiß sie es von Gibbs?«
»Nein. War ganz allein meine Arbeit«, sagte Charlie. »Ich habe Liv verboten, über eure Fälle zu reden, deine und Gibbs’, seit sie letztes Jahr ihre Nase reingesteckt hat. Sie hat sich getreulich daran gehalten.«
»Wie konntest du dann –«
»Ich bin mit unsichtbaren Ketten an dich gefesselt, deshalb. Alle Teile meines eigenen Gehirns, die nicht unbedingt notwendig sind, habe ich rausgeworfen, um in meinem Kopf Platz für eine goldglänzende Replik deines Gehirns zu schaffen, das dem meinen ja so ungeheuer überlegen ist.«
Simon runzelte die Stirn. »Was für einen Scheiß redest du denn jetzt daher?«
Charlie schob ihn zur Seite, öffnete die Wohnzimmertür und ging in die Küche, die ihr heute Abend weniger wie ein Raum vorkam, sondern eher wie eine unnötig aufwendige Verpackung für eine Flasche Wodka. »Ich weiß, wie dein Gehirn arbeitet, Simon. Keine Ahnung, warum dich das überrascht. Wenn das Versuchskaninchen erst einmal weiß, dass es eines ist, wird es viel schwieriger, das betreffende Versuchskaninchen zu überraschen. Was ist? Was denkst du?«
»Willst du das wirklich wissen?« Er folgte ihr in die Küche: ein neuer Raum, in dem er sie einsperren konnte, wenn sie das Falsche sagte. »Ich dachte gerade, niemand, der selbst keine Frau ist, sollte je mit einer Frau sprechen müssen.«
Charlie grinste. Sie trank einen Schluck Smirnoff direkt aus der Flasche. »Das ist witzig«, sagte sie. »Du hast keine Ahnung, wie die meisten Frauen reden, also nimmst du einfach an, dass ich eine typische Vertreterin bin. Aber ich rede nicht wie eine Frau. Eher wie …«, sie suchte nach einer angemessenen Metapher, – »… ein schlecht behandelter Jünger eines verrückten Messias.« Sie kicherte, als sie das Entsetzen in Simons Gesicht sah. »Und wann immer ich kann, rede ich wie du, in der Hoffnung, dass du mir dann zuhören wirst. Wie jetzt. Du irrst dich: Es ist absolut möglich, nicht zu wissen, warum man etwas getan hat, aber mit Sicherheit zu wissen, dass es nicht aus Grund X geschah.«
»Das glaube ich nicht«, sagte Simon. »Man muss eine Ahnung haben, tief innen drin.« Er schlug mit der Faust gegen seine Brust. »Irgendwo da drin weißt du, warum du Liv verziehen hast. Sonst könntest du nicht sagen, dass es aus keinem der von mir genannten Gründe war, nicht mit Bestimmtheit.«
»Doch.« Charlie stellte die Wodkaflasche ab und machte die Geschirrspülmaschine auf. »Denk an etwas, was du getan hast, ohne zu wissen, warum du es getan hast.« Nach einer langen Pause fügte sie hinzu: »Und dann erzähl es mir.«
»Ich habe es an mir selbst ausprobiert und bewiesen, dass meine Annahme stimmt. Wenn ich nicht weiß, warum ich etwas getan habe, dann weiß ich auch nicht, warum ich es nicht getan habe.«
»Wirklich? Welches Beispiel hast du verwendet?«
Simon zögerte. Offenkundig fiel ihm nichts ein, was ihn von der Notwendigkeit einer Antwort befreien würde. »Proust«, sagte er schließlich. »Warum lasse ich ihn damit durchkommen? Warum gehe ich nie in die Personalabteilung und erzähle denen, was bei der Kripo hinter verschlossenen Türen so alles vor sich geht? Ich sollte es machen. Keine Ahnung, warum ich es nicht tue.«
»Perfekt.« Charlie rieb sich die Hände. »Liegt es daran, dass es in der Personalabteilung eine persische Katze gibt und du allergisch gegen Katzen bist?«
Selbst im Gespräch mit seiner eigenen Frau, in der Sicherheit seiner eigenen Küche, hasste Simon das Unerwartete. Er machte ein grimmiges Gesicht. »Du bist absichtlich wenig hilfreich.«
»Wie du es warst, mit deiner Krebs-Idee? Sollte ich etwa glauben, meine Missbilligung könne einen neuen Ausbruch der Krankheit bei meiner Schwester hervorrufen?«
Mit Befriedigung verfolgte sie Simons beherrschte Ausatmung. Jetzt war er an der Reihe, ganz langsam bis zehn zu zählen. Und wenn er bei zehn angelangt war, würde er feststellen, dass er immer noch mit Charlie verheiratet war. »Es gibt keine Katze im Personalbüro«, sagte er. »Und ich weiß, dass ich nicht allergisch gegen Katzen bin. Du kannst doch nicht behaupten, dass etwas, was bekanntermaßen unrichtig –«
»Ich habe gerade bewiesen, dass es unter bestimmten Umständen möglich ist, zu wissen, worin die Motivation nicht besteht, ohne zu wissen, worin sie dann besteht. Beweisvortrag abgeschlossen. Räum die weg.« Sie reichte Simon zwei saubere, dampfende Pasta-Teller aus der Geschirrspülmaschine. »Es gibt Gründe, die uns bewusst sind. Es gibt Gründe, von denen wir nichts wissen. Und es gibt Gründe, die wir einfach nicht haben und von denen wir, wenn wir sie hören, wissen, dass wir sie niemals haben könnten, weil es etwas ist, was uns nie in den Sinn kommen würde.«
»Nehmen wir mal an, du hast jemanden umgebracht.«
»Könntest du diese Teller wegräumen, bevor du abgelenkt wirst und sie fallen lässt?«
»Du gibst es zu.«
»Ich gebe es zu«, sagte Charlie. »Ich war’s.«
»Ich frage dich, warum du es getan hast. Du sagst, du kannst es mir nicht sagen – es gebe keinen Grund. Du wüsstest nicht warum. Du hättest es einfach getan.«
»Habe ich es geplant?«
»Du sagst nein. Es war spontan. Stell dir vor, ich nenne dir einen Grund, aus dem du es getan haben könntest, und es ist ein Grund, der dir, wenn du ihn bestätigst, ein milderes Urteil einbrächte oder dich, wenn du Glück hast, sogar ganz vor einer Gefängnisstrafe bewahrt.«
Charlie hob die Augenbrauen. »Was, du meinst dieses absolut akzeptable Motiv für das Begehen eines Mordes, das Richter und Geschworene sofort zur Nachsicht bewegt?«
»Wäre das dein Motiv, wäre es kein Mord, sondern ein weniger ernsthaftes Verbrechen. Möglicherweise.«
»Aber … es war nicht mein wahres Motiv?«
Simon dachte über ihre Frage nach. »Entweder es war das wahre Motiv und du streitest es ab, oder es war nicht das richtige Motiv und du bist nicht bereit, so zu tun als ob, um weniger Jahre ins Gefängnis zu kommen. In beiden Fällen bleibt die Frage: Warum tust du das?«
Charlie lächelte. »Oder …«, sagte sie. Simon sah sie erwartungsvoll an. »Es wird dir nicht gefallen«, warnte sie ihn. »Es ist ebenso abgefeimt wie unwahrscheinlich.«
»Raus mit der Sprache. Du weißt, wie ich über Ockhams Rasiermesser denke. In den meisten Fällen ist die einfachste Lösung keineswegs die richtige. Abgefeimt und unwahrscheinlich, das ist normal.«
»Du solltest deine eigene Theorie veröffentlichen: Ockhams Bart, könntest du sie nennen. Schön, sagen wir, dein Täter könnte die Zeit, die er hinter Gittern zubringt, halbieren, indem er sein wahres Motiv gesteht, eben das, was du vermutest. Wenn er verzweifelt ist oder ein Pessimist, wird er sich vielleicht darauf einlassen. Aber wenn er selbstsicher ist und ein guter Lügner, wäre es denkbar, dass er sein wahres Motiv abstreitet und so wenig überzeugend wie möglich beteuert, dass das von ihm begangene Verbrechen Mord war. Zu dieser Taktik könnte gehören, dass er vorgibt, keine Ahnung zu haben, warum er die Tat begangen hat, was wenig plausibel wirkt.«
Simon nickte. »Wenn er darauf beharrt, nicht zu wissen, warum er es getan hat, und ich ihm das nicht abnehme, fange ich vielleicht irgendwann an zu denken, dass er gar nicht der wahre Täter ist, sondern jemand anderes deckt. Was genau mein Gedankengang war. Finde ich jemand anderen, dem ich das Verbrechen anlasten kann, kommt er überhaupt nicht ins Gefängnis: Er wird für unschuldig befunden anstatt des geringeren Verbrechens für schuldig.«
»Simon, das ist dermaßen unwahrscheinlich – dass er überhaupt auf die Idee kommen würde, dass er den Nerv hätte, es durchzustehen. Ihm müsste bekannt sein, dass es einen anderen gibt, der es getan haben könnte, jemand mit Motiv und Gelegenheit. Und selbst dann, er müsste doch davon ausgehen, dass du es nicht beweisen kannst, oder? Sämtliche Beweise, die es gibt, werden auf ihn hindeuten, den wahren Täter.«
Es klingelte an der Tür, dann unmittelbar darauf noch einmal, dringlicher. »Zugegeben, es ist eine großartige Idee«, rief Charlie über die Schulter zurück, als sie zur Tür ging. »Leider ist es meine Idee und nicht die deines Verdächtigen.«
»Lass sie nicht rein!«, rief Simon.
»Brüll noch ein bisschen lauter, dann vertreibst du sie vielleicht, bevor ich an der Tür angelangt bin.«
Weiteres Klingeln. Charlie fluchte leise, als sie die Tür öffnete. »Sorry, du hast dein Zeitfenster verpasst. Du wirst einen neuen …« Termin machen müssen. Die letzten Worte schafften es nicht über ihre Lippen.
Die Frau, die im strömenden Regen vor der Tür stand, war nicht Liv. Charlie wusste nicht, wer sie war, obwohl ihr irgendetwas an ihr bekannt vorkam. Und doch hätte sie schwören können, dass sie dieses Gesicht noch nie zuvor gesehen hatte.
»Sind Sie Sergeant Charlie Zailer?«
»Ja. Und wer sind Sie?«
»Mein Name ist Regan Murray.«
Ich kenne den Namen nicht, ich kenne das Gesicht nicht. Und doch …
»Ich bin auf der Suche nach DC Simon Waterhouse. Ich weiß, dass er hier wohnt.«