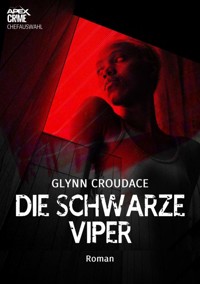5,99 €
Mehr erfahren.
Pascoe, ein junger Taucher, hat sich die Bergungsrechte an der gesunkenen Blushing Bride gesichert.
Aber kaum beginnt er an dem Wrack zu arbeiten, als sich vor allem zwei Leute für Pascoe und das Schiff interessieren: ein hübsches Bikini-Mädchen und - ein Mörder...
Der Roman spielt an der Küste von Südwestafrika.
Glynn Croudace (* 22. April 1917) ist eine britische Kriminal-Schriftstellerin.
Der Roman Der scharlachrote Bikini erschien erstmals im Jahr 1969; eine deutsche Erstveröffentlichung erfolgte 1970.
Der Apex-Verlag veröffentlicht eine durchgesehene Neuausgabe dieses Klassikers der Kriminal-Literatur in seiner Reihe APEX CRIME.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Glynn Croudace
Der scharlachrote Bikini
Roman
Apex Crime, Band 133
Apex-Verlag
Inhaltsverzeichnis
Das Buch
DER SCHARLACHROTE BIKINI
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebtes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Elftes Kapitel
Zwölftes Kapitel
Dreizehntes Kapitel
Das Buch
Pascoe, ein junger Taucher, hat sich die Bergungsrechte an der gesunkenen Blushing Bride gesichert.
Aber kaum beginnt er an dem Wrack zu arbeiten, als sich vor allem zwei Leute für Pascoe und das Schiff interessieren: ein hübsches Bikini-Mädchen und - ein Mörder...
Der Roman spielt an der Küste von Südwestafrika.
Glynn Croudace (* 22. April 1917) ist eine britische Kriminal-Schriftstellerin.
Der Roman Der scharlachrote Bikini erschien erstmals im Jahr 1969; eine deutsche Erstveröffentlichung erfolgte 1970.
Der Apex-Verlag veröffentlicht eine durchgesehene Neuausgabe dieses Klassikers der Kriminal-Literatur in seiner Reihe APEX CRIME.
DER SCHARLACHROTE BIKINI
Erstes Kapitel
Pascoe wurde langsam und widerstrebend wach. Die Schultermuskeln schmerzten noch von der Arbeit des vorangegangenen Tages. In der Kabine des Fischerbootes war es bereits warm, und er schob sich die Wolldecke bis zur Hüfte hinab. Die Seevarkie hob und senkte sich an ihrer Vertäuung. Er hörte das vielfingrige Streicheln des Seetangs am Schiffsrumpf und das sanfte Klatschen der Wellen.
Es herrschte kaum Seegang, und es blies auch nicht der berüchtigte Südost. Nichts stand also einem guten Tagewerk an dem Wrack in der grünen Tiefe, fünfundvierzig Meter unter der Oberfläche des Südatlantiks, im Wege.
Wirklich nichts? Dieser leichtfertige Gedanke kam ihm vor wie eine Herausforderung des Schicksals. Beunruhigt schlug er die Augen auf.
Im ersten Augenblick starrte er nur auf das scharlachrote Dreieck eines Bikinis, kaum eine Armeslänge von ihm entfernt. Aus dieser Nähe konnte er sogar die Poren der sonnenbraunen Haut sehen, die Meerwassertropfen rings um ihren hübschen Nabel und die deutlich vorstehenden Hüftknochen.
»Sie sind doch Mr. Pascoe, nicht wahr?«, fragte das Mädchen.
Er stützte sich auf einen Ellbogen und sah sie an. Sie gehörte zu jenen schlanken, langbeinigen Geschöpfen mit zu viel Busen und zu viel Selbstbewusstsein, wie ihm schien. Ihre grauen Augen hatten die Form von Booten und waren an den Winkeln wie bei einer Katze etwas nach oben gebogen. Sie sahen ihn mehr belustigt als entschuldigend an. Das Meer hatte ihr schwarzes Haar in der Mitte gescheitelt und zu beiden Seiten flach an den Kopf gelegt. Diese Frisur verlieh ihr etwas von einer viktorianischen Strenge, zu der ihre Haltung und der Umstand, dass sie praktisch nackt vor ihm stand, ganz und gar nicht passten.
»Und Sie?«, fragte er. »Was tun Sie denn hier?« Da er von seiner Koje nicht aufstehen konnte, fühlte er sich eindeutig im Nachteil.
Sie schwankte mit dem Rollen des Bootes noch ein Stück näher auf ihn zu. »Mein Name ist Yolande Olivier.«
»Sind Sie ’ne Schauspielerin oder so etwas?« Er hasste diese Künstlernamen. Vielleicht arbeitet sie an einem Film mit und braucht das Boot, überlegte er.
»Oder so etwas«, ahmte sie ihn nach. »Künstlerin bin ich tatsächlich, aber das hat nichts mit meinem Hiersein zu tun.«
Er schlang sich die Wolldecke enger um die Hüften und fuhr sich mit den Fingern durch den wirren Haarschopf.
»Vielleicht sind Sie dann so freundlich und sagen mir, was Sie von mir wollen.«
Ihr Verhalten veränderte sich. Die ironische Selbstsicherheit machte einer ernsthaften Eindringlichkeit Platz. Unnötigerweise senkte sie die Stimme.
»Es geht um eine furchtbar vertrauliche Sache.«
Er hielt den Atem an. »Ich habe selbst Ärger genug, behalten Sie’s für sich.«
»Es hat etwas mit der Blushing Bride zu tun.«
»So?« Er legte den Kopf schräg und runzelte die Stirn.
Die Blushing Bride, nach einer zarten, rosaweißen Blüte aus der Umgebung des Kaps benannt, war ein alter hölzerner Fischtrawler. Vor sechs Wochen hatte sie auf der Rückkehr von den Fischgründen vor der südafrikanischen Küste einen Maschinenschaden erlitten und im Windschatten der winzigen, vom weißen Kot der Seevögel überzuckerten Insel Witkop, rund fünfzig Seemeilen nördlich von Kapstadt und kaum eine halbe Meile von der Küste entfernt, Anker geworfen. Während der Nacht hatte sich der alte Trawler bei mäßigem Seegang von der Vertäuung losgerissen, war an den Felsen der Insel Witkop zerschellt und mit mehreren Tonnen Fisch in den Laderäumen in zweiundzwanzig Faden Tiefe gesunken.
»In der Argus stand, dass Sie von der Reederei die Bergerechte erworben hätten, Mr. Pascoe.«
»Na und?« Die Anrede Mister störte ihn immer mehr. Er nahm sich vor, auf der Hut zu sein.
»Darf ich fragen, ob Sie die Absicht haben, das Wrack wieder flottzumachen?«
Er schüttelte den Kopf. »Das ist der Kahn nicht wert. Selbst wenn ich das nötige Geld und die Geräte dazu hätte. Mich interessiert nur die Maschine, die ist noch ziemlich neu. Außerdem ein paar andere Dinge von Wert, falls ich sie erwischen kann. Netze zum Beispiel.«
Während er sprach, ließ sie keinen Blick von seinem Gesicht. Wenn das Boot vom Seegang rollte und sie ein wenig auf ihn zu schwankte, war ihr Gesicht jedes Mal vom Dreieck ihres Busens eingerahmt. Er wurde immer verlegener.
»Herr im Himmel, so setzen Sie sich doch.«
»Danke.« Für eine Sekunde kehrte der ironische Ton wieder. Er hatte das Gefühl, dass dieser Zynismus immer dicht unter der Oberfläche lauerte. Sie setzte sich auf die Kante der gegenüberliegenden Koje und schlug die Beine übereinander.
»Warum interessieren Sie sich überhaupt für diese Bergungsaktion, Miss Olivier?«
Als typische Frau beantwortete sie seine Frage mit einer Gegenfrage.
»Kannten Sie Desmond Mercer?«
Er zögerte und war sich klar darüber, dass dieses Zögern ihr nicht entgehen würde.
»Ja, ich kannte ihn.«
Ihre Stimme wurde noch leiser. »Er war sozusagen ein Freund von mir.«
Nach diesem vagen Geständnis senkte sie den Blick. Die Morgensonne fiel durch die Luke und beleuchtete ihr Profil. Die linke Seite wurde vergoldet, die rechte blieb im Schatten. Pascoe hatte das seltsame Gefühl, zwei gänzlich verschiedene Frauen vor sich zu haben. Aber so ist es natürlich immer: Es gibt immer eine Frau, die man sieht, und eine, die man nicht sieht.
Er konzentrierte sich ganz bewusst auf Desmond Mercer.
Mercer, das schwarze Schaf einer stolzen, aber längst nicht mehr wohlhabenden Familie vom Kap, war gleichzeitig Eigentümer und Skipper der Blushing Bride gewesen. Er war ein gutaussehender Junge voll Charme und voll Versprechungen, die er nie einhielt, ein unterhaltsamer Trinkkumpan, der aber mit zunehmendem Alkoholkonsum unangenehm werden konnte; ein Mann, der sich für unwiderstehlich hielt und der keiner Frau widerstehen konnte. Gegen Ende seines egoistischen Lebens gelangte er dadurch zu einer Art fragwürdigen Ruhm, dass er einen russischen Trawler zu rammen versuchte, auf den er dicht unter Land gleich nördlich von Port Nolloth gestoßen war.
»Er hatte viele Freundinnen«, sagte Pascoe kühl.
Ihre dunklen Lider flatterten. »Sie mochten ihn anscheinend nicht.«
»Ich hatte nur sehr wenig mit ihm zu tun. Soviel ich weiß, war er ein guter Seemann.«
»Und trotzdem verlor er sein Schiff und sein Leben! In einer ziemlich ruhigen Nacht in Reichweite der Küste.«
Pascoe zuckte die Achseln. »Nach den Berichten war er manövrierunfähig, und sein Ankertau brach.«
»Es wurde nur eine Leiche geborgen«, sagte Yolande Olivier. »Die von Johannes, dem farbigen Koch.«
»Mercer war vermutlich in seiner Kabine, als es die Blushing Bride erwischte.«
»Sie meinen, er war betrunken?« Die grauen Augen wurden schmal.
»Das habe ich nicht gesagt«, antwortete Pascoe. »Er war mit Johannes allein an Bord. Die farbige Crew war an Land gegangen - zur Farm Duinfontein.«
»Die gehört Lex Pickard. Haben Sie ihn schon kennengelernt?«
Er nickte. »Flüchtig. Aber was hat das alles mit Desmond Mercer zu tun?«.
»Verzeihung«, sagte sie, »ich rede offenbar um die Sache herum. Ich wollte Sie eigentlich um einen großen Gefallen bitten.«
Pascoes Lippen wurden schmal. »Das habe ich mir gedacht.«
Sie sah ihn flehend an. »Ich nehme doch an, dass es Ihnen gelingen wird, in die Kapitänskajüte einzudringen?«
Er zögerte für den Bruchteil einer Sekunde. »Das glaube ich eigentlich nicht.« Dabei wusste er, dass er sich längst verplappert hatte. »Die ist durch die offene Luke voll Treibsand geschlagen. Außerdem...«
Möglicherweise lag auch noch die Leiche des Skippers darin. Er hatte ganz und gar nicht die Absicht, sie zu bergen, besonders nicht, nachdem sie sechs Wochen lang im Wasser gelegen hatte, wo es von Panzerkrebsen wimmelte.
»Desmond besaß eine Seekiste«, sagte sie leise trotz seiner Einwände. »Sie war immer am Boden seiner Kabine verankert, völlig wasserdicht und mit persönlichen Gegenständen gefüllt.«
»Falls wir auf persönliche Gegenstände stoßen, so werden die an die nächsten Verwandten geschickt.«
Sie blinzelte. Er sah zwischen ihren Wimpern Tränen schimmern.
»Genau das habe ich befürchtet, Mr. Pascoe.«
Er sah sie verärgert an. Was er nicht ausstehen konnte, waren heulende Frauen.
»Was soll denn das schon wieder? Hab’ ich etwas Falsches gesagt?«
Sie schluckte. »Desmond hinterlässt eine Witwe.«
»Ich hab’ sie kennengelernt, sie wohnt in Kapstadt.«
»Eine wundervolle Frau, meinen Sie nicht auch? Sie hat ihren Mann regelrecht verehrt.«
»Das habe ich mir sagen lassen.« Pascoes Stimme klang sachlich und unverbindlich. Mrs. Mercers Gefühle für ihren verstorbenen Mann gingen ihn nichts an.
»In ihren Augen war er ein Held«, fuhr Yolande Olivier fort. »Sie traute ihm nichts Schlechtes zu und hörte nicht auf all die Gerüchte, die über ihn die Runde machten.«
Pascoe sah sie missmutig an.
»Und wie war Ihnen, als Sie die Frau kennenlernten?«
»Schrecklich.« Sie fuhr sich mit dem Handrücken über die Stirn.
»Zurück zu der Seekiste.«
»Ja, natürlich.« Sie holte mit einem leisen Seufzer Luft. »Ich hoffte, dass Sie da unten auf diese Kiste stoßen würden.«
»Durchaus möglich«, sagte er und fragte sich, was sie daran wohl so beunruhigen mochte.
»Wenn Sie die Kiste bergen und an Desmonds Witwe schicken, wird es sie umbringen.« Der Ernst in ihrer Stimme war unverkennbar.
»Ich kann Ihnen nicht folgen«, murmelte er stirnrunzelnd.
»Weil Sie ihn damit vernichten würden, verstehen Sie nicht? Sie würden das Bild zerstören, das sie von ihm in ihrem Herzen trägt - ich weiß sehr wohl, dass es ein falsches Bild ist, aber es ist das einzige, was ihr geblieben ist, Mr. Pascoe: ihr ungerechtfertigtes Vertrauen in den Mann, den sie liebte, und ihre Erinnerungen.«
Trotz seiner Skepsis rührte ihn doch die Verzweiflung in ihrer Stimme und in ihrem Blick.
»Fangen Sie lieber von vorn an«, schlug er ruhig vor. »Aber wohlgemerkt: Ich verspreche Ihnen gar nichts.«
Sie warf ihm einen dankbaren Blick zu. »Aber Sie werden’s doch versuchen, nicht wahr? Sie werden Ihr Bestes tun?«
»Ich verspreche gar nichts«, wiederholte er.
Es war durchaus die bekannte Geschichte, wenn man von ein paar kleineren Variationen absah. Nach seinem lächerlichen Versuch, den russischen Fischdampfer zu rammen, waren Desmond Mercers Lebensgeschichte und sein Foto in allen Zeitungen erschienen. Einer der Berichterstatter nannte ihn einen Rückfall in die Tage der Seeräuber, und mit seinen kurzen schwarzen Locken, seinem kühnen Gesichtsschnitt und dem Messer, das er stets im Gürtel trug, sah er auch fast wie ein Seeräuber aus.
»Damals hatte ich gerade vor, meine Bilder auszustellen«, sagte Yolande Olivier. »Ich dachte, es sei gut für die Publicity, auch ein Porträt von Desmond Mercer dabei zu haben. Also bat ich ihn, mir zu sitzen. Er besuchte mich in meinem Studio.«
Als Pascoe das hörte, war ihm sofort klar, wie es weitergehen würde. Die beiden verliebten sich ineinander.
»Sehen Sie, Mr. Pascoe, er besaß eine Polaroid-Farbkamera und bat mich, ihm auch Modell zu stehen.«
»Ach so.« Pascoe wusste genau, was nun kommen musste.
»Nackt«, fügte sie zögernd hinzu.
»Aha.«
Sie glaubte nun, sich verteidigen zu müssen.
»Ich war in ihn verliebt, verstehen Sie nicht?«
»Doch, natürlich.«
»Leidenschaftlich verliebt. Ich habe ihm ein paar ziemlich dumme Briefe geschrieben.«
»Und diese Briefe und die Fotos liegen da unten in der Seekiste, nicht wahr?«
Sie nickte kläglich.
»Ich dachte, diese Dinge wären sicher auf dem Boden des Meeres, aber seit ich gelesen habe, dass Sie die Bergungsrechte für diesen alten Trawler erworben haben, habe ich kaum noch geschlafen.« Für einen Augenblick presste sie beide Hände ans Gesicht. »Ich konnte doch nicht einfach Zusehen, Mr. Pascoe, wie Sie diese Seekiste retten und an Joan Mercer zurückschicken.«
»Nun, dann brauchen Sie sich keine Sorgen mehr zu machen. Lassen wir die Kiste da liegen, wo sie ist.«
Sie schüttelte den Kopf, und ihre grauen Augen schimmerten. »Das ist der Gefallen, um den ich Sie bitten wollte«, sagte sie schließlich. »Aber ich sehe jetzt ein, dass mein Problem damit nicht gelöst wäre. Ich hätte trotzdem keine Ruhe.«
»Und warum nicht?«, fragte er knapp, weil ihm die Unterhaltung auf die Nerven ging.
»Wenn Sie nämlich fertig sind, könnten andere Taucher auf den Gedanken kommen, sich das Wrack anzusehen. Fünfundvierzig Meter sind schließlich keine unerreichbare Tiefe. Ich hätte keinen Frieden mehr - immer müsste ich Angst haben, dass .jemand die Kiste herausholt und an Desmonds Witwe zurückschickt. Das darf ich nicht riskieren, Mr. Pascoe.«
»Nein«, sagte er wider Willen, »ich glaube nicht.«
Sie stand auf, hockte sich vor ihn auf den Boden und sah ihn flehend an. »Holen Sie die Kiste für mich heraus, lassen Sie mir ein paar Minuten Zeit, die Beweise meiner Dummheit zu vernichten, dann kann Mrs. Mercer alles andere haben. Sie würde Ihnen sehr dankbar sein und ich auch.«
»Ich verspreche gar nichts«, sagte Pascoe. »Wenn ich sie ohne allzu große Schwierigkeiten bergen kann, werde ich sie heraufholen. Aber zuerst müssen wir die Maschine haben.«
»Das verstehe ich«, sagte sie. »Darf ich wieder nachfragen?«
»Wo wohnen Sie denn?«
»In einem Wohnwagen am Ufer der Lagune, ungefähr eine halbe Meile landeinwärts. Wir sind zu dritt und machen für vierzehn Tage Ferien.«
»Dann melden Sie sich wieder«, sagte Pascoe.
Zweites Kapitel
Yolande Olivier hechtete über den Bug ins Wasser und schwamm auf die Küste zu. Pascoe warf die Decke beiseite, stand auf und musste sich ein wenig bücken, um nicht ans Kabinendach zu stoßen. Eilig zog er sich seine Badehose über und blinzelte durch die offene Luke hinaus in die Sonne, die über den weiten Stoppelfeldern des Weizenanbaugebiets von Malmesbury, über dem Ufergebüsch und den vom Wind geformten Dünen auf ging. Er sah Yolandes dunklen Kopf, schmal und glatt wie den einer Seejungfrau, durch das grüne, rastlose Meer gleiten.
Sie war eine kraftvolle Schwimmerin, auch wenn sie ihm die hilflose, kleine Frau vorgespielt hatte. Er erinnerte sich, wie sie vor ihm gesessen und er geglaubt hatte, zwei verschiedene Frauen zu sehen.
Stirnrunzelnd rieb er sich mit dem Handrücken über das unrasierte Kinn.
Pascoe war während des zweiten Weltkriegs in Johannesburg geboren. Sein dunkles Haar, die lebhaften blauen Augen und die kräftige Hakennase erinnerten an seine Vorfahren aus Cornwall. Seine große, schlaksige Gestalt war jedoch die eines Südafrikaners in der zweiten Generation. Großvater Pascoe hatte schon zu Beginn des Jahrhunderts die ausgebeuteten Zinngruben verlassen, um auf dem Riff nach Gold zu graben. Sein Sohn hatte es ihm nachgemacht und war kurz nach dem Krieg an Tuberkulose gestorben. Seine Witwe hatte später wieder geheiratet, und zwar einen Bergwerksdirektor, den der heranwachsende Steve nicht mochte. Als Steve in die Bergbauakademie eintreten sollte, kaufte er sich eine Fahrkarte zweiter Klasse nach dem tausend Meilen entfernten Kapstadt. Seine Vorfahren waren Fischer gewesen, bevor sie in die Minen hinabstiegen, und Steve Pascoe ergab sich bereitwillig dem Ruf des Meeres.
Er war jung und stark und von rascher Auffassungsgabe. Zuerst tauchte er nach Perlemoen, wie man in Südafrika die Ohrschnecken nennt. Perlemoen sollten auf die Liebeskraft angeblich dieselbe Wirkung ausüben wie Austern, nur sehr viel intensiver, und so fanden diese Meerestiere unter den wohlhabenden Chinesen Hongkongs reißenden Absatz. Als dann die großen Perlemoen-Bestände ausgebeutet waren und andere Lieferanten auf dem Markt erschienen, erlernte Pascoe auf einem Trawler das Handwerk des Fischers.
Irgendwann begegnete ihm Yasmine.
Yasmine war geschieden und drei Jahre älter als er, eine Blondine mit braunen Augen, lebhaft, üppig und von der trügerischen Schönheit mancher fleischfressenden Pflanzen. Die Liebesaffäre dauerte ungefähr ein Jahr, aber als dann die Silvesternacht kam, legte sie ihn ab wie den alten Pin-up-Kalender an ihrer Badezimmertür.
In den darauffolgenden Monaten war es ihm ergangen wie einem Süchtigen, dem man plötzlich die gefährliche, aber ersehnte Droge entzogen hatte. Manchmal ersäufte er den Schmerz seiner gedemütigten und nicht erwiderten Liebe im Alkohol, aber er wusste, dass Trinken in seiner Lage auch nichts half, und er schloss sich bei nächster Gelegenheit einer Walfänger-Flotte an, die nach Süden ins ewige Eis fuhr.
In einer einzigen Fangsaison machte die Antarktis einen harten Mann aus Pascoe. Er musste zusehen, wie zwei seiner neuen Freunde unter furchtbaren Schmerzen starben, als die Sprengladung einer Harpune versehentlich im Bug des Walfängers hochging. Allmählich wuchs ihm ein festes Narbengewebe, nicht nur über die Wunden, die er selbst bei der Explosion erlitten hatte, sondern auch über jene Wunden, die Yasmine ihm seelisch zugefügt hatte.
Das Leben und Arbeiten unter mörderischen Bedingungen, bei Stürmen, die einen Mann bei der geringsten Unvorsichtigkeit über Bord wehten, war für ihn nicht nur eine wertvolle Erfahrung, sondern es brachte ihm auch mehr Geld ein, als er jemals zuvor auf einem Haufen besessen hatte. In Kapstadt erwartete ihn die Heuer plus Prämien. Die Versuchung, alles auf den Kopf zu hauen, war überwältigend. Zum Teufel mit dem Morgen! Aber auf dem Weg zu den zweifelhaften Vergnügungen der Dock Road fiel ihm ein kleines, rundliches Fischerboot auf, das zum Verkauf stand. Es war nach dem seltsam geformten Kofferfisch, dem kleinen Seeferkel Seevarkie genannt.
Er kaufte das Schiff kurz entschlossen, solange er noch genügend Geld in den Taschen hatte. Es wurde für ihn Zuhause und gleichzeitig Lebensunterhalt. Allmählich rüstete er es mit Tauchgeräten und Kompressoren für leichtere Bergungsarbeiten in flachen Gewässern aus. Aber für die Bergungsaktion, die er vorhatte, brauchte er ein größeres und stärkeres Schiff. Auf der Reede von Simonstown war der Rumpf eines alten Seenotkreuzers der Luftwaffe spottbillig zu haben, und eine geeignete Maschine lag in dem Wrack des gesunkenen Trawlers an der Stelle, wo sich die Felsen von Witkop aus dem Meer erhoben.
Fast mit einer Art Schuldgefühl wandte Pascoe den Blick von dem Mädchen und sah hinüber nach Steuerbord. Die Ebbe hatte schon eingesetzt. Die Insel Witkop lag eine halbe Kabellänge entfernt und bot ihm Schutz gegen die im Sommer vorherrschenden Südostwinde, falls sie über Nacht plötzlich aufkommen sollten.
Die Insel bestand aus dem zuckergrauen Granit, der in uralten Zeiten aus vulkanischen Tiefen emporgequollen war. und vom Meeresgrund den Sandstein des Tafelberges hoch in die Luft gehoben hatte. Dieser Granit hatte einen halben Kontinent geformt. Die Klippen von Witkop stiegen seewärts fast dreißig Meter hoch senkrecht aus dem Wasser empor und bildeten die Silhouette eines Segels: nach der Küste hin war der weniger steile Hang von Wind und Wetter ausgewaschen und mit Steinblöcken übersät. Am Fuß des Felsens erhob sich auf einem schmalen Felsband eine alte Hütte der Guano-Sammler, die nur von den höchsten Wogen erreicht werden konnte.
Die Hütte war aus soliden Eisenbahnschwellen errichtet. Sie hatte ein Tor, ein Fenster, Drahtmatratzen und einen vielfach gesprungenen, schmiedeeisernen Ofen. Pascoe sah ein wenig Rauch aus dem Schornstein aufsteigen. Die Jungs waren also endlich wach. Das Mädchen konnten sie nicht gesehen haben, sonst hätte er bestimmt ein paar anerkennende Pfiffe gehört. Er lächelte grimmig vor sich hin und überlegte, ob er ihnen etwas von dem eigenartigen Besuch erzählen sollte. Vorerst wollte er es jedenfalls für sich behalten.
Nachdenklich setzte er den Kessel auf. Er schlief an Bord, weil ihm einerseits das Alleinsein behagte und er andererseits für den Notfall gleich zur Stelle sein wollte. Aber seine Mahlzeiten nahm er an Land zusammen mit der dreiköpfigen Besatzung ein.
Während er wartete, dass das Wasser kochte, trat er wieder an die offene Luke und stellte sich auf die Stufe des Niedergangs, um über das Kabinendach nach vorn sehen zu können. Ein Ruderhaus gab es nicht, nur achtern ein offenes Cockpit wie auf einer Yacht.
Er kam gerade noch recht, Yolande Olivier durch das seichte Wasser waten zu sehen. Das Schwimmen gegen die ablaufende Ebbe musste anstrengend gewesen sein. Wenn er nicht nackt unter seiner Decke gelegen hätte, würde er ihr wahrscheinlich angeboten haben, sie im Dinghi an Land zu bringen. Dass er es nicht getan hatte, war verdammt nachlässig von ihm gewesen, aber im Laufe seines rauen Lebens hatte er galante Gesten gegenüber Damen verlernt.
Er sah sie durch einen Einschnitt in den Dünen klettern und verschwinden. Dass sie sich nicht ein einziges Mal umblickte, enttäuschte ihn ein wenig.
Dieser Einschnitt in den Dünen kennzeichnete die Mündung des winzigen Palmiet River. Im Sommer wurde er durch den Sand blockiert, den die Südstürme aufwirbelten, wodurch die Lagune zustande kam. Sie wohnten zu dritt in einem Wohnwagen an ihrem Ufer, hatte sie gesagt. Drei Frauen.
Er kümmerte sich um den pfeifenden Wasserkessel. Drei Frauen an einer einsamen Küste - das konnte eigentlich nur Probleme aufwerfen. Er hoffte, dass kein größerer Ärger daraus entstand.
Kaffeeduft durchzog die Kabine und verdrängte vorübergehend den Geruch nach Dieselöl, Teer, salzwassergetränkter Takelage und Fisch. Pascoe trank seinen Kaffee aus einer großen Porzellantasse und rauchte dazu eine Zigarette. Mit dem Rest des heißen Wassers rasierte er sich, zog ein Paar Segeltuchschuhe über, räumte die Kabine auf und holte dann das schwarze Schlauchboot ein, das im Heck lag.
Das Dinghi reichte für fünf Mann und notfalls noch einen Kompressor. Es war mit Holz versteift und mit einem soliden 25-PS-Außenborder ausgerüstet. Pascoe ließ es zu Wasser, warf den Motor an und legte ab.
Eine Möwe schwebte über ihn weg, die rosa Füße an die glänzendweißen Federn gezogen, und das Dröhnen der Maschine übertönte sicherlich ihren klagenden Schrei. Pascoe gab Gas und spürte, wie sich der breite Bug hob.
Mython erschien in der offenen Tür der Hütte. Ohne irgendeinen Gruß oder auch nur ein Winken ging er schwerfällig zum Rand des Felsbandes und blieb abwartend stehen.
Pascoe schaltete den Motor ab, das Boot glitt sanft zur Anlegestelle. Er warf Mython ein Tau zu, der fing es mit der linken Hand auf und machte das Boot fest.
»Danke.« Pascoe griff hinauf nach der Felskante und zog sich an Land. »Alles in Ordnung?«
Er versuchte Mython in die wässrig-blauen Augen zu sehen, aber sofort sanken die sandfarbenen Wimpern hinab und schnitten jede Verständigung mit dem ausdruckslosen Mondgesicht ab. Angezogen wirkte Mython wie ein glatzköpfiger Eunuche, aber jetzt, wo er nur eine Badehose trug, hatte man diesen Eindruck ganz und gar nicht. Seine Männlichkeit war nicht zu bezweifeln, obgleich er völlig unbehaart war und ihm die fette Brust wie bei einer Frau auf den Schmerbauch hinabsank. Aber unter der Speckschicht lagen harte Muskeln. Er war der starke Mann des Quartetts, ein sehr geschickter Schwimmer und Taucher, bei der Arbeit unter Wasser unermüdlich, still und fleißig. Über seine Vergangenheit sprach er nicht.
Pascoe wusste von ihm nur, dass er früher einmal als Traktorfahrer gearbeitet hatte und in Südafrika die Deckschicht von Sand und versteinerten Muscheln von den Diamantenstränden weggeräumt hatte. Als er diese Beschäftigung leid war, kam er nach Kapstadt. Hier erfuhr er, dass Pascoe gerade die Bergungsrechte an der Blushing Bride erworben hatte und Taucher benötigte. Er bewarb sich sofort.
Nun hob er eine mit Sommersprossen übersäte Schulter - selbst seine blassen Lippen und die Mundschleimhaut wiesen Sommersprossen auf - und deutete zur Hütte zurück.
»Tony macht Frühstück.«
Seine Stimme klang eigenartig weich und fast einschmeichelnd. Sie bildete einen auffallenden Kontrast zu seiner mürrischen Art.
»Hoffentlich verbrennt er den Porridge nicht wieder«, sagte Pascoe. »Hast du Eier bekommen?«
»Ja, gestern Abend. Tony hat sie von der Farm geholt.«
»He, Skipper.« Tony Spencer tauchte mit einer Bratpfanne in der Hand an der Tür auf. Er hatte sich ein Küchenhandtuch als Schürze um die Mitte gebunden und trug ansonsten nur die Badehose, die praktisch ihre Uniform geworden war.
»Hab’ doch gedacht, dass ich die Maschine höre. Porridge ist fertig. Wenn du willst, haben wir auch Honig und frische Sahne.«
»Großer Gott!«
»Mit einer Empfehlung vom Herrn des Hauses«, sagte Tony lächelnd. »Ich habe gestern Abend Mr. Pickard besucht. Ein sehr gastfreundlicher Herr.«
Tony Spencers vornehmer Akzent hatte Pascoe zuerst gestört. Wenn der Junge etwas sagte, klang es hochnäsig, aber inzwischen hatte Pascoe sich daran gewöhnt. Hinter der Gleichgültigkeit, die er zur Schau trug, verbarg sich sein Mut, hinter der Schlaksigkeit seine Fähigkeit, hart zu arbeiten.
Tony war der Benjamin der Crew. Er war neunzehn und hatte gerade begonnen, an der Universität Kapstadt Zoologie zu studieren. Diese Expedition war sein Ferienjob. Er hatte sich ihnen aus Freude am Abenteuer angeschlossen und nicht aus Interesse am Geld - seine Eltern, die erst kürzlich aus England eingewandert waren, besaßen genug davon.
Pascoe folgte ihm in die Hütte und setzte sich ans Kopfende des Tisches.
»Was hast du bezahlt?« Um die Finanzen kümmerte sich Pascoe. Er war gezwungen, streng hauszuhalten.
»Pickard?« Tony stellte die Pfanne wieder auf den Ofen und lächelte über die Schulter. »Keinen Heller. Er hat gesagt, wir könnten uns revanchieren, wenn wir zufällig einmal auf einen Hummer stießen.«
»In Ordnung.« Pascoe schaufelte sich Porridge aus dem eisernen Topf. »Wo steckt Van?«
»Der ist zu einem Strandlauf an Land geschwommen.«
»Überschüssige Energie abarbeiten?«
»Vermutlich, Skipper. Du weißt ja, wie verrückt er darauf ist, fit zu bleiben.«
Von Staden, ein untersetzter, dickschädliger Sproß einer Burenfamilie, war Pascoes Stellvertreter und das einzige Mitglied der Mannschaft, das schon seit einiger Zeit mit ihm zusammenarbeitete. Nichts konnte Van bekümmern: Er war immer unerschütterlich fröhlich. Genau wie Pascoe hatte er noch in den alten Tagen des Perlemoen-Fischens das Tauchen gelernt.
»In welche Richtung ist er denn gelaufen, Tony?«
Der Junge war gerade damit beschäftigt, die Speckscheiben mit einer Gabel umzudrehen. Er deutete mit dem Kinn nach Norden. »Dort auf die Klippen zu. Warum?«
»Ich dachte, er sei vielleicht landeinwärts gelaufen«, meinte Pascoe.