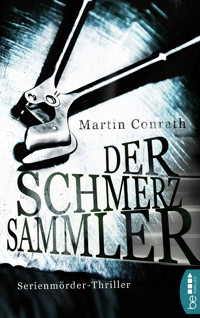
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beTHRILLED
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Profilerin Fran Miller
- Sprache: Deutsch
Er sammelt Stimmen. Schmerzensschreie seiner Folteropfer ...
Fran Miller, Profilerin und Sektenbeauftragte des LKA Düsseldorf, geht einem ruhigen Schreibtischjob nach. Doch während der Ermittlungen zu einem Satanisten-Mord gerät sie selbst ins Fadenkreuz eines obsessiven Killers. Er foltert seine Opfer bestialisch, bevor er sie tötet. Fran erkennt sein Motiv: Er sammelt die Schreie seiner Opfer. Niemand glaubt ihr - ein tödlicher Irrtum. Denn nicht nur Fran steht auf der Liste des Schmerzsammlers ...
Fran Miller ermittelt auch in diesen Serienmörder-Thrillern: "Teufelsblume" und "Ich werde töten".
eBooks von beTHRILLED - mörderisch gute Unterhaltung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 503
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Inhalt
Cover
Weitere Titel des Autors
Über dieses Buch
Über den Autor
Titel
Impressum
Zitat
1. Donnerstag
2. Freitag
3. Samstag
4. Montag
5. Dienstag
6. Mittwoch
7. Donnerstag
8. Freitag
9. Samstag
10. Sonntag
11. Montag
12. Dienstag
13. Mittwoch
14. Donnerstag
15. Sonntag
16. Dienstag
17. Mittwoch
Epilog
Danksagung
Weitere Titel des Autors
Profilerin Fran Miller ermittelt:
Band 2: Teufelsblume
Band 3: Ich werde töten
Über dieses Buch
Er sammelt Stimmen. Schmerzensschreie seiner Folteropfer …
Fran Miller, Profilerin und Sektenbeauftragte des LKA Düsseldorf, geht einem ruhigen Schreibtischjob nach. Doch während der Ermittlungen zu einem Satanisten-Mord gerät sie selbst ins Fadenkreuz eines obsessiven Killers. Er foltert seine Opfer bestialisch, bevor er sie tötet. Fran erkennt sein Motiv: Er sammelt die Schreie seiner Opfer. Niemand glaubt ihr – ein tödlicher Irrtum. Denn nicht nur Fran steht auf der Liste des Schmerzsammlers …
Über den Autor
Martin Conrath schreibt Kriminalromane, von denen einer auch als »Tatort« verfilmt wurde. Außerdem ist er Teil des Autorenduos Sabine Martin, das erfolgreich historische Romane veröffentlicht. Martin Conrath lebt und schreibt in Düsseldorf.
Martin Conrath
Der Schmerzsammler
Serienmörder-Thriller
beTHRILLED
Digitale Neuausgabe
»be« - Das eBook-Imprint der Bastei Lübbe AG
Copyright © 2013 by Bastei Lübbe AG, Köln
Für diese Ausgabe:
Copyright © 2018 by Bastei Lübbe AG, Köln
Lektorat: Daniela Jarzynka
Covergestaltung: ZERO Werbeagentur, München unter Verwendung eines Motives © missbehavior.de
eBook-Produktion: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
ISBN 978-3-7325-6979-3
www.be-ebooks.de
www.lesejury.de
Das Leben ist voller Leid, Krankheit, Schmerz –und zu kurz ist es übrigens auch …
WOODY ALLEN
1. Donnerstag
Mit der rechten Hand hielt sich Fran Miller am Geländer fest. Einhundertsechsundsiebzig Meter unter ihr standen Passanten, klein wie Ameisen, und gestikulierten wild.
Sie brauchte nur ihre Hand zu öffnen, sieben Sekunden später würde ihr Körper mit zweihundertelf Kilometern pro Stunde auf dem Asphalt aufschlagen und wie eine Melone zerplatzen. Vielleicht würde eine Böe sie ein oder zwei Meter nach rechts tragen und ihr Totenbett würde das Dach eines Autos werden. Zumindest war dieser Tod schnell und schmerzlos. Das war die gute Nachricht. Die Nerven waren einfach zu langsam, um den Schmerz bis ins Bewusstsein zu befördern, wenn der Boden wie eine Tausend-Tonnen-Presse ihren Körper zermalmte. Die schlechte Nachricht: Die sechs Komma neun Sekunden bis zum Aufschlag würden die längsten ihres Lebens werden.
Fran Miller schloss die Augen. Wollte sie das wirklich? Ja! Es gab kein Zurück, es gab keine andere Möglichkeit, sie fand keinen Grund, ihr Vorhaben aufzugeben, auf dem massiven Beton der Brücke stehen zu bleiben. Und sie würde ihren Sturz für die Nachwelt dokumentieren. Mit der linken Hand schaltete sie die kleine Kamera ein, die sie zwei Zentimeter über ihrem rechten Ohr befestigt hatte. Sie pumpte ihre Lungen mit Luft voll, öffnete ihre Hand, drückte sich mit voller Kraft ab und fiel in die Tiefe.
2. Freitag
»Aber der Wolf fand sie alle und machte nicht langes Federlesen. Eins nach dem anderen schluckte er in seinen Rachen …«
Ich liebe diese Stelle, die Kinder fangen an zu quietschen und zu schreien, denn ich knurre und schmatze und reiße meinen Mund auf wie der Wolf. Erst wenn ich weiterlese und sie begreifen, dass ein Geißlein sich verstecken konnte, beruhigen sie sich. Und wenn der Wolf mit den Steinen im Bauch jämmerlich im Brunnen ersäuft, dann jubeln sie. Für einen so bösen Wolf kommt ja nur die Todesstrafe in Betracht. Wie sich Steine im Bauch wohl anfühlen?
Kleine Kinder ähneln mir in gewisser Weise. Sie sind gnadenlos, sie sind absolut, sie kennen kein Erbarmen. Der Wolf muss sterben, er ist böse. So wie Hexen. Alles was für Kinder böse ist, wird mit Stumpf und Stiel vernichtet. Ich mag kleine Kinder. Ich würde ihnen niemals etwas antun.
Die Leiterin der Kindertagesstätte St. Martin bedankt sich bei mir, dass ich trotz meines anstrengenden Berufs immer wieder die Zeit finde, den Kleinen vorzulesen. Die Einladung zum Kaffee lehne ich freundlich, aber bestimmt ab, ich muss jetzt alleine sein, ich muss nachdenken.
Mein Lieblingscafé liegt am Carlsplatz, am Eingang zur Altstadt, Plüschsessel, Kaffee in Kännchen, die Bedienung darf man »Fräulein« rufen. Ich bestelle eine heiße Schokolade, sie ist dick und schmeckt wirklich nach Schokolade. Ich habe diesen Ort der dezenten Dekadenz schnell ausfindig gemacht. Ich war erst zwei Monate in Düsseldorf, als ich während einer Aufklärungstour hier vorbeikam, ich war auf der Suche nach einem geeigneten Gast, aber ich musste mit leeren Händen nach Hause fahren.
Manchmal laufen sie mir einfach über den Weg, manchmal muss ich suchen, und einige habe ich bereits gefunden. Sie müssen bestimmte Eigenschaften besitzen, damit ich mit ihnen arbeiten kann. Sie dürfen nicht in meinem Viertel wohnen. Sie müssen gesund sein. Sie müssen alleine sein, niemand darf sie vermissen. Ob sie die wichtigste aller Eigenschaften besitzen, erkenne ich erst, wenn sie mit mir arbeiten.
Morgen lade ich einen Kandidaten ein, von dem ich mir viel verspreche, der alles mitbringt, was ihn zu einem Ausnahmeexemplar macht. Ich hake ihn auf meiner Liste ab.
Wer wird noch das Vergnügen haben? Eine Sängerin, eine Polizistin, ein Bauarbeiter, ein Bankangestellter. Meine Liste ist nicht mehr sehr lang. Viele habe ich schon abgearbeitet.
Es ist gar nicht so einfach, Menschen zu finden, die wirklich einsam sind, die niemand vermissen würde. Obwohl viel mehr Menschen alleine wohnen, sind sie nicht isoliert. Es bilden sich neue soziale Netze, es wird mir wirklich nicht einfach gemacht. Studenten zum Beispiel. Bis jetzt habe ich noch nicht einen gefunden, der nicht eingebunden ist in ein Beziehungsgeflecht. Die Gesellschaft verändert sich. Die Familie verliert ihren Anspruch auf die heilige Stütze der Gesellschaft. Immer mehr wird das Individuum zum Träger eines stabilen Gemeinwesens. Das ist eine gute Entwicklung, denn Familie ist nur eine Illusion, eine Chimäre, ein Betrug. Familie ist Lügengespinst, Familie ist die Hölle.
Ich schlürfe den letzten Rest der heißen Schokolade.
Es gibt noch jemanden, den ich vielleicht einladen werde. Jemand, der auf seltsame Weise mit mir verbunden ist. Aber ich würde ihn nicht zum Arbeiten einladen, sondern zum Plaudern über Gott und die Welt. Und vielleicht würde ich ihn fragen, was es bedeutet, ein guter Vater zu sein, aber es wäre keine echte Frage, denn ich weiß die Antwort. Ich verschiebe die Entscheidung. Die Erkenntnis, dass es diesen Menschen gibt, ist noch zu neu – und auch ein wenig schmerzhaft. Ich verdränge, dass es ihn gibt, wende mich den wichtigen Dingen zu, denn heute ist der erste Tag des Countdowns. Mein Plan ist endlich fertig. Ich und mein Team, dessen Mitgliederfluktuation recht hoch ist, – bisher waren es dreiundzwanzig – haben fast zwei Jahre daran gearbeitet. Mein Herz klopft ein wenig fester. Vorfreude pulst durch meine Adern. Nun denn. Lasset die Kinderlein zu mir kommen!
*
»Fran ist gesprungen!« Bruno Rheinstahl ließ seinen massigen Kopf hängen, den nur noch ein paar Überreste einer ehemals üppigen Haarpracht zierten. »Verdammt!« Er hob den Kopf und blickte seinem Kollegen Günther Anleder direkt ins Gesicht. »Das freut dich, was?«
»Da kannst du Gift drauf nehmen.« Anleder rückte seine rechteckige schwarze Brille zurecht, ohne die er gegen jeden Türpfosten gelaufen wäre. »Wissen es die anderen schon?«, fragte er und strahlte über das ganze Gesicht.
»Ja, na klar, deinen Aushang konnte ja niemand übersehen. Du siehst aus wie ein Buchhalter, aber verdammt, du bist echt ein eiskalter Hund! Und jeder, der es will, kann sich das Drama im Internet ansehen.« Bruno Rheinstahl schlug mit der Faust in seine Hand.
Günther Anleder breitete die Arme aus. »Anders kommt man zu nichts. Du schuldest mir hundert Euro. Bar oder Scheck?«
»Nimmst du Wechsel?«, fragte Bruno Rheinstahl.
»Von dir immer. Du bist so ehrlich, dass es schon wehtut.« Günther Anleder lachte meckernd, so wie er lachte, wenn er glaubte, einen guten Witz gemacht zu haben.
Bruno Rheinstahl reichte ihm einen Hundert-Euro-Schein, der nicht die geringste Falte aufwies. Anleder hielt ihn gegen das fahle Licht, das vom Innenhof des Landekriminalamtes durch die halb mit milchiger Folie verklebte Doppelglasscheibe auf seinen Schreibtisch sickerte.
»Scheint echt zu sein«, sagte Anleder. »Wo hast du den beschlagnahmt?«
»Da, wo du zocken gehst!«, giftete Rheinstahl zurück.
»Wow, Bruno, du gehst heute aber ran. Gut gekontert! Das mit Fran scheint dich echt zu wurmen, was?« Er loggte sich aus dem System aus und erhob sich von seinem Bürostuhl. »Dann geh ich mal bei den anderen kassieren.« Er drehte sich an der Tür noch mal um. »Ich wusste, dass sie springt. Sie hatte keine Wahl. Du bist zu emotional, Bruno, und zu naiv. Denk mal drüber nach. Das sage ich nicht als Psychologe, sondern als Freund.«
»Hey, Anleder!«, rief Rheinstahl. »Jetzt mach mal halblang. Wir sind keine Freunde, ist das klar?«
Anleder winkte und verzog sich.
Bruno drehte sich zum Fenster und legte die Stirn in Falten. »Wie soll ich das nur ertragen?«, murmelte er.
3. Samstag
Friedel Frenzen mochte seinen Namen. Auf der Arbeit sagte sein Chef immer: »Mensch, klasse, das kannst du ja wie aus dem Effeff!« Dann machte ihm das Herumschleppen der Getränkekisten noch mehr Spaß, und er blieb immer gerne eine halbe Stunde länger. Am Samstag arbeiten war auch kein Problem, Kinder hatte er keine und eine Frau auch nicht. Aber heute, da würde er pünktlich nach Hause gehen, denn er hatte eine Karte für das Spiel Leverkusen gegen Köln, ein Knaller!
Er zog seinen blauen Overall aus, den er mit Stolz trug, denn sein Name war darauf gestickt und seine Position: Friedel Frenzen, Servicemitarbeiter, Getränkedienst Durst. Sein Chef sagte immer, wenn er Hungrig heißen würde, dann hätte er ein Restaurant aufgemacht. Alle lachten dann, denn wenn der Chef Witze machte, dann musste man ja lachen, auch wenn man den Witz schon kannte.
Friedel Frenzen hängte den Overall in seinen Spind, der mit Bildern von jungen nackten Frauen ausgekleidet war. Dieselben Bilder hatte er auch zu Hause. Die Zeitschriften, in denen sie abgedruckt worden waren, hatte er zweimal gekauft. Friedel nahm die Obstdose heraus: ein Plastikbehälter, der gekrümmt war wie eine Banane, damit eben diese hineinpasste, und verschloss seinen Spind sorgfältig.
Wie immer nach seiner Schicht ging er im Büro vorbei, um sich bei seinem Chef abzumelden. An diesem Nachmittag geschah etwas Besonderes: Der Chef steckte Friedel einen Fünfziger zu.
»Loben ist gut, aber ein kleiner Bonus ist auch nicht schlecht, oder?«, sagte sein Chef und grinste.
Da konnte Friedel nichts gegen sagen, er bedankte sich und machte sich auf den Weg nach Hause. Er musste sich umziehen, die Tröte holen und vorher noch ein oder zwei Bier zischen, damit er in die richtige Stimmung kam.
Morgen würde er den Tag am Rhein verbringen, alleine mit seiner Angel und dem großen Strom, der ihn beruhigte und ihm zugleich Träume bescherte: von einer Reise mit dem Schiff um die ganze Welt. Niemand würde ihn vermissen, wenn er einfach anheuerte und aus Düsseldorf verschwand. Oft hatte er mit dem Gedanken gespielt, auf einem der Frachter anzufangen. Einmal war er sogar nach Hamburg gefahren, hatte in einer Reederei vorgesprochen, und man hatte ihm sofort eine Stelle auf einem riesigen Containerschiff angeboten, obwohl er gar keine Ausbildung als Matrose hatte. Aber dann hatte er eine unerklärliche Angst bekommen und einen Rückzieher gemacht.
Mit der S-Bahn fuhr er bis zum Hellweg, nahm dort den Bus, stieg eine Station früher aus und lief den Rest der Strecke. Nach ein paar Minuten bog er in die Märkische Straße ein, durchschritt das Tor zum Innenhof, in dem seine Zwei-Zimmer-Wohnung lag. Im Hof stand ein schwarzer Kombi, ein A8, den er auch gerne besessen hätte. Der Wagen gehörte niemandem im Haus, Friedel kannte seine Nachbarn und deren Autos. Wahrscheinlich Besuch. Er wählte den Weg rechts am Audi vorbei, ein freundlich lächelnder Mann trat aus dem Schatten, kam auf ihn zu, hob die Hand. Friedel spürte einen Stich im Arm, ihm wurde schwindelig, sein letzter Gedanke war, dass sich ein Herzinfarkt so anfühlen musste.
Friedel versuchte, seinen rechten Arm zu bewegen, und im selben Moment wurden ihm zwei Dinge bewusst: Er lebte, und sie hatten ihm den Arm festgebunden. Aber nicht nur den rechten. Der linke ließ sich auch nicht bewegen. Seine Beine auch nicht. Er war von oben bis unten gefesselt. Selbst der Kopf war festgeschnallt. Er spürte, dass er nackt war. Er öffnete die Augen. Das war nicht das Krankenhaus. Er hörte ein Plätschern, und Hitze stieg ihm ins Gesicht, als er merkte, dass es sein eigener Urin war, der das Geräusch verursachte. Panik ballte sich in seinem Bauch zu einer heißen Kugel, die den Hals hinaufstieg und in seiner Kehle explodieren wollte, aber er brachte keinen Laut hervor, und nur ein Gedanke beherrschte sein gesamtes Ich: »Du bist so gut wie tot.«
4. Montag
Fran warf ihre schwarze Lieblingslederjacke über den Stuhl. Endlich wieder arbeiten. Das Wochenende hatte sich in die Länge gezogen, außer ihrem Sprung hatte sich nichts Besonderes ereignet. »Na, Bruno? Alles klar? Tun dir die hundert Euro leid?« Sie stach Bruno Rheinstahl mit dem Zeigefinger in die Rippen, aber der zuckte nicht mit der Wimper.
»Ich bin nicht kitzelig, das solltest du wissen.«
Er drehte sich um, sie lächelte ihn an und drückte ihn so, wie sie ihren Vater gedrückt hätte, wenn er das zugelassen hätte: mit dem ganzen Körper. Bruno strich ihr mit der Hand über den Kopf, so wie man einer Tochter über den Kopf streichen sollte.
Er wusste, wie das ging, schließlich hatte er zwei Töchter großgezogen, und beide waren gut geraten, hatten ihren eigenen Weg gefunden. Fran kannte und mochte beide, auch wenn die Lebensentwürfe doch sehr unterschiedlich waren. Brunos Töchter waren verheiratet, hatten jeweils zwei Kinder. Immerhin hatten sie ihre Arbeit nicht der Familie geopfert.
Als Fran zehn gewesen war, hatte ihr Dad Bruno bei einem Einsatz kennengelernt. Es war die erste Leiche für die beiden gewesen. James Miller, frisch gebackener Polizeiobermeister, so hatte es damals noch geheißen, hatte sie gefunden. Ihr Dad hatte den Ersten Angriff gemacht, den Tatort gesichert, die Gaffer verscheucht und dafür gesorgt, dass nicht unnötig Spuren zerstört wurden. Gute Arbeit, nicht selbstverständlich für die Achtziger des zwanzigsten Jahrhunderts.
Aber irgendwann war Dad stehen geblieben. Irgendwann hatte er beschlossen, nur zu glauben, was er sah: ein krasser Widerspruch zu seiner fanatischen Frömmelei. Zu allem tischte er irgendein Bibelzitat auf, er rannte, wenn es irgend ging, jeden Tag einmal in die Kirche und klagte bei jeder Gelegenheit über den Verfall der christlichen Werte und Sitten. Irgendwann war er ein engstirniger Bulle in Uniform geworden, der nicht mehr wollte, als eine kleine Dienststelle zu leiten, sich mit Hausfriedensbruch, randalierenden Besoffenen und Pennern rumzuschlagen.
»Du treibst mich noch in den Wahnsinn, mit deiner verrückten Springerei von Brücken und Gebäuden, von allem, was höher als dreißig Meter ist. Bis jetzt war es ja noch relativ sicher. Aber von dieser Brücke sind schon vier Base-Jumper in den Tod gesprungen. Profis!«
»Sie ist noch fünf Meter höher als der Rekord.«
Bruno schnaubte. »Du hast eine halbe Sekunde, um den Fallschirm auszulösen.« Er hob die Stimme und stach mit dem Zeigefinger in die Luft wie ein altmodischer Schullehrer, der zu einer Gardinenpredigt ansetzt. »Eine halbe Sekunde!«
Fran musste lächeln. »Es ist eine ganze Sekunde. Genau genommen eine Sekunde und drei Zehntel mit meinem Schirm. Eine ganze Sekunde ist eine halbe Ewigkeit. Und wenn ich beim Absprung schön nach oben federe, habe ich eine Sekunde extra, also zwei Ewigkeiten.«
Aber Bruno ließ sich nicht überzeugen. »Eines Tages wirst du diese Ewigkeiten verpassen, und nichts wird von dir bleiben als ein hässlicher Fleck auf dem Asphalt.«
»Diese Brücke ist ein Muss für jeden Base-Jumper, der etwas auf sich hält, der mehr ist als ein Wochenend-Adrenalinjunkie. Du müsstest doch wissen, dass ich tue, was ich sage.« Sie warf die Arme hoch. »Warum glaubst du mir nicht, wenn ich dir sage, dass ich springe? Ich dachte, du kennst mich besser als ich mich selber kenne. Zumindest behauptest du das immer.« Bruno wollte sich verteidigen, aber Fran ließ ihn nicht zu Wort kommen. »Warum glaubt mir hier nur unser verrückter Psychologe?« Fran stieß ihren Zeigefinger auf sein Brustbein. »Weil du genauso bist wie alle anderen. Was du nicht wahrhaben willst, ignorierst du! Und überhaupt: Eines Tages wird so oder so nichts von mir geblieben sein als Staub, so wie von dir auch.«
Bruno schnaubte. »Jetzt wird sie auch noch philosophisch. Na, dann können wir ja gleich alle von der Brücke springen.« Er nahm sie bei den Schultern, hielt sie ein Stück von sich weg. »Wenn du meine Tochter wärst …«
Sie machte sich los. »Dann hätten wir ständig Krach miteinander. Gut, dass wir nur zusammen arbeiten.«
Fran wünschte sich, ihr Vater wäre eine Mischung aus beidem gewesen: der kalten Distanz ihres Erzeugers James und der erdrückenden väterlichen Zuneigung ihres Freundes Bruno, die ihr manchmal ernsthaft auf die Nerven ging. Irgendwo dazwischen lag der Raum, den man brauchte, um sich frei entfalten zu können.
Kopfschmerzen flammten auf. Ursache war der gehörige Kater vom Springen. Das Adrenalin ist weg, das Endorphin ist weg, der Kick ist weg, der Körper fordert seinen Tribut. Ein Gebot hatte sie sich zu eigen gemacht und befolgte es ohne Ausnahme: keine Kopfschmerztabletten. Wenn sie damit beginnen würde, war es nur eine Frage der Zeit, bis sie eine echte Sucht entwickeln würde. Wieder pochte der Schmerz durch ihren Kopf, ein wenig heftiger.
Aber es war einfach unglaublich gewesen. Sie hatte tatsächlich eine halbe Sekunde gezögert, die Landung war hart gewesen, aber sie hatte sich noch nicht einmal den Fuß verstaucht. Allerdings hatte sie Jean-Claude, der Teamleiter des französischen Base-Jumping-Clubs, nach allen Regeln der Kunst zusammengefaltet und ihr gedroht, sie nicht mehr springen zu lassen, wenn sie sich nicht an die Base-Jumping-Regeln hielt, und die wichtigste war: Sicherheit zuerst! Dass sie das nicht interessierte, dass für sie Sicherheit eine Illusion war, das mussten weder Jean-Claude noch Bruno wissen.
Von der Tür her mischte sich Günther Anleder ein. »Na, ihr beiden? Fertig mit der Familienkonferenz?«
»Wir haben alles geklärt, nicht wahr, Bruno?«, sagte Fran, zielte mit Daumen und Zeigefinger auf Anleder und drückte ab.
»Gar nichts haben wir geklärt, und dich geht das sowieso nichts an, Günther«, giftete Bruno.
Fran seufzte und drehte sich Anleder zu. »Wenn ich Bruno erzähle, was ich am nächsten Wochenende vorhabe, dann verpasst er mir Hausarrest, das steht fest.«
Anleder machte einen Schritt in den Raum hinein und zeigte auf Bruno. »Entschuldige, aber als Seelendoktor des Teams geht mich alles etwas an.«
Fran holte tief Luft, aber sie kam nicht dazu, Günther zum hundertsten Mal klarzumachen, dass er nicht der Haustherapeut war, sondern – so wie sie – psychologischer Profiler. Günther hatte sich allerdings auf Krankheitsbilder spezialisiert und sie auf religiöse Sekten, aktuell mit dem Schwerpunkt Okkultismus und Satanismus.
»Gibt es eigentlich Leute, die hier auch mal was arbeiten?« Sabine Fellmis, die Leiterin der Abteilung Operative Fallanalyse und Frans Vorgesetzte, klopfte mit der Faust an den Türrahmen.
Erstaunlich, dass Fran sie überhaupt erkannte, so selten ließ sie sich in der Abteilung blicken, die sie eigentlich leiten sollte. Und heute Morgen sah sie noch dazu richtig schlecht aus, so, als hätte sie das ganze Wochenende durchgezecht.
Günther verzog sich mit wichtiger Miene, Bruno ließ sich auf seinen Stuhl fallen, und Fran nutzte die Gelegenheit, um ihre Chefin um mehr Geld anzubetteln, obwohl sie wusste, dass es sinnlos war.
Sie sollte forschen, sollte Ergebnisse bringen, aber Forschung kostete viel Zeit, viel Material, also viel Geld. Und das gab es nur für die Bereiche, mit denen die Arbeit der Kollegen von der Kripo und der Schupo sofortige Erfolge erzielen konnten. Erfolge, die gut waren für die Presse und die Statistik.
»Ich würde ja gerne …«, begann Fran und spitzte die Lippen.
Fellmis winkte ab. »Sie wollen mehr Geld. Ich weiß, und ich sage Ihnen, was ich Ihnen auch morgen, in einer Woche und in einem Jahr sagen werde: Sie bekommen nicht mehr. Seien Sie froh, dass ich Ihre seltsame Studie über die Teufelsbraten, die eigentlich niemand braucht, überhaupt finanziere. Satanisten sind kein Thema. Die bringen niemanden um. Sie müssen schauen, wie Sie mit dem Etat klarkommen. Erfinden Sie was. Ein Uniprojekt, was auch immer. Wenn es um Ihre suizidalen Tendenzen geht, sind Sie jedenfalls äußerst kreativ. Sie wissen ja, dass Sie keinen Cent kriegen, wenn Sie sich in den Rollstuhl springen. Sonst noch was?«
Fran wurde wütend. Was bildete sich diese Tussi eigentlich ein? Ja, da war noch was. Ich kündige! Aber diesen Gedanken sprach sie nicht aus, denn sie wusste genau, dass sie auch dann nicht kündigen würde, wenn man ihr den Etat komplett streichen würde. Dann würde sie ihr eigenes Geld für die Studie einsetzen, ihre Freizeit und die Freizeit ihrer Freunde. Eine verdammte Falle. Sie war ein Junkie auf der ganzen Linie, und Fellmis wusste das.
»Ja, natürlich, Chef, war ja auch nur so ein Gedanke.« Mehr fiel Fran nicht ein.
Fellmis drehte sich auf dem Absatz um und marschierte davon.
»Ich glaube, du brauchst mal einen Nachhilfekurs in Verhandlungstechnik. Du musst mehr rangehen. Fellmis unter Druck setzen.«
Fran fuhr zu Bruno herum, wollte ihm so richtig die Meinung sagen, aber er war der Falsche, um Dampf abzulassen. Was sie brauchte, war ein Satanist mit klarem Kopf, der ihr einen sauberen Ritualmord lieferte. Dann würde das Geld nur so fließen, und sie würde eine eigene Abteilung bekommen, und die Fellmis würde grün werden vor Neid.
Aber diese dämlichen Satanisten waren alles andere als satanisch und noch weniger mörderisch. Alles, was bisher unter rituellen Morden in den Medien ausgeschlachtet worden war, hatte nichts mit echtem Satanismus zu tun. Das waren durchgeknallte Psychopathen gewesen, nichts weiter. Ein echter ritueller Mord war in der deutschen Polizeigeschichte zumindest seit dem Zweiten Weltkrieg nicht bekannt.
»Du bist auch nicht gerade feinfühlig. Oder findest du richtig, was die Fellmis mit mir anstellt?«
Bruno hob abwehrend die Hände. »Nein, und das weißt du. Aber mit Schmollmund erreichst du gar nichts bei ihr. Du musst ihr was bieten, Herrgott, das weißt du doch alles!«
Ja, sie wusste es, und sie schaffte es nie, sich gegen Fellmis durchzusetzen. Wortlos ließ sich Fran auf ihrem Stuhl nieder, startete ihren Rechner, loggte sich ein und ging die aktuellen Leichenermittlungen durch. Immerhin hatte sie Zugang zu Datenbanken wie ViCLAS, TECS, sogar zur FBI-Datenbank ViCAP, in der die Profile von Tätern und Gewaltverbrechen weltweit gespeichert waren; das wenigstens hatte sie Fellmis zu verdanken. Alle Ermittlungsakten, die mit Mord und Totschlag, Vergewaltigung und Körperverletzung zu tun hatten, standen ihr offen, sie durfte bei jeder Obduktion dabei sein, wenn sie es wünschte. Innerhalb des Apparates hatte sie große Freiheiten. Was sie nicht hatte, war eine Dienstwaffe und eine Hundemarke.
Nach ihrem Psychologiestudium hatte sie drei Jahre an der Hochschule für Verwaltung den Polizeidienst von der Pike auf gelernt, war schnell zur Polizeioberkommissarin befördert worden und hatte sich mit eiserner Disziplin und endlosem Fleiß den Kriminalkommissar erkämpft. Bevor sie als Ermittlerin Karriere machen konnte, hatte das LKA sie rekrutiert, vor allem weil sie sich in der Sektenszene auskannte. Es hatte lange gedauert, bis sie sich an den Status einer Zivilistin gewöhnt hatte und nicht mehr alles und jeden beobachtete und auf eine mögliche Straftat hin abklopfte. Diese Jahre im Polizeidienst waren eine harte Geduldsprobe gewesen, ihr war alles zu langsam gegangen, zu viele Regeln hatten tagtäglich ihre Nerven strapaziert. Und dann war da noch ihr Partner gewesen: ein dicker Phlegmatiker, kurz vor der Verrentung, der lieber am Computer saß als auf der Straße für Ordnung zu sorgen. Aber es war auch eine Zeit der Abenteuer gewesen und eine hervorragende Ergänzung zu ihrem Studium, eine unbezahlbare Schulung in Menschenkenntnis. In neun von zehn Fällen konnte sie alleine am Gang einer Person festmachen, wie diese sich fühlte.
Fran öffnete die Textdatei »Studie über gewalttätiges Verhalten von Mitgliedern der satanischen Szene Deutschlands« und stellte fest, dass der Titel alleine schon furchteinflößend langweilig war. Niemand interessierte sich für so etwas. Vielleicht sollte sie einen anderen Titel wählen. »Satanisten – die rituellen Schlächter Deutschlands?« Das klang gar nicht schlecht. Oder: »Blut auf dem Altar Satans. Warum in Deutschland rituell gemordet wird.« Oder auch nicht, dachte sie, tippte die Titel ein und machte sich einen Vermerk, die Zeilen wieder zu löschen, bevor sie die Arbeit an Fellmis weiterreichte. Bis dahin würde es noch gut zwei Jahre dauern, bei dem Tempo, mit dem sie vorankam. Und dann konnte sie von vorne anfangen, weil die Daten veraltet waren oder irgendein Ereignis alles auf den Kopf gestellt hatte. Die Szene veränderte sich schnell, Sekten verschwanden, andere tauchten auf; es waren mehr als zweihundert, die polizeilich bekannt waren. Manche hatten nur wenige Mitglieder, andere agierten international.
Ihr Telefon begann hektisch zu blinken. Eine Hamburger Nummer. Sie zuckte mit den Achseln, hob ab und sagte: »Ja?«
Eine warme Männerstimme meldete sich, und Fran fiel ein, dass sie schon lange keinen Mann mehr auf eine andere Art berührt hatte als Bruno. »Kriminalhauptkommissar Albert Neusen, KK 1, Hamburg. Spreche ich mit der Kollegin Franziska Miller?«
Neusen klang nicht nur freundlich, er schien auch bester Laune zu sein. Und er sprach sie als Kollegin an, das gefiel ihr.
»Richtig, Kollege Neusen. Wie kann ich Ihnen helfen?«
»Indem wir zuerst mal die förmliche Anrede weglassen. Okay?«
Dieser Albert Neusen war nach Frans Geschmack. »Klar, kein Problem. Nenn mich Fran.«
»Gut. Ich bin Albi.«
Fran unterdrückte ein Lachen. Ob Albi so aussah, wie er hieß? Unter Albi konnte sie sich nur ein spitzmausartiges Gesicht mit weißem Haar vorstellen, aber die Stimme passte einfach nicht.
»Was kann ich für dich tun, Albi?«
Sie klemmte den Hörer zwischen Ohr und Schulter ein und tippte seinen Namen lautlos in Google ein, Bildersuche. Die Suchmaschine brauchte keine hundertstel Sekunde. Fran bestaunte das Bild. Albi war Anfang dreißig, hatte eine leicht gegelte Igelfrisur, die ihm etwas Spitzbübisches verlieh, einen sinnlichen Mund und braune harmlose Rehaugen. Ein Mädchenschwarm.
»Ich glaube, ich habe etwas sehr Interessantes für dich. Du bist doch die Teufelsbraut, die sich mit Satan auskennt? So jemanden wie dich haben wir hier in Hamburg nicht.«
»Das spricht nicht gerade für Hamburg.«
Albi kicherte. »Wir haben genug ›Leibhaftige‹, aber die kommen nicht aus der Hölle, sondern sind leider ganz reale Menschen.«
»Na gut. Bei mir bist du jedenfalls richtig, wenn du eine Teufelsaustreibung brauchst.«
»Ich fürchte, meinem Klienten ist genau das geschehen. Allerdings hat ihn das wahrscheinlich seine Seele und mit Sicherheit sein Leben gekostet.«
*
Es ist genau dieser Moment, den ich liebe: der Moment, bevor der erste Blitz durch die Wolken fährt, der erste Donner durch die Stadt rollt, der die Mauern in Schwingungen versetzt. Natürlich sind die großen Blitze, die nur ein paar Hundert Meter entfernt einschlagen, eine Klasse für sich, mit ihrem Getöse, das in den Ohren wehtut, das die Scheiben zum Klirren bringt. Aber es geht nichts über den ersten Blitz und den ersten Donner – das ist der Moment, der mir eine Sekunde der Ruhe gibt, eine Sekunde, in der ich mich lebendig fühle. Aber der Moment ist so schnell wieder vorüber, dass ich ihn nicht festhalten kann, so schnell, dass mir nach ein paar Stunden die Erinnerung daran verloren geht und ich wieder zurücksinke in mein tägliches Leiden. Also muss ich dafür sorgen, dass ich etwas bekomme, das der heilenden Energie eines Gewitters gleichkommt.
Ich betrachte den Mann, der vor mir auf dem Thron festgeschnallt liegt, und sehe die Panik in seinen Augen. Ich trage eine Clownsmaske, er darf mein Gesicht nicht sehen, noch nicht. Dieser einfache Geist, der den Namen Friedel Frenzen trägt, wird glauben, er sei in der Hölle. Und letztlich trifft das absolut zu. Wie ein Tier spürt er, dass er verloren ist. Seine Fantasie beginnt zu arbeiten, ich sehe es in seinen Augen; das ist nicht immer so, manche Seelen verhüllen sich, versuchen zu leugnen, dass sie in der Gewalt des unaussprechlichen Bösen gefangen sind. Aber Friedel weiß, was ihn erwartet. Nicht jedes Detail, aber er spürt, dass sein Leben bald zu Ende sein wird. Und er fürchtet zu Recht, dass es bis dahin ein langer Weg sein wird. Was er nicht weiß: Sein Name wird noch in Jahrhunderten genannt werden, in einem gehauchten Atemzug mit seinem Henker, mit mir, der ebenbürtig eingereiht sein wird in die Galerie der genialen Menschen, die etwas gewagt haben, die etwas vollbracht haben, das noch niemand vor ihnen gewagt hat. Ich werde so berühmt sein wie Kolumbus, Pizarro, Einstein, Hitler oder Reinhold Messner. Friedel Frenzen ist Teil meines genialen Plans geworden, ich werde ihn unsterblich machen, seine armselige Existenz wird er zugunsten eines höheren Zieles, zugunsten höherer Weihen aufgeben.
Ich werde ihn mit seinem Vornamen ansprechen. Nicht um ihn zu demütigen, sondern um ihm Respekt zu zollen, um ihm nahe zu sein. Friedel ist ein seltenes Exemplar. Von Gestalt ist er geradezu mickrig, aber seine Stimme ist ein volltönender Bass, der eher dem Brustkorb eines Opernstars von beachtlicher Leibesfülle zugetraut werden müsste, aber nicht Friedel, der mit Müh und Not fünfundsechzig Kilo auf die Waage bringt und gerade mal einen Meter und zweiundsechzig Zentimeter misst. Trotzdem ist er kerngesund, seine Krankenakte hat keinen einzigen Eintrag, er ist durchtrainiert, das liegt an seinem Beruf. Niemand wird ihn vermissen. Sein Arbeitgeber wird am Montag einen Brief erhalten, in dem Friedel seine fristlose Kündigung ausspricht, voll Bedauern, aber Friedel wird seinem Chef mitteilen müssen, dass bei ihm eine schwere Krankheit diagnostiziert wurde und er die letzten Monate seines Lebens in der Karibik verbringen wird. Und er wird sich dafür entschuldigen, dass er nicht früher Bescheid gesagt hat und einfach so verschwindet. Er wird seinen Chef um Verständnis bitten, und sein Chef wird traurig mit dem Kopf nicken und vor sich hin brummeln, das Leben sei doch wirklich ein Schwein, und er wird nicht wissen, dass das Leben viel schlimmer ist als ein Schwein, es ist ungerecht und mörderisch und voller Schmerzen, vor allem für Friedel.
So kann ich in aller Ruhe mit meinem neuen Gast arbeiten und ihn zu Höchstleistungen anspornen. Ich betrachte mein Besteck: Die Elektroden. Die Nadel. Die Rippenschere. Gutes Werkzeug!
*
Fran tippte ihren Benutzernamen und ihr Passwort ein, drückte die Entertaste und starrte, wie alle anderen im Raum, auf den überdimensionalen Bildschirm. Nach ein paar Sekunden flimmerte es, dann erschien das Gesicht von Albert Neusen, der breit lächelte und sofort zu sprechen begann. Fran hatte ihn dem Team bereits angekündigt.
»Könnt ihr mich hören?«
Fran nickte, grinste und fragte: »Kannst du mich auch hören?«
»Laut und deutlich, und sehen kann ich dich ebenfalls.«
Fran nahm die Webcam, die vor ihr stand, und schwenkte sie durch den Raum.
»Das sind meine Kolleginnen und Kollegen. Ich stelle sie dir im Schnelldurchgang vor, mal sehen, was du behalten kannst.«
»Das hier ist Bruno Rheinstahl, unser Knochenmann. Er ist ein Multitalent, vereint den Mediziner, den Anthropologen und den forensischen Biologen in einer Person.«
Neusen pfiff anerkennend durch die Zähne.
»Das liegt vor allem daran, dass wir nicht mehr Personal bezahlen können«, sagte Fran und drehte die Kamera ein wenig.
»Christine Austerlitz. Fallanalytikerin, Spezialgebiet Statistik. Gib ihr eine Zahl, und sie macht ein Universum daraus. Ganz nebenbei macht sie noch die Aktenführung.«
Fran machte zwei Schritte und hielt die Kamera Anleder vor die Nase.
»Ohne Psycho-Onkel kommen wir hier auch nicht aus. Günther Anleder. Er versucht ständig, aus diesem Haufen ein Team zu schmieden, und glaub mir, er hat den sichersten Job von uns allen.«
Leises Lachen lief um den Tisch.
»Im Ernst, er ist ein Guter. Ihn einfach nur ›Psychologe‹ zu nennen wäre zu kurz gegriffen. Ich weiß nicht, wie viele Fort- und Weiterbildungen er schon hinter sich gebracht hat.«
Fran ging um den Tisch herum.
»Diese junge Frau hier heißt Martina Schwartz, ist Programmiererin und geografische Fallanalytikerin. Sie arbeitet an erweiterten Algorithmen für die Eingrenzung und Einordnung von Täterräumen. Sie ist ein medizinisches Wunder und ein lebendes Klischee zugleich, denn sie ernährt sich ausschließlich von Kaffee und Donuts.«
Fran setzte sich, stellte die Webcam vor sich ab.
»Unsere Chefin ist nicht da, die ist auf irgendeiner Konferenz, wo darüber sinniert wird, wie man mehr Geld einsparen kann. Jetzt kennst du das Team. Was können wir für dich tun?«
Neusen nickte bedächtig mit dem Kopf. »Ich will ja nicht schleimen, aber das ist jede Menge Kompetenz. Beeindruckend.«
Fran schwenkte noch mal die Kamera, damit Neusen sehen konnte, dass ihr Team Selbstbewusstsein besaß.
»Ich will ja auch nicht schleimen, aber das hast du gut erkannt.«
Neusen lachte, musste husten, räusperte sich und nahm einen Schluck Wasser.
»Okay, ich habe verstanden. Dann bin ich mal gespannt, was ihr hierzu sagt.«
Sein Gesicht verschwand, einen Moment blieb der Bildschirm dunkel, dann füllte ihn ein bizarres Linienmuster aus. Es schien das Bild eines Künstlers zu sein, der die Realität verlassen und sich ganz in die Abstraktion begeben hatte. Aber die Linien waren nicht mit einem Pinsel auf Leinwand aufgetragen, sondern mit einem scharfen Gegenstand in die Haut eines Menschen eingeritzt worden.
Fran erkannte sofort, warum Neusen sich an sie gewandt hatte. So irre die Linien schienen, es gab doch ein Muster darin. Ihr Puls beschleunigte sich. Das war die Chance, endlich mehr Beachtung und damit mehr Geld für ihre Arbeit zu bekommen. Sie brauchte nur zu sagen, dass es sich bei den Schnitten möglicherweise, mit Betonung auf möglicherweise, um satanische Symbole handelte. Sie verschob die Entscheidung.
»Also Kollegen, was sehen wir hier?«
Bruno meldete sich, Fran nickte ihm zu.
»Kollege Neusen, sind die Verletzungen postmortal zugefügt worden?«
Aus dem Nichts antwortete Neusen mit einem kurzen »Ja«, das sich anhörte, als hätte er die Frage erwartet.
Bruno fuhr fort. »Sie sind unterschiedlich tief, unterschiedlich lang, aber alle haben perfekt glatte Wundränder. Ein scharfes Tatwerkzeug. Ein Rasiermesser, ein Skalpell, ein sehr gut geschliffenes Opinel oder Ähnliches. Ein Ausbeinmesser kommt natürlich auch infrage, ebenso wie ein Teppichmesser oder ein Papiercutter. Eben alles, was richtig scharf ist, aber keine lange Klinge hat. Eine Hiebwaffe wie Machete, Schwert oder so würde ich erst mal ausschließen. Wie immer: Um Genaues sagen zu können, müsste ich den Bericht der Gerichtsmedizin haben oder die Leiche auf dem Tisch. Ach ja, es ist eine Frau.«
Fran blickte in die Runde. Alle begutachteten die Verletzungen, dachten nach oder ließen ihren Assoziationen freien Lauf. Sie merkte, dass Günther etwas auf dem Herzen hatte, und zeigte auf ihn.
Er hob den Kopf, rieb sich das Kinn. »Also erst mal würde ich gerne klären, was wir hier machen, Fran. Du hast uns nur erzählt, dass Kollege Neusen unsere Hilfe braucht. Als Nächstes sehen wir diese Verletzungen. Wir wissen nichts über die Tatumstände, das Opfer und so weiter. Kollege Neusen, würdest du uns einweihen?«
Aus dem Off meldete sich Neusen sofort. »Ich wäre euch sehr dankbar, wenn ihr ganz spontan eure Eindrücke formulieren würdet, so wie der Kollege Rheinstahl das getan hat. Der Fall ist sehr komplex, sehr unübersichtlich, die Zeit ist knapp, die MOKO ist verunsichert, wir wissen nicht, in welche Richtung wir verstärkt weiterermitteln sollen.«
»Okay«, sagte Günther und zog die Nase hoch. »Alles klar. Kein Zweifel: Wut! Abgrundtiefe Wut. Auf sich selbst oder das Opfer. Der Täter oder die Täterin wollte das Opfer bestrafen, auch nach dessen Tod. Übertötung. Blutrausch. Da ist was aus dem Ruder gelaufen. Und auch für mich gilt: Die Lottozahlen sind wie immer ohne Gewähr.«
Fran wollte von allen eine Meinung hören, denn das war die Grundlage der Operativen Fallanalyse: Das Problem von möglichst vielen Seiten beleuchten, betrachten, bewerten und einordnen, herausfinden, warum sich der Täter zu was entschieden hat, tagelang die Akten wälzen, alles in Tausende Schnipsel zerlegen, dann wieder zusammenpuzzlen und wirklich allen Thesen nachgehen, so abstrus sie erscheinen mochten.
Sie deutete auf Christine, die heute in einem uringelben Kostüm zur Arbeit gekommen war, zu dem sie plumpe Gesundheitsschuhe trug. Fran hatte einige Zeit gebraucht, um den Modegeschmack von Christine und ihre Fähigkeiten nicht gleichzusetzen. Sie war vor vier Wochen achtunddreißig geworden, ähnelte vom Gesicht her Kate Winslet.
»Ich kann mich Günther nur anschließen. Purer Hass. Tödliche Wut. Allerdings kann ich mir auch vorstellen, dass der Täter, und ich bin mir sicher, es war ein Mann, dass also der Täter auch aus Frustration über ein persönliches Versagen, ein Unglück oder Ähnliches die Tat begangen hat. Anfangsthesen eben.« Sie zuckte mit den Achseln. »Wir haben keinerlei vernünftige Datenbasis.«
Martina Schwartz seufzte. »Ich sehe keine anderen Ansätze. Und was meinst du, Fran?«
Fran wandte sich dem Bild zu. Der Form des Rückens nach zu urteilen, war das Opfer eine Frau, wie Bruno bereits erkannt hatte. Die Schnitte verliefen vom Halsansatz bis zum Steißbein. Der längste maß ungefähr zehn bis zwölf Zentimeter, der kürzeste ein bis zwei. Diese Schnitte waren durch eine Bewegung entstanden, bei der das Tatwerkzeug mit großer Geschwindigkeit über die Haut gezogen worden war. Deswegen Günthers Annahme, es sei in rasender Wut geschehen. Der Rücken des Messers lief dabei zwischen Daumen und Zeigefinger, die übrigen Finger stützten. Die Klinge drang nicht mit der Spitze in die Haut, sondern nur mit der Schneide. Es war schwierig, damit kontrolliert Muster in die Haut zu schneiden.
»Lieber Kollege Neusen«, sagte Fran. »Ich denke, ihr habt bei uns angefragt, weil ihr die Möglichkeit in Betracht zieht, dass es sich um rituelle Verstümmelungen handeln könnte.« Sie zögerte, stellte sich vor, wie es sein würde, wenn sie mit einem Schlag so etwas wie die Jordan Cavanaugh der deutschen Polizei wäre. Geld würde fließen, sie würde in Talk-Shows auftreten, auf der Straße würde man sie erkennen und nach Autogrammen fragen – eine beängstigende Vorstellung. Also entschied sie sich für die Wahrheit, auch wenn sie das vielleicht bereuen würde. »Ich halte das für äußerst unwahrscheinlich.«
Aus den Augenwinkeln sah Fran, dass sich ein feines Lächeln auf Brunos Gesicht ausbreitete.
»Mit viel Fantasie könnte ich ein Pentagramm erkennen oder ein Henkelkreuz«, fuhr sie fort, »aber das kann ich auch, wenn ich mir Wolken ansehe oder das achtlose Gekritzel auf einem Stück Papier. Ich stimme Günther zu. Purer Hass, der sich nach der Tötung darin äußert, dem Opfer weiter Schmerzen zufügen zu wollen, es zu entwerten, vollends zu vernichten – wie gesagt: Übertötung. Das heißt nicht, dass der Täter keinen satanischen Hintergrund haben kann. Ich kann nur kein rituelles Motiv in den Verletzungen erkennen, keine rituelle Ausprägung. Dafür sind die Muster nicht klar genug. Wie der Name schon sagt: Rituelle, also nach kultischem Brauch vollzogene Verstümmelungen, unterliegen klaren Gesetzen und Vorschriften, sonst sind sie unwirksam. Das hier war ein Gemetzel, ohne jede magische Wirkung.«
Günther meldete sich. »Und jetzt raus mit der Sprache, Kollege. War es das, was du wissen wolltest?«
Der geschundene Rücken verschwand, Neusens breites Grinsen füllte den Bildschirm wieder aus.
»So ist es. Wir haben einen Verdächtigen aus der satanischen Szene, der ein Motiv hat, kein Alibi, aber die Gelegenheit und ein entsprechendes Werkzeug. Es fehlen forensische Beweise. Kein Blut, keine DNA, nichts. Er beteuert seine Unschuld, und ich bin geneigt, ihm zu glauben, nachdem ich eure Theorien gehört habe.«
Fran winkte mit dem Zeigefinger. »Du solltest nicht zu voreilig schlussfolgern. Es kann sein, dass dein Satanist aus Wut gehandelt hat und er unbewusst einige seiner vertrauten Zeichen eingebaut hat. Wir haben viel zu wenig Material, um eine vernünftige Aussage zu treffen.« Fran überlegte einen Moment, rief sich die Linien ins Gedächtnis, die ein seelisch deformierter Mensch in den Rücken der Frau geschnitten hatte. Ein Pentagramm zwischen den Schulterblättern, ein umgedrehtes Kreuz oberhalb des Steißbeins vielleicht, vielleicht, vielleicht. Sie schüttelte den Kopf. »Aber wie gesagt, ich halte es für eher unwahrscheinlich.«
»Kann ich das schriftlich haben?«, fragte Neusen mit einem unschuldigen Gesicht.
Alle zuckten sichtbar zusammen.
»Das können wir nicht entscheiden«, sagte Fran und hielt den Atem an. »Da musst du mit unserem Chef reden. Und ich glaube nicht, dass Fellmis so eine Schnellschussexpertise freigibt. Was glaubst du, was los ist, wenn wir schiefliegen und es doch dein kleiner Teufelsanbeter war? Dann ist hier der echte Teufel los! Wenn du uns anforderst, sind wir zur Stelle.«
»Ups!«, sagte Neusen. »Logisch. Vergesst es. Ich nehme das auf meine Kappe und hoffe, dass wir richtigliegen. Vielen Dank auf jeden Fall, und wenn einer von euch mal nach Hamburg kommt, dann zeige ich euch gerne, dass es dort nicht nur die Reeperbahn gibt.«
Fran atmete wieder aus. »Das Angebot nehmen wir gerne an. Und halt uns auf dem Laufenden!«
Neusen winkte, dann verschwand sein Bild, die Verbindung war unterbrochen. Fran spürte etwas, das sie nicht einordnen konnte. Ein leichtes Ziehen in der Magengegend, kein Schmerz, nicht einmal unangenehm.
Sie schaute sich um. Niemand sagte etwas. Alle starrten auf das interaktive Whiteboard, auf dem noch vor einigen Minuten das Opfer eines furchtbaren Verbrechens zu sehen gewesen war, und Fran hatte das Gefühl, dass sich diese Bilder in die Oberfläche der Wand einbrennen müssten. Gleichzeitig war sie erleichtert, dass sie der Versuchung widerstanden hatte, das Opfer ein weiteres Mal zu missbrauchen, um ihre eigenen Interessen durchzusetzen. Ein Blick auf die Uhr sagte ihr, dass es Zeit war, in die Pause zu gehen.
Den Rest des Tages verbrachte sie damit, Fragebögen auszuwerten, das hieß: einhundertsiebenundsechzig Fragen – fast so viel wie bei einem Standardformular für die Serientäter-Datenbank ViCLAS – in den Rechner übertragen, für jeden einzelnen Bogen. Obwohl es technisch längst möglich war, solche Formulare automatisch einzuscannen, musste sie ungezählte Stunden vor dem Bildschirm verbringen. Das alte Problem. Kein Geld. Die Technik war teuer, die Geräte, die verfügbar waren, auf Monate ausgelastet, sie war vergleichsweise billig. Der einzige Trost war, dass erstaunlich viele Satanisten den Bogen zurückgeschickt und die Beantwortung sehr ernst genommen hatten. Aus ganz Deutschland lagen ihr insgesamt sechshundertdreiundsiebzig ausgefüllte Bögen vor. Damit hatte sie nicht im Traum gerechnet. Und das Beste: Fast zwei Drittel waren nicht anonym, also konnte sie davon ausgehen, dass die Angaben korrekt waren. Mit dieser hohen Anzahl war sie fast schon im Bereich einer repräsentativen Befragung, auch wenn Fellmis nur darüber lachte. Aber Fran war keine Studie bekannt, die auch nur annähernd eine so große Datenbasis vorweisen konnte wie die ihre. Oft stützten sich soziologische und religiöse Studien auf ein paar Dutzend Auskunftswilliger. Sie hatte die Konsequenzen daraus gezogen und war Monate kreuz und quer durch Deutschland gereist, hatte ihren Urlaub geopfert und eigenes Geld, denn der Etat für Dienstreisen war schneller erschöpft gewesen, als ein Eimer Wasser durch ein Sieb lief. Ihr fiel ein, dass sie nicht in Hamburg gewesen war. Landauf und landab hatte sie mit den unterschiedlichsten Gruppierungen gesprochen, hatte es geschafft, bei den allermeisten das Misstrauen zu zerstreuen, das viele den Behörden gegenüber zu Recht hegten: Die großen Kirchen bekämpften natürlich jede Form des Satanismus, die Polizei vor Ort war oft hilflos und kriminalisierte harmlose Jugendliche. Aber nicht alle waren harmlos und hatten eine weiße Weste. Vor einiger Zeit war eine neue Gruppierung aufgetaucht, die die Grenzen des Üblichen klar überschritt. Bisher hatte sie nur Phantome ausmachen können, und bis jetzt war außer schwerer Tierquälerei noch keine Straftat ans Licht gekommen. Aber in der Szene gab es Unruhe. Auf die Spur gekommen waren sie diesem satanischen Zirkel durch einen Zufall.
Ein fünfzehnjähriger Schüler aus München hatte mit seinem Handy Teile einer schwarzen Messe gefilmt. Personen waren nicht zu identifizieren, aber es war zu sehen, wie ein Huhn, eine Katze und ein Hund rituell von einer Person in Satanskostüm auf einem Stein, der eindeutig den Altar darstellte, geschlachtet wurden. Dem Huhn wurde der Kopf zertrümmert, der Katze die Kehle durchgeschnitten, und dem armen Hund wurden bei lebendigem Leibe die Därme herausgerissen, nachdem man ihm die Schnauze zugebunden hatte. Da hatte es der Amateurfilmer mit der Angst zu tun bekommen und war abgehauen. Ein paar Wochen später hatte er dann auf dem Schulhof mit dem Video angegeben, ein Lehrer hatte ihn erwischt und sofort die Polizei eingeschaltet. Der Tatort war natürlich längst von jeglichen verwertbaren Spuren befreit, die Presse hatte eine Schlagzeilenorgie veranstaltet, und seitdem hatte man nichts außer ein paar Gerüchten über die Gruppe gehört.
Die Sekte war vorsichtig, wollte keine Öffentlichkeit, wollte unter sich bleiben. Das waren keine spätpubertierenden Hobby-Satanisten, die ihren Gesellschaftsprotest auslebten, das waren Überzeugungstäter. Wie schmal war der Grat, auf dem sie sich bewegten? Was war nötig für die Eskalation, was musste in der Gruppe vorgehen, damit sie anstatt eines Tieres einen Menschen auf dem Altar schlachteten?
Ja, Fran wünschte sich mehr Geld und mehr Ansehen – aber nicht zu dem Preis eines ermordeten Menschen.
Sie erfasste noch zwei Bögen, dann sicherte sie die Daten, fuhr ihren Rechner herunter und verließ ihr Büro. Wie so oft war sie die Letzte.
Sie sprang auf ihr Fahrrad, fuhr hinüber zum Kirchplatz, ein Umweg, aber dort konnte sie die 712 abpassen, um sich mit ihr zu messen. Die Straßenbahn brauchte neun Minuten bis zur Hellriegelstraße, das machte eine Durchschnittsgeschwindigkeit von dreiundzwanzig Kilometern pro Stunde. Kein Problem für Fran, aber sie hatte sich zur Regel gemacht, die Verkehrsvorschriften zu beachten, und das hieß bei Rot stehen bleiben, auch wenn die 712 an ihr vorbeizog. An der Kreuzung Südring/Aachener Straße verlor sie zwei Minuten und musste an ihre Grenzen gehen, um wieder aufzuholen. Zeitgleich kam sie mit der 712 am Wendekreis Hellriegelstraße an, winkte dem Fahrer zu, der ebenfalls freundlich grüßte, und fuhr weiter bis zum Deich.
Sie trug das Fahrrad in den Keller, nahm bis in den dritten Stock zwei Stufen auf einmal, grüßte Frau Kowalaczek, die sich mit ihren Einkaufstüten die Treppe hochquälte, aber auf Hilfe verzichtete, weil sie abnehmen wollte.
Fran atmete ein paar Mal tief durch, kramte den Schlüssel aus ihrem Rucksack, wollte ihn gerade ins Schloss stecken, als sie stutzte. Sie beugte sich zum Schließzylinder hinunter: Kratzspuren, die heute Morgen noch nicht da gewesen waren. Sie schreckte hoch, schaute sich um, aber es gab nichts zu sehen. Vielleicht hatte sie heute Morgen am Schloss rumgefummelt und die Kratzer hinterlassen? Nein, sie war sich sicher, da war heute Morgen nichts gewesen. Nahm das denn kein Ende? Mit einer schnellen Bewegung schloss sie auf, huschte in den Flur und drückte die Tür wieder zu. Sie legte den Rucksack auf das geölte Birkenparkett und lauschte angestrengt. Nichts. Sie inspizierte alle Zimmer, aber niemand war hier. Du bist paranoid, dachte sie. Die Sache ist erledigt, vorbei, Geschichte.
Sie legte Mozarts Requiem in den CD-Player, drehte die Lautstärke auf, stellte sich zwanzig Minuten unter die Dusche, machte sich einen Salat, zum Nachtisch gönnte sie sich einen Fruchtjoghurt, sie musste auf ihre Figur achten, das Kantinenessen schlug unheimlich schnell an. Der letzte Akkord des Requiems verklang, Fran schaute auf die Uhr. Einundzwanzig Uhr zwölf. Es war schon wieder später geworden, als sie es gewollt hatte. Es begann zu dämmern, und mit dem schwindenden Licht verflog auch ihre gute Laune.
Würde sie anders leben, wenn hier jemand wäre, der sie erwartete? Sie musste kurz an Albert Neusen denken, ein wirklich sympathischer Kollege. Vielleicht sogar Kinder? Ihre Kinder und ein Mann, der nicht unbedingt der Erzeuger sein musste? Ein Ziehen fuhr ihr durch den Unterleib. Kinder? Um Gottes willen, nein. Das Ziehen wuchs sich zum Schmerz aus. »Verdammt«, flüsterte Fran. Nicht schon wieder, denk an etwas anderes, los, mach schon. Aber die Erinnerungen begannen sie mit Blut zu überschwemmen.
*
Ich muss mich beeilen. Der Stau hat mich viel Zeit gekostet. Friedel könnte wach werden, bevor ich bei ihm bin, und das möchte ich vermeiden. Obwohl ich das Mittel präzise dosiert habe, Körpergewicht, Alter und Konstitution berücksichtigt habe, weiß ich nie ganz genau, wann sie wieder aufwachen. Es gibt immer eine Grauzone, manchmal sind es zehn Minuten, einmal war es eine ganze Stunde, die mein Gast zu früh aufgewacht und fast wahnsinnig geworden war, ich habe einen ganzen Vormittag gebraucht, um ihn wieder hinzubekommen, damit er eine gute Leistung bringen konnte. Ich bin kein Anästhesiearzt und muss mich auf die Angaben meines Lieferanten verlassen, der mich bisher immer hervorragend beraten hat. Er ist zuverlässig und stellt keine Fragen. Zweifelsfrei hat er sich sein Geld redlich verdient. Und er ist sicher, da wir das Geschäft anonym abwickeln. Ich hinterlege in einem hohlen Stamm Geld, so wie früher, als wir noch Räuber und Gendarm gespielt haben, er nimmt das Geld und hinterlegt die Narkose- und Aufwachmittel. Die Mittel wirken hervorragend, bis jetzt ist mir noch keiner wegen der Betäubung abgegangen. Das wäre äußerst unangenehm, denn jeder Kandidat kostet viel Geld, Zeit und Energie, und meine Ressourcen sind nicht unbegrenzt.
Kristin stellt keine Fragen. Ich habe gesagt, ich bin wandern. Alles in allem bin ich wirklich ein Glückspilz. Kristin, meine Frau, und meine beiden Töchter Hella und Veronika lassen mir alle Freiheiten, die ich brauche. Sie haben ja auch keine Wahl, schließlich bin ich der Boss in der Familie und werde es immer sein. Die Starken müssen führen, die Schwachen gehorchen. Das ist sinnvoll.
Meinen Wagen lasse ich auf dem Parkplatz stehen, gut versteckt zwischen den anderen Spießerkisten, ich trage dieselbe Freizeituniform wie die anderen, niemand würde sich an mich erinnern. Bis zu meinem Refugium brauche ich bei mittlerem Jogging-Tempo etwa zwanzig Minuten. Wenn ich ankomme, bin ich schön warmgelaufen. Ich checke, ob jemand in der Nähe ist, dann entschärfe ich die Bombe an der Falltür und steige hinab in die real existierende Hölle. Ich schalte die Bombe wieder scharf und entschärfe die Zugangstür zum Flur, der Hebel quietscht, ich schmiere ihn sofort, das muss sein, ich kann Unordnung nicht ertragen, und eine quietschende Tür ist der Gipfel der Unordnung.
Danach gehe ich sofort ins Tonstudio, dritte Tür rechts; grüne, gelbe und rote LEDs leuchten oder blinken an den verschiedenen Geräten.
Hinter der Scheibe, die das Studio vom Aufnahmeraum schalldicht trennt, liegt Friedel und schläft. Sein Körper ist von einem leichten Schweißfilm bedeckt, das mag daran liegen, dass ich die Temperatur im Raum auf neunundzwanzig Grad eingestellt habe. Er darf mir auf keinen Fall unterkühlen. Ich bewundere seine Sehnen und Muskeln, vor allem die Bauchmuskulatur ist wichtig, denn damit presst er die Luft durch seine Stimmbänder. Der Beutel mit Kochsalz- und Nährflüssigkeit ist noch halb voll, das Herz schlägt ruhig, die Atemfrequenz ist normal, doch das wird sich bald ändern.
Mein Handy vibriert. Der Dienstleiter. Verdammte Scheiße! Ich gebe mir selbst eine Ohrfeige. »Du sollst nicht fluchen!«, sage ich streng. Es hilft nichts, ich muss ran, wieder sind ein paar krank geworden, der Personalplan steht kurz vor dem Kollaps. Ich sage, dass ich in einer Dreiviertelstunde da bin, betrachte das Handy, würde es am liebsten an die Wand werfen. Aber wenn ich Bereitschaft habe, muss ich erreichbar sein, deswegen habe ich mir einen Umsetzer für das Mobilnetz installiert, ansonsten hätte ich hier unten keinen Empfang, die meterstarken Betonwände schlucken alles.
Ich säubere Friedel, leere den Kotbehälter, dann verpasse ich ihm noch eine anständige Dosis, damit er nicht aufwacht, bevor ich wiederkomme. Hoffentlich wacht er überhaupt wieder auf! Ich beobachte noch ein paar Minuten die Kontrollgeräte. Er bleibt stabil.
Ab morgen habe ich reguläre Wechselschicht, da bleibt das Handy aus.
Genieß deinen Schlaf, kleiner Friedel. In vierundzwanzig Stunden heißt es: »Ran an den Speck!«, dann heißt es: »Schrei um dein Leben!«
5. Dienstag
Lars Rüttgen warf einen Blick auf seine Armbanduhr. Es war kurz vor drei Uhr, die Nacht war weit fortgeschritten, es wurde Zeit. Er wandte sich an Marvin, seinen Adepten der ersten Stufe. »Hast du es?«, flüsterte er und fuhr sich mit der rechten Hand durch seinen roten Bart.
Es musste die Rechte sein, er hatte lange gebraucht, bis er sich daran gewöhnt hatte, denn eigentlich war er Linkshänder, aber es brachte Unglück, sich mit der Linken durch den Bart zu fahren.
Heute Morgen hatte er die Länge gemessen. Es waren, wenn er die widerspenstigen lockigen Barthaare glättete, elf Komma sechs Zentimeter. Noch zehn Zentimeter, dann hatte er sein Ziel erreicht. Zumindest, was seine Kinntracht anging. Sein Kopfhaar reichte ihm bereits bis zur Unterkante seiner Schulterblätter, und da er fast zwei Meter maß, ohne Schuhe, war das schon ganz anständig. Nicht schlüssig war er sich darüber, ob die Mischung aus Kieselerde und Zink, die er jeden Tag nahm, den Wuchs beschleunigte. Und ob es wirklich half, nur bei zunehmendem Mond die Spitzen zu schneiden.
»Hast du es?«, wiederholte er, griff seinen Adepten an den Schultern und drehte ihn zu sich. »Hat es dir die Sprache verschlagen? Was ist los?«, zischte er, bemüht, nicht zu laut zu werden.
Er musterte Marvin, der vor sich hin stierte und kein Wort sagte. Der Kerl sah echt gut aus, so ein bisschen wie James Dean, und trotzdem hatte er bei den Mädchen kein Glück. Das musste daran liegen, dass Marvin etwa so gesprächig war wie ein Goldfisch. Er selbst, Lars Rüttgen, Sohn hässlicher Eltern, hatte schon viele Mädchen gehabt, und das lag nicht an seiner Knollennase, seinen überbreiten Wangenknochen und seinen Fleischerhänden. Es lag daran, dass er wusste, was Frauen wollten, zumindest eine ganz bestimmte Art von Frauen. Marvin war sogar noch Jungfrau, das hatte er ihm in einer Beichtstunde gestanden, und Lars hatte daraufhin beschlossen, diesen Zustand zu beenden, denn als Jungfrau konnte Marvin auf keinen Fall Adept der zweiten Stufe werden. Sein Schüler wusste noch nichts von seinem Glück, ebenso wenig wie Johanna, die er für den Initiationsritus ausgewählt hatte. Sie war Single, definitiv Jungfrau und sicher nicht abgeneigt, den schönen Marvin in die Künste der Fleischeslust einzuführen, natürlich unter strenger Aufsicht ihres Meisters und Hohepriesters Amothep des Großen alias Lars Rüttgen. Seine Lenden pulsierten bei dem Gedanken an Johanna und Marvin, die auf dem Altar der Church of XXXL ihre Körper vereinen würden.
Johanna war zurzeit in England, machte ein dreiwöchiges Praktikum in einem Hotel an der Südküste, in einem kleinen Touristenort namens Sidmouth. Am Wochenende erwartete er sie zurück. Sie hielten per E-Mail Kontakt, er wusste, dass er seine Schäfchen nicht von der Leine lassen durfte. Doch heute Abend stand etwas anderes auf dem Programm.
Lars riss Marvin den Beutel aus der Hand, der lebendig zu sein schien, denn ständig beulte er sich an verschiedenen Stellen aus. Das Huhn, das in dem Beutel steckte, schien zu ahnen, was ihm bevorstand, denn normalerweise fielen Hühner in der Dunkelheit in eine todesähnliche Starre.
Marvin zuckte, als sei eine Kobra auf ihn losgegangen, dann stutzte er, presste sich die Hand vor die Nase, zog ein Papiertaschentuch aus der Tasche und prustete hinein.
Lars konnte es nicht fassen. Es gab Menschen, die sich vor Angst in die Hose machten, Marvin musste niesen, wenn er sich fürchtete. Lars lauschte in die Dunkelheit, aber nichts rührte sich, sie hatten Glück gehabt.
Supay-Kim und Lilith-Jana waren mitgekommen, sie würden das Blutritual mit ihm vollziehen. Beide hatten ihre Prüfungen zum Adepten der vierten Stufe mit Bravour bestanden, beide waren würdig. Vielleicht sollte er es Kim überlassen, das Huhn zu opfern, und Jana würde etwas von ihrem eigenen Blut beisteuern. Ja, das war eine gute Idee. Aber er musste zuerst nachsehen, ob Jana sich in der letzten Zeit nicht zu viel geritzt hatte.
Sie war eher der intellektuelle Typ, sie studierte Jura, trug Brille, obwohl sie genauso gut Kontaktlinsen hätte tragen können. Ihr rundes Gesicht war eingerahmt von glatten braunen Haaren, selten lachte sie, selten geriet ihre Mimik aus dem Gleichgewicht.
Der Beutel in Lars’ Hand begann wieder zu zappeln. Schnell öffnete er ihn ein Stück, und schon schoss der Kopf des Huhns hervor, das gierig Luft durch die kleinen Öffnungen in seinem Schnabel sog, der mit einem Draht zusammengehalten wurde. Er nickte Marvin zu, der seinen Kopf noch tiefer senkte und seine Schultern hochzog, als wolle er den Kopf im Hals verschwinden lassen.
Die Nacht war auf ihrer Seite. Wolken verdeckten den Himmel, es war diesig, die Temperaturen lagen um die zehn Grad. Niemand trieb sich freiwillig um drei Uhr in der Nacht auf einem Friedhof herum. Der Nachtwächter hatte gerade seine Runde beendet und war auf dem Weg zurück in seine warme Stube. Sie hatten eine Viertelstunde.
Er deutete auf Jana, sie beugte sich zu ihm herüber, der Duft von Äpfeln stieg ihm in die Nase. »Zeig mir deine Arme.«
Sie warf den schwarzen Samtumhang zurück, der als Zeichen ihres Standes mit einer mattgoldenen Borte gesäumt war, schob die Ärmel ihres Sweatshirts nach oben und hielt ihm die Innenflächen ihrer Unterarme entgegen.
Mit dem Zeigefinger fuhr er vom Ellenbogen hinab zu den Handgelenken und spürte auf beiden Seiten die sanften Hügel der Narben, die jahrelanges Ritzen hinterlassen hatte. Seit Jana bei ihm in die Lehre ging, seit er sie darüber aufgeklärt hatte, dass ihr Schicksal nicht unveränderlich feststand und dass Gott und Jesus und all das die Erfindung von Männern war, denen es nur um Macht ging, hatte sie sich nur noch selten geritzt. Allerdings hatte sie jetzt ständig Ärger mit ihrer Mutter, die brav jeden Sonntag in die Kirche tapste und sich von den Pfaffen Gift ins Ohr träufeln ließ.
Er fand keine frische Wunde, ein Zeichen, dass sie ihrem Meister gegenüber echten Gehorsam übte. Lars wusste, wie schwer es war, den Drang zu unterdrücken, sich das Messer langsam über die Haut zu ziehen, zuzusehen, wie das Blut hervorquoll, und den Schmerz zu genießen. Seine eigenen Narben begannen zu pochen, er biss sich auf die Zunge, um nicht sofort die Klinge zu ziehen und sich eine schöne lange Blutlinie zu ziehen. Einen Moment musste er sich konzentrieren, dann flüsterte er: »Du wirst dein Blut mit dem Blut des Tieres mischen.«
Ihre Augen leuchteten auf.
Er wandte sich Kim zu. »Du wirst das Tier seiner Erfüllung zuführen.«
Kims langes gewelltes Haar leuchtete selbst in der Dunkelheit noch rot. Sie war seine schwerste Versuchung, seit er Hoher Priester war. Am liebsten hätte er jeden Tag mit ihr das große Ritual vollzogen, aber er musste enthaltsam sein, das verlangte seine Position. Nur einmal im Jahr durfte er sie nehmen, zur Wintersonnenwende.
Ein feines Lächeln umspielte ihre Lippen, dann schlug sie die Augen nieder.
Ihr Lächeln erinnerte ihn daran, mit welcher Inbrunst sie zum Adepten der vierten Stufe aufgestiegen war. Drei Stunden war sie in Ekstase versunken, ihr Körper hatte gezuckt und gezittert, dann wieder hatte sie dagelegen wie eine Tote, und kurz bevor er abbrechen wollte, war sie zurückgekehrt, mit einem Blick, der ihm verraten hatte, dass sie die andere Seite geschaut hatte, dass sie Luzifer geschaut hatte.
Noch einmal spähte Lars die Wege hinab. Niemand weit und breit. Er schob sich vorsichtig aus dem Gebüsch, blieb in der Hocke und winkte den anderen. Ihr heutiger Altar, das Grab von Friedrich von Solderwein lag auf der südlichen Seite, etwa dreihundert Meter von ihrem jetzigen Standort entfernt.
Wie die Wiesel huschten sie über die Wege, einmal rechts, zweimal links. Der Grabstein war frisch poliert, die Oberfläche schimmerte mattsilbern, frische Schnittblumen dufteten, in goldenen Lettern war zu lesen, dass er mit fünfundsechzig Jahren gestorben war. Da ging man normalerweise in Rente, dachte Lars, doch es wäre trotzdem genug Zeit gewesen, um seine Dinge zu ordnen, aber Friedrich von Solderwein hatte es versäumt. Trotzdem war er ein guter Verbündeter, und davon hatte Lars nicht viele. Um genau zu sein, nur seine kleine Gemeinde.
Er stellte sich vor das Grab, Kim stand zu seiner Linken, Jana zu seiner Rechten, Marvin, als Rangniedrigster, kniete sich auf den Weg und senkte seinen Kopf, die Haltung, die ihm anscheinend am besten gefiel und Lars an Charlie Brown erinnerte. Mit einem geübten Griff zog Lars das Huhn ganz aus dem Beutel, ein zuckender Federklumpen, gebunden an Flügeln und Füßen. Immerhin das hatte Marvin gut gemacht. Ein flatterndes gackerndes Huhn wäre dem Ritual, das sie jetzt abhalten würden, sehr abträglich gewesen. In kürzester Zeit wäre die Polizei aus dem Boden gewachsen, um sie zu kassieren.
Jana entblößte ihren rechten Unterarm, hielt mit der linken ihr Zeremonienmesser. Es war die Handarbeit eines Schmiedes, den sie auf einem Mittelalterfest kennengelernt hatte, Damaszenerstahl, mit einem Elfenbeingriff, in den ihr wahrer Name eingraviert war: Lilith, die hebräische Bezeichnung für Teufel in Frauengestalt.
Lars löste einen Lederbeutel vom Gürtel, in dem er den satanischen Kelch transportierte, sein Meisterstück. Er hatte eine echte menschliche Schädeldecke mit einem Edelstahlfuß verklebt, in den die magischen Worte eingeritzt waren, die er jetzt zum Blutritual sprechen würde. Die Schädeldecke hatte er auf dem Südfriedhof gefunden, als alte Gräber geräumt wurden, die Totengräber hatten sie übersehen.
Er nickte Jana und Kim zu.
Jana schloss kurz die Augen, setzte das Messer fünf Zentimeter unterhalb der Armbeuge an – sie wusste genau, wo sie schneiden musste, damit sie keine zu großen Gefäße verletzte –, drückte auf die Klinge und zog sie langsam über die Haut.





























