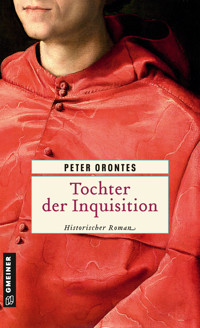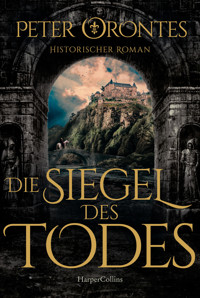Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die düsteren Geheimnisse der Vergangenheit: Der historische Kriminalroman »Der Seelenhändler« von Peter Orontes jetzt als eBook bei dotbooks. Herzogtum Steiermark, Anno Domini 1385: Eine brutale Räuberbande zieht marodierend durch die Lande und tötet scheinbar wahllos – die Bewohner der abgelegenen Bergregion flüstern deswegen hinter vorgehaltener Hand von der Geißel Gottes. Kann der eigenbrötlerische, aber scharfsinnige Wolf von der Klause dem grausamen Treiben trotzdem ein Ende setzen? Unerwartete Unterstützung erhält er dabei von der ebenso klugen wie schönen Katharina von Klingfurth. Bei ihren Ermittlungen stoßen sie zunächst auf die Spur eines mysteriösen Ordens – und erkennen, dass sie die brutale Mordserie nur beenden können, wenn sie das Geheimnis eines viele Jahre zurückliegenden Verbrechens lösen … Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der fesselnde historische Kriminalroman »Der Seelenhändler« von Peter Orontes. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 809
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Herzogtum Steiermark, Anno Domini 1385: Eine brutale Räuberbande zieht marodierend durch die Lande und tötet scheinbar wahllos – die Bewohner der abgelegenen Bergregion flüstern deswegen hinter vorgehaltener Hand von der Geißel Gottes. Kann der eigenbrötlerische, aber scharfsinnige Wolf von der Klause dem grausamen Treiben trotzdem ein Ende setzen? Unerwartete Unterstützung erhält er dabei von der ebenso klugen wie schönen Katharina von Klingfurth. Bei ihren Ermittlungen stoßen sie zunächst auf die Spur eines mysteriösen Ordens – und erkennen, dass sie die brutale Mordserie nur beenden können, wenn sie das Geheimnis eines viele Jahre zurückliegenden Verbrechens lösen …
Über den Autor:
Peter Orontes wurde in Venezuela geboren und wuchs in der Nähe des Bodensees auf. Der studierte Grafikdesigner und Artdirector schreibt seit vielen Jahren zeitgenössische und historische Kriminalromane. Für seinen Roman »Die Tochter der Inquisition« erhielt er 2017 den Goldenen Homer in der Kategorie Historischer Krimi.
***
eBook-Neuausgabe April 2020, Dezember 2023
Copyright © der Originalausgabe 2009 Peter Orontes
Copyright © der Neuausgabe 2019 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung mehrerer Bildmotive von © shutterstock
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (fb)
ISBN 978-3-96655-295-0
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Der Seelenhändler«an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Peter Orontes
Der Seelenhändler
Historischer Kriminalroman
dotbooks.
Anmerkungen zur mittelalterlichen Tageszeiteinteilung
Das gesamte Mittelalter hindurch wurden Tageseinteilung und Lebensrhythmus der Menschen durch zwei Faktoren bestimmt. Zum einen durch den natürlichen Tagesverlauf: Morgendämmerung, lichter Tag, Abenddämmerung, Nacht. Zum anderen durch bestimmte, rhythmisch wiederkehrende, von der Kirche festgesetzte Zeitabschnitte, die so genannten kanonischen Stunden, auch Horen genannt. Dies waren festgesetzte Zeiten, zu denen von den Mitgliedern der verschiedenen Mönchsorden jeweils bestimmte gottesdienstliche Handlungen verrichtet wurden. Dabei orientierte man sich an der alten, von den Römern übernommenen Einteilung des Tages in Stunden. Diese Einteilung teilte, im Gegensatz zu heute, den Tag jedoch nicht in vierundzwanzig gleiche Zeitabschnitte ein; vielmehr maß man die Zeit in zwölf Tages- und zwölf Nachteinheiten. Beginnend mit Sonnenaufgang, zählte man zwölf Tagesstunden bis Sonnenuntergang und zwölf Nachtstunden von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang. Infolgedessen variierte die Länge der Stunden je nach Jahreszeit und Gegend (Breitengrad) erheblich. So waren im Sommer die Tagesstunden länger, die Nachtstunden kürzer, im Winter war es umgekehrt.
Zum besseren Verständnis der in diesem Roman geschilderten Tagesabläufe und genannten Zeitbegriffe folgt daher hier im Anschluss eine Gegenüberstellung der klösterlichen Horen mit den heute gebräuchlichen Tagesstunden. Dabei handelt es sich um einen Tagesablauf, wie er in der Gegend, in der dieser Roman spielt, während des Sommers üblich gewesen sein dürfte. Es gibt verschiedene Quellen mit unterschiedlichen Tagesstunden-Angaben, die von den nachstehend genannten durchaus etwas abweichen können (siehe u. a. »Alltag im Spätmittelalter«, hrsg. von Harry Kühnel, Verlag INGENIEUM, GmbH a Co. KG, Graz)
Prolog
Die Steiermark, Mittwoch/Donnerstag, 21. und 22. Juni im Jahr des Herrn 1385
Auf samtenen Pfoten schlich die Dämmerung heran; Beute witternd wie ein Raubtier. Der Tag floh. Erste Wolken begannen im Westen heraufzuziehen, begleitet von einer frischen Brise. Als leichter Hauch strich sie über die dunklen Wälder hinweg, streichelte sanft das Wipfelmeer und entlockte ihm ein leises Rauschen.
Regen kündigte sich an.
Abendliche Kühle strich auch über die erhitzten Gesichter der vier Männer, die sich verbissen den Berg hinaufquälten.
»Verdammt, Luchs, warte, nicht so schnell!«
»Ja, verflucht, mach langsamer. Diese Eile bringt einen ja um. Wir brauchen unsere Kräfte noch für später.«
»Randolph hat Recht, Luchs. Wie sollen wir den ganzen Rest noch schaffen, wenn uns jetzt schon die Zunge zum Hals heraushängt?«
Die Rufe der drei Männer, die laut maulend ihrem Unmut Luft machten, galten dem vierten, der ihnen voranstieg und das Tempo vorgab. Seiner Kletterkünste und seiner geschmeidigen Behändigkeit wegen nannten sie ihn stets nur den »Luchs`. Immer größer war der Abstand zwischen ihm und ihnen geworden; nur mühsam vermochten sie ihm noch zu folgen.
Jetzt wandte er sich erbost nach ihnen um.
»Haltet endlich das Maul, ihr Memmen. Ich sagte doch, bevor's dunkel wird, müssen wir oben sein. Sonst können wir das Ganze vergessen. Bis zum Ziel sind's schließlich noch mal verdammte zwei Stunden. Dass es kein Spaziergang wird, habt ihr bereits gewusst, bevor wir von Rieden aufgebrochen sind. Also, reißt euch verflucht noch mal zusammen und hört auf zu jammern.«
Das Murren verstummte. Was der Luchs sagte, war richtig. Dass der Auftrag, den sie zu erfüllen hatten, seine Tücken haben würde, war ihnen im Voraus bekannt gewesen. Ebenso, dass der Berg, den sie nun zu bezwingen hatten, den schwierigsten Teil der Strecke ausmachte. Doch erst, wenn sie seine Kuppe erklommen hatten, konnten sie sich wähnen, bald am Ziel zu sein. Dann erst würde sie ein kaum begangener, abschüssiger Pfad auf der anderen Seite den dicht bewaldeten Hang wieder nach unten führen.
Hinunter in die Abgeschiedenheit des Tales, das die Hütte barg. Die Hütte, in der der Köhler wohnte.
Dabei hatte sie schon der gestrige Tag ordentlich Kraft gekostet.
Bereits am Nachmittag waren sie im Tal der Enns angelangt und dann, nach einer kurzen Ruhepause, im Schutz der Nacht bis Pürgschachen weitergezogen. Zu diesem Zeitpunkt waren sie noch zu fünft gewesen; da hatte sich noch der Einarmige in ihrer Begleitung befunden. Dann, heute, in aller Frühe, lange bevor es zu tagen anfing, hatten sie dem Krüppel die Pferde anvertraut und ihm Weisung gegeben, sich mit den Tieren in einer geräumigen Waldhöhle versteckt zu halten; erst im Morgengrauen des übernächsten Tages sollte er an dem vereinbarten Treffpunkt bei der großen Eiche am Fluss wieder zu ihnen stoßen. Sie selbst hatten bei Frauenberg die Straße nach Admont verlassen und sich seitlich in den Wald geschlagen. Dem Straßenverlauf folgend, waren sie mühsam durch die Wildnis vorgedrungen und erst spätnachmittags am Fuß des Waldberges angelangt, dessen höchsten Punkt sie noch vor Einsetzen der Dunkelheit zu erreichen hofften.
Der Luchs hatte diese Route ganz bewusst gewählt, obwohl sie schwierig und vor allem zeitraubend war. Es wäre weitaus bequemer gewesen, den Vorstoß auf die in der Senke gelegene Hütte des Köhlers direkt von der Straße her zu unternehmen. Doch die führte über Zeiring, Trieben und Admont über den Buchauer Sattel nach Altenmarkt und war stark befahren, seitdem ein Verbot Herzog Albrechts den Steyrer Kaufleuten untersagte, die von Venedig kommenden Waren über den Pyhrn zu führen und ihnen damit die Strecke über Admont und Sankt Gallen nach Altenmarkt regelrecht aufzwang. Im Gegensatz dazu wies die mühselige Variante abseits der Straße über den Berg einen nicht zu unterschätzenden Vorteil auf: Die Gefahr, irgendwelchen Personen zu begegnen, war so gut wie ausgeschlossen.
Überhaupt hatten sie, seit sie im Ennstal angekommen waren, dank der Ortskenntnisse des Luchses sämtliche Hauptverkehrswege meiden können. Er kannte das Gelände wie seine Gürteltasche. Was nicht weiter verwunderte, denn hier hatte er fast sein ganzes Leben verbracht, bevor er vor Jahren wegen einer unangenehmen Geschichte aus der Gegend hatte verschwinden müssen.
»Na endlich, verdammt noch mal!«
Erschöpft ließ sich der Mann, der Randolph hieß, auf einem der Felsbrocken nieder, die zuhauf über die kahle, moosbewachsene Kuppe verstreut waren. Der Luchs tat es ihm gleich, während die beiden anderen sich einfach auf den weich federnden Boden fallen ließen und alle viere von sich streckten. Die Männer keuchten vor Anstrengung, und obwohl es kühl war, troff Schweiß von ihren Gesichtern. Aber das war ihnen gleichgültig. Sie hatten den Aufstieg geschafft; das allein zählte. Es war aber auch an der Zeit. Inzwischen hatte die Dämmerung den Tag zur Gänze gefressen; am nachtdunklen Himmel spielten Wolken mit dem Licht des Mondes Katz und Maus.
»Wie lange noch bis zum Ziel, sagtest du?«
Einer der beiden, die auf der Erde lagen, hatte die Frage gestellt. Sein Blick richtete sich auf den Luchs, der neben ihm auf dem Stein hockte.
Der zuckte mit den Schultern.
»Vielleicht zwei Stunden; allerhöchstens drei«, brummte er.
»Nicht mehr lange, dann schüttet es wie aus Kübeln«, prophezeite der andere der beiden, die sich auf den Moosteppich hatten gleiten lassen, mürrisch. Die Hände unter dem Kopf verschränkt, starrte er in den wolkenverhangenen Nachthimmel.
»Das kann uns scheißegal sein. Im Wald dürften wir vorerst trocken bleiben. Hauptsache, wir schaffen alles, noch bevor der Morgen graut«, entgegnete Randolph und erhob sich.
Der Luchs sprang auf. »Du sagst es. Also, sehen wir zu, dass wir weiterkommen! Faulenzen können wir morgen früh wieder!«
Entgegen ihrer Erwartung gestaltete sich der Abstieg über den bewaldeten Nordhang allerdings nicht weniger mühevoll als der Aufstieg über die Südseite. Der Pfad war schwierig und steil. Darüber hinaus erschwerte Dunkelheit ihr Vorwärtskommen. Nachdem sich der Mond auch noch hinter einer Wolkenbank versteckt hatte, zwang undurchdringliche Schwärze die Männer, die mitgeführten Fackeln zu entzünden.
Wieder fluchten sie.
Mittlerweile hatte der Wind weitere Wolken herangetrieben, und heftiger Regen setzte ein. Doch den nahmen die Männer vorerst nur als dumpfes Rauschen wahr. Das dichte Dach aus Zweigen und Blättern über ihnen dämpfte den prasselnden Lärm und hielt sie verhältnismäßig trocken. Dann aber hatten sie die Talsohle erreicht – der schützende Wald war zu Ende. Eine mit niederen Büschen und hohem Gras bestandene Senke breitete sich vor ihnen aus.
»Löscht die Fackeln. Sie könnten uns verraten«, zischte der Luchs und trat vorsichtig aus dem Schutz der Bäume heraus. Die Männer folgten ihm – und bekamen augenblicklich die ungehemmte Wucht des Regens zu spüren. Hunderte wütender Tropfen peitschten ihnen ins Gesicht und attackierten die breitkrempigen Hüte, die sie trugen – das dumpfe Rauschen verwandelte sich in wütendes Trommeln. Dennoch hielten sie voller Anspannung inne und spähten angestrengt in die Lichtung. Wo lag ihr Ziel?
Dann sahen sie das Glimmen.
Unheimlich und verheißungsvoll zugleich, bohrte sich ein verschwommener rötlicher Schein ins Nassschwarz der Nacht und schien sie durch den strömenden Regen hindurch zu grüßen. Dort, im Osten, wo die Senke im Begriff war, wieder in einen steilen Hang überzugehen, musste der Köhler wohnen.
Mit seiner Frau. Mit seinem Bruder. Und dem Jungen. Das Glimmen verlieh ihnen neue Kräfte. Sie rückten weiter vor, wurden schneller. Als sie ihr Ziel fast erreicht hatten, verringerten sie das Tempo wieder und hielten heftig atmend inne als sie erkannten, woher das verhaltene Leuchten stammte: Neben der niedrigen Hütte, die schief am kahlen Fels lehnte, glühten die Reste eines Feuers – in einer grob ummauerten, offenen Herdstelle und von einem ausladenden Felsvorsprung vor dem Regen geschützt.
Die Glut war noch frisch, die Flammen noch nicht lange erloschen. Obwohl kein Laut aus der Hütte drang, bereitete ihnen ihre Entdeckung Unbehagen.
Verunsichert blickten sie einander an. Fragend, unentschlossen. Doch sie wagten nicht zu sprechen.
Angespannt heftete der Luchs seinen Blick auf die Tür des Hütteneingangs. Seine Gedanken rasten. Mit der Frau und dem Jungen würden sie schnell fertig sein. Aber der Köhler und sein Bruder waren wahre Hünen. Was, wenn sie noch nicht schliefen?
Sie brauchten Gewissheit!
Eng an den Boden geschmiegt, robbte der Luchs nahe an die Behausung heran und spähte vorsichtig durch die Ritzen der aus groben Bohlen bestehenden Tür. Behutsam drückte er dagegen – sie war nicht verriegelt. Angestrengt verharrte er noch einige Augenblicke und horchte, bis er erleichtert jenes regelmäßige Schnarchen registrierte, das nur im Tiefschlaf befindliche Personen von sich geben.
Erst danach richtete er sich wieder auf. Rasch bewegte er sich auf die rot glühende Feuerstelle zu, die ihnen den Weg gewiesen hatte. Zum wiederholten Mal in dieser Nacht zog er eine Fackel aus dem Gürtel. Sie würden Licht benötigen, um sich im Dunkel der Hütte zurechtzufinden. Er stieß den Stab in die verbliebene Glut, die das Werg augenblicklich entzündete und ihm das umständliche Feuerschlagen ersparte.
Die brennende Fackel in der Rechten, wandte er sich wieder seinen Begleitern zu. Er atmete tief durch. Dann nickte er und hob langsam den Arm, um das Zeichen zu geben. Das Zeichen, auf das die anderen, wie zum Sprung bereite Raubtiere, warteten. Die Zeit des Handelns war gekommen.
Und sie würden handeln. Ohne Wenn und Aber. Und noch bevor die vor Nässe triefende Schwärze im Begriff wäre, sich im feuchten Grau des beginnenden Morgens aufzulösen, würden sie ihre Mission erfüllt haben.
So, wie man es von ihnen erwartete.
Kapitel 1
I – Freitag, 23. Juni im Jahr des Herrn 1385
Nebelschwaden entstiegen dem Fluss, waberten über die dunklen Fluten hinweg und stiegen nach oben, um sich hoch über den Wipfeln der Bäume im dämmrigen Morgengrau aufzulösen. Noch verbarg sich die Sonne hinter der schwarz gezackten Silhouette des Buchsteinmassivs. Doch sie hatte ihren Boten vorausgeschickt – ein schmaler Streifen diffusen Lichtes kündigte von ihrem Kommen.
In einem notdürftig aus Reisig und Blättern gefertigten Unterschlupf, nah am Flussufer, schliefen zwei Männer; ein älterer und ein jüngerer.
Schon am Abend des vorhergehenden Tages hatte ein prüfender Blick zum Himmel die beiden bewogen, sich ins dichte Unterholz am Ufer der Enns zu verkriechen. Schließlich galt es, sich vor der unbarmherzigen Nässe zu schützen, die irgendwann in den nächsten Stunden vom Himmel herniederprasseln würde.
Als Wanderprediger der »Armen Christi«, der geheimen Bruderschaft, die vom römischen Klerus verächtlich als »Waldenser« beschimpft und als Ketzer gejagt wurden, waren sie es gewohnt, im Freien zu nächtigen. Ihr Versteck am Rande des Waldes, der sich bis ans Ufer der Enns erstreckte, schützte sie nicht nur vor dem Unwetter, sondern auch vor den möglichen Blicken Neugieriger, die sich auf der gegenüberliegenden Seite des Flusses auf dem Uferpfad entlangbewegen mochten. Sie mussten vorsichtig sein, denn es waren schlimme Zeiten angebrochen. Die Inquisition war wieder aktiv in dieser Gegend geworden und drohte all denen, die sich nicht zum römischen Glauben bekannten, mit Kerker, Folter und Verbrennung. Daher bedurften ihre Glaubensbrüder in den verstreut liegenden Dörfern und Weilern des Ennstales gerade jetzt zunehmend ihres Rats, ihrer Hilfe und ihrer tröstenden Worte.
Die beiden waren nicht blutsverwandt, dennoch betrachteten sie sich als Brüder. »Bruder« Heinrich und »Bruder« Rudlin, so nannten sie sich gegenseitig, während sie von den Gläubigen, denen ihr Dienst galt, ehrenvoll mit »Meister« angesprochen wurden.
»Die Versammlung morgen Nacht – sie wird im Haus Peter Mohrs stattfinden, nicht wahr?«
Den Kopf in die Rechte gestützt, lag Heinrich auf seinem Lager und sah den neben ihm liegenden Gefährten fragend an.
Rudlin nickte. »Ja, er ist einer der Zuverlässigsten unter den Brüdern.«
»Wird auch Konrad Steckelyn dabei sein?«
Wieder nickte Rudlin. »Mit Frau und Kindern, wie die anderen auch. Die Familie rumort schon seit Tagen in meinem Kopf herum«, seufzte er.
Gedankenversonnen nickte Heinrich. Wenn jemand ein Problem hatte, dann die Steckelyns. Auch sie bekannten sich zu den »Armen Christi« und wohnten in einem abgelegenen Weiler, der zur Ortschaft Weng gehörte, nur einen Katzensprung von Admont entfernt. Rudlin und Heinrich hatten davon gehört, dass Konrad vor dem Stadtrichter in Rottenmann per Eid eine Aussage bestätigen sollte. Die Verhandlung sollte in einigen Wochen stattfinden.
Damit schwebte jedoch die Gefahr der Preisgabe ihrer Identität wie ein Damoklesschwert sowohl über den Steckelyns als auch dem Rest der Gemeinde. Denn die »Armen Christi« waren diejenigen, die jegliches Schwören unter allen Umständen, sogar bis in den Tod hinein, kategorisch verweigerten.
»Wenn Konrad nicht schwören will, wird er sich in eine schwierige Lage bringen. Und was dann mit ihm geschieht ...« Heinrich unterbrach sich und zuckte vielsagend mit den Schultern.
Auch ohne dass sein Gefährte den Satz zu Ende brachte, wusste Rudlin, was er meinte. »Damit müssen wir rechnen, das weißt du. Er wäre schließlich nicht der Erste, den sie in die Mangel nehmen, um ihm ein Geständnis abzupressen.«
Heinrich überlegte kurz; dann entschloss er sich, Rudlin einen Vorschlag darzulegen, der ihn insgeheim schon lange beschäftigte.
»Ich glaube, dass man den Stadtrichter durchaus dazu bringen könnte, auf den Schwur zu verzichten«, begann er.
»Ach ja? Welchen Grund sollte es für einen Stadtrichter wohl geben, die Verweigerung eines Eides zu akzeptieren?«
Heinrich richtete sich auf.
»Wie wäre es, wenn Konrad sagen würde, er müsse seine Aussage zurückziehen. Weil man ihn inzwischen damit erpresse, dass, wenn er dabei bleibe, man seiner Frau und den beiden Kindern Übles antun werde.«
Noch hatte er nicht zu Ende gesprochen, als Rudlin vom Lager hochfuhr und zu einer scharfen Erwiderung ansetzte. »Wie stellst du dir das vor! Soll Konrad seinen Kopf etwa mit einer Lüge retten? Willst du unsere Grundsätze verraten?«
»Nein, Bruder Rudlin. Bei allem schuldigen Respekt, aber ich beurteile die Dinge anders. Ich sehe darin keine Lüge – eher eine List. Sagte nicht der Herr selbst, dass wir unschuldig wie Tauben, aber listig wie Schlangen sein sollen? Wir halten uns an das Gebot des Herrn, das uns den Schwur verbietet. Aber wir befinden uns in einem Krieg – dem Krieg des Glaubens. So sagt es der heilige Paulus in seinen Briefen. Und in einem Krieg, Bruder Rudlin, muss es auch erlaubt sein, sich einer List zu bedienen!«
Heinrich hatte sich in einen leidenschaftlichen Eifer hineingeredet. Er glühte förmlich. Wie viele andere unter den Armen, verfügte er über eine ausgezeichnete Kenntnis der Heiligen Schrift.
Rudlin hatte seinem jüngeren Begleiter stirnrunzelnd zugehört.
Danach fiel seine Antwort etwas sanfter aus als zuvor. »Vielleicht hast du Recht, Bruder Heinrich. Ich will mir das Ganze noch einmal durch den Kopf gehen lassen.«
»Tu das, Bruder Rudlin. Und verzeih mir meinen Eifer. Ich wollte dir nicht zu nahe treten.«
»Schon gut. Du bist mir nicht zu nahe getreten.«
Das herzhafte Gähnen, das seinen Worten folgte, wirkte geradezu ansteckend auf Heinrich, und so waren sie kurz nach Mitternacht mit ihrer Unterhaltung zu Ende gekommen und bald über dem monotonen Rauschen des Regens eingeschlafen.
Rudlin wusste nicht, was ihn geweckt hatte, aber er war auf einen Schlag wach geworden. Es hatte aufgehört zu regnen, Nebel kroch über den Fluss. Er sah zu Heinrich hinüber, der noch immer tief und fest den Schlaf des Gerechten schlief. Im Gegensatz zu ihm verfügte Rudlin über viele Jahre an Erfahrung, die seine Sinne außerordentlich geschärft hatten.
Vor allem seinen Sinn für Gefahr.
Da – da war es wieder!
Das Schmatzen stapfender Stiefel auf dem vom Regen aufgeweichten Boden. Stark gedämpft, aber doch vernehmbar, klang das Geräusch vom gegenüberliegenden Ufer herüber.
Rudlin erstarrte. Waren sie entdeckt worden?
Vorsichtig richtete er sich auf. Die Ohren gespitzt wie ein Wachhund, spähte er, verborgen hinter einem Gewirr von Laub und Zweigen, in Richtung des Geräusches.
Jetzt, endlich, begann er deutlicher zu sehen.
Das erste fahle Licht des Tages, das als Streifen am Horizont heraufzog, genügte; um ihn durch die Nebelschwaden hindurch, mal mehr, mal weniger deutlich, die dunklen Silhouetten von vier Männern erkennen zu lassen. Langsam ging einer von ihnen, groß und schlank gebaut, den am Fluss entlangführenden Weg auf und ab.
Er läuft wie eine Katze, registrierte Rudlin in Gedanken. Zwei der Männer, beide mit schwarzen Bärten, standen bei einer knorrigen alten Eiche nahe am Fluss. Der vierte hatte sich auf einem großen Stein dicht am Ufer niedergelassen. Auch er verfügte über eine beachtliche Körpergröße, aber besonders auffällig war sein langes Haar, das ihm bis auf die Schultern fiel.
Die zwei bei der Eiche unterhielten sich, wobei sie aufgeregt mit den Armen fuchtelten. Obwohl sie laut zu sprechen schienen, klang das Gemurmel ihrer Stimmen nur gedämpft an Rudlins Ohr, sodass er nicht verstehen konnte, was sie sprachen. Dann gesellte sich der Katzengestaltige, der bis jetzt unruhig hin und her geschritten war, zu den beiden. Er sagte etwas zu ihnen und deutete mit der Linken zuerst in die eine, dann in die andere Richtung des Weges.
Rudlin hielt den Atem an, Schweiß trat auf seine Stirn. Wer waren diese Männer? Schergen im Dienst der Inquisition, ausgesandt, um Heinrich und ihn zu ergreifen?
Jetzt ließen sich die drei, die bei der Eiche standen, im Gras nieder und lehnten ihre Rücken an den Stamm des Baumes. Der vierte auf dem Stein am Ufer erhob sich, schlenderte zu ihnen hinüber und setzte sich zu ihnen. Im Gegensatz zu vorher verlief die Unterhaltung nun wesentlich ruhiger, das aufgeregte Gefuchtel der beiden Schwarzbärte hatte aufgehört, das Gemurmel war leiser geworden.
Mit einem Mal wurde Rudlin klar, dass die Männer warteten. Sie waren nicht geschickt worden, um nach ihm und seinem Begleiter zu suchen. Sonst hätten sie sich anders verhalten. Sie warteten einfach nur. Und sie hatten keinen blassen Schimmer, dass sie dabei von einem Häretiker beobachtet wurden. Die Vorstellung brachte ihn zum Schmunzeln, seine Anspannung legte sich.
Blieb nur die Frage, auf wen die vier warteten.
In diesem Augenblick kam Rudlin ein Gedanke.
Seitlich seines Unterschlupfes ragte ein schmaler, mit Bäumen und Büschen dicht bewachsener Streifen Land ein gutes Stück weit in den Fluss hinein. Wenn er es schaffte, ungesehen bis dorthin zu robben, würde er so nah an die Männer herankommen, dass er mühelos verstehen konnte, was sie sagten.
Rudlin überlegte. Er sah auf seinen schlafenden Begleiter. Sollte er ihn wecken? Nein. Tiefe, regelmäßige Atemzüge verrieten, dass Heinrich nicht so schnell erwachen würde. Also kroch er kurzentschlossen und ohne ein verdächtiges Geräusch zu verursachen, im Schutz des Dickichts zur Landzunge hinüber. Als er jedoch am Ende der Zunge ankam und hinter einem Gebüsch innehielt, musste er feststellen, dass die Unterhaltung zwischen den Männern mittlerweile verstummt war. Das Kinn auf die Brust gesenkt, dösten sie vor sich hin.
Rudlin beschloss zu warten. Doch während der schmale Streifen am Horizont zunehmend breiter und sein Licht stärker wurde, machte keiner der Männer auch nur die geringsten Anstalten, zu erwachen. Schon glaubte Rudlin, sich unverrichteter Dinge zurückziehen zu müssen, als einer der beiden Schwarzbärte urplötzlich mit einem Fluch aufsprang, worauf auch die anderen hochfuhren.
»Verdammt! Gleich geht die Sonne auf. Wo bloß der Einarmige bleibt«, hörte Rudlin den mit den langen Haaren schimpfen.
»Vielleicht hat er verpennt«, antwortete die »Katze«.
»Was machen wir, wenn er nicht kommt?«, fragte einer der beiden Schwarzbärte.
»Er wird schon noch kommen«, antwortete ihm der andere.
»Er müsste schon lange da sein«, erwiderte der eine.
»Hör auf, dir in die Bruche zu scheißen, du Nonnenfurz.«
»Halts Maul, du verlauster Hund.«
»Ich glaub, du willst eine aufs Fressloch, du Stück Eselsscheiße.«
Rudlin bemerkte, dass die beiden bärtigen Streithähne kurz davor standen, handgreiflich zu werden.
Energisch ging der Langhaarige dazwischen und trennte sie. »Gebt Ruhe, ihr Schwachköpfe. Ihr wollt Brüder sein? Eure dämlichen Schädel könnt ihr euch einschlagen, wenn wir wieder zu Hause sind. Wenn ihr nicht aufhört, euch wie Kindsköpfe zu benehmen, seid ihr diesmal das letzte Mal dabei gewesen, verstanden?«
»Is' ja schon gut«, lenkte einer der beiden ein. »Wir sind eben ein bisschen gereizt. Is' doch kein Wunder. Da erledigen wir die Sache, verstecken uns danach einen ganzen beschissenen Tag, wo der Wald am dichtesten ist, hauen uns wieder eine Nacht um die Ohren, um uns den ganzen verdammten Weg zurück bis hierher zu schlagen, und was macht der Einarmige? Der Ziegenarsch lässt uns warten.«
»Ihr werdet's schon überleben. Und jetzt haltet endlich das Maul«, schimpfte der Langhaarige.
Plötzlich erschallte ein überraschter Ruf. »Verfluchter Mist, wo bist du so lange gewesen?«
Ärgerlich klang die Stimme des Katzengestaltigen zu Rudlin herüber. Seine Worte galten einem Reiter, der plötzlich hinter einer Wegbiegung aufgetaucht war und vier Pferde hinter sich herführte.
Rudlin hatte ihn zuerst nicht bemerkt; zu sehr war er auf den Streit der Männer konzentriert gewesen. Erst als er den Kopf in die Richtung wandte, in die die »Katze« gerufen hatte, nahm er den Mann und die Tiere wahr. Kein Zweifel, es war der Einarmige. Dem Reiter fehlte der linke Arm; nutzlos baumelte der Ärmel seiner Jacke hin und her. Bei der Eiche angekommen, stieg er vom Pferd.
»Wo warst du, Ingolf? Verdammt, seit Stunden warten wir auf dich«, wiederholte der Katzengestaltige seine Frage.
Ingolf begann daraufhin seltsam zu gestikulieren, wozu er seinen gesamten Körper mit einsetzte. Doch er sagte nichts. Er deutete nur und bewegte seine Lippen, über die jedoch kein einziges Wort drang. Es war, als vollführe er einen seltsamen Tanz.
Vor allem die »Katze« schien der wunderlichen Vorstellung des Einarmigen konzentriert zu folgen. Erst nachdem Ingolf seinen Auftritt beendet hatte, wandte sie sich den anderen wieder zu.
»Er sagt, dass er warten musste. Kurz bevor er aufbrechen wollte, machte ein Tross Reisender mit spitzen gelben Hüten bei seinem Versteck Rast. Wahrscheinlich verdammte Juden, die genauso wenig darauf aus sind wie wir, jemandem zu begegnen«, lachte er hämisch.
Jetzt verstand Rudlin. Ingolf fehlte nicht nur der linke Arm, sondern auch die Fähigkeit, zu sprechen. Er war stumm. Nur die »Katze« konnte sich anscheinend mit ihm verständigen, seine Gesten deuten und ihm von den Lippen ablesen. Um den anderen dann seine unausgesprochenen Worte zu übersetzen.
»Genug der Trödelei, Männer! Wir brechen auf! Wir müssen uns sputen. – Und du, Randolph, gib Acht auf die Zehe. Der Eber in Rieden wartet auf seine Trophäe!«, schallte der Ruf der »Katze« über den Fluss.
Der langhaarige Mann, der sich als Randolph herausstellte, lachte roh. »Keine Sorge, die hab ich gut verwahrt«, antwortete er. Er zog einen kleinen Beutel aus seinem Gürtel hervor und schwenkte ihn in der Luft. »Hier ist das kostbare Stück. Warum sich der Alte wohl gerade die Zehe ausgesucht hat? Wir hätten ihm ja auch was anderes abschneiden können!«
Jetzt war es an dem Katzengestaltigen, laut zu lachen – so, als ob der Langhaarige einen guten Witz gemacht hätte.
Ein seltsamer Witz,dachte Rudlin und erschauerte, während die Männer die Pferde bestiegen und davonritten.
Erleichtert verließ Rudlin sein Versteck und kehrte zu seiner Lagerstatt zurück. Heinrich schlief noch immer. Rudlin lächelte. Was würde sein Gefährte wohl sagen, wenn er ihm später von dem Geschehen berichtete, dessen Zeuge er geworden war? Er beschloss, noch ein wenig zu schlafen, obwohl es immer heller wurde. Schüchtern tasteten sich die ersten Strahlen der Sonne in den beginnenden Tag hinein.
Es war ein Freitag; der dreiundzwanzigste Tag im Monat Juni im Jahr des Herrn 1385.
Kapitel 2
Dafür, dass die Sonne noch lange nicht im Zenit stand, war es bereits ungewöhnlich heiß. Die Nässe der vergangenen Nacht war im Verdampfen begriffen, die angenehme Kühle des frühen Morgens einer drückenden Schwüle gewichen. Auf den beiden Reitern, die an diesem Vormittag auf dem Weg in die Buchau waren, lastete sie wie eine schwere, feuchtwarme Decke, die ihnen den Schweiß aus allen Poren trieb.
»Sag, Bertram, was macht dich so schweigsam? Ist es die Schwüle, oder habe ich dich gestern Abend zu spät aufs Lager geschickt?«
Wolf von der Klause, ein hochgewachsener, kräftig gebauter Mann mit schwarzem Bart und auffällig blauen Augen, hatte seinen Rappen zum Stehen gebracht und sah über die Schulter hinweg schmunzelnd nach hinten.
Der Junge, der ihm in einigem Abstand auf einem Fuchs folgte und seinen Kopf bis jetzt tief über den Hals des Pferdes gebeugt hatte, richtete sich entrüstet auf.
»Zu spät aufs Lager? Von wegen, ich bin wach wie eine Kaulquappe im Tümpel, wenn's regnet.«
Wolf von der Klause lachte. Der Vergleich gefiel ihm.
»Dann sag mir wenigstens, worüber du nachdenkst.«
Bertram grinste. »Ihr wisst also, dass ich nicht müde bin, sondern nachdenke. Warum tut Ihr dann so, als ob Ihr es nicht wüsstet?«
Erneut lachte Wolf. »Ich gebe mich geschlagen. Du hast mich durchschaut. Also – worüber denkst du nach?«
Bertram zögerte. Wieder grinste er. »Ich denke darüber nach, wie Ihr Euch als Ehemann ausnehmen würdet. Das Fräulein, das wir gestern im Gästehaus des Klosters trafen, Ihr wisst schon, die mit dem Adlerzinken«, er fasste sich an die Nase und machte eine ausladende Geste, »wäre die nicht etwas für Euch?«
Wolf war verblüfft.
Jetzt war es an Bertram, schallend zu lachen. »Verzeiht, Wolf, aber ... aber wenn Ihr jetzt ... wenn Ihr jetzt Euer Gesicht sehen könntet ...«, prustete er.
Die Verblüffung in Wolfs Miene verwandelte sich in ein Schmunzeln. Dann brach es auch aus ihm heraus, und er fiel in das Gelächter des Jungen mit ein.
»Du meinst also, ich sollte heiraten«, erwiderte er. »Nun, gut, Hauptsache, sie hat hiervon genug.« Er klopfte mit der Rechten an den Beutel, den er am Sattel hängen hatte und in dem er Geld und andere Utensilien aufbewahrte, die ihm wichtig waren. »Damit sie mich ordentlich ernähren kann«, fügte er hinzu.
Scherzend ritten sie weiter, doch mit der zunehmenden Hitze verging ihnen die Lust am Plaudern; immer öfter mussten sie sich den Schweiß aus Stirn und Nacken wischen.
Während sie ihrem Ziel immer näher kamen, dachte Wolf von der Klause an die Zeit zurück, als er vor dreizehn Jahren das erste Mal auf diesem Weg geritten war. Mitten im Winter war er damals in dieser Gegend aufgetaucht und hatte sich irgendwo in einem der unzähligen, schier unzugänglichen Waldlabyrinthe niedergelassen.
Wie ein einsamer, verirrter Wolf.
Anfänglich war man ihm mit einer gehörigen Portion Misstrauen begegnet. Hier im Tal der Enns war den Menschen alles Fremde zunächst suspekt. Alles, was sie nicht sofort in die Truhen und Kisten ihres einfachen Denkens einordnen und ablegen konnten, erschien ihnen nicht geheuer. Doch im Laufe der Jahre hatte sich ihr Misstrauen gelegt, und nicht nur das: An seine Stelle war sogar wachsende Sympathie getreten.
Das hatte durchaus handfeste Gründe. Denn so zurückhaltend und knapp an Worten Wolf im Umgang mit den Leuten auch war, so bereitwillig bot er ihnen seine Hilfe an, wenn er sie von unmittelbarer Not betroffen vorfand. Stand und Herkunft spielten dabei keine Rolle. Manch einer aus dem Tal verdankte ihm sogar das Leben.
So wie Otto Metschacher, der Prior im Benediktinerstift zu Admont.
An einem Wintertag, während eines Rittes durch den Wald, war Ottos Pferd auf dem hart gefrorenen Pfad gestürzt und hatte seinen Reiter unter sich begraben. Eingeklemmt unter dem Gaul, der sich nicht mehr erheben konnte, hatte der Geistliche aufgrund rasender Schmerzen, klirrender Kälte und der Tatsache, dass er sich weit entfernt von jeglicher menschlicher Behausung befand, bereits mit seinem Leben abgeschlossen.
Dann war Wolf gekommen – ein glücklicher Zufall – und hatte sich seiner angenommen. Er hatte ihn unter dem Tier hervorgezogen, fürs Erste seine Wunden versorgt und ihm das gebrochene Bein geschient. Hatte ihn aufs Pferd gehievt und ins Stift zurückgebracht. Der Prior vergalt es ihm mit einer großzügigen Geste. Er räumte ihm fortan das Recht ein, sich völlig frei in den klösterlichen Auen und Wäldern bewegen und ohne Einschränkung jagen und fischen zu können.
Allerdings glaubte Wolf, dass dieses Zugeständnis Metschachers lediglich dem Anstand geschuldet und aus der Erkenntnis heraus geboren worden war, ihm, dem Lebensretter, Dankbarkeit zollen zu müssen. Obgleich das Ereignis jenes Wintertages zweifelsohne ein Gefühl gegenseitiger Wertschätzung in ihnen hatte entstehen lassen, war ihre Beziehung von herzlicher Freundschaft noch immer weit entfernt. Das Einzige, was von einer gewissen Vertrautheit zwischen ihnen zeugte, war, dass sie sich beim Vornamen nannten, wobei sie es allerdings vorzogen, gleichzeitig das förmliche »Ihr« beizubehalten. Sie waren einfach zu unterschiedlich. Auf der einen Seite der Prior: ein kompromissloser Mann der Kirche, umgeben von einer Aura subtiler Anmaßung, unduldsam gegenüber allem, was er für nicht katholisch hielt, und stets darauf bedacht, die Erwartungen, die man klösterlicherseits in ihn setzte, zu erfüllen. Auf der anderen Seite er, der Einzelgänger: zurückgezogen das Leben eines Klausners führend, ohne wirklich einer zu sein. Jemand, der die Einsamkeit nicht um des Herrn und des allerheiligsten Glaubens, sondern ausschließlich um seiner selbst willen gewählt hatte. Weil ihm die damit verbundene Freiheit über alles ging. Ein Freigeist, der, was nur wenige wussten, sich ein hohes Maß an Bildung und umfangreiches Wissen erworben hatte, aber jede Art dogmatischer Gängelei verabscheute und deshalb im tiefsten Innern mit der allerheiligsten Kirche auf Kriegsfuß stand – was allerdings niemand wusste. Und so blieb Letzteres auch dem Prior verborgen, denn Wolf widerstand der Versuchung, sich mit Otto in Streitgesprächen messen zu wollen.
Ganz anders geartet war dagegen seine freundschaftliche Beziehung zu Arnulf, dem Köhler. Rein äußerlich ein Hüne von Gestalt, war Arnulf seinem Wesen nach sanft und empfindsam. Ein einfacher, aber aufrechter Mann. Ein geradliniger Charakter, stets hilfsbereit und zu jedermann freundlich.
Auch zu Arnulfs Familie hatte Wolf ein herzliches Verhältnis aufgebaut. Zu Agnes, der Ehefrau. Zu Tassilo, dem Bruder, und zu den Kindern Anna und Bertram. Letzterem galt seine besondere Zuneigung. Wolf mochte den aufgeweckten Knaben. Im Alter von sechs Jahren hatte er ihn das erste Mal auf einen seiner Streifzüge mitgenommen. Von da an war die Beziehung zwischen den beiden noch enger geworden; der Junge hielt sich mit Einwilligung des Vaters oft tagelang in Wolfs abgelegener Klause auf und begleitete ihn zeitweise auf Schritt und Tritt.
So war im Verlauf der Jahre aus dem väterlichen Freund zunehmend auch ein Lehrer geworden. Schon früh hatte Wolf die besonders schnelle und klare Auffassungsgabe des Knaben erkannt und nach Kräften gefördert. Mit der Zeit brachte er ihm Lesen, Schreiben, Rechnen und sogar Latein bei. Er führte ihn ein in die Geheimnisse von Wald und Flur, zeigte ihm, wie man Spuren las und die Himmelsrichtung bestimmte, aber auch, wie man mit Bogen und Schwert umging und sich in halsbrecherischem Galopp erfolgreich auf einem ungesattelten Pferderücken hielt.
Besonderes Vergnügen bereitete es Wolf jedoch, sich mit Bertram über »Gott und die Welt«, wie er es nannte, zu unterhalten.
So wie an diesem Tag.
Der, wie so viele andere Tage, unbeschwert begonnen hatte – aber in einen Abgrund des Entsetzens münden sollte.
Wolf und Bertram spornten die Tiere zu einer schnelleren Gangart an. Rasch näherten sie sich ihrem Ziel; bald würden sie die Behausung des Köhlers erreicht haben.
Aber diesmal würden sie nicht nur von Arnulf, Agnes, Anna und Tassilo begrüßt werden.
Sondern auch von Paul.
Schon seit einigen Tagen wohnte Paul bei der Köhlerfamilie. Der Junge war schon des Öfteren Gast in Arnulfs Hütte gewesen. Seine Mutter war schon vor Jahren gestorben, und so war Hademar, sein Vater, der als Taglöhner in einem der Hammerwerke bei Sankt Gallen arbeitete, froh darüber, dass Paul hin und wieder Familienanschluss im Heim des Köhlers genießen durfte.
Diesmal allerdings hatte nackte Not den Sohn Hademars dazu gebracht, die Hütte Arnulfs aufzusuchen. Einige Tage bevor Bertram mit Wolf aufgebrochen war, war Paul schluchzend aufgetaucht und hatte Arnulf davon in Kenntnis gesetzt, dass sein Vater auf dem Weg von Sankt Gallen nach Hieflau tödlich verunglückt war. Arnulf hatte daraufhin beschlossen, Paul, der keine Verwandten besaß, vorübergehend bei sich aufzunehmen. Wolf wiederum hatte Arnulf versprochen, sich im Kloster für Paul zu verwenden. Noch heute, gleich nachdem er Bertram zu Hause abgeliefert hätte, wollte er mit dem Prior darüber reden.
Sie verließen den Hauptweg und gelangten an eine Wegkreuzung, die von drei dicht beieinanderstehenden Buchen markiert wurde. Dort bogen sie auf den Pfad, der in das Tal führte, in dem die Köhlerfamilie wohnte. Schon jetzt sahen sie hinter einigen hohen Bäumen Qualm aufsteigen – ein vertrauter Anblick; denn dort befanden sich auf einer gerodeten Fläche die Meiler: in die Erde getriebene Gruben, in denen Holz zu Kohle verschwelte und aus deren Öffnungen der im Innern entstehende Rauch entlassen wurde.
Und doch war das Bild, das sich ihnen diesmal bot, ein anderes.
Während des Sommers waren sie gewohnt, bei ihrer Heimkehr auch stets Rauch aus der neben der Hütte gelegenen Herdstelle aufsteigen zu sehen. Auf ihr bereitete Agnes gewöhnlich die täglichen Mahlzeiten zu.
Aber dieses Mal vermissten sie den Rauch des Feuers. Die Herdstelle war kalt.
Sie hielten kurz inne und sahen sich erstaunt an.
Zögernd ritten sie weiter. Auf Rufweite bei der Hütte angekommen, stiegen sie ab und führten die Tiere am Halfter.
Niemand war zu sehen; nichts war zu hören.
Keine Antwort auf ihr Rufen.
Ein ungutes Gefühl bemächtigte sich Wolfs. Er hieß den Jungen in einiger Entfernung warten und übergab ihm die Zügel seines Rappen. Vorsichtig blickte er sich um und ging dann allein weiter. Bei der Hütte angekommen, stellte er fest, dass die Tür etwa eine Hand breit offen stand. Vorsichtig drückte er dagegen. Mit einem klagenden Knarzen bewegte sie sich in den hölzernen Angeln – glitt schwerfällig auf und gab zögernd den Blick in das dunkle Innere frei.
Wolf duckte sich langsam durch die niedrige Öffnung hindurch und betrat den aus grobem Lehm gestampften Boden.
Hinter ihm fiel die Tür wieder in ihre ursprüngliche Position zurück; nur durch den handbreiten Spalt drang Licht herein.
Das Erste, was er wahrnahm, war das plötzliche Summen einer Unmenge aufgescheuchter Schmeißfliegen, die unmittelbar vor ihm vom Boden aufstoben.
Erschrocken richtete er den Blick nach unten, blieb stehen und versuchte Genaueres zu erkennen – doch noch legte sich das Dunkel wie eine schwarze Binde gnädig auf seine Augen.
Dann hatte es mit der Gnade jedoch ein Ende.
Er begann zu sehen – schemenhaft zunächst, doch allmählich immer deutlicher.
Zuerst die seltsam dunklen Stellen auf dem Lehmboden zu seinen Füßen. Das durch den Türspalt und die Ritzen der Wände eindringende Licht, verlieh ihnen ein eigenartig stumpfes Aussehen.
Er beugte sich nieder, berührte die Stellen mit dem Finger – und fing an zu begreifen.
Blut! Lachen getrockneten Blutes!
Das Blut – die Fliegen.
Er richtete sich wieder auf, tappte zwei, drei Schritte vorwärts – und stieß plötzlich gegen einen weichen Gegenstand. Verstört blickte er abermals nach unten – und erstarrte.
Jetzt erst erfasste sein Blick das gesamte Grauen und brannte es unauslöschlich in sein Gedächtnis.
Unmittelbar vor ihm, auf dem Boden hingestreckt, direkt zu Füßen des Lagers, das er mit Agnes teilte, lag Arnulf, der Köhler. Inmitten einer riesigen geronnenen Blutlache und lediglich mit einer Bruche bekleidet. Ein mächtiger Hieb hatte ihm die rechte Schläfe zertrümmert. Trotz der mageren Lichtverhältnisse vermochte Wolf die halb geschlossenen Lider des Toten zu erkennen. Sie waren blutunterlaufen und verhüllten nur unzureichend den stumpfen Schleier des Todes, der sich auf das einst so kraftvoll blitzende Augenpaar gesenkt hatte.
Neben Arnulf: Agnes, nackt, unter ihrem Haupt ebenfalls eine riesige Lache getrockneten Blutes, das eine geschwollene Lid halb geschlossen, mit dem anderen Auge blicklos ins Leere starrend.
Achtlos und wie zufällig über die Füße der beiden gebreitet: das grobe wollene Nachthemd, das Agnes immer getragen hatte, wenn sie zur Ruhe ging. Es war schmutzig und zerrissen.
Wolf stand wie vom Donner gerührt. Eine Welle eisigen Entsetzens breitete sich in ihm aus, die ihn zunächst völlig lähmte. Dann kam das Zittern. Heftig erfasste es seinen ganzen Körper, ohne dass er ihm Einhalt gebieten konnte. Noch weigerte sich sein Verstand zu glauben, was er sah, als auch schon eine Ahnung in ihm aufstieg, gepaart mit ohnmächtigem Zorn. Offensichtlich hatten sie wieder zugeschlagen. Doch was, zum Teufel, hatten sie denn geglaubt, bei einem einfachen Köhler finden zu können, bei dem es, weiß Gott, nichts zu holen gab. Warum mussten sie Arnulf töten? Warum Agnes? Warum ...?
Er blickte auf.
»Mein Gott«, murmelte er bebend, »oh, mein Gott – nein.«
Schwindel ergriff ihn, dennoch drang er einige Schritte weiter vor, zwang sich, zu sehen, was er bereits wusste.
Auf der rechten Seite, im hinteren Teil der Behausung, auf ihrer hölzernen Bettstatt in ihrem Blut liegend, fand er Anna, die Augen friedlich geschlossen, als ob sie schliefe. Ihr Leibchen war blutdurchtränkt. Offensichtlich hatte ein gezielter Stich ins Herz ihrem Leben ein Ende gesetzt. Das gleiche bei Paul. Er schlief dort, wo Bertram sonst seinen Schlafplatz hatte. Beide hatten noch die Schaffelle über ihre Unterkörper gebreitet, der Tod war verhältnismäßig schnell und barmherzig – wahrscheinlich während des Schlafs – über sie gekommen.
In panischer Hast wandte sich Wolf nach links. Dort befand sich, wie er wusste, durch eine Bretterwand vom übrigen Raum getrennt, das Lager Tassilos. Und dort fand er auch ihn. Mit eingeschlagenem Hinterhaupt, bäuchlings, mit dem Gesicht nach unten; die Arme hingen seitlich schlaff herunter. Im Gegensatz zu den anderen war er fast vollständig angekleidet. Auch hier überall Blut. Blut auf dem Boden. Blut auf dem hölzernen Bretterverschlag. Blut, das durch das grobe Laken aus Hanf gedrungen und in das sich darunter befindende Stroh gesickert war.
Heftig atmend versuchte Wolf, die aufsteigende Übelkeit niederzuringen. Immer noch sträubte sich sein Bewusstsein verzweifelt, das Furchtbare zur Kenntnis zu nehmen. Er stolperte durch das Halbdunkel des Raumes, vorbei an der ummauerten Feuerstelle, die während des Winters Wärme spendete, hinüber auf jene Seite, auf der ein Holzladen eine kleine Fensteröffnung verschloss. Er stieß den Riegel zurück und klappte den Laden auf. Helles Tageslicht strömte in die Hütte und offenbarte gnadenlos das vollständige Ausmaß des Grauens.
Die leblosen Körper. Das Blut. Die Schmeißfliegen.
Jetzt erst begriff Wolf die volle Tragweite dessen, was geschehen war. Er brach in die Knie, fassungslos, hilflos. Stöhnend schlug er die Hände vors Gesicht – und plötzlich wurde ihm bewusst, dass er weinte, weinte, wie ein kleines Kind ...
... ein Kind! Er fuhr auf. Der Junge schoss ihm in den Sinn. Er durfte nicht sehen, was hier geschehen war. Alles, nur das nicht. Er würde, er musste es zwar erfahren, aber er sollte es wenigstens nicht sehen müssen. Wolf schnellte hoch, stürzte zum Eingang ...
Bertram!
Fast schlagartig hatte er die Tür aufgestoßen. Mit kurzem heftigem Druck, ungeduldig, ahnungsvoll.
Wolf erstarrte.
Bewegungslos verharrte der Junge im Türrahmen. Seine kräftige Gestalt warf einen dunklen Schatten ins Innere der Hütte.
Er sah Wolf an ... blickte an ihm vorbei ... sah ihn wieder an. Ließ dann die weit aufgerissenen Augen langsam über das Bild des Grauens wandern, auf dem wie zum Hohn das Sonnenlicht tanzte.
Die entseelten Körper. Das Blut. Die Schmeißfliegen.
Er sah all dies. Aber er begriff es nicht. Noch nicht.
Bis zu dem Moment, da Wolf sich bewegte und auf ihn zuging. Jetzt erst löste sich die Starre des Jungen. Jetzt erst begann er zu begreifen.
Schock und Schmerz ließen ihn zuerst unartikuliert stammeln – dann brach es aus ihm heraus.
»Neeeiiiin!« Mit einem Schrei, der Wolf bis ins Mark traf, warf sich der Junge auf den leblos daliegenden Vater. Kniend barg er den Kopf Arnulfs in seinen Händen, drückte ihn fest an sich, küsste verzweifelt die blutige Stirn, während er seinen Schmerz und seine Verzweiflung laut hinausschrie.
Rasch trat Wolf hinter ihn. Umfasste ihn mit beiden Armen und drückte ihn an sich. Versuchte, ihn zu beruhigen, aus der Hütte zu ziehen. Vergeblich. Die Kraft des Schmerzes, ungleich größer als die Kraft der Vernunft, ließ es nicht zu. Bertram riss sich los, stürzte dorthin, wo die Mutter lag, warf sich abermals nieder, streichelte ihr Haar, küsste die kalte Stirn und den leicht geöffneten Mund, warf schreiend den Kopf hin und her und schluchzte immer wieder »Mutter! Mutter!«. Und wieder war Wolf hinter ihm und legte seine Arme um ihn, diesmal fester, wie eiserne Klammern. Lange hielt er ihn so an sich gepresst, wiegte ihn hin und her, wie ein kleines Kind. Bis der Junge, von Weinkrämpfen geschüttelt, seinen Widerstand endlich aufgab und sich aus der Hütte führen ließ.
Sie traten hinaus und tauschten das Halbdunkel des Grauens gegen die trügerische Idylle eines hellen Sommertages. Schmetterlinge und Bienen teilten sich die Blüten der sommerlichen Wiese; Grillen zirpten, Vögel zwitscherten – die Banalität eines ganz gewöhnlichen Junitages im Tal umfing sie.
Wäre da nicht das Geschehen in der Hütte gewesen.
Die das Unfassbare barg.
Die leblosen Körper. Das Blut. Die Schmeißfliegen.
Bertram war ins Gras gesunken und weinte noch immer hemmungslos. In dumpfer Verzweiflung ruhte Wolfs Blick auf dem Jungen. Er legte den Arm um ihn und zog ihn an sich. Bertram ließ es willenlos geschehen. Irgendwann ging sein Weinen in leises Wimmern über.
Wie lange sie vor der Hütte gesessen hatten, um dem Schmerz Raum zu geben, wussten sie später nicht mehr. Jedenfalls stand die Sonne ein gutes Stück weiter westwärts, als Wolf schließlich das Schweigen brach und dem Jungen behutsam klarzumachen versuchte, dass es an der Zeit war, den Ort zu verlassen.
Vorher aber hatte er noch etwas zu erledigen. Er erhob sich und ging langsam zur Hütte hinüber. Vor der Tür blieb er kurz stehen. Dann trat er entschlossen über die Schwelle und ging rasch zum Fenster hinüber. Er schloss den Laden, den er kurz zuvor aufgestoßen hatte, und verriegelte ihn von innen. Mit einem Strick und einigen kräftigen Ästen sicherte er danach die Tür von außen, so gut es ging, damit Arnulf und Agnes, Anna, Paul und Tassilo wenigstens vor den Tieren der Nacht sicher waren.
Etwa eine und eine halbe Stunde nachdem sie aufgebrochen waren, ritten sie durch das obere Tor der Abtei. Das Klappern der Hufe schreckte Bruder Theobald – Pförtner und hospitarius im Stift zu Admont und damit auch zuständig für die Belange der Pilger und Gäste – aus seinem nachmittäglichen Dösen auf. Mit einigen wenigen Sätzen gelang es Wolf, ihm klarzumachen, dass er sie sofort zu Prior Metschacher bringen müsse.
Über den Klosterhof folgten sie Theobald in Richtung des Abtshauses. Für gewöhnlich befand sich die Arbeitsstätte Metschachers im Priorat, das sich im Konventsbereich befand und direkt an den Kreuzgang anschloss. Zurzeit wohnte und arbeitete der Prior allerdings im Haus des Abtes, das sich außerhalb des Klausurbereiches im Osten der Klosteranlage befand. Als Vertreter des Abtes Wilhelm von Reisperg, der zu einer größeren Reise nach Bayern aufgebrochen war, hatte er nicht nur dessen Vorsteheramt wahrzunehmen, sondern auch Repräsentationspflichten zu erfüllen; eine Aufgabe, die er in den großzügigen und gut ausgestatteten Räumlichkeiten des domus abbatis weitaus besser wahrnehmen konnte.
Knarrend öffnete sich die Tür zum Scriptorium des Abtes.
»Der Vater Prior erwartet Euch«, sagte Theobald an Wolf gewandt, nachdem er zuvor Metschachers Erlaubnis, den Besucher eintreten zu lassen, eingeholt hatte. Bertram ließ sich auf einer Bank, die gegenüber der Tür zum Scriptorium an der Wand stand, nieder.
Kaum dass Wolf über die Schwelle trat, erhob sich der Prior vom Schreibtisch. Metschacher war ein großer, hagerer Mann mit römischen Gesichtszügen, dessen gesamtes Äußeres kongruent den zwar feinsinnigen, aber auch kompromisslos dogmatischen Kleriker widerspiegelte, der er im Innern war. Das tonsierte Haupt von einem silbergrauen Haarkranz umgeben, wölbte sich unter der hohen Stirn eine kühn gebogene Nase über schmalen Lippen. Die tiefen Furchen um die Mundwinkel wirkten wie gemeißelt und verliehen dem bartlosen Gesicht einen permanent leidenden Ausdruck. Der Blick aus schmalen, grauen Augen, die unter leicht geschwungenen Brauen lagen, wirkte meist seltsam distanziert, fast hochmütig, verriet in seltenen Augenblicken jedoch auch einen Anflug von Heiterkeit und Güte.
Jetzt eilte er seinem Besucher mit ausgebreiteten Armen entgegen. Er lächelte, allerdings nicht wirklich herzlich, sondern mehr aus pflichtbewusster Höflichkeit. »Ihr, Wolf? Seid gegrüßt. Was führt Euch denn hierher?«
Seine Stimme klang unverbindlich freundlich, wies aber einen leichten Anflug von Ungeduld auf. Der Gruß war nichts weiter als eine bloße Floskel. Doch kaum, dass er ihn geleistet hatte, entdeckte er den flackernden Blick Wolfs, in dem sich die unterschiedlichsten Gefühle zu mischen schienen.
Trauer und Wut. Verzweiflung und Ratlosigkeit.
»Wolf? Wolf! ... Was ... was ist mit Euch?« Die ansonsten sonore Stimme Otto Metschachers hatte plötzlich einen scheppernden Klang angenommen.
Wolf trat hart an ihn heran.
»Was mit mir ist, fragt Ihr? Ich will es Euch sagen. Erinnert Ihr Euch an Rutgerd Baro, den Weinhändler? Ihr wisst schon, der, der das viele Geld unter seiner Bettstatt versteckt hielt. Oder an Peter Söller, den Tuchmacher aus Judenburg? Oder an Gero von Weiningen aus Steyr? Ist Euch der Überfall auf die ungarischen Kaufleute noch in Erinnerung, die nach Passau wollten?« Seine Stimme wurde heiser. Er stand jetzt unmittelbar vor dem Prior, sodass ihre Gesichter sich fast berührten. »Sie haben wieder zugeschlagen. Und wer, glaubt Ihr, ist diesmal das Opfer?«
Metschacher war zusehends blasser geworden. »Hört auf, in Rätseln zu sprechen. Sagt es frei heraus. Was ... was gibt es?«
»Arnulf, den Köhler, haben sie sich diesmal vorgenommen. Mitsamt seiner Familie. Außer Bertram sind alle tot«, stieß Wolf in verzweifeltem Grimm hervor.
Der Prior sah ihn ungläubig an.
»Den Köhler? Was sollte es bei ihm zu holen geben?« Er schüttelte verständnislos den Kopf. »Und überhaupt ... woher wisst Ihr ...?«, fragte er gedehnt, worauf Wolf ihn in kurzen Zügen über die Einzelheiten dessen, was er in Arnulfs Hütte vorgefunden hatte, in Kenntnis setzte.
Metschacher ließ sich auf einen der Stühle fallen, die den mitten im Raum stehenden Tisch flankierten. Er war tief getroffen. Er wusste um die Freundschaft, die Wolf mit der Familie des Köhlers verband, und um die besondere Beziehung, die sich zwischen ihm und Bertram herausgebildet hatte.
»Und wo ist der Junge jetzt? Was soll mit ihm geschehen?«, fragte er.
Wolf zuckte mit den Achseln. »Gegenwärtig sitzt er auf einer Bank. Da draußen, auf dem Gang«, er deutete mit dem Kopf zur Tür. »Ich werde ihn natürlich zu mir nehmen. Allerdings ...« – er zögerte kurz – »allerdings wäre ich Euch sehr verbunden, wenn er fürs Erste bei Euch unterkommen könnte. Ich möchte dem Jungen ein neues Heim geben. Doch dazu sind Umbauten in meiner Klause nötig.«
Metschacher nickte. »Keine Frage. Natürlich kann der Junge so lange hier im Kloster wohnen.«
Sie schwiegen.
Wolf trat an eines der Fenster und blickte hinaus. Die Sonne, mittlerweile tief im Westen stehend, spiegelte sich in den Butzenglasscheiben. Feiner Dunst umwob die gezackten Gipfel der Haller Mauern.
Er wandte sich um. »Was werdet Ihr jetzt tun, Otto? Die Tat geschah auf Eurem Grund und Boden.«
Es war eine rein rhetorische Frage, denn er wusste, was nun geschehen würde. Aber er hatte irgendwie das Gefühl, das zwischen ihnen entstandene Schweigen brechen zu müssen.
Der Prior seufzte. »Ihr wisst, was zu geschehen hat, Wolf. Der Fall muss ordentlich abgewickelt und untersucht werden. Dafür ist der Landrichter auf Wolkenstein zuständig, Markwart von Taupekh. Doch er befindet sich gegenwärtig zusammen mit dem derzeitigen Stiftsrichter in Graz und hat die Amtsgeschäfte vorübergehend dem Stadtrichter in Rottenmann übertragen. Also werde ich als Vertreter Abt Wilhelms einen Boten nach Rottenmann senden und bei der weltlichen Obrigkeit um Amtshilfe bitten.«
Wolf lachte verächtlich. »Obrigkeit! Amtshilfe! Seit vier Jahren mordet und raubt die Bande. Das Pack taucht auf, schlägt zu und verschwindet ins nichts. Und was geschieht? Die Obrigkeit tritt auf den Plan und versucht, Spuren zu sichern. Sie findet aber keine und kehrt achselzuckend in die Amtsstube zurück. Ob Landrichter oder Stadtrichter, bleibt sich dabei gleich. Glaubt Ihr etwa, dass es diesmal anders sein wird?«
Wolf hatte sich in Rage geredet. Er war an den Tisch herangetreten und schlug mit der Faust ärgerlich auf die dunkle Eichenplatte.
Sofort erkannte er, dass er zu weit gegangen war.
»Verzeiht, Otto«, entschuldigte er sich. »Ihr könnt, weiß Gott, nichts dafür. Doch wenn es so weitergeht, wird man der Bande nie das Handwerk legen können – und das wisst Ihr nur zu gut!«
Der Prior war sichtbar zusammengezuckt In der impulsiven Geste Wolfs lag unbestreitbar eine gewisse Respektlosigkeit. Doch er ignorierte sie.
»Ich sehe es Euch nach, Wolf«, erwiderte er beherrscht. »Ihr seid verständlicherweise sehr erregt. *Und Ihr habt Recht. Wenn es so weitergeht, wird man der Bande nie das Handwerk legen. Sie wird weiter morden und rauben und den Weg über die Buchau zur Eisenstraße noch mehr in Verruf bringen, was natürlich dem Stift und seinen Geschäftsbeziehungen außerordentlich schadet.«
Metschacher erhob sich und trat an das geöffnete Fenster. Nachdenklich wanderte sein Blick am mächtigen Felsmassiv der Haller Mauern empor. »Es sei denn«, fuhr er bedächtig fort, »jemand anders nimmt sich der Sache an. Jemand, der Mut und einen scharfen Verstand besitzt. Jemand, der es versteht, Spuren zu lesen und Zusammenhänge zu erkennen. Wie zum Beispiel – Ihr!« Beim letzten Wort hatte er sich ostentativ umgedreht.
Wolf sah ihn verblüfft an. »Das meint Ihr doch wohl nicht im Ernst«
»Da irrt Ihr Euch, es ist mein voller Ernst. Ich denke, dass Markwart von Taupekh nichts dagegen hätte, wenn ihm ein fähiger Mann diese Aufgabe abnehmen würde. – Also, stimmt zu, Wolf Nehmt Euch der Sache an. Im offiziellen Auftrag des Stiftes, gewissermaßen als sein Sonderbeauftragter. Und denkt daran: Ihr tut es nicht nur für das Stift. Sondern auch – für Bertram!«, beschwor Metschacher seinen Besucher.
Der Prior hatte seine Worte sehr sorgfältig gewählt.
Die beabsichtigte Wirkung blieb nicht aus.
Betroffen sah Wolf ihn an. Metschacher hatte unbestreitbar Recht. Bertram würde in seinem künftigen Leben besser mit dem schrecklichen Geschehen zurechtkommen, wenn er wusste, dass die Tat gesühnt worden war.
»Nun, was sagt Ihr?«
Die Frage des Priors machte den Grübeleien Wolfs ein Ende.
»Vielleicht habt Ihr Recht, Otto. Ich will's mir überlegen. Lasst uns morgen früh noch einmal darüber reden. Aber jetzt bitte ich Euch um ein Nachtlager für den Jungen und mich. Wir sind beide erschöpft.«
Der Prior nickte und ging zur Tür. »Ihr wisst, dass Ihr in Admont jederzeit willkommen seid. Wegen des Lagers wendet Euch an Bruder Theobald.«
Als er die Tür öffnete, sahen sie Bertram auf der Bank kauern. Er war vor Erschöpfung eingeschlafen. In einem Anflug von Mitleid legte der Prior den Zeigefinger an die Lippen.
»Lasst ihn vorerst schlafen«, raunte er Wolf zu. »Der Pförtner wird ihn holen, wenn er Euer Lager bereitet hat. Wenn Ihr unten seid, schickt ihn mir noch einmal hoch.«
Kapitel 3
II – Samstag, 24. Juni im Jahr des Herrn 1385
Die Nacht zum Samstag schien nicht enden zu wollen.
Von seinem Lager aus beobachtete Wolf die helle Scheibe des Mondes. Karges, weiches Licht drang durch die Fensteröffnung und erfüllte seine Kammer mit jenem seltsam milden Schimmer, den er schon als Kind gemocht hatte, weil er ihn stets zutiefst beruhigte.
In dieser Nacht jedoch hatte er das Empfinden, als habe sich der milchige Schimmer des Mondes in das skelettfarbene Weiß des Todes verwandelt. Ein grässliches Weiß, das ihn nicht schlafen ließ. Erst gegen Morgen fiel er in einen unruhigen Dämmerschlaf, aus den ihn das Läuten zur Prim recht unsanft herausriss.
Langsam erhob er sich und blieb erst einmal auf der Bettkante sitzen. Er fühlte sich wie gerädert. Mit Schaudern dachte er an die vergangene, von bleierner Schwere erfüllte Nacht zurück: an die unsäglich langsam dahinziehende Zeit, den dunklen, jenseitsgerichteten Gesang der Mönche – und an das Schluchzen und Weinen des Jungen, das aus der Kammer neben ihm an sein Ohr gedrungen war.
Wolf stand auf und reckte die Glieder. Er beschloss, sich anzukleiden und in den Hof hinunterzugehen. Am Brunnen würde er sich frisch machen und versuchen, die Reste der albtraumgeschwängerten Nacht zu verscheuchen, die ihm immer noch ins Gesicht geschrieben stand.
Das kalte Wasser war in der Tat erfrischend. Es kühlte die heiße Stirn. Aber nicht die Gedanken, die hinter ihr glühten. Geschweige denn, dass es den Schmerz zu löschen vermochte, der in seinem Innern brannte. Nein, dazu bedurfte es des Wassers der Vergeltung. Aus dem Brunnen zu schöpfen, der dieses Wasser enthielt, würde nun seine vorrangige Aufgabe sein. Er wusste, dass er dazu einen klaren Kopf benötigte – jetzt, da er sich dazu entschlossen hatte, dem Ansinnen des Priors stattzugeben und die Suche nach den Verbrechern aufzunehmen, die seinem Leben und vor allem dem des Jungen eine so furchtbare Wende gegeben hatten. Er wusste auch, dass er nicht eher ruhen würde, bis er sie gefunden hätte.
Gleich nachdem er zusammen mit Bertram gefrühstückt hatte, begab er sich ins Abtshaus. Metschacher hatte ihm ausrichten lassen, dass er ihn möglichst bald zu sprechen wünsche.
Er fand den Prior am Tisch sitzend vor.
»Nun, Wolf, wie habt Ihr Euch entschieden?«, empfing ihn dieser, indem er ohne Umschweife auf das gestrige Gespräch zurückkam.
Wolf trat an den Tisch, stützte die Arme darauf und beugte sich weit nach vorne.
»Ich nehme Euren Vorschlag an«, antwortete er bedächtig. »Unter einer Bedingung: Ich erhalte von Euch so etwas wie eine Generalvollmacht – persönlich von Euch unterzeichnet und gesiegelt sowie von dem Landrichter, Markwart von Taupekh, und dem Inquisitor Heinrich von Olmütz. Er weilt zur Zeit in Steyr, wie Ihr wisst.«
Metschacher hob überrascht die Brauen. »Eine Generalvollmacht? Warum denn das, in drei Teufels Namen?«, fragte er, seine mönchische Zurückhaltung gänzlich aufgebend.
»Ich will es Euch erklären, Otto. Ich beabsichtige, als Vertreter des Inquisitors getarnt, die Untersuchungen aufzunehmen. Unter dem Vorwand, dass sich die Bande eines Sakrilegs schuldig gemacht hat, hefte ich mich an ihre Fersen. So die offizielle Version meiner Aufgabe. Ihr versteht: Die Vollmacht dient mir gewissermaßen als Tarnkappe.«
Der Prior hatte mit wachsendem Interesse zugehört. Jetzt erhob er sich von seinem Stuhl und ging nachdenklich auf und ab. Unmittelbar vor Wolf blieb er stehen.
»Was Ihr da sagt, klingt einleuchtend. Ihr sollt Eure Vollmacht bekommen«, stimmte er schließlich zu. »Aber es wird einige Zeit dauern – Ihr müsst Euch gedulden.«
»Daran soll's nicht liegen.« Wolf atmete auf. Die erste Hürde war genommen. »Und noch etwas, Otto: Ich werde viel und vielleicht auch über längere Zeiträume hinweg unterwegs sein müssen. Ich möchte Euch bitten, Euch während dieser Zeiten des Jungen anzunehmen. Ihr wisst, er ist begabt. Könnte er nicht bei Euch im Kloster bleiben und in der äußeren Schule Unterricht erhalten?«, bat Wolf.
Das Gesicht des Priors entspannte sich. »Wenn es nur das ist ... das wird sich regeln lassen. Aber was gedenkt Ihr nun als Nächstes zu tun?«
»Ich werde mir die Spuren ansehen, welche die Mörder vor Ort hinterlassen haben. Und ich will, dass Arnulf und die Seinen endlich Ruhe finden. Wenn der Amtmann mit seinen Bütteln wieder abgezogen ist, möchte ich die Leichen daher an Ort und Stelle begraben – mit Eurer Erlaubnis.«
Metschacher nickte. »Die habt Ihr natürlich. Ich werde Euch einen Helfer mitgeben.«
Wolf schüttelte den Kopf. »Nein, Otto. Ich danke Euch, aber das ist nicht nötig. Lasst mich die Sache allein erledigen.«
Der Prior sah ihn erstaunt an. Dann hob er die Schultern. »Wie Ihr wollt. Wendet Euch an den Cellerar, Bruder Basilius. Er wird Euch alles zur Verfügung stellen, was Ihr benötigt.«
Als Wolf die Mauern der Abtei verließ, war er mit allem versehen, was er für die deprimierende Arbeit, die vor ihm lag, benötigte. Etwa ein und eine halbe Stunde nachdem er aufgebrochen war, verrieten dünne Rauchschwaden, die über die Wipfel der Bäume hinwegwaberten, dass er sich seinem Ziel näherte. Noch verschwelte an dem Platz, an dem sich die von Arnulf und Tassilo errichteten Erdmeiler befanden, Holz zu Kohle. Wie schon gestern ... nein, eigentlich wie schon immer, dachte Wolf bitter, als er in das Tal einbog, das bis vor Kurzem noch die Heimat der Köhlerfamilie gewesen war.
Er lenkte seinen Rappen zur Feuerstelle und stieg ab. Dann schnürte er einen Packen und eine eiserne Kohlenpfanne vom Sattel. Der Packen barg Werkzeuge und einen in ein Tuch gehüllten kupfernen Behälter. Vorsichtig wickelte er ihn aus und nahm den Deckel ab. Gelbe, unterschiedlich große, kristallen aussehende Brocken glänzten ihm entgegen: Schwefel. Er schüttete die Schwefelbrocken in die Pfanne und ging zur Hütte hinüber, um sie neben dem Eingang abzustellen. Anschließend begab er sich hinter die Behausung, wo ein winziger Bach den Hang hinabrieselte. Er zog ein großes Stück Tuch aus dem Gürtel, tauchte es in das Nass und band es sich als Schutz gegen den Verwesungsgeruch, der ihn gleich erwarten würde, vor Nase und Mund. Dann nahm er einen dicken Ast auf, der nahe dem Rinnsal lag, und begab sich mit schweren Schritten wieder zur Vorderseite der Hütte. Dort löste er den Strick, mit dem er gestern den Eingang gesichert hatte, stieß die Tür weit auf und klemmte den Ast so zwischen Boden und untere Kante, dass sie nicht von selbst wieder zufallen konnte. Ein kurzes Zögern noch – danach trat er mit der mit Schwefel gefüllten Pfanne in der Hand entschlossen über die Schwelle.