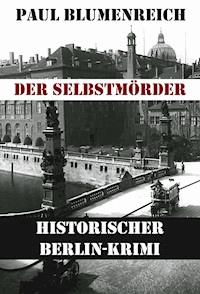Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Ein Kriminalroman aus dem Berlin vor der Jahrhundertwende. Spannend und unter die Haut gehend.
Das E-Book Der Selbstmörder wird angeboten von Jazzybee Verlag und wurde mit folgenden Begriffen kategorisiert:
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 274
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der Selbstmörder
Paul Blumenreich
Inhalt:
Der Selbstmörder
Der Selbstmörder, P. Blumenreich
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
86450 Altenmünster, Loschberg 9
Deutschland
ISBN:9783849623128
www.jazzybee-verlag.de
www.facebook.com/jazzybeeverlag
Cover Image: "Freshwater Lakes" von Kevin Dooley, lizenziert unter der Creative Commons LizenzNamensnennung 2.0 US-amerikanisch (nicht portiert) (CC BY 2.0)
Der Selbstmörder
I.
Der Morgen war gekommen, und noch immer war er nicht da. Man mußte die Rolljalousien aufziehen, das Geschäft eröffnen, trotzdem er fehlte, er, die Hoffnung des ganzen Hauses.
Er war nicht der Sohn des Hauses, aber mehr als ein solcher. Nicht nur sollte er einst das blühende Geschäft fortführen, er galt als der Bräutigam der einzigen Tochter des Hauses, und nicht nur die Zukunft der Firma, auch das Lebensglück dieses jungen Mädchens lag in seiner Hand. Und er war fort, rätselhaft verschwunden, vermißt, seit gestern abend ausgeblieben. Keine Spur, keine Nachricht von ihm.
Und während die Morgensonne ihre ersten Strahlen in das reich dekorierte Schaufenster warf auf die Andromeda von Bronze, die Tanagrafigürchen und auf die kunstvoll gestalteten Leuchter und Stafetten, saßen und standen alle müßig umher mit der einen Frage: Was ist aus ihm geworden?
Es kamen um diese Morgenstunde noch keine Kunden. Solch ein vornehmes Geschäft wie dieses wird nur pro forma so früh geöffnet. Gestern abend beim Schluß des Ladens hatte noch niemand ernste Besorgnis. Ein junger Mann kann einmal ausbleiben bis zehn Uhr, was will das heißen? – Freilich, bei der pedantischen Ordnung im Hause mußte das auffallen. Er war ja manchmal abwesend, aber man wußte doch immer, wo er sei, wann er zu erwarten.
Herr August Hilmar, der Chef des Hauses, war ein alter Herr, ein musterhafter, übergewissenhafter Geschäftsmann. Niemals hätte er etwas verkauft, von dessen sorgsamer Ausführung und Preiswürdigkeit er nicht fest durchdrungen gewesen wäre. Er kalkulierte seine Preise noch nach der alten Art, die sich Unkosten, Herstellung, Zinsen zusammenrechnete und einen ganz bestimmten Prozentsatz als Gewinn daraufschlug, gleichviel ob die Ware besonders billig erworben und leicht loszuschlagen war oder nicht. Daher denn auch das alte, gute Renommee der Firma.
Hilmar hatte eine einzige Tochter. Deshalb hatte man auch ein Mündel, einen entfernten Verwandten, in früheren Jahren in das Haus gezogen und direkt für das Geschäft vorbereitet. Karl Hilmar, ein hübscher, geweckter Bursche, genoß im Hause Hilmar eine sorgfältige Erziehung. Mit sechzehn Jahren war er in das Geschäft getreten, und der Onkel und Vormund führte ihn bei dem versammelten Personal als den zukünftigen Chef ein.
»Dein Glück ist gemacht,« sagte er damals zu dem Jüngling, und nicht ohne Neid sahen die älteren Angestellten den jungen Glückspilz in Tätigkeit treten.
Karl freilich schien nicht sehr davon durchdrungen, daß die neue Wendung der Dinge zu seinem Glücke sei. Als er ausgelernt hatte, begann er lässig zu werden, ja auszubleiben, zeigte sich ohne Eifer für das Geschäft, und die Folgen waren manches Mal heftige Scenen. Eine gewisse künstlerische Veranlagung, die man übrigens in der Schule besonders gepflegt hatte, mochte in ihm den Wunsch entstehen lassen, einen anderen Beruf einschlagen zu dürfen. Er zeigte Neigung zum Modellieren; das Herumstehen hinter dem Ladentisch war ganz und gar nicht nach seinem Sinn; aber alle Vorstellungen nach dieser Richtung hin prallten an dem Onkel und Vormund ob.
»Du wirst Deine künstlerischen Fähigkeiten, Dein Urteil über Form und Farbe auch in unserem Geschäft vorteilhaft verwerten können, und meine Firma würde gewiß noch größere Erfolge erzielt haben, wenn auch mir gleiche Begabung zur Seite gestanden hätte.«
Solcherart suchte der Onkel in seiner bestimmten, wenn auch gutherzigen Weise den jungen Menschen von abenteuerlichen Plänen zurückzuhalten.
Wirklich, Karl hatte nichts von einem Kaufmann, hatte alles von einer Künstlernatur. Mit seinen blitzenden Augen, seinem lässig lebhaften Wesen, seinen wechselnden Stimmungen und Einfällen schien er wenig für die stille, einförmige Arbeit des Kontors zu passen. Er geriet in Entzücken über eine hübsche Figur aus Bronze oder Gips, begann sie wohl auch nachzuzeichnen, aber er dachte nicht an ihren Handelswert, an die Rolle, die sie im Hauptbuche spielte. Er war im stande, irgend einen neuen, kunstgewerblichen Gegenstand lediglich deshalb geschäftlich zu vernachlässigen, weil vielleicht die ornamentale Ausschmückung desselben sein fein entwickeltes Stilgefühl verletzte. Einmal war es geschehen, daß er einem Kunden seines Onkels geradezu ungezogen begegnet war, weil dieser sich für den Ankauf einer geschmacklosen Wandgarnitur entschieden hatte. Dergleichen nahm Herr Hilmar manchmal übel. Wenn nun diese Verstimmungen zwischen beiden anhaltender, ernstlicher sich gezeigt hätten, so hätte man daraus auf einen Grund schließen können für Karls Verschwinden, einen Anlaß für ihn, etwas Tolles, Verzweifeltes zu unternehmen. Aber seit einiger Zeit war Ruhe eingetreten zwischen dem jungen Mann und dem alten Herrn.
Josepha, die einzige Tochter Hilmars, war zwei Jahre bei einer Tante in Dresden gewesen, die ein berühmtes Pensionat besaß. Lernen freilich hätte sie auch in Berlin alles mögliche können, aber die ehrgeizigen Eltern legten Wert darauf, daß Josepha sich feine Manieren, angenehme Formen aneigne, sich musterhaft betrage: das sollte sie in dem aristokratischen Pensionat erlernen.
Nun kam sie von dort zurück als eine Schönheit, als eine vollkommene junge Dame, und seither war es gewesen, daß eine Verwandlung mit Karl vorgegangen. Er wurde sanft, geduldig, aufmerksam, sichtlich verliebt in Josepha. Die Eltern schienen das sich offenkundig entwickelte Verhältnis zu begünstigen, und eines Tages hieß es, die jungen Leute seien stillschweigend verlobt; an Josephas achtzehntem Geburtstage sollte die Verlobung proklamiert werden. Nun erst schien Karl sich ganz und gar in sein Geschick fügen zu wollen. Wenige Tage vor dem Geburtstage aber war es, als das Unglück geschah.
Karl führte die Bücher. Gegen Abend war er von seinem Onkel zu einem Geschäftsfreunde geführt worden und gab von da aus telephonisch Nachricht, der Mann käme erst gegen neun Uhr zurück; er, Karl, werde in einem Restaurant so lange warten und dann seinen vorher vergeblichen Besuch wiederholen. Man wartete in der Familie mit dem Abendessen. Karl bewohnte ein möbliertes Zimmer im Hinterhause, aber er pflegte mit am Familientische zu speisen. Heute abend kam er nicht. Gegen halb zehn Uhr fragte man mittelst des Fernsprechers bei dem Geschäftsfreunde an; Karl war zum zweiten Male nicht dagewesen. Man setzte sich verstimmt und unruhig zu Tische, aß wenig oder gar nichts. Der Onkel und die Tante, zwei alte, sehr pedantische Menschen, die auf die Minute zu speisen pflegten, täglich aus den gleichen Gläsern genau das gleiche Quantum Wein tranken, mit dem Glockenschlage zu Bett gingen und wie Uhrwerke arbeiteten, waren von solch einer Unregelmäßigkeit doppelt empfindlich berührt. Inkorrektheiten konnten sie nicht ertragen; entweder mußte Karl ein Unglück zugestoßen sein, oder er betrug sich unverantwortlich.
Nur Josepha war ruhig; sie war ein gelassenes, harmonisches Gemüt. Vorläufig glaubte sie nichts Böses; irgend ein Zufall konnte die Ursache des Ausbleibens sein. Vielleicht auch hatte sie mehr eine ruhige Gewohnheitszuneigung, als eine heftige Leidenschaft für den Mann, der ihr Kamerad und Spielgefährte gewesen, obgleich er mehrere Jahre älter war als sie.
»Er wird kommen, muß jeden Augenblick kommen,« versicherte sie. Sie verschwieg den Eltern, daß sie manchmal deutlich seinen Tritt gehört hatte, wenn er abends, nachdem die Eltern sich bereits zur Ruhe begeben, noch ausging. – Nach dem Abendessen in der Familie spielte er meist vierhändig mit Josepha und zog sich dann auf sein Zimmer zurück. Sie aber hörte ihn nachher oft noch davonschreiten, ihr Schlafzimmer ging nach der Treppe. Sie wußte nicht, wann er nach Hause kam, grollte ihm auch nicht; sie war jung und begriff vollkommen, daß er nicht so leben konnte, wie die Eltern sich einbildeten. Sie verzieh es, weil er das Dekorum wahrte, fühlte sich aber heute nicht beunruhigt, denn er war eben einer Versuchung erlegen, hatte vielleicht einen Dienstmann oder eine Depesche gesandt, die zufällig ihr Ziel verfehlt hatten. Er kam ja sonst nach Hause, wenn auch noch so spät, und während die Eltern unruhig und ärgerlich dasaßen, zur gewohnten Stunde nicht zu Bett gehen wollten, blickte sie gleichmütig drein aus ihrem schönen, gelassenen Gesichtchen, in ihrer ruhigen, musterhaften Haltung: Er würde schon kommen! –
Aber er kam nicht, kam nicht.
Als es Mitternacht geworden, riet sie den Eltern, zur Ruhe zu gehen. Es kostete sie einen Entschluß, zu verraten, daß er schon manchmal des Nachts fortgeblieben, es hätte auch wohl heute nichts damit zu bedeuten. Im ersten Augenblicke waren die Eltern entrüstet über Karl, über Josepha, die gewissermaßen sein Verhalten beschönigte, aber sie waren doch auch andererseits beruhigt und gingen in ihr Schlafzimmer. Auch Josepha suchte die Ruhe. Bald darauf glaubte sie Karls Schritt zu hören, und so schlief sie ein.
Schon um sechs Uhr stand der Papa auf, eine Stunde früher als sonst verließ er sein Schlafzimmer und begab sich hinauf in Karls Zimmer. Bleich und verstört kehrte er zurück: Karl war nicht da, nicht gekommen.
Eiligst kleideten sich die beiden Damen an. Nun war man ernstlich bestürzt; man ließ auch vor den Dienstboten die Maske fallen, lief unruhig und ratlos umher. Josepha blieb verhältnismäßig die Ruhigste, sie sagte gelassen:
»Er hat sich einen Rausch geholt, den er irgendwo ausschläft, weil er sich schämte.«
Aber auch diese ungewisse Möglichkeit zerfiel sehr bald, denn der Morgen stieg höher und nichts wurde vernehmbar. So machte sich Papa denn auf, nahm eine Droschke, fuhr zur Polizei. Man wußte nichts von Karl; keiner der in der Nacht Verunglückten oder Verhafteten konnte Karl sein. Herr Hilmar fuhr nach Hause in der Hoffnung, der junge Mann werde inzwischen angekommen sein; es ging bereits auf zehn, – aber auch das war eine Täuschung. So entschloß man sich, die Diener zu Freunden zu schicken, zu Verwandten und Bekannten Karls; niemand wußte von ihm zu melden.
Inzwischen versammelte sich das Personal des Hauses. Das Gerücht lief durch die langgestreckten Verkaufsräume: Der junge Herr wird vermißt; er ist seit gestern nicht gekommen. Teilnehmend hörten es die meisten, weil sie gut behandelt wurden, wenn auch streng gehalten.
Fräulein Pauline war die einzige Dame im Geschäft. Man wunderte sich vielfach, daß sie auf ihrem Posten aushielt; sie meinte aber, ein Mädchen müsse seine Tugend selbst schützen; je größer die Gefahr, desto größer war auch das Verdienst. Uebrigens war die Gefahr nicht groß in diesem Mustergeschäft, bei dieser feinen Kundschaft. Allerdings, es fehlte nicht an Versuchung, denn sie war eine pikante, üppige Blondine, kokett gekleidet, von ein wenig auffälligem, sehr entschiedenem Wesen. Nach ihrem Aeußeren hätte man sie für eine leicht zugängliche Kokette halten mögen, aber sie ging nie über einen harmlosen Scherz hinaus; wer mehr versuchte, dem begegnete sie nachdrücklich, ja grob. Sie unterstützte von ihrem Gehalt die Mutter und jüngere Geschwister.
Niemand bemerkte, daß Fräulein Pauline, die Kassiererin, die sich sonst durch außerordentliche Pünktlichkeit auszeichnete, heute fehlte. Schlag acht Uhr sah man sonst ihren hübschen, blonden Kopf hinter dem Kassentischchen auftauchen, jetzt – um halb neun Uhr – kam sie an, ganz atemlos und dunkelrot.
»Wissen Sie vielleicht etwas von ihm?« rief ihr der erste Kommis entgegen, ein ganz kleines, aber sonst hübsches Männchen mit gebrannten Locken und geschniegelter Toilette.
»Von wem?« fragte Pauline verwundert. Sie hatte ganz vergessen, daß Karl gestern abend nicht mehr in das Geschäft gekommen war.
»Von dem jungen Herrn. Er ist nicht nach Hause gekommen.«
Das junge Mädchen fuhr erzürnt auf:
»Wie soll ich wissen, was mit ihm geworden ist! Sie glauben doch nicht, daß ich Rendezvous mit ihm habe? – Es ist empörend.«
»Sie waren so aufgeregt, Fräulein Pauline,« meinte jener begütigend; »und außerdem, ich sah es doch, Sie hatten immer ein Auge auf ihn.«
Der kleine, hübsche, parfümduftende Kommis war offenbar eifersüchtig; Pauline aber hörte nicht auf die Anzüglichkeiten. Jetzt erst gab sie der Vorstellung Raum: Er ist nicht nach Hause gekommen, und mit dem Ausdruck des Schreckens und der Besorgnis fragte auch sie:
»Was ist aus ihm geworden?«
In fünfzig Varianten erzählte man ihr:
»Der junge Herr ist ausgeblieben. Vom jungen Herrn ist nichts zu hören, nichts zu sehen.« Niemand aber wußte ihr Näheres zu sagen.
Man hatte es, wie gesagt, nicht bemerkt, daß sie zu spät gekommen war, sie, die Pünktlichkeit selbst. Sie dachte einen Augenblick daran, sich beim Chef zu entschuldigen, aber er hörte sie nicht; er hatte ihr Zuspätkommen übersehen.
Alles fraternisierte heute mit dem Chef, lobte den Verschwundenen, kombinierte mit dem alten Herrn, wo Karl geblieben sein könne. Man hatte sonst gewaltigen Respekt vor dem Chef, der in seiner steifen, würdigen Haltung eine gewisse Unzugänglichkeit sich zu wahren gewußt. Heute machte der Schreck, die Besorgnis alle gleich; nur der kleine Kommis machte auch diesmal eine Ausnahme. Ein Kundiger hätte ihm die schlecht verhehlte Schadenfreude vom Gesicht lesen können.
Der junge Herr, der Verlobte der schönen Tochter des Hauses, nach dem auch die pikante Pauline angelte, war fort, verschwunden. Das war eigentlich kein Grund, sich zu ärgern. Der kleine Kommis hieß Waldenburg; er entstammte einem alten Adelsgeschlecht, aber der Chef hatte ihm die Bedingung gestellt, von seinem Adel keinen Gebrauch zu machen, und jener ging darauf ein, tat auch seine Schuldigkeit, aber er spielte doch gern den Freiherrn, den Ritterlichen, den Mann von Welt; auch hatte er wirklich seine Manieren. Anfangs machte er Josepha den Hof, und wenn diese es nicht merkte, so warf er sich auch ein wenig zum Kavalier der schönen Kassiererin auf. Alls reinem Vergnügen an der Sache geschah das alles; Josepha war ja nicht mehr frei, und Pauline würde ihn nicht erhören. Unbegreiflich genug war, warum sie sich so spröde zeigte. Ein hübsches Mädchen, das von früh bis abends an der Kasse saß und nach einem Vergnügen, einer Zerstreuung lechzen mußte, dazu ein tugendhaftes Mädchen, dem zarte Huldigungen gefallen mußten, und er, Waldenburg, war galant und ritterlich. Ach, er hatte alles: Namen, hübsches Aeußere, gewinnende Manieren, eine auskömmliche Stellung, nur er war zu klein. Josepha reichte er kaum an die Schulter, Pauline bis an den oberen Rand des Ohres; der sechzehnjährige Lehrling des Hauses war größer als er. Ach, wie froh war Herr von Waldenburg: Der hübsche, junge »Chef« war fort, neben dem nicht aufzukommen war. Tot? – Nein, tot brauchte er nicht zu sein, nur durchgebrannt, weil er eine Dummheit gemacht hatte, weil er eine andere liebte. Nur wiederkommen sollte er nicht; irgendwo in Amerika mochte es ihm wohlgehen, nur hier nicht.
Josepha war heute unten nicht zu sehen, also konnte man Pauline ein wenig Aufmerksamkeit zuwenden. Im Grunde genommen gefiel ihn? Pauline besser als Josepha, aber diese war doch die Tochter des Chefs.
»Warum kamen Sie heut so spät, Fräulein Pauline? – Es ist doch kein Unfall in Ihrer Familie geschehen?« –
»Ja, doch,« flüsterte Pauline. »Meine Tante hatte einen Schlaganfall.«
Waldenburg schnellte empor. Jene Tante war, wie er wußte, eine Erbtante, sie sollte Vermögen besitzen, ein geheimnisvolles Testament deponiert haben. In seinem findigen Vorstellungsvermögen entwickelten sich liebliche Möglichkeiten.
»Ist sie tot?« fragte er.
»Nein, es war nur eine Streifung.«
»Aber wenn es sich wiederholt?« fuhr er fort.
»Ach, wer wird daran denken!« wies ihn Pauline ab.
Er aber dachte daran. Wenn Pauline erbte! Sie gefiel ihm, aber ein ganz armes Mädchen heiraten, war doch ein Wagestück. Wenn er jedoch Ernst machte, seinem Namen würde man nicht widerstehen, und sein Rivale im Geschäft war fort, verschwunden. Leise flüsternd erwog er mit Paulinen die Chancen für die Genesung ihrer Tante; sie waren wie das junge Mädchen leider selbst zugeben mußte, gering. Aber sie sprach über das alles, offenbar ohne auch nur zu ahnen, woran Waldenburg dabei dachte.
Der Chef hatte sich in seiner Aufregung wieder entfernt, er war nochmals zur Polizei gegangen. Zehn Uhr war längst vorüber, man mußte jetzt etwas wissen. Ein zufälliges Ausbleiben war gar nicht mehr möglich; wenn Karl aus irgend einem Grunde bei einem Freunde übernachtet hatte, so hätte er längst hier sein müssen.
»Mein Gott, wie verwirrt mein Mann ist!« sagte Frau Hilmar. »Da hat er den Schlüssel an meiner Privatkasse stecken lassen. Zum Glück sind ehrliche Leute hier.«
»Und Fremde kommen nicht in das Comptoir,« beruhigte sie Waldenburg. Er sagte das ganz unbefangen. Plötzlich aber veränderte sich seine Miene; mit eigentümlichem Ausdruck hing sein Blick an der Kasse. Wenn darin Geld fehlte – wenn »er« – der glänzende Karl, der Sieger bei allen Frauen – o, es wäre großartig!
Nein, er, Waldenburg wünschte niemand etwas Böses. Aber diesen Karl hätte er manchmal erwürgen können. Anfangs hatte jener sehr auffällig mit Pauline, der hübschen Kassiererin, getändelt, und ihm, Waldenburg, gefiel das Mädchen selbst. Aber gegen den sieghaften, jungen, schönen – ach, so schlank gewachsenen Herrn Hilmar – konnte der fast komisch kleine Freiherr nicht aufkommen.
Und dann kam Josepha – wieder ein schönes Mädchen! Jetzt kaperte der verführerische Karl diese – nur so im Handumdrehen. Es war wirklich empörend. O – wenn dieser unwiderstehliche Held mit der Kasse durchgebrannt wäre! –
Aber niemand dachte an diese Möglichkeit. Es war wohl auch Unsinn. Der junge Mann war wohlsituiert, war als künftiger Schwiegersohn auch der präsumtive Erbe.
Nein – es war nichts! Die Kasse war doch intakt!
Und Waldenburg wandte sich indigniert ab.
Die Privatkasse war eigentlich diejenige der Frau Hilmar. Sie enthielt die Depositenscheine über ihre Mitgift nebst einigem barem Gelde. Bei der musterhaften Ordnung auch in den Privatverhältnissen des Hauses war man darüber einig geworden, daß Frau Hilmar einen gewissen Teil ihrer Ausgaben aus ihren Privatmitteln bestreite, und das geschah aus jener wohlbesetzten kleinen Kassette, die morgens aus dem großen Geldschrank genommen wurde, um abends wieder unter Verschluß zu gelangen. Jetzt zog sie den Schlüssel ab und verbarg ihn ängstlich.
Und jetzt kamen auch Kunden. Die neuen Armleuchter mit farbigen elektrischen Glühlämpchen waren ein begehrter Artikel geworden, ebenso die reizenden Blumenvasen aus einer Kombination von Marmor und Bronze. Waldenburg verkaufte mit gewohnter Beredsamkeit und gewohntem Erfolge. Und jetzt kam der alte Hilmar vom Polizeibureau zurück, sank in einen für die Kunden bestimmten Sessel.
»Keine Spur von ihm, man weiß nichts,« jammerte er, ohne auf die im Laden Anwesenden zu achten. Zwei Damen, welche eben eine Schreibtischgarnitur erhandelten, zeigten Teilnahme; der Chef beachtete sie kaum. Er klagte weiter:
»Und es ist doch kein Grund vorhanden, absolut keiner! Der Junge war gut gestellt, hatte Geld, er hatte auch keine Schulden; ich habe eben sein Ausgabenbuch gesehen, auch nachgefragt, wo immer eine Möglichkeit gewesen wäre; niemand weiß von Schulden. Er war kerngesund und hatte eine schöne Zukunft vor sich. Er war verlobt und liebte meine Josepha; das Leben lag vor ihm wie eitel Rosenfarbe und Sonnenlicht.«
»Es muß ihm ein Unfall zugestoßen sein,« bemerkte Waldenburg, während er den Damen auseinandersetzte, daß cuivre poli ein überwundener Standpunkt sei.
»Dann wüßte man's auf der Polizei,« fuhr der Alte fort, »der Junge wäre in einem Krankenhause. Ich habe überall angefragt und anfragen lassen.«
Alle schwiegen. Der Chef konnte sich nicht beruhigen.
»Er muß irgendwo verunglückt sein, z. B. an einem der Seen; anders kann man außerhalb Berlins nicht leicht zu Schaden kommen, und in der Stadt ist ihm nichts geschehen, sonst wüßte man es auf der Polizei. Was aber bestimmte ihn, gestern abend hinauszugehen ohne uns, ohne Josepha? Er sollte und wollte doch um neun Uhr bei meinem Geschäftsfreunde sein, hat dort sein Wiederkommen in Aussicht gestellt. Von diesem Augenblicke an fehlt jede Spur von ihm. Wenn ihn schon die Lust zu einem Ausfluge ankam, warum sollte er uns nicht benachrichtigt haben, und wär's selbst mit einer Ausrede? – Mein Gott, ich selbst habe nie eine Ausrede gebraucht, aber die junge Welt von heute ... nun, ich würde es ja gelten lassen, es kann ja vorkommen! Aber so ohne Erklärung abends, da er noch geschäftlich zu tun hatte, etwa nach dem Müggelsee zu fahren und dort zu ertrinken, – und auch gleich zu ertrinken! Und man wüßte auch das bei der Polizei, man müßte eine Nachricht haben!«
Die beiden Damen hörten schweigend zu; das rätselhafte Unglück interessierte sie mehr, als die Schreibtischgarnitur in vieil argent.
»Er wird fortgereist sein,« wagte Waldenburg zu bemerken.
»Aber warum? – Und warum heimlich?« fragte der Alte, der in dieser Stimmung auf alles einzugehen bereit war. –
Niemand antwortete, und plötzlich brach Herr Hilmar in Verzweiflung aus:
»Er ist tot, tot!« Der alte Mann war ganz gebrochen.
Inzwischen war Josepha eingetreten.
»Nein,« versicherte sie bestimmter als es sonst ihre Art war, »er ist nicht tot. Es kann nicht sein, Papa.«
Zufällig begegnete ihr Blick dem Paulinens, und diese erwiderte zuversichtlich:
»Nein, er ist nicht tot; ich glaube es nicht. Er wird wiederkommen!«
*
Ein Schuß krachte. – Armin Bode stieß einen Schreckensschrei aus. Er war noch spät abends in den Tiergarten gegangen, um einen Spaziergang zu machen; er hatte sich dabei in dem fremden, ungeheueren Park verlaufen. Das steigerte das Gefühl der schmerzlichen Bangigkeit, die ihn in diesen Tagen befallen hatte, zu heftigem Weh.
Er war vollständig fremd in Berlin. In einer entfernten Provinzstadt war er als einziger Sohn kleiner Bürgersleute aufgewachsen, hatte gute Schulbildung und eine praktische Kenntnis sich erworben; nun waren seine Eltern rasch hintereinander gestorben, und er stand allein.
Allein und traurig hatte er ein Abendbrot eingenommen, das ihm nicht schmeckte, denn er war die süddeutsche Kost gewöhnt: nun ging er in den Tiergarten in der unbestimmten Erwartung, auf irgend einer Bank einen Menschen zu finden, der mit ihm plauderte – irgend eine Bekanntschaft zu machen. Wie oft hatte er derlei in Romanen gelesen! – Aber das Glück war ihm nicht hold. Zwei junge Damen, die er schüchtern zu grüßen wagte, als er sich neben sie setzte, wandten ihm den Rücken; ein alter Herr erwies sich als schwerhörig und ein jüngerer war mißtrauisch und unzugänglich. So stand Arnim sehr bald auf, um nach weiterem Wandern wiederum Platz zu suchen, um neuerdings nichts erlebt zu haben.
Dabei verlor er die Richtung, und als ihn jemand nach der Charlottenburger Chaussee weisen wollte, verlief er sich noch mehr; die Weisung war falsch gewesen, oder er hatte sie falsch verstanden.
Es dunkelte, und die Wege wurden einsam hier draußen in der Gegend des neuen Sees, wo der Park nirgends erleuchtet war; und diese fremde, dämmernde, einsame Parkwildnis machte ihn melancholisch, schien ihm symbolisch für seine Existenz.
Und jetzt krachte ein Schuß im Gebüsch.
Der ahnungslose Spaziergänger zitterte vor Schreck. »Ein Selbstmörder!« zuckte es ihm durch's Hirn. »Einer von denjenigen, die in der Riesenstadt einen harten Kampf ums Dasein führten und erlagen.«
O Gott, war das eine Vorbedeutung für ihn? –
Aber er durfte nicht müßig bleiben. Ohne Rücksicht auf seine Kleider drang er in das Gebüsch, woher der Schuß gekommen. Er erbebte im innersten Herzen, als er, mit dem Rücken gegen einen Stamm lehnend, eine dunkle, schwach ächzende Gestalt erblickte. Zaghaft trat er näher. Er wußte, derlei war in der Großstadt eine alltägliche Erscheinung; für ihn aber bot sich da etwas Neues, Unerhörtes, das er sich vielleicht einmal in müßigen Stunden nach aufregender Lektüre vorgestellt, das er aber niemals glaubte, selbst erleben zu müssen. Sein Herz drohte ihm zu zerspringen.
Es war ein junger Mann ungefähr in demselben Alter wie er; der Kopf hing ihm zur Seite, er schien bewußtlos. Aus einer kleinen Wunde an der Schläfe rieselte Blut.
Arnim stand ratlos. Was sollte er tun? – Hilfe herbeirufen? – Es war so still und einsam hier, woher Hilfe nehmen? – Oder sollte er selbst –? Aber wie?
Er preßte sein Taschentuch auf die Schläfe des Fremden, eine ganze Weile hindurch; plötzlich schlug der junge Mann die Augen auf, seufzte und lächelte schwach, wie geistesabwesend. Dann murmelte er:
»Da – der Ring, – bitte gleich – rasch – Josepha – Luisendenkmal – gleich –«
Er streckte Arnim die Hand hin. Da steckte ganz lose ein schmaler Reif mit einem Türkis, ein bescheidenes Ringlein. Noch einmal murmelte der Sterbende:
»Nur rasch!«
Arnim nahm, sinnlos vor Aufregung, den Ring und stürzte davon. Er überlegte nichts, er wußte nur, es gab ein Luisendenkmal im Tiergarten, und dort wartete Josepha; er mußte sie rufen.
Wie ein Verzweifelter stürzte er irgend einen Weg entlang, blindlings, sinnlos; er wollte ja Josepha rufen. Dann blieb er plötzlich auf einem einsamen Pfade stehen. Was wollte er eigentlich? – Er konnte eine Stunde umherirren, bevor er das Luisendenkmal fand. Und war Josepha auch dort? – Und würde sie ihm folgen? – Was um Gottes willen sollte er ihr sagen? – Welch ein Narr er war! – Aber was sollte er tun? –
Da stand er nun völlig ratlos. Der Abendwind rauschte in den Bäumen, und aus weiter Ferne hörte man die Züge der Stadtbahn donnern, die Equipagen der Tiergartenvillen dahinrollen. Greifbar nahe toste um ihn das Treiben der Hauptstadt, greifbar nahe und doch ihm unerreichbar.
Plötzlich erschrak er über seine eigene Torheit. Wie konnte er den Sterbenden, den mindestens schwer Verwundeten verlassen, um einem Phantom nachzujagen, einer romantischen Grille, dem unklaren Wink eines fast Bewußtlosen? – Er hätte nichts weiter tun müssen, tun dürfen als Hilfe bringen. Gewiß, der Park war nicht so einsam als es schien; man brauchte nur einigemale laut um Hilfe zu rufen, und sie wäre dagewesen.
Er kehrte um, fand sich nicht gleich zurück. Nun lief er in wachsender Angst, schweißgebadet hin und her. Da endlich, da war die Stelle: ja, er erkannte sofort den mächtigen Stamm hinter dem leichten Gebüsch, – aber nein – hier war ja niemand, – alles leer und still. – Hier war's nicht gewesen. – Aber wo sonst? – Trieb ein böser Dämon sein Spiel mit ihm?« –
Und doch, hier muß es recht sein. Da lag sein zerknilltes, blutiges Taschentuch, da war auch auf dem Grase ein schauerlich dunkler Fleck, eine kleine Blutlache. Der Sterbende war fort. Ohne Zweifel hatten auch andere den Schuß gehört und waren herbeigeeilt: sie hatten ihn fortgetragen. War er tot? –
Am andern Morgen vermeinte Arnim es geträumt zu haben, aber genau wie er es oft in verschiedenen Dichtungen gelesen, z. B. im »Stillen Dorf« von Baumbach: das Türkisenringlein erinnerte ihn an die volle Wirklichkeit. Dennoch wandelte er umher wie ein Träumender. Das Bild des Selbstmörders schwebte ihm vor, das bleiche Gesicht mit der blutenden Wunde an der Stirnseite. Unaufhörlich wiederholte er sich die wenigen Worte des Selbstmörders. Der Selbstmörder – das war das Band, welches ihn nun mit der ihm so fremden Außenwelt verknüpfte.
Und Josepha? – Das arme Kind hatte mit schwerem Herzen gewartet und gewartet auf ihn, und er kam nicht, er war ihr entflohen in die Ewigkeit.
Mit äußerster Spannung erwartete Armin die Abendblätter. Sie erhielten nichts von dem Fall, obwohl heute eine ganze Serie von Selbstmorden verzeichnet waren, merkwürdigerweise kein einziger Erschießungsfall. Auch nicht die Zeitungen der folgenden Tage brachten eine Nachricht, welche auf den Vorfall hätte angewendet werden können, und die Tageschronik nahm doch sonst so pünktlich Notiz von derartigen Unglücksfällen; es hätte dieser ihr unmöglich entgehen können. Der Tiergarten liegt niemals so still und einsam, wie es ihm zu jener Zeit erschienen war. Wer immer den Selbstmörder gefunden hatte, der mußte sich doch an die Polizei wenden; es mußte etwas verlauten. Aber es drang nichts an die Oeffentlichkeit. Zu sonderbar! Wie ging das zu? – Wirklich nur ein Traum? – Aber der Ring war da, der fremde Ring, der eine unbekannte Leidensgeschichte umschloß. – Tag und Nacht grübelte er darüber; der Ring indessen blieb stumm, stumm.
Das einzig Korrekte wäre gewesen, den Ring bei der Polizei zu hinterlegen; aber dann erhielt ihn »Josepha« wohl niemals. Wie sollte sie auch auf den Gedanken kommen? – Diese formale Ehrlichkeit wäre diesmal Unehrlichkeit gewesen. Er mußte die Mission des Sterbenden erfüllen und er wollte es auch gern. Nun hatte er um jemanden zu sorgen, an jemand zu denken, an »Josepha«. In seinem kleinen, kahlen Hotelzimmer, auf seinen Wegen durch die fremden Straßen dachte er an Josepha. Sie war jung und hübsch, und sie war geliebt worden. Er, Armin, ersann sich Roman um Roman. – Und er sollte ihr den Ring bringen. Durfte er den Ring und was daran hing, nicht als sein Erbe betrachten? – Würde Josepha ihn nicht lieben können? –
Er suchte in den Straßen ein junges Mädchen mit ernster, kummervoller Miene, vielleicht war es Josepha; er wollte dann auf sie zutreten, ihr fragend die Hand mit dem Ringe reichen. Aber alle jungen Mädchen lachten oder lächelten. Endlich schalt er sich einen Narren.
Dann fiel ihm ein Ausweg ein, das Luisendenkmal. – Vielleicht hatte Josepha an jenem Abende dort gewartet. – Er war nach mühseligem Suchen neulich zum ersten Male dort gewesen, aber er fand niemanden. Sie war längst fort, wenn sie überhaupt dagewesen. – Aber gewiß, es war dies ein Rendezvousplatz, es war auch derjenige, von dem der Sterbende gesprochen. Und nun wählte er dieselbe Stunde, das Denkmal aufzusuchen, gegen neun Uhr abends. Aber alles blieb vergeblich.
Stundenlang promenierte er zwischen den beiden weißen Marmorbildern einher. Abend für Abend, jede vorübergehende Dame scharf beobachtend, und bald mußte er sehen, daß die eine sehr bald von einem Wartenden in Empfang genommen wurde, die andere eilig den Platz kreuzte, offenbar ohne auf irgend eine Begegnung zu rechnen.
Endlich faßte er einen Entschluß; er setzte ein Zeitungsinserat auf: »Josepha, komm heute abend gegen neun Uhr zum Luisendenkmal.« – Es war ein Betrug, denn wahrscheinlich würde sie auf »ihn« raten, auf den Gestorbenen. Sie wußte wohl heute noch nichts von seinem Tode. Aber ein frommer Betrug war es. Auf diesen Ruf würde sie kommen, und er würde sich seiner Pflicht, seines stumm gegebenen Versprechens entledigen können.
Und nun hatte er eine Aufgabe, nun hatte er einen Zusammenhang mit der Menschheit. Er wartete jeden Abend am Luisendenkmal, den Türkisenring am Finger; eine traurige Mission freilich, aber er wartete doch auf jemanden, und zwischen den vielen fremden Menschen schien er sich nicht mehr so verlassen wie zuvor. –
Freilich, Josepha kam nicht. Er umschritt das Denkmal wieder und wieder, schon hätte er jede Linie desselben aus dem Kopfe zeichnen können; er studierte die Muster und Blumenflora hinter dem Gitter, er kannte jede Blume, er befreundete sich mit dem Ziergesträuch und trieb so sein Spiel. Damen allein kamen jetzt, wo der Winter nahte, nur noch selten, entweder schüchterne, die schnell vorüberhuschten, oder man sah es, sie schritten auf einen bestimmten Punkt zu, auf dem sie jemand erwartete, oder endlich kecke, Abenteuer suchende Damen, die nicht Josepha waren. Keine war Josepha, und er ging trauernd nach Hause in sein Hotel, vier Treppen hoch in das kahle, kleine Zimmer, und sein Herz jammerte.
Er war sparsam, dennoch erschien die Zeitungsannonce täglich und verschlang Unsummen. Er wußte nichts anderes und Josepha mußte er finden.
Eines Abends – der dritte oder vierte war es, den er in diesem Monat hier verlebte, – der Himmel war bedeckt, es dunkelte bereits früh, und es war recht einsam um das Denkmal, er stand im tiefen Schatten eines Baumes, da kam zaghaften Schrittes eine tiefverschleierte, dunkelgekleidete Frauengestalt daher. Sie blieb vor dem Denkmal stehen und schien es zu betrachten. Aber es war schon zu dunkel, und sie sah auch nicht hinauf nach dem schönen Königsbilde. Leise und zaghaft frug er:
»Fräulein Josepha, sind Sie's?«
Sie blieb stehen, erwiderte fast zitternd:
»Ja, ich bin es.«
Sie war es! –
»Ist's wahr? – Ist's möglich?« stammelte er.
»Leider ja. Ich bin eine rechte Törin! – Nie hätte ich es wagen dürfen in dieser Stunde, aber ich habe es doch gewagt.«
Er verstummte. Sie wunderte sich so gar nicht und sie frug so gar nicht nach jenem. Vielleicht aber kannte sie schon sein Schicksal, vielleicht auch war er nicht tot.
»Sind Sie es denn wirklich, Josepha?«
»Ja,« wiederholte sie, »ich bin es.« Sie schlug den Schleier zurück. Ein hübsches, lächelndes Gesicht, das sich ihm eifrig hinneigte. Er begriff nicht, was hier vorging.
»Und der Tote?« frug er.
»Lassen Sie ihn doch ruhen,« antwortete sie, »ich bin frei.«
»Ist er also wirklich tot?«
»Gewiß ist er tot, mein Mann.«
»So war es Ihr Mann? – Und dieser Ring?«
»Was ist's mit dem kleinen Ringe?« fragte sie.
»Sie kennen ihn nicht?« rief er verwundert aus. »Nein? – So sind Sie also nicht Josepha?«
»Freilich bin ich das, und Sie – Sie sind doch der Herr, der mir abends immer folgte?«
»Niemals bin ich Ihnen gefolgt, ich sehe Sie zum ersten Male.«
Josephine lachte laut auf.
»Ach, das ist zu komisch! – Sie suchen eine andere und ich einen anderen, denjenigen, der mir tagelang nachstellte, – zu komisch!«
Und sie schüttete sich aus vor Lachen; schließlich mußte er auch lachen. Er war halb enttäuscht, halb belustigt.
»Gehen wir nun doch ein wenig spazieren, da uns das Schicksal so zusammengeführt!« schlug er vor.
Und sie gingen. Sie plauderte heiter und unbefangen; sie war Witwe und lebte bei einer strengen Tante, wollte sich ein wenig amüsieren. Und er, – was wollte er nur mit dem Toten, Josepha? – Er widersprach: Er hätte Pflichten gegen sie zu erfüllen.
»Ach, lassen wir die Gespenstergeschichten, amüsieren wir uns! – Wir sind jung, wir leben.«
Sie schlug ihm vor, da und dorthin zu gehen; er kannte ja noch gar nicht die Vergnügungen der Großstadt. Sie wußte um so besser Bescheid.
Als sie neuerdings das Monument passierten, wohin er unwillkürlich wieder gelangt war, sah er plötzlich ein süßes, blasses Mädchengesicht mit traurigen, fragenden Augen; sie schien auf jemanden zu warten. Plötzlich wurde es ihm klar: Die Josepha an seiner Seite war die Sirene, die ihn verlockte in den Sumpf der Großstadt. Er riß sich gewaltsam los, plötzlich aber besann er sich noch, führte sie ritterlich bis zu einer Droschke, und nun stürzte er zurück nach dem Denkmal. –
Da stand die andere noch immer und wartete.
»Josepha, Du bist es!« – Ganz unwillkürlich sagte er Du und er eilte mit offenen Armen auf sie zu. Sein Herz sagte es ihm ja, das war die richtige Josepha. Und da hing sie auch schon an seinem Halse.