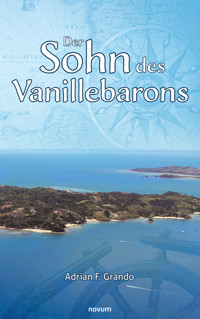
17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: novum Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der 16-jährige Eric Gabriel wagt Mitte der dreißiger Jahre den Umzug in die französische Kolonie Madagaskar, um endlich wieder mit seinem Vater, der dort erfolgreich eine Vanilleplantage betreibt, vereint zu sein. Unwissend über die seeräuberische Vergangenheit seines Großvaters und eingehüllt in die Tradition einer Seefahrergeneration, wird Eric mit der bedrohlichen Realität von rebellischen Einheimischen, lokalen Aufständen und den Absichten von Nazideutschland konfrontiert. In diesem turbulenten Umfeld sucht Eric Halt in seiner ersten Liebe und der brüderlichen Freundschaft mit einem madagassischen Jungen aus dem Arbeiterdorf. Während er nach seinem Platz in der Hierarchie des väterlichen Unternehmens sucht, droht ihn jedoch die unbekannte Vergangenheit seiner Familie einzuholen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 484
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Impressum
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie.
Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://www.d-nb.de abrufbar.
Alle Rechte der Verbreitung, auch durch Film, Funk und Fernsehen, fotomechanische Wiedergabe, Tonträger, elektronische Datenträger und auszugsweisen Nachdruck, sind vorbehalten.
© 2025 novum publishing gmbh
Rathausgasse 73, A-7311 Neckenmarkt
ISBN Printausgabe: 978-3-7116-0417-0
ISBN e-book: 978-3-7116-0418-7
Lektorat: BA
Umschlagfotos: Yevhenii Tryfonov, Mirecca | Dreamstime.com
Umschlaggestaltung, Layout & Satz: novum publishing gmbh
www.novumverlag.com
Widmung
für meine Frau Ursula
Libertalia
Der Mythos rankt sich um drei faszinierende Persönlichkeiten, die das Schicksal von Madagaskar geprägt haben sollen: ein gebildeter Franzose namens Misson, der Dominikaner-Pater Caraccioli und der draufgängerische Kapitän Louis Gabriel aus Marseille. Der Ursprung dieser Geschichten führt nach Rom, wo Misson und Caraccioli sich 1690 begegneten und beschlossen, gemeinsam in die Karibik zu segeln, um Jagd auf Piraten zu machen. Für dieses riskante Abenteuer engagierten sie den kühnen Kapitän, der über Seeerfahrung und Unerschrockenheit verfügte.
Auf ihrer Reise kaperten sie Schiff um Schiff, machten auf den Komoren Halt, kämpften an der Küste Mosambiks und vergrößerten stetig ihre Mannschaft. Ihr Traum von einer Republik, in der Piraten frei und brüderlich leben könnten, führte sie zur Bucht von Diego Suarez im Norden von Madagaskar. Dort schufen sie einen versteckten Schlupfwinkel mit 40 Kanonen zur Sicherung der Einfahrt. Eine Stadt, eine Werft und ein Vorratslager entstanden und in wenigen Monaten beherbergte Libertalia, eine der ersten Demokratien der Neuzeit, 600 Piraten.
Dieses utopische Staatswesen endete allerdings bald im Chaos. Zwei Versionen des Untergangs existieren: Entweder griff die französische Flotte die Stadt an, als die meisten Piraten auf Kaperfahrt waren, oder die Ureinwohner metzelten alle Einwohner nieder und setzten Libertalia in Flammen.
Wie auch immer, die heimkehrenden Piraten bauten Libertalia nicht wieder auf, sie zogen weiter. Lediglich Kapitän Louis Gabriel überlebte auf der Insel Sainte Marie vor der Ostküste Madagaskars und verbreitete dort noch jahrelang Angst und Schrecken zur See. Ein von seiner begeisterten Gefolgschaft errichteter Gedenkstein erinnert an seine Beliebtheit und die heroische Piraten-Epoche.
Prolog I
1879–1918
Der Nachthimmel zeigte sich im Herbst 1879 in finsterem Schwarz, ohne Mond und Sterne. Einzig die abgedeckte Decksbeleuchtung beim Steuermann ließ die Konturen der Handelsfregatte rund ums Kartenhaus schemenhaft erkennen. Breitbeinig, die stampfenden Bewegungen des Schiffs ausgleichend, stand der 29-jährige erste Offizier, Luc Gabriel, auf dem Achterdeck und lauschte dem Meeresrauschen. Der Wind knarrte in den Masten und Spieren. Den Blick nach Südwesten gerichtet, beobachtete er das bedrohliche Wetterleuchten. Die Nase im stetig wehenden Nordostpassat, der die Segel füllte, spürte er die rasante Fahrt des Schiffs. Seine Stimmung war schlecht und Sorgenfalten zeigten sich auf seinem Gesicht. Nicht das Wetterleuchten oder die pechschwarze Nacht bereitete ihm Unruhe. Als Mitglied einer jahrhundertealten Seefahrerdynastie war er den harten Elementen der See gewachsen. Vielmehr machte ihn die Route, die sie auf dem Weg nach Durban durchkreuzen mussten, unruhig. Der Kapitän hatte entschieden, die Straße von Mosambik zu meiden und stattdessen der Ostseite von Madagaskar zu folgen. Luc konnte diese Entscheidung nicht nachvollziehen. Sainte Marie, die von Gerüchten und abenteuerlichen Schauermärchen umrankte Pirateninsel an der Ostseite von Madagaskar, war gefährlich. Von der Handelsgesellschaft, für die sie segelten, waren sie ausdrücklich davor gewarnt worden. Der Kapitän hatte den Kurs festgelegt, war in seine Kabine zurückgekehrt und hatte es dem ersten Offizier überlassen, eine sichere Durchfahrt zu gewährleisten. Luc hätte das Unwetter direkt durchsegeln wollen, auf einem für ihn weniger gefährlichen Weg. Aber Befehl war Befehl! Er konnte und wollte sich nicht widersetzen, nicht vor der Mannschaft. Seine Karriere und sein Ruf als ergebener Offizier hingen davon ab. Luc träumte davon, selbst Kapitän eines Handelsschiffs zu werden, und da war Befehlsverweigerung keine Option.
Seufzend begab sich Luc zu einer weiteren Runde an Deck. Das Achterdeck wurde zuerst abgeschritten, dann setzte er seinen Weg steuerbordseitig fort. Er überprüfte die Segelstellung, kommunizierte mittschiffs mit dem Matrosen im Topp und stellte so sicher, dass dieser weiterhin wachsam nach Schiffen Ausschau hielt und jegliche Entdeckungen sofort meldete. Schließlich erreichte er den Bug, wo er eine Weile verweilte. Trübsinnig und in Gedanken versunken, setzte Luc seinen Rundgang zurück zum Kartenhaus auf der backbordseitigen Route fort. Seine Stimmung und eine unheilvolle Vorahnung begleiteten ihn weiter. Am Kartenhaus angekommen, bestätigte er den vorgegebenen Kurs beim Steuermann und entschied sich, einen zusätzlichen Ausguck im Bug zu postieren, um mögliche Kontakte zu anderen Schiffen frühzeitig zu erkennen. Die Stunden seiner Wache verstrichen ohne nennenswerte Ereignisse. Der Wind blies weiterhin konstant und in nahezu gleichbleibender Stärke. Angesichts der undurchdringlichen Wolkendecke konnte Luc die genaue Position des Schiffs nicht feststellen. Er musste bis zum Morgengrauen warten, um eine Peilung mit der Küste Madagaskars vorzunehmen, doch dazu sollte es nicht kommen. Erste helle Schimmer am östlichen Horizont kündigten bereits den neuen Tag an.
Plötzlich riss ein Ausruf des im Toppmast sitzenden Ausgucks Luc aus seinen trübsinnigen Gedanken: „Schiff, Steuerbord voraus – keine Flagge, aber die Form lässt auf ein Kaperschiff schließen!“ Luc eilte zur Steuerbordseite und erblickte tatsächlich ein schnittiges Kaperschiff, das unter Vollzeug rasch auf sie zukam. Keine Flagge! Luc ahnte Schlimmes. Sofort ließ er den Kapitän durch den diensthabenden Fähnrich wecken und ordnete das Setzen zusätzlicher Segel an. Ein neuer Kurs wurde befohlen, um das Kreuzen mit dem anderen Schiff zu vermeiden und an Fahrt aufzunehmen. Durch das Fernrohr blickend, sah Luc jedoch nichts Beruhigendes: Eine grimmig bewaffnete Meute säumte die Reling des Kaperschiffs. Diese hatte die Kursänderung bemerkt und reagierte mit einem eigenen neuen Kurs. Unterdessen erschien der verschlafene Kapitän an Deck und Luc erläuterte ihm die prekäre Lage und die ergriffenen Maßnahmen, wobei er wenig Zuversicht ausstrahlte. War der Punkt gekommen, an dem sie sich dem Unvermeidlichen ergeben mussten? Das Kaperschiff änderte erneut den Kurs und verringerte die Distanz weiter. Ein neuer Kurs, vom Kapitän angeordnet, verhieß wenig Hoffnung auf eine Verhinderung des drohenden Zusammenstoßes beider Schiffe. Die Absicht des Kaperschiffs war offensichtlich und ein Kreuzen der Kurse erschien unumgänglich. Ein erneuter Ruf des Matrosen im Masttopp verschärfte die Situation dramatisch: „Piratenflagge soeben gehisst!“ Luc konnte den bedrohlich flatternden, schwarzen Totenkopf auf rotviolettem Grund am Topp des Kaperschiffs erkennen. Selbst eine von ihm vorgeschlagene Änderung zu einem Zickzack-Kurs änderte nichts an der ausweglosen Lage, in der sich das Frachtschiff befand. Das Kaperschiff näherte sich gefährlich, die Rufe der blutrünstigen Piraten waren unüberhörbar. Schließlich ließ der Kapitän die Segel streichen und befahl, sich zu bewaffnen und dem bevorstehenden Entern der Piratenmeute entgegenzutreten. Nach wenigen Minuten kam das Kaperschiff längsseits. Enterhaken verkeilten sich knirschend in der Reling, Holzsplitter spritzten und beide Schiffe krachten hart zusammen. Luc stand bewaffnet mit Pistole und Säbel im Bug, während der Kapitän auf dem Achterdeck von zahlreichen Matrosen flankiert wurde. Unter lautem Kampfgebrüll enterten die Piraten das Handelsschiff und die Hölle brach los! Es entwickelte sich ein harter, heroischer, aber kurzer und ungleicher Kampf. Luc verteidigte den Bugbereich, solange es ging, doch die Übermacht der Piraten war erdrückend. Es war wie beim Kampf gegen die Hydra: Kaum erledigte man einen Piraten, tauchten bereits zwei neue auf. Zwischendurch blickte Luc zum Achterdeck, wo der Kapitän von Piraten umzingelt den Befehl zur Kapitulation gab.
Von grimmig grinsenden Piraten entwaffnet, wurden sie zusammengetrieben. Erst jetzt realisierte Luc den hohen Blutzoll. Von der ursprünglich 30-köpfigen Crew waren nur noch acht übrig, darunter der Kapitän und er selbst. Ein schmächtiger, glatzköpfiger Anführer erschien. Er gab einige Befehle und zwei Piraten begaben sich in Richtung der Kapitänskajüte, bevor er sich Luc und dem Kapitän zuwandte. Zu ihrer Überraschung sprach er sie auf Französisch mit holprigem Akzent an: „Nun, meine tapferen Herren Offiziere, darf ich mich vorstellen? Mein Name ist Tippu-Tin. Ich bin der Anführer der Piraten auf Sainte Marie.“
Er machte eine Pause und ließ seine Worte auf die Besatzung des Handelsschiffs wirken. „Mit wem habe ich das Vergnügen?“, fragte er spöttisch.
„Ich bin Francois Borel, der Kapitän, und das ist mein erster Offizier!“, erwiderte der Kapitän mit heiserer Stimme und Schweißperlen im Gesicht.
Die Sonne ging gerade im Osten über dem Horizont auf und tauchte die Szenerie in ein goldgelbes Glühen. Auch Lucs Kopf fühlte sich heiß an vom Kampf und er beobachtete, wie zwei Piraten ein Seil mit Galgenknoten hervorholten und über den Baum des Großmasts warfen – die Absicht war glasklar, es schien, als hätte ihre letzte Stunde geschlagen. Doch so schnell wollte er sich nicht geschlagen geben. Was sollte er unternehmen? War das nun sein Ende? Jetzt galt es, einen kühlen Kopf zu bewahren, und er machte sich Gedanken, wie er ungeschoren aus dieser ausweglosen Situation herauskommen konnte. Aus zahlreichen Geschichten war ihm klar, dass die gesamte Mannschaft, zuerst der Kapitän, dann er und anschließend der Rest der Crew, aufgehängt würden. Schön der Rangordnung folgend. Piraten machten grundsätzlich keine Gefangenen; sie waren nur an der Ladung interessiert – Piraten eben.
„Was haben die Herren geladen, wenn ich fragen darf?“
Weder er noch der Kapitän machten Anstalten, zu antworten.
Der Piratenanführer trat ganz nah an den Kapitän heran, schaute ihm grimmig lächelnd ins Gesicht und wartete geduldig. Die Situation war aufs Äußerste angespannt.
„Haben die Herren meine Frage nicht verstanden?“, schrie er sie plötzlich unbeherrscht an. „Nun, wir können auch selbst nachschauen. Für Sie habe ich leider keine Verwendung, wobei der kühne Versuch, uns zu entkommen, auf taktisches Segelhandwerk schließen lässt und meine Bewunderung verdient!“
Er ließ seinen fragenden Blick zu Luc wandern. Es schien, als hätte er gerne gewusst, wer verantwortlich war für das kurze, dennoch zähe Verfolgungsduell. Ein kurzes Nicken des Anführers genügte und schon packten drei Piraten den Kapitän, zwangen seinen Kopf durch die Schlinge und zogen ihn hoch. Luc zuckte zusammen und wollte seinem Vorgesetzten zu Hilfe kommen, wurde aber von eisenharten Griffen um die Oberarme gehindert. Zappelnd und um Luft ringend hing Borel am Galgen. Es war grauenhaft, das mitansehen zu müssen. Nach kurzem Kampf erschlaffte der Körper. Luc wusste, er würde der Nächste sein. Was sollte er unternehmen? Hatte er überhaupt noch eine Chance?
Die beiden Piraten, die zur Kapitänskajüte gerannt waren, kehrten mit einem Stapel Papier, wahrscheinlich den Frachtpapieren, zurück und überreichten sie dem Anführer. Er studierte sie kurz und eine große Zufriedenheit zeichnete sich auf seinen Gesichtszügen ab, erkennbar an einem breiten Grinsen. „Leute, hört zu“, rief er mit lauter Stimme aus, „wir haben offensichtlich einen wertvollen Fang gemacht!“ Lautes Gebrüll der Piraten folgte, sie klopften sich zufrieden auf die Schultern und schwenkten bedrohlich ihre Waffen. Lucs Gemütslage verschlechterte sich zusehends und er musterte die hoffnungslosen Gesichter seiner verbliebenen Matrosen. Was würde als Nächstes passieren? Alle Blicke waren gespannt auf den Piratenanführer gerichtet. Er schnüffelte weiter in den Unterlagen. Hoffte er, noch weitere Schätze zu finden?
Plötzlich erhellte sich sein Blick. Offensichtlich hatte er etwas Interessantes entdeckt. Was war es? Langsam schritt er zu Luc und schaute ihm direkt ins Gesicht: „Wie heißt du? Der Kapitän hat vergessen, deinen Namen zu erwähnen.“ „Ich heiße Luc, Luc Gabriel, und bin, wie gesagt, der erste Offizier!“, antwortete er mit Stolz in der Stimme. „Lass den Rest meiner Crew am Leben, begnüge dich mit der Hinrichtung der Offiziere!“, schloss Luc mit fester Stimme.
„Soso, Gabriel ist also dein Name, interessant, höchst interessant!“
Der Hauch eines Lächelns und Wissens umspielte sein von Falten zerfurchtes Gesicht. „Deine Opferbereitschaft ist äußerst nobel, aber auch dumm und für mich ohne Belang!“, schloss er mit einer wegwerfenden Handbewegung. Eine definitive Entscheidung schien gefallen zu sein und er wandte sich einem einheimisch aussehenden Piraten zu, auf dessen Stirn sich eine auffällige Narbe zeigte: „Sofolo, übernimm du das Kommando hier, richtet die Crew hin – und den hier“, er zeigte auf Luc, „nehmt gefangen und bringt ihn zu mir aufs Schiff. Die Fregatte erwarte ich umgehend im Hafen, damit die Ladung gelöscht werden kann!“
„Aye aye!“, bestätigte Sofolo den Befehl ohne die kleinste Regung im Gesicht.
Luc wurde daraufhin von zwei kräftigen Piraten an den Händen gefesselt, unsanft gepackt und aufs Kaperschiff gebracht. Ein letzter verzweifelter Blick zurück zu seiner verängstigt dreinschauenden Crew und schon wurden sie von einer johlenden, blutgeilen Piratenmeute unter irrem Geschrei, Säbel schwingend, massakriert. Luc verstand nicht, wie ihm geschah. Was sollte das nun? Schon bald jedoch sollte er vom Piratenanführer den Grund für die wundersame Rettung seines Lebens erfahren.
Zwei Jahre waren bereits seit seiner Gefangennahme vergangen. Oder sollte er ‚seit seiner Rettung‘ sagen? Luc Gabriel stand breitbeinig auf dem Achterdeck seines Schiffs. Er genoss die stetig wehende Brise und die wärmenden Sonnenstrahlen. Als Kapitän mit eigener Crew auf einer ehemaligen Handelsfregatte, bestückt mit schweren Kanonen, gehörte er nun zur erweiterten Piratenflotte des berüchtigten Tippu-Tin. Der Mann, der ihn nicht hinrichten, sondern gefangen nehmen lassen hatte, war DER Anführer – nicht nur der Piraten auf Sainte Marie, sondern auch der Sklavenhändler der Region. Luc verdankte ihm seine Rettung, basierend auf Tippu-Tins Annahme, dass er ein Nachkomme des berühmten Piraten Louis Gabriel sein müsse. Dieser Piratenvorfahre sollte im 17. Jahrhundert sein Unwesen getrieben und den Grundstein des Piratennests auf Sainte Marie gelegt haben. Schauerlich! Luc wusste nichts von einem solchen Vorfahren. Das war aber der Grund dafür, dass Tippu-Tin ihn vor die Entscheidung seines Lebens gestellt hatte: Entweder konvertierte er zum Piraten und zeigte sich seiner vermeintlichen Vorfahrensgeschichte würdig oder Tippu-Tin würde seine Hinrichtung sofort veranlassen. Tippu-Tin hatte sich genüsslich in den Stuhl sinken lassen und geduldig auf Lucs Antwort gewartet.
Es war eine existenzielle Wahl gewesen. Luc wollte leben, das war klar, aber in Madagaskar und der Region Ostafrikas zu bleiben, fern der Heimat Frankreich, und ein Teil dieser mordenden Meute zu werden, war nicht gerade verlockend und nicht das, was sich Luc für seine Zukunft vorstellte. Schließlich träumte er von Frau und Familie. Ganz zu schweigen von den Konsequenzen, falls die Kolonialmächte Frankreich, Großbritannien oder Deutschland, die hier aktiv waren, das Piratennest vernichteten und alle gefangen nahmen oder hinrichteten. Somit hatte sich Luc für das Leben entschieden – über eine spätere Flucht konnte er sicherlich jederzeit nachdenken.
„Ich hoffe, du zeigst dich deiner Piratenvorfahren würdig, und vergiss nie, mein Arm reicht weit, sehr weit, und ich kann dir dein Leben jederzeit nehmen, solltest du dich als illoyal erweisen!“, sicherte der hämisch grinsende Tippu-Tin sich feierlich die Gefolgschaft Lucs zu. Überdies würden für ihn große Gewinne und Schätze anfallen. Tippu-Tin versprach, ihn zu einem reichen Mann zu machen.
Er war schon ein seltsamer Typ: arabischer Abstammung aus dem Sultanat Oman, grausam und gnadenlos auf der einen Seite, großherzig und verschwenderisch auf der anderen. Wahrscheinlich musste er beides sein, um diese Piratenmeute zu beherrschen und eine gewisse Ordnung aufrechtzuerhalten: Zuckerbrot und Peitsche! Gefolgschaft oder Tod! Luc verdankte diesem schauerlichen Mann nicht nur seine Rettung, basierend auf einem Mythos, sondern er genoss auch eine gewisse Gunst, die Tippu-Tin ihm entgegenbrachte. Andernfalls wäre er nicht so schnell zum Kapitän geworden und hätte Sofolo, der scheinbar die rechte Hand von Tippu-Tin war, übertroffen. Diese Gunst wollte er nicht fahrlässig verspielen. Deshalb stellte er vorerst seine Fähigkeiten voll und ganz in den Dienst des Piratenführers. Einzig die Eifersucht, die Missgunst und der offen zur Schau gestellte Hass Sofolos bedeuteten für Luc immer wieder eine Herausforderung. Er musste ihn im Auge behalten; ein Fehler von Luc und er würde von Sofolo bei Tippu-Tin gnadenlos angeschwärzt oder noch schlimmer denunziert. Aber Lucs Führungsstil, sein Ideenreichtum und seine Segelfähigkeiten erwiesen sich als große Vorteile. Kein Kapitän der Piratenflotte war ihm ebenbürtig und so hatte er sich Sofolos Wut bis jetzt vom Leibe halten können.
Eben, als sie sich querab zum Cap Est auf Südkurs befanden, hatten sie eine dieser für die Region berüchtigten Gewitterwolken passiert. Der Regen war in wahren Sturzfluten über dem Schiff niedergegangen. Die Decksbalken schimmerten in der auftauchenden gleißenden Sonne wie ein goldenes Vlies. Ein Geruch nach Frische, Meer und nassem Holz war zu vernehmen. Es schien, als würden sie das Piratennest doch noch wie vorgesehen kurz vor Sonnenuntergang erreichen, was Luc recht war. Er wollte der Crew Ruhe gönnen und erst am darauffolgenden Tag Bericht erstatten müssen. Einmal mehr befanden sie sich auf dem Rückweg von Sansibar, wo er die Sklaven abgeliefert hatte, zum Stützpunkt auf Sainte Marie. Einheimische Führer, ein berüchtigter war anscheinend mit Sofolo verwandt, rekrutierten jeweils ganze madagassische Völkerstämme und zwangen sie zur Sklaverei, um sie Tippu-Tin zu verkaufen. Dieser organisierte mit seiner Piratenherrschaft den Verkauf an den Sultan von Sansibar und weiter an den Sultan von Oman. Es war ein grausiges, menschenverachtendes Geschäft, bei dem viel, sehr viel Geld verdient wurde. Auch Luc bereicherte sich erheblich daran. Darum hasste er sich zuweilen und brachte sich zunehmend widerwillig ein. Es war langsam an der Zeit, sich eine mögliche Flucht auszudenken. Oder war es noch zu früh? Riskierte er, von den Piraten erneut geschnappt zu werden? Es gab kaum Gelegenheit zur Flucht. Wann und wo war der beste Zeitpunkt? An wen sollte er sich wenden? Solange er entweder Raubzüge auf See befehligte oder Sklaven nach Sansibar brachte, befanden sich immer loyale und von Tippu-Tin abhängige Leute um ihn herum. Auf dem Schiff, im Piratennest auf Sansibar oder Sainte Marie. Nie war er wirklich allein. Tippu-Tin achtete exakt darauf, Luc immer eingebunden im Piratennetz operierend zu wissen. Nur einmal, vor einem halben Jahr, hatte er das erste Mal das Gefühl gehabt, es gäbe eventuell doch eine Möglichkeit zur Flucht. Er war von Tippu-Tin zusammen mit den engsten Gefolgsleuten in die madagassische Hauptstadt Tanarivo mitgenommen worden. Dort hatten sie einen jungen Franzosen namens Henri Bouillier getroffen, ungefähr gleich alt wie er, der offensichtlich die finanziellen Belange der Piraten verwaltete. Dort hatte Luc zum ersten Mal erfahren, dass auch sein Vermögen, das bereits zu einer ansehnlichen Summe herangewachsen war, von diesem Treuhänder verwaltet wurde. Luc wurde den Eindruck nicht los, dass Bouillier die Verbindung zu Tippu-Tin nicht geheuer war. Bestimmt heiligte ein gutes Honorar die Dienste, die er für sie tätigte. Interessant war seine Reaktion gewesen, als er Luc gesehen und erfahren hatte, dass dieser Haudegen von Seemann neu zur Crew gehörte und sehr gute Arbeit leistete. Spätestens nach seiner Feststellung, dass Luc auch Franzose war, hatte er sein Interesse offen bekundet.
„Oh, auch Franzose, sehr schön. Ich würde mich freuen, mit Ihnen, Monsieur Luc, noch ein paar Worte über unsere Heimat auszutauschen.“ Er blickte zu Tippu-Tin, als müsste dieser die Einwilligung dazu geben, aber schon antwortete Luc selbst: „Welch gute Idee. Das würde auch mich sehr freuen, war ich doch bereits etliche Jahre der Heimat fern. Vielleicht könnten Sie mich auf den aktuellen Stand bringen.“ Ein Lächeln umspielte seine Gesichtszüge.
„Nun, diese Gelegenheit bestünde heute Abend im Hotel beim Abendessen, meine Herren!“, beendete Tippu-Tin griesgrämig das Treffen, stand auf, reichte Bouillier die Hand und signalisierte seinen Leuten, ihm zu folgen. Leider ergab sich am Abend nicht, wie von Luc erhofft, eine Gelegenheit, unter vier Augen mit Bouillier zu sprechen, denn immer war eine dritte Person zugegen – von Tippu-Tin so gesteuert? Er wusste es nicht, wollte aber auch keinen Verdacht wecken. Schon gar nicht in Anwesenheit seines Erzrivalen Sofolo. Einzig, als sie sich zufällig auf dem Weg zur Toilette begegneten, eröffnete Bouillier kurz das Gespräch: „Ihr Vermögen ist schon ganz ordentlich angewachsen. Was wollen Sie eigentlich mit dem Haufen Geld anfangen?“
Er schaute misstrauisch den Gang rauf und runter, um sicherzustellen, dass sie von niemandem belauscht würden. Ohne auf Lucs Antwort zu warten, fuhr er fort: „Ich empfehle Ihnen, Land zu kaufen. Damit meine ich, das Geld so schnell wie möglich zu investieren. Ich weiß nämlich nicht, wie lange die französische Regierung noch wartet, bis sie Truppen in den Norden von Madagaskar entsendet. Und was dann mit uns passiert, wissen wir beide nicht, aber es scheint mir die beste Investition zu sein. Unsere Regierung will Madagaskar unbedingt als Kolonie in Besitz nehmen und dann sind Franzosen, die bereits Land besitzen, das Beste, was Frankreich passieren könnte. Sie verstehen?“
Luc nickte – ja, das schien ihm eine gute Idee zu sein. Es ergab sich, sollten tatsächlich einmal französische Truppen auftauchen, die Möglichkeit, sich aus den Fängen der Piraten zu befreien. Bouillier sprach hastig weiter, spürte er doch, dass er schnell zum Punkt kommen musste, um nicht doch noch Verdacht zu erwecken: „Es gibt im Nordosten Madagaskars sehr ertragreiches Land. Ein Kauf würde sich extrem lohnen. Wenn Sie einverstanden sind, leite ich alles Nötige in die Wege und erwerbe das Land. Als Aufwand würde ich 10 Prozent des Lands auf mich überschreiben, den Rest stellvertretend für Sie, Monsieur Luc. Wie ich es einschätze, haben Sie im Moment mehr als genug Geld für eine riesige Landfläche. Noch sind die Landpreise zwar sehr tief, jedoch besteht leider ein immenses Risiko. Wer weiß schon, was unsere Regierung morgen entscheidet, ganz zu schweigen von den Briten.“
Das erschien Luc sehr einleuchtend und zum jetzigen Zeitpunkt der einzige Lichtblick, jemals diesem Piraten-Albtraum zu entkommen. Und so entschied er sich zu diesem risikoreichen Geschäft.
Die Sonne ging soeben hinter dem Festland von Madagaskar unter. Noch in Gedanken versunken, hörte er den Ausguck „Pointe Albrand in Sicht“ rufen und tatsächlich zeigte sich bereits die Nordspitze der Insel. Endlich zu Hause, welch Ironie! Sehr wahrscheinlich war er bereits Besitzer riesiger Ländereien jenseits der berüchtigten Piratenhochburg Sainte Marie. Luc konnte sich ein Schmunzeln nicht verkneifen.
Der erneute Ruf aus dem Toppmast ließ es jedoch schnell verschwinden. „Warnsignal hängt kopfüber!“, lautete die Nachricht.
Luc erstarrte! Merde, was war da los? Er brüllte umgehend Befehle: „Schiff klar machen zum Gefecht! Geschützpforten Steuerbords besetzen! Großsegel einholen, Steuermann, abfallen – bring uns näher heran, aber langsam!“
Was Luc mit seiner Crew während Tagen und Wochen drillmäßig eingeübt hatte, sollte sich jetzt einmal mehr auszahlen. Die Mannschaft reagierte sofort und routiniert, wie in zahlreichen Gefechten zuvor. Der erste Offizier überwachte die Vorbereitungen an Deck, zwei Fähnriche verschwanden umgehend im Unterdeck, um die Mannschaft zu mobilisieren und die Geschützpforten schnellstmöglich zu besetzen. Luc ergriff sein Fernglas. Noch konnte er kaum etwas vom Hafen erkennen, nur das Warnsignal, das tatsächlich kopfüber hing. Dieses sogenannte Warnsignal am nördlichsten Punkt der Insel war seine Idee gewesen. Es sollte als Frühwarnung für die heimkehrenden Piratenschiffe dienen. Die Flagge, oben weiß, unten schwarz, signalisierte: alles in Ordnung auf der Insel. Wenn sie kopfüber hing, wie jetzt, konnte das nur bedeuten, dass etwas Schlimmes passiert war.
„Schiff klar zum Gefecht, Luc!“, meldete der erste Offizier.
Er nickte unmerklich, immer noch konzentriert durch das Fernrohr spähend. Quälende Minuten vergingen, die Fregatte schlich langsam voran. Sie hatten jetzt den nördlichsten Punkt querab erreicht. Normalerweise befand sich dort eine Gruppe von Piraten, aber es war keine Menschenseele zu sehen. Lucs Kehle fühlte sich staubtrocken an, er musste schlucken. Seine Hände waren schweißnass, sein Hemd klebte feucht am Körper. War es tatsächlich so weit, das Ende des Piratenlebens? Im schwächer werdenden Licht konnte er schemenhaft ein fremdes Schiff am Hafenkai ausmachen. Es wirkte wie eines dieser neuartigen, mit Dampf betriebenen Schiffe. Eine kleine Rauchfahne stieg aus dem Schornstein, kein Licht brannte an Bord und Luc vermochte keine Aktivitäten an Deck wahrzunehmen. Das Einzige, was er erkennen konnte: Es musste ein Kriegsschiff sein, denn er sah schemenhaft große Kanonen auf dem Bug und am Achterdeck. Panzerkorvetten nannte man sie, wenn er sich recht erinnerte. Panik ergriff Luc. Er winkte seinen ersten Offizier heran und flüsterte ihm ins Ohr: „Sämtliche Befehle werden flüsternd erteilt und quittiert. Verständige sofort die Mannschaft, ich will keinen Laut mehr hören!“
Erneut wandte er sich dem unbekannten Kriegsschiff zu und sein Blick schwenkte mittschiffs, wo sich die Hauptaufbauten und die Kommandobrücke befanden. Auch dort erkannte er kein Licht. Er hob das Fernrohr weiter an bis zum Top und dann sah er, was er befürchtet hatte: Dort flatterte in der schwach blasenden Nachtbrise die Trikolore. Sofort ließ Luc das Schiff wenden. Wie von Geisterhand schwenkte die Fregatte leise herum, nur das Knarren der Rahen und Spieren war zu hören. „Neuer Kurs Nord-Nord-Ost liegt an!“, meldete der Steuermann flüsternd. Nahezu geräuschlos wurden weitere Segel gesetzt und die Fregatte nahm erneut Fahrt auf, weg vom französischen Kriegsschiff. Lucs Hauptsorge war, dass man ihr Auftauchen bemerkt hatte. Im Moment deutete noch nichts darauf hin, denn weder auf dem Kriegsschiff noch an Land schienen Aktivitäten in Gang gesetzt worden zu sein. Hatten sie Glück im Unglück und die Franzosen wussten nichts von ihrer Existenz? Luc wirbelten die Gedanken durch den Kopf und sein Herz begann zu rasen.
Was sollte er nun tun?
„Lass von ‚Klar zum Gefecht‘ abtreten! Es gilt weiterhin absolute Stille und es wird kein Licht gemacht, verstanden?“, herrschte er seinen ersten Offizier nervös an. Es galt nun, den Notfallplan, der von Luc für solche Situationen ausgearbeitet worden war, umzusetzen. Das bedeutete, sie segelten um die Nordspitze von Madagaskar, um zu der Insel Nosy Be im Nordwesten zu gelangen. Dort hatten sie auf Geheiß von Tippu-Tin hin ein kleines Notfallcamp errichtet. Leider war Luc in diesen zwei Jahren nie dort gewesen. Er wusste also nicht, was ihn dort erwartete, und ebenso wenig, ob auch dieser Ort bereits vom Militär besetzt worden war. Etwas viele Unsicherheiten, dachte er. Darum musste er umgehend weitere Handlungsoptionen erarbeiten. Aber welche?
Je länger Luc über seine Situation nachdachte, desto klarer wurde ihm, dass jetzt die ultimative, vom Himmel gesandte Gelegenheit zur Flucht gekommen war. Wann, wenn nicht jetzt? Das war die Chance, endlich! Es sei denn, der Piratenmeute inklusive Sofolo und Tippu-Tin war es gelungen, nach Nosy Be zu flüchten … Nach einer Stunde Fahrt war sich Luc sicher, keine Verfolger auf den Fersen zu haben. Er hatte entschieden, was weiter geschehen sollte. So ließ er die gesamte Mannschaft antreten und informierte sie über das französische Kriegsschiff und die Tatsache, dass der Piratenstützpunkt verloren war. Sie befanden sich nun auf dem Weg zur Insel Nosy Be, wo er, Luc, die gesamte Crew mit dem Geld der letzten Sklavenfahrt zu entlohnen beabsichtigte, um anschließend eine gewisse Zeit abzuwarten. Vielleicht ergab sich die Möglichkeit, sich neu zu organisieren, oder sie fanden heraus, dass sie die einzigen Überlebenden von Tippu-Tins Piratenmannschaft waren und sich somit nicht mehr neuformieren konnten. Die Crew war nicht begeistert, verstand jedoch die Dramatik der Situation und akzeptierte Lucs Entscheidung. Schließlich freuten sich alle auf die in Aussicht gestellte Beute. Im Morgengrauen näherten sie sich der Insel Nosy Be von Norden kommend und steuerten in die Bucht von Mahazandry, wo sie vor Anker gingen. Luc wollte abwarten, ob sich an Land angesichts ihrer Anwesenheit etwas ereignete. In der Zwischenzeit ließ er antreten und händigte jedem seinen Anteil aus. Die Mehrheit wollte auf dem Schiff warten und hoffte, dass sich weitere Schiffe der Piratenflotte einfinden würden. Weder ein weiteres Schiff noch eine Person an Land war zu sehen – ideal. Luc entschied sich, mit ein paar Freiwilligen auf einem Beiboot überzusetzen, um die Lage zu klären. Dem ersten Offizier vertraute er an, dass er nicht mehr zurückkehren würde; es galt, dem Piratenleben den Rücken zu kehren. Er wusste, der Weg in die Hauptstadt Tananarivo war lang und beschwerlich, aber er führte ihn in eine neue Zukunft.
Endlich fühlte sich Luc wieder frei. Seine Flucht fünf Monate zuvor hatte ihn über mehrere Stationen und einen langen, entbehrlichen Weg in die Hauptstadt und zu Bouillier geführt, um mehr und vor allem Genaueres zu erfahren. Luc war zu ihm ins Büro gekommen, um einerseits die Reiseunterlagen, andererseits seine neuen persönlichen Identifikationspapiere abzuholen. Seit seiner Gefangenschaft verfügte er nicht mehr über eine offizielle Identität. Luc nahm die Papiere und Dokumente mit einem zufriedenen Lächeln entgegen.
„Ich bedanke mich herzlich für Ihre Unterstützung, Monsieur Bouillier. Ich weiß nicht, was ich ohne Sie gemacht hätte.“
Nicht der Rede wert, gern geschehen. Ich bin sehr froh, dass Sie am Leben sind. Nach all dem, was ich gehört und gelesen hatte, dachte ich nicht mehr, Sie je wieder zu treffen. Ich war in großer Sorge und habe schon Überlegungen angestellt, was ich mit den erworbenen Ländereien machen sollte. Ich bin froh, dass wir auch das klären konnten. Wissen Sie schon, wann Sie zurückkehren werden?“
„Nein, das kann ich noch nicht sagen, aber wie versprochen bleiben wir in Kontakt. Ich will zuerst meine Familie wiedersehen und natürlich meine Heimat, aber ich muss eingestehen, Madagaskar hat es mir angetan. Ich werde zurückkehren, allein schon, um mein Land in Besitz zu nehmen und zu kultivieren. Ich habe gehört, dass der Vanilleanbau sehr vielversprechend ist.“
Bouillier und Luc unterhielten sich noch eine Weile und tauschten Gedanken über die Zukunft, das politische Geschehen und ihr persönliches Verhältnis aus. Schließlich verabschiedete sich Luc. Das Schiff, auf dem Bouillier für ihn eine Kabine gebucht hatte und das ihn zurück nach Frankreich bringen würde, sollte am nächsten Nachmittag ablegen. Bouillier zufolge stritten Frankreich und Großbritannien um die Vorherrschaft in Madagaskar. Großbritannien hatte zwar im Norden Truppen stationiert, die Franzosen jedoch die Insel Sainte Marie in ihren Besitz gebracht. Der Piratenstützpunkt war vollständig vernichtet worden. Luc hatte großes Glück, dass er nicht da gewesen war. Von Tippu-Tin und Sofolo fehlte jede Spur. Frankreich konzentrierte seine Kräfte momentan um den einzigen und wichtigen Handelshafen Tamatave und die Hauptstadt. Noch war offen, wer sich durchsetzen würde. Taktisch befand sich Frankreich im Vorteil und die Ambitionen von Großbritannien waren unklar. Auch die Einheimischen um Königin Ranavalona II. galten als ein unberechenbares Element und nicht zu unterschätzen. Luc wollte mehr über das erworbene Land erfahren. Laut Bouillier erstreckt es sich im Dreieck der Städte Sambava und Antalaha, jeweils an der Küste gelegen, und Andapa im Vorgebirge. Sicher war er regelmäßig daran vorbeigesegelt. Angesichts dessen, dass Großbritannien den Norden besetzt hielt, hielt er es für unklug von Luc, das gekaufte Land jetzt zu besuchen. Geduld war angebracht. Nun, das kam Luc entgegen, denn er sehnte sich danach, endlich wieder nach Frankreich zurückzukehren und seine Liebsten zu sehen. Die Gedanken an eine eigene Familie ließen ihn nachdenklich werden – es wurde langsam Zeit, das spürte er. Die Jahre vergingen und er wurde nicht jünger. Zuversichtlich wandte sich Luc in Richtung Hotel. Welche Abenteuer und Herausforderungen mochte die Zukunft für ihn bereithalten? Wann würde er erneut einen Fuß auf madagassischen Boden setzen und endlich sein Land in Besitz nehmen können? Er wusste es nicht – noch nicht.
Luc hielt es nicht länger in seiner engen, stickigen Kabine aus. Ein Sehnen nach frischer Luft trieb ihn an Deck, wo er die wohltuende Brise des Sommermorgens des Jahres 1895 genoss. Der Himmel präsentierte sich fast wolkenlos, während die aufgehende Sonne ihre Strahlen wie flüssiges Gold auf die mit Tau benetzten Decksbalken ergoss. Vom zweiten Offizier erfuhr er, dass sie bald die Nordspitze Madagaskars erreichen, entlang der Küste gen Süden gleiten und die berüchtigte Pirateninsel Sainte Marie bei Sonnenaufgang passieren würden, bevor sie am späten Nachmittag im Hafen von Tamatave anlegten. Die Erinnerung an die Zeit auf Sainte Marie, wo er über zwei Jahre unfreiwillig verweilt hatte, als Gefangener des berüchtigten Sklavenhändlers und Piraten Tippu-Tin, weckte Nervosität in Luc. Allein auf dem Panoramadeck der ‚Salazie‘ stehend, lehnte er an der Reling und spürte trotz des spärlichen Morgendunstes die Nähe der Insel. Unzählige Male war er mit seinem umgebauten Frachtschiff ins Piratennest zurückgekehrt, um Bericht und Geld abzuliefern. Die zwei Jahre im Piratendienst erschienen ihm wie ein Albtraum, doch sie bildeten den Ursprung seines Reichtums und den Grund seiner jetzigen Rückkehr. Vor einem Jahr hatte er von seinem Treuhänder Bouillier die Nachricht erhalten, dass die Zeit günstig sei, zurückzukehren. Ein Vertrag zwischen Frankreich und Großbritannien ebnete den Weg, indem Madagaskar den Franzosen überlassen worden war. Luc hatte endlich die von Bouillier erworbenen Ländereien in Besitz nehmen können und Hals über Kopf Frau und Sohn verlassen, um sich seiner Vergangenheit zu stellen.
Er atmete die vertraute, tropisch angehauchte Luft ein und konnte es kaum glauben – ein neues Abenteuer stand bevor. Vater geworden und schon wieder dem vertrauten Familienleben entrissen, musste er den Tatsachen gegenübertreten. Schmunzelnd verließ er das Deck nach einem letzten Blick auf Sainte Marie. Es war Zeit, zu packen und sich für die kommende Herausforderung zu wappnen. Luc war überzeugt, dass es nicht leicht werden würde, aber er war glücklich, zurück zu sein. Jean Bouillier hörte ihm interessiert und geduldig zu. Über ein Jahr und einige Monate waren seit Lucs Rückkehr vergangen und es war höchste Zeit, mit dem Treuhänder weitere Schritte zu besprechen. Diverse kaum zu bewältigende Herausforderungen erforderten dringend Maßnahmen. Die erworbenen Ländereien präsentierten sich in einem erbärmlichen und verwilderten Zustand. Luc musste sich zunächst einen Überblick verschaffen, bevor er an die Umsetzung von Plänen, wie dem möglichen Anbau einer Vanilleplantage, denken konnte. Einheimische hatten kleine Siedlungen an verschiedenen Orten errichtet und versuchten sich in primitiver Landwirtschaft. Teile des Landes waren von britischen Besatzungstruppen für Lager, Gebäude und mehr genutzt worden. Zahlreiche befestigte und gut ausgebaute Straßen durchzogen die Ländereien. An einem von Luc bereits evaluierten Standort für ein Wohnhaus und Betriebsgebäude mit Arbeiterdorf hatten die Briten sogar einen langen Holzsteg ins Meer gebaut, um Militärmaterial nicht ausschließlich auf der Straße transportieren zu müssen. Nicht alles, was Luc auf seinem Land vorfand, war zum Nachteil, allerdings mussten die Einheimischen, die über das gesamte Gebiet verteilt lebten, mithilfe des Militärs vertrieben und zwangsumgesiedelt werden. Dies führte oft zu Handgreiflichkeiten und kleinen Scharmützeln, die den Unmut über die neuen Kolonialherren, insbesondere Luc, schürten. Androhungen von Gewalt und guerrillakriegsähnliche Auseinandersetzungen wurden offen ausgesprochen.
„Nun, ich darf Ihnen mitteilen, dass das Oberkommando der Armee endlich zu weiterer Unterstützung bereit ist. In den nächsten Wochen werden zusätzliche Truppenkontingente in den Norden gesandt“, schloss ein erleichterter Bouillier seine Ausführungen.
„Das freut mich, zu hören, und ich danke Ihnen für Ihre Bemühungen. Was würde ich bloß ohne Sie machen?“, antwortete Luc lächelnd.
„Des Weiteren darf ich Ihnen mitteilen, dass sich Henry Maître, der Franzose, von dem ich Ihnen schon einige Male erzählt habe, endlich zugesagt hat. Sie werden in ihm einen sehr fähigen Vorarbeiter erhalten. Er ist im Norden, nahe von Diego Suarez, aufgewachsen und somit orts- und darüber hinaus sprachkundig in verschiedenen Dialekten. Der größte Benefit jedoch ist seine langjährige Erfahrung im Vanilleanbau“, führte Bouillier mit heiterem Gesicht weiter aus.
„Besten Dank, Monsieur Bouillier. Ich weiß das sehr zu schätzen. Wann kann ich ihn treffen?“, wollte Luc wissen.
„Nun, er befindet sich ebenfalls in der Stadt. Sie können sich somit jederzeit verabreden. Soll ich ein Treffen arrangieren?“
„Ja, gerne, das wäre sehr nett. Danke!“
Bouillier machte sich eine Notiz und hob dann den Blick.
„Was ich noch wissen wollte, Monsieur Bouillier, haben Sie meine Budgetaufstellungen schon überprüfen können?“
„Natürlich. Das habe ich bereits erledigt und einige Korrekturen sowie Vorschläge hinzugefügt, aber alles befindet sich im finanziellen Rahmen und ist tragbar“, erklärte er und klopfte lächelnd auf ein stattliches Bündel Papier zu seiner Rechten.
„Ausgezeichnet!“, entfuhr es Luc, der hocherfreut reagierte.
„Wie steht es eigentlich um Ihre Familie? Wann werden Ihre Frau und Ihr Sohn Rémy nach Madagaskar umsiedeln?“, erkundigte sich Bouillier interessiert.
„Tja, das ist ein trauriges Thema“, Luc zeigte sich besorgt. „Meine Frau weigert sich standhaft und will nicht kommen, leider. Vielleicht ändert sie ihre Meinung, sobald das Lebensprojekt weiter vorangekommen ist. Schließlich will ich ihr eine angenehme Zukunft und ein sicheres Auskommen bescheren. So oder so, ich bleibe dran. Die Hoffnung stirbt zuletzt, nicht wahr, Monsieur Bouillier? Ich habe schon viele Hürden genommen und werde noch weitere überspringen müssen“, versuchte Luc, sich Mut zu zusprechen. Er lächelte verlegen.
„Hoffen wir auf das Beste!“, antwortete Bouillier leise.
Sie tauschten sich noch eine Weile weiter aus. Bouillier betonte erneut, wie wichtig es für Frankreich war, nach dem ersten Feldzug die Kolonialherrschaft auf Madagaskar weiter zu festigen und zu sichern. Dies war ihm durch seine hervorragenden Verbindungen bekannt, die bis ins Élysée in Paris reichten. Nachdem die Sicherung der Hauptstadt und des strategisch wichtigen Nordens abgeschlossen war, galt es nun, sich auf den Süden und vor allem auf das Hochland zu konzentrieren. Die Königin war schon vor über einem Jahr ins Exil geschickt worden und Railinaiarivony, nur sehr kurz als Premierminister im Amt, hatte ihr alsbald ins Exil folgen müssen. Er war im Juli in Algerien verstorben und somit war der Weg frei für den ersten französischen Generalgouverneur. Bouillier hatte gehört, dass für Brigadegeneral Joseph Gallieni gute Chancen auf den Posten bestanden, da er sich in Indochina durch seinen gnadenlosen und brutalen Kampf gegen chinesische Piraten besonders verdient gemacht hatte, denn die Region war nun wesentlich stabiler. Lucs Besitz im Norden und sein Engagement hob Bouillier als eminent wertvoll hervor. Die Regierung war gerne bereit, die Unterstützung auszubauen. Er hatte auch Gerüchte über einen bevorstehenden zweiten Feldzug vernommen. Vielleicht würde man jedoch die Ankunft des neuen Generalgouverneurs abwarten. Mit der Zusage Bouilliers, das Treffen mit Henry Maître umgehend zu arrangieren, und dem voluminösen Papierstapel unter dem Arm verließ ein zufriedener Luc Bouilliers Büro. Es gab viel zu tun und er musste sich möglichst zeitnah mit diesem Maître treffen, um alles Notwendige zu besprechen.
Die Sonne stand fast senkrecht über ihren Köpfen und brannte unbarmherzig auf Luc und seine Begleiter herab. Die hohe Luftfeuchtigkeit sorgte für ein Waschküchengefühl. Glücklicherweise wehte, wie meistens am Nachmittag, ein lauer Wind, der zwar warm war, aber durch den Luftzug etwas Kühle generierte. Endlich hatten sie die obere Kante der großen Böschung erreicht, indem sie auf allen vieren hinaufgekraxelt waren. Die Böschung erstreckte sich entlang der Küstenstraße. Von hier oben konnten sie einen beeindruckenden Blick über das Gabriel-Land werfen und somit wichtige Entscheidungen über anstehende Bautätigkeiten treffen. Luc trocknete mit einem gestreiften Taschentuch den Schweiß in seinem Gesicht, schob den breitkrempigen Hut in den Nacken und atmete geräuschvoll ein und aus. Sein beiges Leinenhemd klebte wie ein nasser Waschlappen an seinem Oberkörper. Seinen Begleitern erging es nicht anders. Henry Maître keuchte ähnlich schwer wie er. Einzig der einheimische Jüngling Faly zeigte kaum Müdigkeit, lächelte spitzbübisch und schaute erwartungsvoll zu den beiden herunter, bis auch sie endlich oben angekommen waren. Luc gönnte ihnen eine kurze Pause, ehe er diverse Pläne der Umgebung, seines Landes, aus der mitgetragenen Mappe herausnahm, sie auseinanderfaltete und auf dem steinigen Boden auszulegen versuchte. Faly sammelte bereits Steine zur Beschwerung, drohte doch die laue Brise, die Pläne durcheinanderzuwirbeln.
Faly war der Erste, der Atem zum Sprechen fand: „Master Luc, womit wollen Sie nun beginnen?“, wollte der noch nicht 20-jährige Junge in seinem unnachahmlichen, bruchstückhaften Französisch wissen.
„Nun, ich denke, wir besprechen zuerst die Anordnung der Gebäude anhand der bereits vorhandenen, durch die Briten erstellten Straßen. Danach schauen wir uns die Lage, die Größe und das Anlegen der geplanten Plantagen an. Zum Schluss sehen wir, welche Straßen und Wege zusätzlich erstellt werden müssen – wenn überhaupt. Ich habe mehrmals darauf hingewiesen, dass wir die Aufteilung möglichst ohne Neubau von Straßen hinbekommen sollten. Oder was meinen Sie, Henry?“, beendete Luc das Ausführen seiner Gedanken.
Gierig trank er aus der Wasserflasche, die ihm Faly hingestreckt hatte.
„Ich sehe das genauso wie Sie“, antwortete Henry keuchend.
Luc konnte sich ein Schmunzeln nicht verkneifen und fächelte sich mit seinem Hut Luft zu. Was sie nun gemeinsam entwickelten, diskutierten und schließlich entwarfen, sollte der Grundstein für ihre Zukunft sein. Der gesamte Erfolg hing entscheidend von einer sinnvollen Planung und deren Umsetzung ab. Daher gingen sie strategisch, umsichtig und detailliert vor, immer wieder korrigierend. Transportwege, die Unterbringung der Arbeiter, der Betrieb und der Unterhalt der Plantagen sowie das Privathaus, der Fahrzeugunterstand, das Betriebs- und das Ökonomiegebäude wurden lebhaft debattiert. Immer wieder mussten sie die ins Auge gefasste Aufteilung verwerfen, da sich die bestehenden Wege, Straßen und Distanzen nicht sinnvoll mit den zu erstellenden Gebäuden verbinden ließen. Schlussendlich, die Sonne neigte sich bereits dem Horizont zu, war Luc mit der ersonnenen Anordnung zufrieden. Müde, hungrig und durstig, die Wasserflaschen waren alle leer getrunken, falteten sie die mit Entscheidungen vollgekritzelten Pläne zusammen. Die Böschung mehr herabrutschend als gehend, erreichten sie endlich den Kleinlaster und fuhren zurück. Bis spät in den Abend sortierte und vervollständigte Luc die Pläne, den Ablauf und die Planung.
Bei einem Glas französischen Wein ließ er die vergangenen Monate seit seiner Rückkehr Revue passieren. Der Vorschlag von Bouillier, Henry Maître als Vorarbeiter einzustellen, kam einer Offenbarung gleich und zeigte sich als voller Erfolg. Dank ihm verfügte Luc nun über beste Verbindungen zu den wichtigsten und entscheidenden Personen. Er kannte die hiesigen Gepflogenheiten, einheimischen Verhandlungstaktiken und konnte somit kosteneffizient und zeitgerecht vorgehen, um alles Notwendige umzusetzen. Ein wahrer Glücksfall, wie sich zeigen sollte, je länger sich Luc wieder in Madagaskar aufhielt. Auch der Umstand, dass er Faly, diesen jugendlichen Einheimischen, dabeihatte, erwies sich als Gewinn. Zuerst hatte sich in ihm alles gegen eine Anstellung gesträubt, aber die Versicherung von Maître, dass der Kerl Gold wert war, hatte ihn schließlich überzeugt und zu einer Einwilligung geführt. Und so war es auch. Der Junge entwickelte sich zu einem ergebenen und arbeitswilligen Arbeiter. Dank ihm war die Rekrutierung der Einheimischen als billige Arbeitskräfte noch einfacher geworden und auch die Arbeit von Maître erleichterte sich entscheidend. Einzig die Herkunft von Faly ließ bei Luc zum ersten Mal seit der Rückkehr die Alarmglocken läuten. Maître zufolge war Falys Vater Teil der ruchlosen Sklavenhändler gewesen, die auf der Insel Sainte Marie ihr Unwesen getrieben hatten. Luc entschied sich, nicht weiter darauf einzugehen, und mimte gegenüber Maître den Unwissenden, was diese Geschichten und Erzählungen anbelangte. Nichtsdestotrotz wollte er die Informationen nicht ignorieren, im Gegenteil. Er musste alle Augen und Ohren in dieser Sache offenhalten, denn er wollte nicht, dass ihn seine Vergangenheit einholte. Dessen ungeachtet zeigte sich das Schicksal einmal mehr ihm wohlgesonnen. Wie lange würde sein Glück andauern?
Ein zufriedener Luc saß auf der kleinen Veranda seines neu erbauten Herrschaftshauses. Obgleich müde vom Arbeitstag, zögerte er, sich zur Ruhe zu begeben. Die Ereignisse der vergangenen Wochen und Monate beschäftigten seinen Geist. Neue Herausforderungen zeigten sich: sintflutartige Regenfälle, die den Boden der Vanillestauden erodierten, und die zunehmend feindseligen Auseinandersetzungen der einheimischen Bevölkerung mit der Kolonialmacht Frankreich und deren Großgrundbesitzern, zu denen auch Luc gehörte. Trotz dieser Herausforderungen war er erfüllt von der Realisierung seines Lebensprojekts. Nach einem Jahr intensiver Bauarbeit waren alle Gebäudeteile fertiggestellt. Sein Privathaus, bescheiden konzipiert, aber groß genug für seine Frau, seinen Sohn Rémy und möglichen zukünftigen Nachwuchs, zeugte von seiner Vision. Das Überzeugen seiner Frau davon, mit ihm nach Madagaskar zu ziehen, erwies sich jedoch als ein schwieriges Unterfangen. Die Trennung belastete Luc sehr und er verstand nicht, dass sie sich weigerte, ihm zu folgen. Während Europa ihr Ziel schien, träumte er von einer gemeinsamen Zukunft in seinem Land. Die Hoffnung, dass sie mit dem abgeschlossenen Bauvorhaben und der bevorstehenden Ernte, die finanzielle Sicherheit versprach, ihre Meinung ändern könnte, hielt ihn aufrecht. Vor der Erschließung der Plantagen wurden Unterkünfte für die Arbeiter gebaut. Luc überließ diese Aufgabe den beeindruckend geschickten Einheimischen. Unter der strengen Aufsicht von Maître entstanden Hütten und die entdeckte Quelle wurde zu einer zentralen Wasserstelle ausgebaut. Die Anlage der ersten von drei geplanten Plantagen begann mit dem Glück, reife Vanillestauden von einer verlassenen Plantage im Norden übernehmen zu können. Luc setzte sich das Ziel, die Betriebsgebäude bis zur ersten Ernte zu vollenden. Die bevorstehende Vanilleproduktion war für ihn eine große Herausforderung, da ihm das nötige Wissen fehlte. Henry Maîtres Engagement erwies sich erneut als glückliche Fügung, zumal er bereits Erfahrungen gesammelt hatte, doch die schiere Größe der Plantagen stellte selbst ihn vor Herausforderungen. Als Luc erfuhr, dass es über hundert Vanillevarianten gab und er die passende auswählen musste, konnte er ein lautes Lachen nicht unterdrücken. „Über hundert? Wie bitte? Und wie soll ich wissen, welche geeignet ist?“ Maître lachte angesichts der Überforderung seines Patrons. „Nun, so schlimm ist es nicht, Master Luc. Theoretisch gibt es über hundert, aber hier auf Madagaskar haben wir nur die Bourbon-Vanille. Sie wurde vor Jahrzehnten von der Insel La Réunion eingeführt und gedeiht prächtig“, beruhigte er Luc. Eine viel größere Herausforderung betraf die Bestäubung, die von Hand vorgenommen werden musste, was mehr Erfahrung voraussetzte. Das würden sie aber sicherlich meistern, fügte Faly grinsend hinzu. Er erinnerte Luc daran, dass die Namen für die drei Plantagen immer noch fehlten. Im Großen und Ganzen waren sie gut gestartet. Die erste Ernte war ertragreich ausgefallen und die Pflanzen auf den beiden anderen Plantagen wuchsen und gediehen ebenfalls. Der französische Markt verlangte nach Vanillestangen, was den Verkauf vorerst sicherte. Luc gähnte. Es war Zeit, ins Bett zu gehen. Gedanken über die Namen der Plantagen konnte er sich morgen machen und die Furcht vor neuerlichen Angriffen seitens der Rebellen schob er beiseite.
Der nächste Morgen brach an. Luc nippte an seinem zweiten Kaffee und blickte auf den wolkenverhangenen Himmel. Zwei Regenfronten waren bereits vorbeigezogen und ein sanfter Wind spielte mit den zarten Blättern der Palmenzweige. In dieser friedlichen Atmosphäre wurde ihm ein Brief seiner Frau durch den Kurierdienst der französischen Armee überreicht. Mit erwartungsvoller Neugier öffnete er ihn, in der stillen Hoffnung, dass sie sich doch noch dazu entschließen würde, zu ihm nach Madagaskar auszuwandern. Bereits zur Jahrhundertwende hatte er einen Versuch unternommen, jedoch erfolglos. Weder seine Frau noch sein mittlerweile zwölfjähriger Sohn Rémy zeigten Interesse an seinem neuen abenteuerlichen Leben. Für sie gab es keinen Grund, Frankreich zu verlassen, und sie verstanden nicht, dass er sie damals so abrupt zurückgelassen hatte. Sein Brief war ein letzter verzweifelter Versuch gewesen, seine Frau und seinen Sohn zu überzeugen, zu ihm zu kommen. Er berichtete vom Abschluss der Bauvorhaben, insbesondere des Wohnhauses, von seinen Plantagen, die er nun alle nach französischen Königen oder Kaisern benannt hatte, und natürlich von seinem geschäftlichen Erfolg. Die Übergriffe der Rebellen erwähnte er bewusst nicht, um ihnen keine Angst zu machen und die Wahrscheinlichkeit ihres Übersiedelns nicht weiter zu verringern. Leider enthielt auch dieser Brief enttäuschende Nachrichten. Luc legte die gelesenen Zeilen resigniert beiseite. Es gab nichts Neues: dieselben Vorwürfe und totales Unverständnis. Zusätzlich meinte er erstmals, tiefe Verbitterung zwischen den Zeilen zu spüren. Es war schade, aber auch verständlich. Die Abreise damals hatte er in wenigen Monaten und recht überstürzt umgesetzt. In Lucs Vorstellung war klar gewesen, dass Frau und Sohn nach kürzester Zeit folgen würden, spätestens, wenn er in Madagaskar eine neue Existenz aufgebaut hätte. Leider hatte sich das als Trugschluss erwiesen. Der Erfolg stellte sich ein, aber weder seine Frau noch sein Sohn wollten daran teilhaben. Ein Verlassen seines Großgrundbesitzes in Madagaskar kam für Luc nicht mehr in Frage. Hier gehörte er hin, hier fühlte er sich zu Hause. Wohl oder übel musste er sich eingestehen, dass er sein Leben allein verbringen würde.
Wie Bouillier richtig vorhergesagt hatte, war Joseph Gallieni zum Generalgouverneur ernannt worden. Kaum in Madagaskar eingetroffen, leitete er einen weiteren Feldzug ein. Mit eiserner Hand wurden die Einheimischen im Süden und im Hochland angegriffen, niedergemetzelt und gnadenlos unterworfen. Schaurige Geschichten und Gerüchte verbreiteten sich wie ein Lauffeuer. Der Widerstand brach schnell zusammen, da die Madagassen, aus zahlreichen Stämmen bestehend, untereinander zerstritten waren und keine konzentrierte Gegenwehr entfalten konnten. Die offiziellen Kampfhandlungen hatten vor kaum sechs Monaten im Sommer 1905 mit der totalen Kapitulation ihr Ende gefunden. Die Unterwerfung war vollständig und Madagaskar gehörte nun zu Frankreich. Trotzdem flammten hier und da immer wieder kleine Aufstände auf, die Luc zunehmend Kopfzerbrechen bereiteten, auch wenn sein Besitztum bisher verschont geblieben war. Insbesondere die französische Armee und deren Stützpunkte standen im Fokus der guerillaähnlichen Widerstandsgruppen. Wie lange würde er selbst wohl noch verschont bleiben? Es schien nur eine Frage der Zeit zu sein. Dennoch sollte es mehr als zehn Jahre dauern, bis die Ereignisse sich überstürzten und Luc von seiner Vergangenheit eingeholt wurde.
„Master Luc, es ist mir reichlich unangenehm, aber ich muss diese Frage jetzt stellen. Sie liegt mir schon seit Wochen auf der Zunge. Was ist wahr an den Gerüchten über Ihre Vergangenheit im Zusammenhang mit den Piraten von Sainte Marie, die überall kursieren?“ Ein sichtlich angespannter und nervöser Henry Maître saß Luc gegenüber und schaute ihm unentwegt in die Augen. Schweißperlen zeigten sich auf seiner zerfurchten Stirn, nervös trommelte er mit den Fingern seiner linken Hand auf den Salontisch. Maître hatte die dramatische Zuspitzung wesentlicher Faktoren, die die Geschäfte betrafen, nicht übersehen können – abgesehen von den Gerüchten und ganz zu schweigen von Lucs chronisch schlechtem Gemütszustand. Das war schon seit Monaten spürbar. Dass Maître endlich Klarheit verlangte, war nur logisch und menschlich nachvollziehbar, denn er hatte erst kürzlich seinen jungen Sohn Richard motivieren können, ebenfalls für Luc zu arbeiten. Somit verbanden sich sein Schicksal, sein Erfolg und sein Misserfolg mit Lucs Geschick und er konnte das Unbehagen fast körperlich spüren. Lucs Gesichtszüge verkrampften sich und er rang nach Atem. Im Grunde war er sehr froh, dass sich jetzt alles endlich klären ließ, und er machte sich Vorwürfe, dass er es nicht von sich aus schon viel früher angesprochen hatte. Ihm war klar gewesen, dass nach den turbulenten Ereignissen der letzten Monate früher oder später Fragen gestellt würden. Unbequeme Fragen. Fragen, die einer Erklärung bedurften. Dass sich all die negativen Entwicklungen so plötzlich kumulierten und auf ein grausames Ende zuliefen, machte die Situation nicht erträglicher, aber Luc hatte es kommen sehen, ja, gespürt und das schon seit Längerem. Angefangen hatte es mit übernatürlich zahlreichen und heftigen Sommergewittern im Jahr 1911. Diese hatten eine starke Bodenerosion in Gang gesetzt, derer sie nicht mehr Herr geworden waren. Zwei der drei Plantagen hatten deshalb komplett neu bepflanzt werden müssen. Zusätzlich hatte Luc festgestellt, dass die Qualität und die Effizienz der Bestäubung unzureichend zu sein schienen. Leider kannten weder er noch Maître die Gründe und waren sich unsicher, wie das Problem gelöst werden konnte. Niemand aus ihrem Umfeld wusste einen Rat oder hätte Abhilfe leisten können. Die Folge war ein Ernteausfall gigantischen Ausmaßes mit dementsprechend großem Einkommensverlust. Luc hatte sämtliche Rückstellungen für Neubepflanzungen und das Ausgleichen der Verluste aufwenden müssen. Im Jahre 1914 hatten sie endlich die Talsohle durchschritten. Die Plantagen gediehen wieder prächtig und sie dachten, sie hätten das Schlimmste überstanden. Dann brach der Erste Weltkrieg aus und die weltweite Nachfrage und Absatzmärkte brachen komplett ein. Dank Verbindungen von Bouillier bis in die höchsten Regierungskreise Frankreichs überstanden sie auch diese vier Kriegsjahre. Finanzielle Unterstützung und eine vertraglich vereinbarte Mindestabsatzmenge verhinderten die Katastrophe, sprich den Konkurs. Leider erholte sich die Weltwirtschaft danach nur langsam und Luc hatte sogar seine letzten Vermögenswerte zur Weiterführung des Geschäfts aufwenden müssen. Es blieb ihm nichts anderes übrig. Er wollte nicht aufgeben. Noch nicht. Als wäre das nicht schon tragisch genug gewesen, machten plötzlich Gerüchte die Runde, wonach Luc seinen Reichtum der Mitgliedschaft bei den Piraten von Sainte Marie zu verdanken hätte. Die hielten sich hartnäckig. Was sollte er tun? Sie saßen, wie so oft in den letzten Wochen, auf Lucs Veranda, um wichtige Entscheidungen und Vorgehensweisen für die nächsten Tage zu besprechen. Seit Tagen erwarteten sie nämlich einen Großangriff einheimischer Rebellen. Diesen entscheidenden Hinweis hatten sie von der französischen Armeespitze erhalten, die sich auf einen in den gegnerischen Reihen platzierten Spitzel berief. Einzig über den Zeitpunkt war nichts bekannt und das Warten zerrte an ihren Nerven. Das Verteidigungsdispositiv war aufgezogen und das Land von Luc glich einem Armeecamp.
„Die Gerüchte über meinen Reichtum stimmen“, begann Luc seufzend, die drängende Frage von Maître zu beantworten. „Ich diente zwei Jahre lang in Tippu-Tins Piratenbande und machte dank meines privilegierten Postens als wichtigster Kapitän einer umgebauten Handelsfregatte richtig viel Geld. Wie es dazu kam, erzähle ich Ihnen gerne ein anderes Mal. So oder so, es war äußerst abenteuerlich, doch bin ich keinesfalls stolz darauf. Ich habe hier und jetzt nur eine Bitte: Behalten Sie dieses Wissen für sich oder wir gehen gemeinsam unter, egal wie der Kampf gegen die Rebellen ausgeht. Sofolo, der mutmaßliche Rebellenanführer, kenne ich aus meiner Piratenzeit. Mit ihm habe ich noch eine Rechnung offen und ich freue mich, endlich Rache üben zu können!“, endete Luc.
Sein Blick war furchteinflößend, sodass Maître ihn erstaunt ob des Gefühlsausbruchs ansah.
Zwei Tage nach diesem klärenden Gespräch griffen die Rebellen im Morgengrauen an.
Schon vor Wochen hatten Luc, Maître und zwei Armeeoffiziere einen Plan zur Verteidigung des Gabriel-Landes ausgearbeitet. Allen war klar, dass der Angriff sehr wahrscheinlich im Morgengrauen erfolgen würde. Taktisch beurteilt konnten die Rebellen nicht von Westen, aus dem Hinterland, kommen, da sie in dem Fall zwei Armeecamps als Hindernis überwinden mussten. Und die Wahrscheinlichkeit, dass sie vom Meer kamen, war gleich null, weil sie über keine größeren Schiffe mit entsprechender Truppentransportkapazität verfügten. So blieb einzig der Norden übrig, zumal im Süden der Masoala-Urwald lag und der nicht überwunden werden konnte. Somit war klar, worauf sie ihre Verteidigung ausrichten mussten. Die beiden Offiziere entwarfen nun einige Angriffsszenarien. Einerseits zeigte sich so, wie sie es selbst angehen würden, und andererseits, was ihre Erfahrungen im Kampf mit den Einheimischen während der geführten Feldzüge sie lehrten. So kristallisierte sich eine klare Hauptstrategie heraus, mit diversen möglichen und im Kleinen abweichenden Varianten. Der Hauptstrom würde über die Küstenstraße geführt, und zwar so massiv, dass die Verteidiger glaubten, es gebe keine andere Front mehr. Damit ließe sich alle Kraft auf der Küstenstraße binden und mögliche Umgehungsrouten würden dadurch vernachlässigt oder gar nicht mehr in Erwägung gezogen. Optionale Routen bestanden darin, die massive Straßensperre im Westen durch die Plantagen oder im Osten entlang des Meeres durch das Schilf, das von einigen schmalen Pfaden durchzogen war, zu umgehen. Oder sie würden mit einem kleinen Schiff ein bescheidenes Kontingent an Rebellen am großen Steg absetzen. So oder so, und da waren sich alle einig, sämtliche Umgehungsrouten mussten zusätzlich abgesichert werden. Eine hitzige Diskussion entbrannte über die Frage, ob sie die Angreifer auf der Straße mit allen Mitteln abwehren oder nach geraumer Zeit eine Scheinflucht inszenieren und die Rebellen ins Arbeiterdorf lassen sollten. Dort könnten sie den Hauptteil der Angreifer erwarten und gezielt und konzentriert eliminieren. Es handelte sich um eine gewagte Aktion und sie diskutierten lange über das Für und Wider dieser Taktik. Schließlich verwarfen sie die Variante, da Luc darauf bestand, den Kampf möglichst fernab der Gebäude und Häuser zu führen. Er wollte so wenig Kollateralschaden wie möglich zulassen. Es war anzunehmen, dass ohnehin einige Rebellen über die Umgehungsrouten ins Dorf vordringen könnten, und eine Konzentration der Rebellenkräfte wollten sie nicht. Damit war das Verteidigungsdispositiv geklärt und die beiden Offiziere begannen, die Truppenstärke entsprechend zu verteilen. Das stärkste Kontingent sollte die Straße sichern, das zweitgrößte im Dorf agieren, auch als Reserve dienend, jeweils unter dem Befehl der beiden Offiziere. Zwei etwas kleinere Verbände formierten sich in den Plantagen unter der Leitung von Maître und das andere am Meer wurde von Luc höchstpersönlich befehligt. Zusätzlich sollten Patrouillen und Späher vor Überraschungsangriffen schützen. Jetzt galt es, die Stellungen zu besetzen und auszubauen, um anschließend den Dienst antreten zu können und das lange Warten zu ertragen. Währenddessen nahm das geregelte Arbeitspensum auf Gabriel-Land seinen gewohnten Lauf.
Luc wurde durch das schrille Läuten des Armeetelefons, einer Standleitung von der Straßensperre der Armee zu seinem Haus, jäh aus dem Schlaf gerissen. Er hob den Hörer: „Ja, ich höre?“
„Master Luc, sie greifen an. Wie wir vermutet haben, bewegt sich ein großer Konvoi auf uns zu. Es wurde bereits ein Meldeläufer ins Arbeiterdorf geschickt, zwei andere sind zum Abwehrdispositiv am Meer und in die Plantagen geschickt worden“, beendete der Nachrichtensoldat mit erregter Stimme seinen Bericht.
„Danke!“, lautete die trockene Antwort von Luc.
Er hängte auf und glaubte, im Hintergrund schon Gewehrsalven zu vernehmen. Endlich, der Tag der Entscheidung war da. Erleichterung machte sich in ihm breit. Er atmete tief ein und zog rasch die Stiefel an. Die Kleidung hatte er in den letzten Nächten nicht ausgezogen. Er wollte stets bereit sein. Luc hasste Überraschungen, vor allem, wenn jemand nach seinem Leben trachtete. Eine anhaltende Nervosität und die ständige Erinnerung daran, dass heute sein Todestag sein konnte, weckten Erinnerungen an seine Piratenzeit. Dieses Gefühl kam ihm seltsam vertraut vor. Nachdem er seine Pistole und sein Messer überprüft und am Gürtel befestigt hatte, verließ er das Haus. Sein Ziel war es, sich zu der Gruppe am Meer zu gesellen, wie geplant. Er hatte eine Vorahnung, dass Sofolo die Gruppe am Meer anführte.
Die Anspannung stieg von Sekunde zu Sekunde. Dunkelheit beherrschte noch die Umgebung. Luc musste sein Tempo drosseln, um nicht zu stolpern. Ein Silberstreifen am östlichen Himmel deutete auf den beginnenden Morgen hin, während am Strand letzte Nebelschwaden vorüberzogen. Luc bog vom Pfad zum Strand links in einen noch schmaleren Pfad ab und näherte sich langsam und leise der Stellung der Armee. Vor einer 90-Grad-Biegung blieb er stehen und lauschte den ersten Gewehrsalven von der Straße her.
In Kauerstellung flüsterte er kaum hörbar das Passwort „Trikolore!“ – keine Reaktion. Seine Anspannung wuchs. Er wiederholte es und hörte daraufhin ein Rascheln vor ihm.
„Sind …sind Sie das, Master Luc?“, stammelte Faly unsicher.
Plötzlich eröffnete ein Maschinengewehr das Feuer, gefolgt von zahlreichen Schreien. Detonationen und der Lärm von Petarden erfüllten die kühle Morgenluft. Tod und Verderben breiteten sich an der Straßensperre aus. Der Kampf hatte begonnen.
„Ja, ich bin es, Faly“, antwortete Luc leise. Er bog um die Ecke. „Ist hier alles ruhig?“, wollte er wissen. Aus dem Augenwinkel sah er, wie Faly nickte. Luc kroch weiter voran, an Faly vorbei, und konnte nun schemenhaft diverse Soldaten in Schussstellung mit aufgestellten Bajonetten erkennen. Der Lärm von der Straße intensivierte sich weiter. Der diensthabende Korporal drehte sich zu Luc um und legte den Zeigefinger an die Lippen, um anschließend mit dem Daumen in die entgegengesetzte Richtung zu weisen. Alle verharrten und lauschten angespannt ins dunkle Schilf. War da nicht ein Rascheln und Getrampel zu hören? Unsicher schauten sich Luc und der Korporal an. Da war dieses Geräusch wieder. Die Anspannung steigerte sich nochmals. Es wurde zunehmend schwierig, in dem Kampflärm von der Straße, der immer intensiver und lauter zu werden schien, etwas Genaueres auszumachen. So oder so, etwas oder jemand kam auf dem Pfad auf ihre Stellung zu. Es wurde zunehmend heller und Luc traute sich, aufzustehen, um über das Schilfgras hinwegzuspähen. Er zählte zehn Köpfe und duckte sich sofort wieder. Dem Korporal zeigte er mit zweimal fünf Fingern an, was auf dem Pfad vor ihnen los war. Dieser nickte verstehend. Die Gruppe der Rebellen bog auf die Gerade des Pfads, der direkt zu ihnen in den Hinterhalt führte.
Luc hatte bereits seine Pistole gezogen und wollte das Feuer eröffnen, als überraschend Schüsse zu ihrer Rechten losknatterten. Das musste am Strand sein, durchfuhr es Luc, und schon schrie der Korporal: „Feuer!“
Eine orchestrierte Salve entlud sich. Die Rebellen brachen zusammen oder wurden durch die Wucht der Treffer nach hinten geworfen. Zwei Soldaten erhoben sich sofort und rannten wild schreiend auf die letzten zwei verbleibenden Rebellen zu, um sie mit ihren Bajonetten gnadenlos niederzustechen.
„Dem Pfad folgen und herausfinden, ob noch mehr kommen!“, befahl der Korporal den beiden. „Ihr sichert diese Stelle. Wir machen keine Gefangenen. Alle anderen nachladen, haltet euch bereit“, befahl er dem Rest der kleinen Gruppe mit aufgeregter und zittriger Stimme.
Zwei Soldaten durchsuchten die gefallenen Rebellen und stachen eventuell Verwundeten gezielt mit dem Bajonett ins Herz. Keine Gefangenen. Luc musste schlucken. Ihm wurde übel angesichts solcher Grausamkeit und er war für Sekunden wie gelähmt.





























