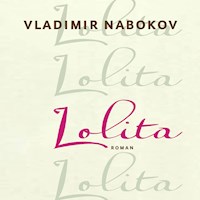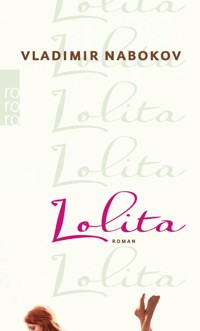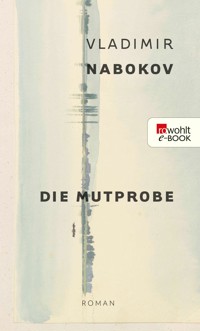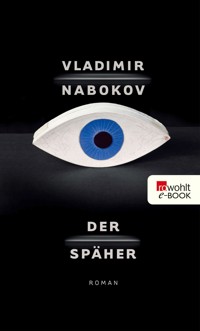
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Dieser frühe Roman des großen Erzählers Vladimir Nabokov gibt sich vordergründig als unglückliche Liebesgeschichte: Der junge Smurow liebt ein Mädchen, das einen anderen erwählt hat. Aber "man kann den ´Späher´ sehr unterschiedlich lesen - als psychologische Studie, als Kriminalroman für Anspruchsvolle, als ironisches Genrebild, als amüsantes Denkspiel und schließlich auch als traurige erotische Geschichte --- So ist dieses kleine Buch äußerst reichhaltig und vielseitig." (Marcel Reich-Ranicki, Frankfurter Allgemeine Zeitung)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 128
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Vladimir Nabokov
Der Späher
Roman
Über dieses Buch
Dieser frühe Roman des großen Erzählers Vladimir Nabokov gibt sich vordergründig als unglückliche Liebesgeschichte: Der junge Smurow liebt ein Mädchen, das einen anderen erwählt hat. Aber «man kann den ‹Späher› sehr unterschiedlich lesen – als psychologische Studie, als Kriminalroman für Anspruchsvolle, als ironisches Genrebild, als amüsantes Denkspiel und schließlich auch als traurige erotische Geschichte – So ist dieses kleine Buch äußerst reichhaltig und vielseitig.» (Marcel Reich-Ranicki, Frankfurter Allgemeine Zeitung)
Vita
Vladimir Nabokov ist einer der wichtigsten Schriftsteller des 20. Jahrhunderts.
Er entstammte einer großbürgerlichen russischen Familie, die nach der Oktoberrevolution von 1917 emigrierte. Nach Jahren in Cambridge, Berlin und Paris verließ Nabokov 1940 Europa und siedelte in die USA über, wo er an verschiedenen Universitäten arbeitete.
In den USA begann er, seine Romane auf Englisch zu verfassen, «Lolita» war Nabokovs Liebeserklärung an die englische Sprache, wie er im Nachwort selber schrieb. Nach einer anfänglich schwierigen Publikationsgeschichte wurde «Lolita» zum Welterfolg, der es Nabokov ermöglichte, sich nur noch dem Schreiben zu widmen.
Nabokov zog in die Schweiz, wo er schrieb, Schmetterlinge fing und seine russischen Romane ins Englische übersetzte.
Er lebte in einem Hotel in Montreux, wo er am 2. Juli 1977 starb.
Der Herausgeber, Dieter E. Zimmer, geboren 1934 in Berlin, 1959 bis 1999 Redakteur der Wochenzeitung «Die Zeit», seit 2000 freier Autor. Zahlreiche Veröffentlichungen über Themen der Psychologie, Biologie und Anthropologie, literarische Übersetzungen (u.a. Nabokov, Joyce, Borges).
Das Gesamtwerk von Vladimir Nabokov erscheint im Rowohlt Verlag.
Impressum
Geschrieben in Berlin 1929/30 auf Russisch. Erstveröffentlichung in der Zeitschrift «Sowremennyje sapiski», Paris, November 1930 und als Buch im Verlag «Russkije Sapiski», Paris, 1938. Englische Übersetzung von Dmitri und Vladimir Nabokov unter dem Titel «The Eye» im Verlag Phaedra, New York, 1965. Deutsche Übersetzung von Dieter E. Zimmer unter dem Titel «Der Späher» im Rowohlt Verlag, Reinbek, 1985 und 1992.
Der Text folgt: Vladimir Nabokov, Gesammelte Werke, Band 2, Frühe Romane, herausgegeben von Dieter E. Zimmer.
Überarbeitete Ausgabe November 2018
Veröffentlicht im Rowohlt Taschenbuch Verlag, Reinbek bei Hamburg
Copyright © 1985, 1992, 2018 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
«The Eye» Copyright © 1965 by Vladimir Nabokov
Veröffentlicht im Einvernehmen mit The Estate of Vladimir Nabokov
Umschlaggestaltung any.way, Cordula Schmidt
Umschlagabbildung akg-images/Rabatti & Domingie
ISBN 978-3-644-00233-3
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Für Véra
1
Diese Frau, diese Mathilde, habe ich im ersten Herbst meines Emigrantenlebens in Berlin kennen gelernt, in den frühen zwanziger Jahren zweier Zeitspannen, der des zwanzigsten Jahrhunderts und der meines widerwärtigen Lebens. Jemand hatte mir gerade eine Hauslehrerstelle bei einer russischen Familie verschafft, die noch keine Zeit gehabt hatte, arm zu werden, und die noch immer an den Phantasmen ihrer alten Petersburger Gewohnheiten festhielt. Mit Kindererziehung hatte ich keinerlei Erfahrungen – hatte nicht die geringste Ahnung, wie man mit ihnen umzugehen hat und worüber man mit ihnen redet. Es waren zwei, zwei Jungen. In ihrer Gegenwart fühlte ich mich auf demütigende Weise unsicher.
Sie zählten nach, wie viel ich rauchte, und angesichts dieser ihrer rücksichtsvollen Neugier hielt ich meine Zigarette in einem ungewohnten, unbeholfenen Winkel, so als rauchte ich zum ersten Mal; immer wieder fiel mir Asche auf den Schoß, und dann wanderte ihr klarer Blick aufmerksam von meiner Hand zu dem blassgrauen Pollen, der nach und nach in die Wolle hineingerieben wurde.
Mathilde, die mit ihren Eltern befreundet war, besuchte sie oft und blieb dann zum Abendessen. Als bei ihrem Abschied eines Abends gerade ein geräuschvoller Regenguss niederging, liehen sie ihr einen Schirm, und sie sagte: «Ach wie nett, vielen Dank auch. Der junge Mann begleitet mich nach Hause und bringt ihn dann mit zurück.» Von dieser Stunde an gehörte es zu meinen Pflichten, sie nach Hause zu bringen. Sie muss mir wohl in gewisser Weise gefallen haben, diese füllige, ungezügelte, kuhäugige Dame mit den großen Lippen, die sich zu einem scharlachroten Schmollmund, einer Möchtegern-Rosenknospe spitzten, wenn sie beim Pudern ihres Gesichts in den Taschenspiegel sah. Sie hatte schlanke Fesseln und einen anmutigen Gang, was vieles wettmachte. Eine großzügige Wärme ging von ihr aus; sobald sie erschien, hatte ich immer das Gefühl, die Zimmerheizung wäre höher gedreht worden, und wenn ich diesen großen lebendigen Ofen fortgeschafft hatte, indem ich sie nach Hause brachte, und inmitten der sanft tönenden Geräusche und des Quecksilberschimmers der erbarmungslosen Nacht allein nach Hause zurückging, dann fror ich, fror so sehr, dass mir übel wurde.
Später kam ihr Mann aus Paris und begleitete sie, wenn sie zum Abendessen erschien; er war ein Mann wie alle andern, und ich achtete nicht weiter auf ihn – mir fiel nur seine Angewohnheit auf, sich vor dem Sprechen mit einer raschen Folge von Grunzlauten in seine Faust hinein zu räuspern; und auch sein schwerer schwarzer Stock mit dem glänzenden Knauf, mit dem er auf den Boden zu klopfen pflegte, während Mathilde den Abschied von ihrer Gastgeberin in einen munteren Monolog verwandelte. Nach einem Monat fuhr er wieder weg, und als ich sie am ersten Abend danach nach Hause brachte, bat mich Mathilde mit nach oben, damit ich mir ein Buch hole, zu dessen Lektüre sie mich schon lange zu überreden versucht hatte, etwas Französisches, betitelt Ariane, Jeune Fille Russe[1]. Wie gewöhnlich regnete es, und die Straßenlaternen hatten zittrige Heiligenscheine; meine rechte Hand war in das heiße Fell ihres Moleskinmantels vergraben; mit der Linken hielt ich einen geöffneten Regenschirm, auf den die Nacht herabtrommelte. Dieser Schirm lag – später in Mathildes Wohnung – aufgeklappt neben einem Dampfheizungskörper und tropfte und tropfte, alle halbe Minute eine Träne vergießend, sodass sich eine große Lache um ihn sammelte. Was das Buch angeht, so vergaß ich es.
Mathilde war nicht meine erste Mätresse. Vor ihr hatte mich eine Näherin in St. Petersburg geliebt. Auch sie war füllig gewesen, auch sie hatte mir zugeredet, einen bestimmten Schundroman zu lesen (Murotschka, die Lebensgeschichte einer Frau). Beide diese ausladenden Damen stießen während des sexuellen Sturms ein schrilles, erstauntes, kindliches Piepsen aus, und manchmal kam es mir vor, als sei alles eine Kraftvergeudung gewesen, was ich durchgemacht hatte, als ich aus dem bolschewistischen Russland flüchtete, indem ich unter Todesängsten die finnische Grenze überquerte (selbst wenn es im D-Zug war und ausgestattet mit einem prosaischen Ausweispapier), nur um von einer Umarmung zu einer fast identischen anderen überzuwechseln. Außerdem begann mich Mathilde bald zu langweilen. Sie hatte nur einen einzigen ständigen Gesprächsgegenstand, und der deprimierte mich – ihren Mann. Dieser Mann, sagte sie, sei ein herrlicher Rohling. Wenn er sie erwischen sollte, brächte er sie auf der Stelle um. Er bete sie an und sei barbarisch eifersüchtig. In Konstantinopel habe er sich einmal einen vorwitzigen Franzosen gegriffen und ihn wie einen Scheuerlappen mehrfach gegen den Boden geklatscht. Er sei so leidenschaftlich, es mache einem Angst und Bange. Doch sei er schön in seiner Grausamkeit. Immer wieder versuchte ich, sie von dem Thema abzubringen, doch es blieb das Steckenpferd, das sie mit ihren kräftigen fetten Schenkeln ritt. Das Bild ihres Mannes, das sie so entstehen ließ, war mit der Erscheinung dieses Herrn, den ich kaum bemerkt hatte, schwer zu vereinbaren; gleichzeitig fand ich es höchst unerquicklich, mir vorzustellen, dass es vielleicht doch nicht ihre Erfindung war und dass im nämlichen Augenblick ein eifersüchtiger Unhold in Paris die missliche Lage ahnte, in der er sich befand, und die banale Rolle ausagierte, die seine Frau ihm zugewiesen hatte: mit den Zähnen zu knirschen, mit den Augen zu rollen, schnaufend durch die Nase zu atmen.
Wenn ich mich dann mit leerem Zigarettenetui nach Hause schleppte, mein Gesicht in der Morgenbrise brannte, als hätte ich soeben Bühnenschminke entfernt, und bei jedem Schritt ein pochender Schmerz durch meinen Kopf hallte, inspizierte ich oft mein kümmerliches kleines Glück von allen Seiten, staunte, bemitleidete mich und fühlte mich mutlos und verängstigt. Der Gipfel der Liebe war für mich nur eine kahle Hügelkuppe mit einer unerbittlichen Aussicht. Um glücklich zu sein, muss der Mann schließlich ab und zu ein paar Augenblicke vollkommener Leere durchmachen. Doch war ich immer exponiert, hatte ich immer geweitete Augen; selbst im Schlaf hörte ich nicht auf, mich zu belauern, begriff ich nichts von meinem Dasein, wurde ich verrückt bei dem Gedanken, dass ich nicht aufhören könne, meiner selbst gewahr zu sein, und beneidete alle diese einfachen Leute – Angestellte, Revolutionäre, Ladenbesitzer –, die ihre bescheidene Arbeit voller Selbstvertrauen und Konzentration verrichten. Ich besaß keine Schale dieser Art; und an jenen schrecklichen pastellblauen Morgen, wenn meine Absätze durch die Wildnis der Stadt klapperten, stellte ich mir jemanden vor, der dem Irrsinn anheimfällt, weil er deutlich der Bewegung der Erdkugel innewird: Da geht er, stolpert, versucht das Gleichgewicht zu halten, klammert sich an die Möbel; oder er lässt sich mit einem aufgeregten Grinsen auf einen Fensterplatz nieder, wie ein Fremder im Zug, der sich mit den Worten «Der legt ja ein Affentempo vor!» an einen wendet – doch bald schon verursachen ihm das Geschuckel und Geschlinger Übelkeit; er beginnt an einer Zitrone oder einem Eiswürfel zu lutschen und legt sich flach auf den Boden, doch alles ist vergeblich. Die Bewegung ist nicht aufzuhalten, der Fahrer ist blind, die Bremsen sind nirgends zu finden – und wenn die Geschwindigkeit unerträglich wird, dann muss sein Herz zerspringen.
Und wie war ich einsam! Mathilde, die schüchtern fragte, ob ich Gedichte schriebe; Mathilde, die mich auf der Treppe oder an der Tür listenreich anstiftete, sie zu küssen, nur um die Gelegenheit zu haben, ein Erbeben zu heucheln und leidenschaftlich «Du bist ja wahnsinnig …» zu flüstern – Mathilde zählte natürlich nicht. Und wen kannte ich in Berlin sonst? Den Sekretär einer Hilfsorganisation für Emigranten; die Familie, bei der ich als Hauslehrer angestellt war; Herrn Weinstock, den Eigentümer einer russischen Buchhandlung; die kleine alte deutsche Dame, bei der ich früher einmal zur Untermiete gewohnt hatte – eine magere Liste. So lud mein ganzes schutzloses Wesen das Unglück geradezu ein. Eines Abends wurde die Einladung angenommen.
Es war so um sechs. Die Zimmerluft wurde schwer von Abenddämmerung, und ich konnte kaum noch die Zeilen der humorvollen Tschechow-Geschichte erkennen, die ich meinen Zöglingen mit stolpernder Stimme vorlas; doch traute ich mich nicht, das Licht anzumachen: Diese Jungs hatten einen seltsamen, unkindlichen Hang zur Sparsamkeit, einen gewissen scheußlichen Trieb zum Haushalten; sie kannten die genauen Preise von Wurst, Butter, Elektrizität und verschiedenen Automodellen. Während ich also laut Die Kontrabass-Romanze las, in dem vergeblichen Versuch, sie zu unterhalten, und mich dabei für mich wie für den armen Autor schämte, wusste ich, dass ihnen mein Kampf mit der Verwischung stiftenden Dunkelheit bewusst war und dass sie kühl abwarteten, ob ich durchhielte, bis im Haus gegenüber das erste Licht anging und ein Beispiel gab. Ich schaffte es, und Licht ward mein Lohn.
Gerade schickte ich mich an, meine Stimme (beim Herannahen der komischsten Passage der Geschichte) lebendiger zu machen, als im Flur plötzlich das Telephon klingelte. Wir waren in der Wohnung allein, und die Jungen sprangen sofort auf und rannten um die Wette zu dem Geschrille. Ich blieb mit dem geöffneten Buch auf dem Schoß sitzen und lächelte die unterbrochene Zeile gerührt an. Der Anruf, stellte sich heraus, war für mich. Ich setzte mich in einen knarrenden Korbsessel und legte den Hörer ans Ohr. Meine Schüler standen daneben, einer zu meiner Rechten, einer zu meiner Linken, und beobachteten mich unbewegten Gesichts.
«Ich bin auf dem Weg», sagte eine männliche Stimme. «Sie sind doch zuhause, nehme ich an?»
«In Ihrer Annahme sollen Sie nicht enttäuscht werden», antwortete ich heiter. «Aber wer sind Sie?»
«Sie erkennen mich nicht? Umso besser – dann wird es eine Überraschung», sagte die Stimme.
«Aber ich wüsste gern, wer am Apparat ist», beharrte ich lachend. (Später sollte ich mich nur mit Grauen und Beschämung an die kokette Verspieltheit meines Tons erinnern.)
«Warten Sie nur ab», sprach die Stimme knapp.
Jetzt begann ich erst recht zu frohlocken. «Aber warum? Warum?», fragte ich. «Das ist ja eine witzige Art, sich …» Da mir klar wurde, dass ich in ein Vakuum hinein sprach, zuckte ich die Achseln und hängte auf.
Wir gingen ins Wohnzimmer zurück. Ich sagte: «Na, wo waren wir denn stehengeblieben?», und als ich die Stelle gefunden hatte, las ich weiter.
Trotzdem verspürte ich eine sonderbare Unruhe. Während ich mechanisch vorlas, überlegte ich, wer dieser Gast sein mochte. Ein Neuankömmling aus Russland? Vage ließ ich die mir bekannten Gesichter und Stimmen Revue passieren – viele waren es ja leider nicht –, und aus irgendeinem Grund hielt ich bei einem Studenten namens Uschakow inne. Die Erinnerung an mein einziges Jahr auf der Universität in Russland und an meine Einsamkeit dort hortete diesen Uschakow wie einen Schatz. Wenn bei einer Unterhaltung von dem Kneiplied Gaudeamus igitur und der tollen Studentenzeit die Rede war und ich dabei einen wissenden, leicht verträumten Gesichtsausdruck bekam, so bedeutete das, dass ich an Uschakow dachte, obwohl ich weiß Gott nur ein paarmal mit ihm geplaudert hatte (über politische oder sonstige Bagatellen, ich weiß nicht mehr). Es war indessen kaum wahrscheinlich, dass er sich am Telephon so geheimnisvoll gäbe. Ich verlor mich in Vermutungen und stellte mir bald einen kommunistischen Agenten, bald einen exzentrischen Millionär vor, der einen Sekretär brauchte.
Die Klingel. Wieder stürzten die Jungen kopfüber in den Flur. Ich legte mein Buch weg und schlenderte hinter ihnen her. Sehr eifrig und behände schoben sie den kleinen Stahlriegel beiseite, fummelten an irgendeiner weiteren Vorrichtung, und die Tür ging auf.
Eine sonderbare Erinnerung … Selbst jetzt, da vieles sich geändert hat, verlässt mich mein Mut, wenn ich mir diese sonderbare Erinnerung wie einen gefährlichen Verbrecher aus der Zelle herbeirufe. Damals nämlich stürzte eine ganze Mauer meines Lebens lautlos wie auf der Stummfilmleinwand ein. Mir wurde klar, dass eine Katastrophe bevorstand, aber bestimmt hatte ich ein Lächeln im Gesicht, und wenn ich nicht irre, dann war es ein gewinnendes Lächeln; meine sich ausstreckende Hand war verurteilt, ins Leere zu fassen, und obschon sie dieser Leere gewärtig war, versuchte sie die Geste dennoch zu Ende zu führen (die für mich mit dem Klang der Phrase «elementare Höflichkeit» verbunden war).
«Runter mit der Hand», waren die ersten Worte meines Gastes, als er meine dargebotene Hand sah – die bereits in einen Abgrund sank.