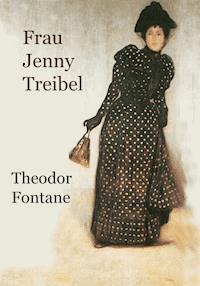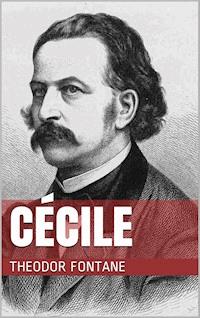0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Null Papier Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Klassiker bei Null Papier
- Sprache: Deutsch
Der Stechlin ist Fontanes letzter Roman. Seine Hauptfigur, der alte Dubslav von Stechlin, trägt den gleichen Namen wie der nahegelegene See, der in die märkische Landschaft eingebettet ist. Das Gewicht des Romans liegt nicht auf der Handlung, sondern auf den vielfältigen Dialogen, die die gesellschaftliche Wirklichkeit zur Wende vom 19. auf das 20. Jahrhundert offenbaren. »I, keineswegs. Und dann, Sie waren ja ganz unschuldig, die Gnäd'ge fing ja davon an; erinnern Sie sich, sie verliebte sich ordentlich in die Geschichte von den Rinnsteinbohlen, und wie sie drauf rumgetrampelt, bis die Ratten rauskamen. Ich glaube sogar, sie sagte ›Biester‹. Aber das schadet nicht. Das ist so Berliner Stil. Und unsre Gnäd'ge hier (beiläufig eine geborene Helfrich) is eine Vollblutberlinerin.« Null Papier Verlag
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 633
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Theodor Fontane
Der Stechlin
Theodor Fontane
Der Stechlin
Veröffentlicht im Null Papier Verlag, 2024Klosterstr. 34 · D-40211 Düsseldorf · [email protected] 3. Auflage, ISBN 978-3-954188-15-4
null-papier.de/newsletter
Inhaltsverzeichnis
Vorwort des Verlegers
Schloß Stechlin
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Kloster Wutz
Siebentes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Nach dem »Eierhäuschen«
Elftes Kapitel
Zwölftes Kapitel
Dreizehntes Kapitel
Vierzehntes Kapitel
Fünfzehntes Kapitel
Wahl in Rheinsberg-Wutz
Sechzehntes Kapitel
Siebzehntes Kapitel
Achtzehntes Kapitel
Neunzehntes Kapitel
Zwanzigstes Kapitel
In Mission nach England
Einundzwanzigstes Kapitel
Zweiundzwanzigstes Kapitel
Dreiundzwanzigstes Kapitel
Vierundzwanzigstes Kapitel
Verlobung – Weihnachtsreise nach Stechlin
Fünfundzwanzigstes Kapitel
Sechsundzwanzigstes Kapitel
Siebenundzwanzigstes Kapitel
Achtundzwanzigstes Kapitel
Neunundzwanzigstes Kapitel
Dreißigstes Kapitel
Einunddreißigstes Kapitel
Hochzeit
Zweiunddreißigstes Kapitel
Dreiunddreißigstes Kapitel
Vierunddreißigstes Kapitel
Fünfunddreißigstes Kapitel
Sonnenuntergang
Sechsunddreißigstes Kapitel
Siebenunddreißigstes Kapitel
Achtunddreißigstes Kapitel
Neununddreißigstes Kapitel
Verweile doch. Tod. Begräbnis. Neue Tage
Vierzigstes Kapitel
Einundvierzigstes Kapitel
Zweiundvierzigstes Kapitel
Dreiundvierzigstes Kapitel
Vierundvierzigstes Kapitel
Fünfundvierzigstes Kapitel
Sechsundvierzigstes Kapitel
Danke
Danke, dass Sie sich für ein E-Book aus meinem Verlag entschieden haben.
Sollten Sie Hilfe benötigen oder eine Frage haben, schreiben Sie mir.
Ihr Jürgen Schulze
Klassiker bei Null Papier
Alice im Wunderland
Anna Karenina
Der Graf von Monte Christo
Die Schatzinsel
Ivanhoe
Oliver Twist oder Der Weg eines Fürsorgezöglings
Robinson Crusoe
Das Gotteslehen
Meisternovellen
Eine Weihnachtsgeschichte
und weitere …
Newsletter abonnieren
Der Newsletter informiert Sie über:
die Neuerscheinungen aus dem Programm
Neuigkeiten über unsere Autoren
Videos, Lese- und Hörproben
attraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehr
https://null-papier.de/newsletter
Vorwort des Verlegers
Zu Zeiten des Autors waren kleine, französische Anmerkungen und Ergänzungen wie »coûte que coûte« oder »pour combler le bonheur« noch weit verbreitet. Heute gelten sie (laut Duden) als veraltet. Ich habe mir erlaubt, die Übersetzungen derselben in Fußnoten einzufügen. Ebenso verfahren bin ich bei den lateinischen Passagen.
Jürgen Schulze, 11. Oktober 2016
Schloß Stechlin
Erstes Kapitel
Im Norden der Grafschaft Ruppin, hart an der mecklenburgischen Grenze, zieht sich von dem Städtchen Gransee bis nach Rheinsberg hin (und noch darüber hinaus) eine mehrere Meilen lange Seenkette durch eine menschenarme, nur hie und da mit ein paar Dörfern, sonst aber ausschließlich mit Förstereien, Glas- und Teeröfen besetzte Waldung. Einer der Seen, die diese Seenkette bilden, heißt »der Stechlin«. Zwischen flachen, nur an einer einzigen Stelle steil und kaiartig ansteigenden Ufern liegt er da, rundum von alten Buchen eingefaßt, deren Zweige, von ihrer eignen Schwere nach unten gezogen, den See mit ihrer Spitze berühren. Hie und da wächst ein weniges von Schilf und Binsen auf, aber kein Kahn zieht seine Furchen, kein Vogel singt, und nur selten, daß ein Habicht drüber hinfliegt und seinen Schatten auf die Spiegelfläche wirft. Alles still hier. Und doch, von Zeit zu Zeit wird es an ebendieser Stelle lebendig. Das ist, wenn es weit draußen in der Welt, sei’s auf Island, sei’s auf Java zu rollen und zu grollen beginnt oder gar der Aschenregen der hawaiischen Vulkane bis weit auf die Südsee hinausgetrieben wird. Dann regt sich’s auch hier, und ein Wasserstrahl springt auf und sinkt wieder in die Tiefe. Das wissen alle, die den Stechlin umwohnen, und wenn sie davon sprechen, so setzen sie wohl auch hinzu: »Das mit dem Wasserstrahl, das ist nur das Kleine, das beinah Alltägliche; wenn’s aber draußen was Großes gibt, wie vor hundert Jahren in Lissabon, dann brodelt’s hier nicht bloß und sprudelt und strudelt, dann steigt statt des Wasserstrahls ein roter Hahn auf und kräht laut in die Lande hinein.«
Das ist der Stechlin, der See Stechlin.
*
Aber nicht nur der See führt diesen Namen, auch der Wald, der ihn umschließt. Und Stechlin heißt ebenso das langgestreckte Dorf, das sich, den Windungen des Sees folgend, um seine Südspitze herumzieht. Etwa hundert Häuser und Hütten bilden hier eine lange, schmale Gasse, die sich nur da, wo eine von Kloster Wutz her heranführende Kastanienallee die Gasse durchschneidet, platzartig erweitert. An ebendieser Stelle findet sich denn auch die ganze Herrlichkeit von Dorf Stechlin zusammen; das Pfarrhaus, die Schule, das Schulzenamt, der Krug, dieser letztere zugleich ein Eck- und Kramladen mit einem kleinen Mohren und einer Girlande von Schwefelfäden in seinem Schaufenster. Dieser Ecke schräg gegenüber, unmittelbar hinter dem Pfarrhause, steigt der Kirchhof lehnan, auf ihm, so ziemlich in seiner Mitte, die frühmittelalterliche Feldsteinkirche mit einem aus dem vorigen Jahrhundert stammenden Dachreiter und einem zur Seite des alten Rundbogenportals angebrachten Holzarm, dran eine Glocke hängt. Neben diesem Kirchhof samt Kirche setzt sich dann die von Kloster Wutz her heranführende Kastanienallee noch eine kleine Strecke weiter fort, bis sie vor einer über einen sumpfigen Graben sich hinziehenden und von zwei riesigen Findlingsblöcken flankierten Bohlenbrücke haltmacht. Diese Brücke ist sehr primitiv. Jenseits derselben aber steigt das Herrenhaus auf, ein gelbgetünchter Bau mit hohem Dach und zwei Blitzableitern.
Auch dieses Herrenhaus heißt Stechlin, Schloß Stechlin.
*
Etliche hundert Jahre zurück stand hier ein wirkliches Schloß, ein Backsteinbau mit dicken Rundtürmen, aus welcher Zeit her auch noch der Graben stammt, der die von ihm durchschnittene, sich in den See hinein erstreckende Landzunge zu einer kleinen Insel machte. Das ging so bis in die Tage der Reformation. Während der Schwedenzeit aber wurde das alte Schloß niedergelegt, und man schien es seinem gänzlichen Verfall überlassen, auch nichts an seine Stelle setzen zu wollen, bis kurz nach dem Regierungsantritt Friedrich Wilhelms I. die ganze Trümmermasse beiseite geschafft und ein Neubau beliebt wurde. Dieser Neubau war das Haus, das jetzt noch stand. Es hatte denselben nüchternen Charakter wie fast alles, was unter dem Soldatenkönig entstand, und war nichts weiter als ein einfaches Corps de logis, dessen zwei vorspringende, bis dicht an den Graben reichende Seitenflügel ein Hufeisen und innerhalb desselben einen kahlen Vorhof bildeten, auf dem, als einziges Schmuckstück, eine große blanke Glaskugel sich präsentierte. Sonst sah man nichts als eine vor dem Hause sich hinziehende Rampe, von deren dem Hofe zugekehrten Vorderwand der Kalk schon wieder abfiel. Gleichzeitig war aber doch ein Bestreben unverkennbar, gerade diese Rampe zu was Besonderem zu machen, und zwar mit Hilfe mehrerer Kübel mit exotischen Blattpflanzen, darunter zwei Aloes, von denen die eine noch gut im Stande, die andre dagegen krank war. Aber gerade diese kranke war der Liebling des Schloßherrn, weil sie jeden Sommer in einer ihr freilich nicht zukommenden Blüte stand. Und das hing so zusammen. Aus dem, sumpfigen Schloßgraben hatte der Wind vor langer Zeit ein fremdes Samenkorn in den Kübel der kranken Aloe geweht, und alljährlich schossen infolge davon aus der Mitte der schon angegelbten Aloeblätter die weiß und roten Dolden des Wasserliesch oder des Butomus umbellatus auf. Jeder Fremde, der kam, wenn er nicht zufällig ein Kenner war, nahm diese Dolden für richtige Aloeblüten, und der Schloßherr hütete sich wohl, diesen Glauben, der eine Quelle der Erheiterung für ihn war, zu zerstören.
Und wie denn alles hier herum den Namen Stechlin führte, so natürlich auch der Schloßherr selbst. Auch er war ein Stechlin.
Dubslav von Stechlin, Major a. D. und schon ein gut Stück über Sechzig hinaus, war der Typus eines Märkischen von Adel, aber von der milderen Observanz, eines jener erquicklichen Originale, bei denen sich selbst die Schwächen in Vorzüge verwandeln. Er hatte noch ganz das eigentümlich sympathisch berührende Selbstgefühl all derer, die »schon vor den Hohenzollern da waren«, aber er hegte dieses Selbstgefühl nur ganz im stillen, und wenn es dennoch zum Ausdruck kam, so kleidete sich’s in Humor, auch wohl in Selbstironie, weil er seinem ganzen Wesen nach überhaupt hinter alles ein Fragezeichen machte. Sein schönster Zug war eine tiefe, so recht aus dem Herzen kommende Humanität, und Dünkel und Überheblichkeit (während er sonst eine Neigung hatte, fünf gerade sein zu lassen) waren so ziemlich die einzigen Dinge, die ihn empörten. Er hörte gern eine freie Meinung, je drastischer und extremer, desto besser. Daß sich diese Meinung mit der seinigen deckte, lag ihm fern zu wünschen. Beinah das Gegenteil. Paradoxen waren seine Passion. »Ich bin nicht klug genug, selber welche zu machen, aber ich freue mich, wenn’s andre tun; es ist doch immer was drin. Unanfechtbare Wahrheiten gibt es überhaupt nicht, und wenn es welche gibt, so sind sie langweilig.« Er ließ sich gern was vorplaudern und plauderte selber gern.
Des alten Schloßherrn Lebensgang war märkisch-herkömmlich gewesen. Von jung an lieber im Sattel als bei den Büchern, war er erst nach zweimaliger Scheiterung siegreich durch das Fähnrichsexamen gesteuert und gleich danach bei den Brandenburgischen Kürassieren eingetreten, bei denen selbstverständlich auch schon sein Vater gestanden hatte. Dieser sein Eintritt ins Regiment fiel so ziemlich mit dem Regierungsantritt Friedrich Wilhelms IV. zusammen, und wenn er dessen erwähnte, so hob er, sich selbst persiflierend, gerne hervor, »daß alles Große seine Begleiterscheinungen habe«. Seine Jahre bei den Kürassieren waren im wesentlichen Friedensjahre gewesen; nur anno vierundsechzig war er mit in Schleswig, aber auch hier, ohne »zur Aktion« zu kommen. »Es kommt für einen Märkischen nur darauf an, überhaupt mit dabei gewesen zu sein; das andre steht in Gottes Hand.« Und er schmunzelte, wenn er dergleichen sagte, seine Hörer jedesmal in Zweifel darüber lassend, ob er’s ernsthaft oder scherzhaft gemeint habe. Wenig mehr als ein Jahr vor Ausbruch des vierundsechziger Kriegs war ihm ein Sohn geboren worden, und kaum wieder in seine Garnison Brandenburg eingerückt, nahm er den Abschied, um sich auf sein seit dem Tode des Vaters halb verödetes Schloß Stechlin zurückzuziehen. Hier warteten seiner glückliche Tage, seine glücklichsten, aber sie waren von kurzer Dauer – schon das Jahr darauf starb ihm die Frau. Sich eine neue zu nehmen, widerstand ihm, halb aus Ordnungssinn und halb aus ästhetischer Rücksicht. »Wir glauben doch alle mehr oder weniger an eine Auferstehung« (das heißt, er persönlich glaubte eigentlich nicht daran), »und wenn ich dann oben ankomme mit einer rechts und einer links, so ist das doch immer eine genierliche Sache.« Diese Worte – wie denn der Eltern Tun nur allzu häufig der Mißbilligung der Kinder begegnet – richteten sich in Wirklichkeit gegen seinen dreimal verheiratet gewesenen Vater, an dem er überhaupt allerlei Großes und Kleines auszusetzen hatte, so beispielsweise auch, daß man ihm, dem Sohne, den pommerschen Namen »Dubslav« beigelegt hatte. »Gewiß, meine Mutter war eine Pommersche, noch dazu von der Insel Usedom, und ihr Bruder, nun ja, der hieß Dubslav. Und so war denn gegen den Namen schon um des Onkels willen nicht viel einzuwenden, und um so weniger, als er ein Erbonkel war. (Daß er mich schließlich schändlich im Stich gelassen, ist eine Sache für sich.) Aber trotzdem bleib’ ich dabei, solche Namensmanscherei verwirrt bloß. Was ein Märkischer ist, der muß Joachim heißen oder Woldemar. Bleib im Lande und taufe dich redlich. Wer aus Friesack is, darf nicht Raoul heißen.«
Dubslav von Stechlin blieb also Witwer. Das ging nun schon an die dreißig Jahre. Anfangs war’s ihm schwer geworden, aber jetzt lag alles hinter ihm, und er lebte »comme philosophe« nach dem Wort und Vorbild des großen Königs, zu dem er jederzeit bewundernd aufblickte. Das war sein Mann, mehr als irgendwer, der sich seitdem einen Namen gemacht hatte. Das zeigte sich jedesmal, wenn ihm gesagt wurde, daß er einen Bismarckkopf habe. »Nun ja, ja, den hab’ ich; ich soll ihm sogar ähnlich sehen. Aber die Leute sagen es immer so, als ob ich mich dafür bedanken müßte. Wenn ich nur wüßte, bei wem; vielleicht beim lieben Gott, oder am Ende gar bei Bismarck selbst. Die Stechline sind aber auch nicht von schlechten Eltern. Außerdem, ich für meine Person, ich habe bei den sechsten Kürassieren gestanden, und Bismarck bloß bei den siebenten, und die kleinere Zahl ist in Preußen bekanntlich immer die größere; – ich bin ihm also einen über. Und Friedrichsruh, wo alles jetzt hinpilgert, soll auch bloß ’ne Kate sein. Darin sind wir uns also gleich. Und solchen See, wie den ›Stechlin‹, nu, den hat er schon ganz gewiß nicht. So was kommt überhaupt bloß selten vor.«
Ja, auf seinen See war Dubslav stolz, aber destoweniger stolz war er auf sein Schloß, weshalb es ihn auch verdroß, wenn es überhaupt so genannt wurde. Von den armen Leuten ließ er sich’s gefallen: »Für die ist es ein ›Schloß‹, aber sonst ist es ein alter Kasten und weiter nichts.« Und so sprach er denn lieber von seinem »Haus«, und wenn er einen Brief schrieb, so stand darüber »Haus Stechlin«. Er war sich auch bewußt, daß es kein Schloßleben war, das er führte. Vordem, als der alte Backsteinbau noch stand, mit seinen dicken Türmen und seinem Luginsland, von dem aus man, über die Kronen der Bäume weg, weit ins Land hinaussah, ja, damals war hier ein Schloßleben gewesen, und die derzeitigen alten Stechline hatten teilgenommen an allen Festlichkeiten, wie sie die Ruppiner Grafen und die mecklenburgischen Herzöge gaben, und waren mit den Boitzenburgern und den Bassewitzens verschwägert gewesen. Aber heute waren die Stechline Leute von schwachen Mitteln, die sich nur eben noch hielten und beständig bemüht waren, durch eine »gute Partie« sich wieder leidlich in die Höhe zu bringen. Auch Dubslavs Vater war auf die Weise zu seinen drei Frauen gekommen, unter denen freilich nur die erste das in sie gesetzte Vertrauen gerechtfertigt hatte. Für den jetzigen Schloßherrn, der von der zweiten Frau stammte, hatte sich daraus leider kein unmittelbarer Vorteil ergeben, und Dubslav von Stechlin wäre kleiner und großer Sorgen und Verlegenheiten nie los und ledig geworden, wenn er nicht in dem benachbarten Gransee seinen alten Freund Baruch Hirschfeld gehabt hätte. Dieser Alte, der den großen Tuchladen am Markt und außerdem die Modesachen und Damenhüte hatte, hinsichtlich deren es immer hieß, »Gerson schicke ihm alles zuerst« – dieser alte Baruch, ohne das »Geschäftliche« darüber zu vergessen, hing in der Tat mit einer Art Zärtlichkeit an dem Stechliner Schloßherrn, was, wenn es sich mal wieder um eine neue Schuldverschreibung handelte, regelmäßig zu heikeln Auseinandersetzungen zwischen Hirschfeld Vater und Hirschfeld Sohn führte.
»Gott, Isidor, ich weiß, du bist fürs Neue. Aber was ist das Neue? Das Neue versammelt sich immer auf unserm Markt, und mal stürmt es uns den Laden und nimmt uns die Hüte, Stück für Stück, und die Reiherfedern und die Straußenfedern. Ich bin fürs Alte und für den guten alten Herrn von Stechlin. Is doch der Vater von seinem Großvater gefallen in der großen Schlacht bei Prag und hat gezahlt mit seinem Leben.«
»Ja, der hat gezahlt; wenigstens hat er gezahlt mit seinem Leben. Aber der von heute…«
»Der zahlt auch, wenn er kann und wenn er hat. Und wenn er nicht hat, und ich sage: ›Herr von Stechlin, ich werde schreiben siebeneinhalb‹, dann feilscht er nicht und dann zwackt er nicht. Und wenn er kippt, nu, da haben wir das Objekt: Mittelboden und Wald und Jagd und viel Fischfang. Ich seh’ es immer so ganz klein in der Perspektiv’, und ich seh’ auch schon den Kirchturm.«
»Aber, Vaterleben, was sollen wir mit ’m Kirchturm?«
In dieser Richtung gingen öfters die Gespräche zwischen Vater und Sohn, und was der Alte vorläufig noch in der »Perspektive« sah, das wäre vielleicht schon Wirklichkeit geworden, wenn nicht des alten Dubslav um zehn Jahre ältere Schwester mit ihrem von der Mutter her ererbten Vermögen gewesen wäre: Schwester Adelheid, Domina zu Kloster Wutz. Die half und sagte gut, wenn es schlecht stand oder gar zum Äußersten zu kommen schien. Aber sie half nicht aus Liebe zu dem Bruder – gegen den sie, ganz im Gegenteil, viel einzuwenden hatte -, sondern lediglich aus einem allgemeinen Stechlinschen Familiengefühl. Preußen war was und die Mark Brandenburg auch; aber das Wichtigste waren doch die Stechlins, und der Gedanke, das alte Schloß in andern Besitz und nun gar in einen solchen übergehen zu sehen, war ihr unerträglich. Und über all dies hinaus war ja noch ihr Patenkind da, ihr Neffe Woldemar, für den sie all die Liebe hegte, die sie dem Bruder versagte.
Ja, die Domina half, aber solcher Hilfen unerachtet wuchs das Gefühl der Entfremdung zwischen den Geschwistern, und so kam es denn, daß der alte Dubslav, der die Schwester in Kloster Wutz weder gern besuchte noch auch ihren Besuch gern empfing, nichts von Umgang besaß als seinen Pastor Lorenzen (den früheren Erzieher Woldemars) und seinen Küster und Dorfschullehrer Krippenstapel, zu denen sich allenfalls noch Oberförster Katzler gesellte, Katzler, der Feldjäger gewesen war und ein gut Stück Welt gesehen hatte. Doch auch diese drei kamen nur, wenn sie gerufen wurden, und so war eigentlich nur einer da, der in jedem Augenblicke Red’ und Antwort stand. Das war Engelke, sein alter Diener, der seit beinahe fünfzig Jahren alles mit seinem Herrn durchlebt hatte, seine glücklichen Leutnantstage, seine kurze Ehe und seine lange Einsamkeit. Engelke, noch um ein Jahr älter als sein Herr, war dessen Vertrauter geworden, aber ohne Vertraulichkeit. Dubslav verstand es, die Scheidewand zu ziehen. Übrigens wär’ es auch ohne diese Kunst gegangen. Denn Engelke war einer von den guten Menschen, die nicht aus Berechnung oder Klugheit, sondern von Natur hingebend und demütig sind und in einem treuen Dienen ihr Genüge finden. Alltags war er, so Winter wie Sommer, in ein Leinwandhabit gekleidet, und nur wenn es zu Tisch ging, trug er eine richtige Livree von sandfarbenem Tuch mit großen Knöpfen dran. Es waren Knöpfe, die noch die Zeiten des Rheinsberger Prinzen Heinrich gesehen hatten, weshalb Dubslav, als er mal wieder in Verlegenheit geraten war, zu dem jüngst verstorbenen alten Herrn von Kortschädel gesagt hatte: »Ja, Kortschädel, wenn ich so meinen Engelke, wie er da geht und steht, ins märkische Provinzialmuseum abliefern könnte, so kriegt’ ich ein Jahrgehalt und wäre raus.«
*
Das war im Mai, daß der alte Stechlin diese Worte zu seinem Freunde Kortschädel gesprochen hatte. Heute aber war dritter Oktober und ein wundervoller Herbsttag dazu. Dubslav, sonst empfindlich gegen Zug, hatte die Türen aufmachen lassen, und von dem großen Portal her zog ein erquicklicher Luftstrom bis auf die mit weiß und schwarzen Fliesen gedeckte Veranda hinaus. Eine große, etwas schadhafte Markise war hier herabgelassen und gab Schutz gegen die Sonne, deren Lichter durch die schadhaften Stellen hindurchschienen und auf den Fliesen ein Schattenspiel aufführten. Gartenstühle standen umher, vor einer Bank aber, die sich an die Hauswand lehnte, waren doppelte Strohmatten gelegt. Auf eben dieser Bank, ein Bild des Behagens, saß der alte Stechlin in Joppe und breitkrempigem Filzhut und sah, während er aus seinem Meerschaum allerlei Ringe blies, auf ein Rundell, in dessen Mitte, von Blumen eingefaßt, eine kleine Fontäne plätscherte. Rechts daneben lief ein sogenannter Poetensteig, an dessen Ausgang ein ziemlich hoher, aus allerlei Gebälk zusammengezimmerter Aussichtsturm aufragte. Ganz oben eine Plattform mit Fahnenstange, daran die preußische Flagge wehte, schwarz und weiß, alles schon ziemlich verschlissen.
Engelke hatte vor kurzen einen roten Streifen annähen wollen, war aber mit seinem Vorschlag nicht durchgedrungen. »Laß. Ich bin nicht dafür. Das alte Schwarz und Weiß hält gerade noch; aber wenn du was Rotes dran nähst, dann reißt es gewiß.«
Die Pfeife war ausgegangen, und Dubslav wollte sich eben von seinem Platz erheben und nach Engelke rufen, als dieser vom Gartensaal her auf die Veranda heraustrat.
»Das ist recht, Engelke, daß du kommst… Aber du hast da ja was wie ’n Telegramm in der Hand. Ich kann Telegramms nicht leiden. Immer is einer dod, oder es kommt wer, der besser zu Hause geblieben wäre.«
Engelke griente. »Der junge Herr kommt.«
»Und das weißt du schon?«
»Ja, Brose hat es mir gesagt.«
»So, so. Dienstgeheimnis. Na, gib her.«
Und unter diesen Worten brach er das Telegramm auf und las: »Lieber Papa. Bin sechs Uhr bei dir. Rex und von Czako begleiten mich. Dein Woldemar.«
Engelke stand und wartete.
»Ja, was da tun, Engelke?«, sagte Dubslav und drehte das Telegramm hin und her. »Und aus Cremmen und von heute früh«, fuhr er fort. »Da müssen sie also die Nacht über schon in Cremmen gewesen sein. Auch kein Spaß.«
»Aber Cremmen is doch soweit ganz gut.«
»Nu, gewiß, gewiß. Bloß sie haben da so kurze Betten… Und wenn man, wie Woldemar, Kavallerist ist, kann man ja doch auch die acht Meilen von Berlin bis Stechlin in einer Pace machen. Warum also Nachtquartier? Und Rex und von Czako begleiten mich. Ich kenne Rex nicht und kenne von Czako nicht. Wahrscheinlich Regimentskameraden. Haben wir denn was?«
»Ich denk’ doch, gnädiger Herr. Und wovor haben wir denn unsre Mamsell? Die wird schon was finden.«
»Nu gut. Also wir haben was. Aber wen laden wir dazu ein? So bloß ich, das geht nicht. Ich mag mich keinem Menschen mehr vorsetzen. Czako, das ginge vielleicht noch. Aber Rex, wenn ich ihn auch nicht kenne, zu so was Feinem wie Rex pass’ ich nicht mehr; ich bin zu altmodisch geworden. Was meinst du, ob die Gundermanns wohl können?«
»Ach, die können schon. Er gewiß, und sie kluckt auch bloß immer so rum.«
»Also Gundermanns. Gut. Und dann vielleicht Oberförsters. Das älteste Kind hat freilich die Masern, und die Frau, das heißt die Gemahlin (und Gemahlin is eigentlich auch noch nicht das rechte Wort), die erwartet wieder. Man weiß nie recht, wie man mit ihr dran ist und wie man sie nennen soll, Oberförsterin Katzler oder Durchlaucht. Aber man kann’s am Ende versuchen. Und dann unser Pastor. Der hat doch wenigstens die Bildung. Gundermann allein ist zu wenig und eigentlich bloß ein Klutentreter. Und seitdem er die Siebenmühlen hat, ist er noch weniger geworden.«
Engelke nickte.
»Na, dann schick also Martin. Aber er soll sich proper machen. Oder vielleicht ist Brose noch da; der kann ja auf seinem Retourgang bei Gundermanns mit rangehen. Und soll ihnen sagen sieben Uhr, aber nicht früher; sie sitzen sonst so lange rum, und man weiß nicht, wovon man reden soll. Das heißt mit ihm, sie red’t immerzu… Und gib Brosen auch ’nen Kornus und funfzig Pfennig.«
»Ich werd’ ihm dreißig geben.«
»Nein, nein, funfzig. Erst hat er ja doch was gebracht, und nu nimmt er wieder was mit. Das ist ja so gut wie doppelt. Also funfzig. Knaps ihm nichts ab.«
Zweites Kapitel
Ziemlich um dieselbe Zeit, wo der Telegraphenbote bei Gundermanns vorsprach, um die Bestellung des alten Herrn von Stechlin auszurichten, ritten Woldemar, Rex und Czako, die sich für sechs Uhr angemeldet hatten, in breiter Front von Cremmen ab; Fritz, Woldemars Reitknecht, folgte den dreien. Der Weg ging über Wutz. Als sie bis in die Nähe von Dorf und Kloster dieses Namens gekommen waren, bog Woldemar vorsichtig nach links hin aus, weil er der Möglichkeit entgehen wollte, seiner Tante Adelheid, der Domina des Klosters, zu begegnen. Er stand zwar gut mit dieser und hatte sogar vor, ihr, wie herkömmlich, auf dem Rückwege nach Berlin seinen Besuch zu machen, aber in diesem Augenblick paßte ihm solche Begegnung, die sein pünktliches Eintreffen in Stechlin gehindert haben würde, herzlich schlecht. So beschrieb er denn einen weiten Halbkreis und hatte das Kloster schon um eine Viertelstunde hinter sich, als er sich wieder der Hauptstraße zuwandte. Diese, durch Moor- und Wiesengründe führend, war ein vorzüglicher Reitweg, der an vielen Stellen noch eine Grasnarbe trug, weshalb es anderthalb Meilen lang in einem scharfen Trabe vorwärts ging, bis an eine Avenue heran, die gradlinig auf Schloß Stechlin zuführte. Hier ließen alle drei die Zügel fallen und ritten im Schritt weiter. Über ihnen wölbten sich die schönen, alten Kastanienbäume, was ihrem Anritt etwas Anheimelndes und zugleich etwas beinah Feierliches gab.
»Das ist ja wie ein Kirchenschiff«, sagte Rex, der am linken Flügel ritt. »Finden Sie nicht auch, Czako?«
»Wenn Sie wollen, ja. Aber Pardon, Rex, ich finde die Wendung etwas trivial für einen Ministerialassessor.«
»Nun gut, dann sagen Sie was Besseres.«
»Ich werde mich hüten. Wer unter solchen Umständen was Besseres sagen will, sagt immer was Schlechteres.«
Unter diesem sich noch eine Weile fortsetzenden Gespräche waren sie bis an einen Punkt gekommen, von dem aus man das am Ende der Avenue sich aufbauende Bild in aller Klarheit überblicken konnte. Dabei war das Bild nicht bloß klar, sondern auch so frappierend, daß Rex und Czako unwillkürlich anhielten.
»Alle Wetter, Stechlin, das ist ja reizend«, wandte sich Czako zu dem am andern Flügel reitenden Woldemar. »Ich find’ es geradezu märchenhaft, Fata Morgana – das heißt, ich habe noch keine gesehn. Die gelbe Wand, die da noch das letzte Tageslicht auffängt, das ist wohl Ihr Zauberschloß? Und das Stückchen Grau da links, das taxier’ ich auf eine Kirchenecke. Bleibt nur noch der Staketzaun an der andern Seite; – da wohnt natürlich der Schulmeister. Ich verbürge mich, daß ich’s damit getroffen. Aber die zwei schwarzen Riesen, die da grad in der Mitte stehn und sich von der gelben Wand abheben (›abheben‹ ist übrigens auch trivial; entschuldigen Sie, Rex), die stehen ja da wie die Cherubim. Allerdings etwas zu schwarz. Was sind das für Leute?«
»Das sind Findlinge.«
»Findlinge?«
»Ja, Findlinge«, wiederholte Woldemar. »Aber wenn Ihnen das Wort anstößig ist, so können Sie sie auch Monolithe nennen. Es ist merkwürdig, Czako, wie hochgradig verwöhnt im Ausdruck Sie sind, wenn Sie nicht gerade selber das Wort haben… Aber nun, meine Herren, müssen wir uns wieder in Trab setzen. Ich bin überzeugt, mein Papa steht schon ungeduldig auf seiner Rampe, und wenn er uns so im Schritt ankommen sieht, denkt er, wir bringen eine Trauernachricht oder einen Verwundeten.«
Wenige Minuten später, und alle drei trabten denn auch wirklich, von Fritz gefolgt, über die Bohlenbrücke fort, erst in den Vorhof hinein und dann an der blanken Glaskugel vorüber. Der Alte stand bereits auf der Rampe, Engelke hinter ihm und hinter diesem Martin, der alte Kutscher. Im Nu waren alle drei Reiter aus dem Sattel, und Martin und Fritz nahmen die Pferde. So trat man in den Flur. »Erlaube, lieber Papa, dir zwei liebe Freunde von mir vorzustellen. Assessor von Rex, Hauptmann von Czako.«
Der alte Stechlin schüttelte jedem die Hand und sprach ihnen aus, wie glücklich er über ihren Besuch sei. »Seien Sie mir herzlich willkommen, meine Herren. Sie haben keine Ahnung, welche Freude Sie mir machen, einem vergrätzten alten Einsiedler. Man sieht nichts mehr, hört nichts mehr. Ich hoffe auf einen ganzen Sack voll Neuigkeiten.«
»Ach, Herr Major«, sagte Czako, »wir sind ja schon vierundzwanzig Stunden fort. Und, ganz abgesehen davon, wer kann heutzutage noch mit den Zeitungen konkurrieren! Ein Glück, daß manche prinzipiell einen Posttag zu spät kommen. Ich meine mit den neuesten Nachrichten. Vielleicht auch sonst noch.«
»Sehr wahr«, lachte Dubslav. »Der Konservatismus soll übrigens, seinem Wesen nach, eine Bremse sein; damit muß man vieles entschuldigen. Aber da kommen Ihre Mantelsäcke, meine Herren. Engelke, führe die Herren auf ihr Zimmer. Wir haben jetzt sechseinviertel. Um sieben, wenn ich bitten darf.«
Engelke hatte mittlerweile die beiden von Dubslav etwas altmodisch als »Mantelsäcke« bezeichneten Plaidrollen in die Hand genommen und ging damit, den beiden Herren voran, auf die doppelarmige Treppe zu, die gerade da, wo die beiden Arme derselben sich kreuzten, einen ziemlich geräumigen Podest mit Säulchengalerie bildete. Zwischen den Säulchen aber, und zwar mit Blick auf den Flur, war eine Rokokouhr angebracht, mit einem Zeitgott darüber, der eine Hippe führte. Czako wies darauf hin und sagte leise zu Rex: »Ein bißchen graulich«, – ein Gefühl, drin er sich bestärkt sah, als man bis auf den mit ungeheurer Raumverschwendung angelegten Oberflur gekommen war. Über einer nach hinten zu gelegenen Saaltür hing eine Holztafel mit der Inschrift: »Museum«, während hüben und drüben, an den Flurwänden links und rechts, mächtige Birkenmaser- und Ebenholzschränke standen, wahre Prachtstücke, mit zwei großen Bildern dazwischen, eines eine Burg mit dicken Backsteintürmen, das andre ein überlebensgroßer Ritter, augenscheinlich aus der Frundsbergzeit, wo das bunt Landsknechtliche schon die Rüstung zu drapieren begann.
»Is wohl ein Ahn?«, fragte Czako.
»Ja, Herr Hauptmann. Und er ist auch unten in der Kirche.«
»Auch so wie hier?«
»Nein, bloß Grabstein und schon etwas abgetreten. Aber man sieht doch noch, daß es derselbe ist.«
Czako nickte. Dabei waren sie bis an ein Eckzimmer gekommen, das mit der einen Seite nach dem Flur, mit der andern Seite nach einem schmalen Gang hin lag. Hier war auch die Tür. Engelke, vorangehend, öffnete und hing die beiden Plaidrollen an die Haken eines hier gleich an der Tür stehenden Kleiderständers. Unmittelbar daneben war ein Klingelzug mit einer grünen, etwas ausgefransten Puschel daran. Engelke wies darauf hin und sagte: »Wenn die Herren noch etwas wünschen… Und um sieben… Zweimal wird angeschlagen.«
Und damit ging er, die beiden ihrer Bequemlichkeit überlassend.
Es waren zwei nebeneinander gelegene Zimmer, in denen man Rex und Czako untergebracht hatte, das vordere größer und mit etwas mehr Aufwand eingerichtet, mit Stehspiegel und Toilette, der Spiegel sogar zum Kippen. Das Bett in diesem vorderen Zimmer hatte einen kleinen Himmel und daneben eine Etagere, auf deren oberem Brettchen eine Meißner Figur stand, ihr ohnehin kurzes Röckchen lüpfend, während auf dem unteren Brett ein Neues Testament lag, mit Kelch und Kreuz und einem Palmenzweig auf dem Deckel.
Czako nahm das Meißner Püppchen und sagte: »Wenn nicht unser Freund Woldemar bei diesem Arrangement seine Hand mit im Spiele gehabt hat, so haben wir hier in bezug auf Requisiten ein Ahnungsvermögen, wie’s nicht größer gedacht werden kann. Das Püppchen pour moi, das Testament pour vous.«
»Czako, wenn Sie doch bloß das Necken lassen könnten!«
»Ach, sagen Sie doch so was nicht, Rex; Sie lieben mich ja bloß um meiner Neckereien willen.«
Und nun traten sie, von dem Vorderzimmer her, in den etwas kleineren Wohnraum, in dem Spiegel und Toilette fehlten. Dafür aber war ein Rokokosofa da, mit hellblauem Atlas und weißen Blumen darauf.
»Ja, Rex«, sagte Czako, »wie teilen wir nun? Ich denke, Sie nehmen nebenan den Himmel, und ich nehme das Rokokosofa, noch dazu mit weißen Blumen, vielleicht Lilien. Ich wette, das kleine Ding von Sofa hat eine Geschichte.«
»Rokoko hat immer eine Geschichte«, bestätigte Rex. »Aber hundert Jahre zurück. Was jetzt hier haust, sieht mir, Gott sei Dank, nicht danach aus. Ein bißchen Spuk trau’ ich diesem alten Kasten allerdings schon zu; aber keine Rokokogeschichte. Rokoko ist doch immer unsittlich. Wie gefällt Ihnen übrigens der Alte?«
»Vorzüglich. Ich hätte nicht gedacht, daß unser Freund Woldemar solchen famosen Alten haben könnte.«
»Das klingt ja beinah«, sagte Rex, »Wie wenn Sie gegen unsern Stechlin etwas hätten.«
»Was durchaus nicht der Fall ist. Unser Stechlin ist der beste Kerl von der Welt, und wenn ich das verdammte Wort nicht haßte, würd’ ich ihn sogar einen ›perfekten Gentleman‹ nennen müssen. Aber…«
»Nun…«
»Aber er paßt doch nicht recht an seine Stelle.«
»An welche?«
»In sein Regiment.«
»Aber, Czako, ich verstehe Sie nicht. Er ist ja brillant angeschrieben. Liebling bei jedem. Der Oberst hält große Stücke von ihm, und die Prinzen machen ihm beinah den Hof…«
»Ja, das ist es ja eben. Die Prinzen, die Prinzen.«
»Was denn, wie denn?«
»Ach, das ist eine lange Geschichte, viel zu lang, um sie hier vor Tisch noch auszukramen. Denn es ist bereits halb, und wir müssen uns eilen. Übrigens trifft es viele, nicht bloß unsern Stechlin.«
»Immer dunkler, immer rätselvoller«, sagte Rex.
»Nun, vielleicht daß ich Ihnen das Rätsel löse. Schließlich kann man ja Toilette machen und noch seinen Diskurs daneben haben. ›Die Prinzen machen ihm den Hof‹, so geruhten Sie zu bemerken, und ich antwortete: ›Ja, das ist es eben.‹ Und diese Worte kann ich ihnen nur wiederholen. Die Prinzen – ja, damit hängt es zusammen und noch mehr damit, daß die feinen Regimenter immer feiner werden. Gucken Sie sich mal die alten Ranglisten an, das heißt wirklich alte, voriges Jahrhundert und dann so bis anno sechs. Da finden Sie bei Regiment Garde du Corps oder bei Regiment Gensdarmes unsere guten alten Namen: Marwitz, Wakenitz, Kracht, Löschebrand, Bredow, Rochow, höchstens daß sich mal ein höher betitelter Schlesischer mit hineinverirrt. Natürlich gab es auch Prinzen damals, aber der Adel gab den Ton an, und die paar Prinzen mußten noch froh sein, wenn sie nicht störten. Damit ist es nun aber, seit wir Kaiser und Reich sind, total vorbei. Natürlich sprech’ ich nicht von der Provinz, nicht von Litauen und Masuren, sondern von der Garde, von den Regimentern unter den Augen Seiner Majestät. Und nun gar erst diese Gardedragoner! Die waren immer piek, aber seit sie, pour combler le bonheur,1 auch noch ›Königin von Großbritannien und Irland‹ sind, wird es immer mehr davon, und je pieker sie werden, desto mehr Prinzen kommen hinein, von denen übrigens auch jetzt schon mehr da sind, als es so obenhin aussieht, denn manche sind eigentlich welche und dürfen es bloß nicht sagen. Und wenn man dann gar noch die alten mitrechnet, die bloß à la suite stehn, aber doch immer noch mit dabei sind, wenn irgendwas los ist, so haben wir, wenn der Kreis geschlossen wird, zwar kein Parkett von Königen, aber doch einen Zirkus von Prinzen. Und da hinein ist nun unser guter Stechlin gestellt. Natürlich tut er, was er kann, und macht so gewisse Luxusse mit, Gefühlsluxusse, Gesinnungsluxusse und, wenn es sein muß, auch Freiheitsluxusse. So ’nen Schimmer von Sozialdemokratie. Das ist aber auf die Dauer schwierig. Richtige Prinzen können sich das leisten, die verbebeln nicht leicht. Aber Stechlin! Stechlin ist ein reizender Kerl, aber er ist doch bloß ein Mensch.«
»Und das sagen Sie, Czako, gerade Sie, der Sie das Menschliche stets betonen?«
»Ja, Rex, das tu’ ich. Heut’ wie immer. Aber eines schickt sich nicht für alle. Der eine darf’s, der andre nicht. Wenn unser Freund Stechlin sich in diese seine alte Schloßkate zurückzieht, so darf er Mensch sein, soviel er will, aber als Gardedragoner kommt er damit nicht aus. Vom alten Adam will ich nicht sprechen, das hat immer noch so ’ne Nebenbedeutung.«
*
Während Rex und Czako Toilette machten und abwechselnd über den alten und den jungen Stechlin verhandelten, schritten die, die den Gegenstand dieser Unterhaltung bildeten, Vater und Sohn, im Garten auf und ab und hatten auch ihrerseits ihr Gespräch.
»Ich bin dir dankbar, daß du mir deine Freunde mitgebracht hast. Hoffentlich kommen sie auf ihre Kosten. Mein Leben verläuft ein bißchen zu einsam, und es wird ohnehin gut sein, wenn ich mich wieder an Menschen gewöhne. Du wirst gelesen haben, daß unser guter alter Kortschädel gestorben ist, und in etwa vierzehn Tagen haben wir hier ’ne Neuwahl. Da muß ich dann ran und mich populär machen. Die Konservativen wollen mich haben und keinen andern. Eigentlich mag ich nicht, aber ich soll, und da paßt es mir denn, daß du mir Leute bringst, an denen ich mich für die Welt sozusagen wieder wie einüben kann. Sind sie denn ausgiebig und plauderhaft?«
»O sehr, Papa, vielleicht zu sehr. Wenigstens der eine.«
»Das is gewiß der Czako. Sonderbar, die von Alexander reden alle gern. Aber ich bin sehr dafür; Schweigen kleid’t nicht jeden. Und dann sollen wir uns ja auch durch die Sprache vom Tier unterscheiden. Also wer am meisten red’t, ist der reinste Mensch. Und diesem Czako, dem hab’ ich es gleich angesehn. Aber der Rex. Du sagst Ministerialassessor; ist er denn von der frommen Familie?«
»Nein, Papa. Du machst dieselbe Verwechslung, die beinah alle machen. Die fromme Familie, das sind die Reckes, gräflich und sehr vornehm. Die Rex natürlich auch, aber doch nicht so hoch hinaus und auch nicht so fromm. Allerdings nimmt mein Freund, der Ministerialassessor, einen Anlauf dazu, die Reckes womöglich einzuholen.«
»Dann hab’ ich also recht gesehen. Er hat so die Figur, die so was vermuten läßt, ein bißchen wenig Fleisch und so glatt rasiert. Habt ihr denn beim Rasieren in Cremmen gleich einen gefunden?«
»Er hat alles immer bei sich; lauter englische. Von Solingen oder Suhl will er nichts wissen.«
»Und muß man ihn denn vorsichtig anfassen, wenn das Gespräch auf kirchliche Dinge kommt? Ich bin ja, wie du weißt, eigentlich kirchlich, wenigstens kirchlicher als mein guter Pastor (es wird immer schlimmer mit ihm), aber ich bin so im Ausdruck mitunter ungenierter, als man vielleicht sein soll, und bei ›niedergefahren zur Hölle‹ kann mir’s passieren, daß ich nolens volens ein bißchen tolles Zeug rede. Wie steht es denn da mit ihm? Muß ich mich in acht nehmen? Oder macht er bloß so mit?«
»Das will ich nicht geradezu behaupten. Ich denke mir, er steht so wie die meisten stehn; das heißt, er weiß es nicht recht.«
»Ja, ja, den Zustand kenn’ ich.«
»Und weil er es nicht recht weiß, hat er sozusagen die Auswahl und wählt das, was gerade gilt und nach oben hin empfiehlt. Ich kann das auch so schlimm nicht finden. Einige nennen ihn einen ›Streber‹. Aber wenn er es ist, ist er jedenfalls keiner von den schlimmsten. Er hat eigentlich einen guten Charakter, und im cercle intime2 kann er reizend sein. Er verändert sich dann nicht in dem, was er sagt, oder doch nur ganz wenig, aber ich möchte sagen, er verändert sich in der Art, wie er zuhört. Czako meint, unser Freund Rex halte sich mit dem Ohr für das schadlos, was er mit dem Munde versäumt. Czako wird überhaupt am besten mit ihm fertig; er schraubt ihn beständig, und Rex, was ich reizend finde, läßt sich diese Schraubereien gefallen. Daran siehst du schon, daß sich mit ihm leben läßt. Seine Frömmigkeit ist keine Lüge, bloß Erziehung, Angewohnheit, und so schließlich seine zweite Natur geworden.«
»Ich werde ihn bei Tisch neben Lorenzen setzen; die mögen dann beide sehn, wie sie miteinander fertig werden. Vielleicht erleben wir ’ne Bekehrung. Das heißt Rex den Pastor. Aber da höre ich eine Kutsche die Dorfstraße raufkommen. Das sind natürlich Gundermanns; die kommen immer zu früh. Der arme Kerl hat mal was von der Höflichkeit der Könige gehört und macht jetzt einen zu weitgehenden Gebrauch davon. Autodidakten übertreiben immer. Ich bin selber einer und kann also mitreden. Nun, wir sprechen morgen früh weiter; heute wird es nichts mehr. Du wirst dich auch noch ein bißchen striegeln müssen, und ich will mir ’nen schwarzen Rock anziehn. Das bin ich der guten Frau von Gundermann doch schuldig; sie putzt sich übrigens nach wie vor wie ’n Schlittenpferd und hat immer noch den merkwürdigen Federbusch in ihrem Zopf – das heißt, wenn’s ihrer ist.«
um das Glück vollkommen zu machen <<<
(im) vertrautem Kreis <<<
Drittes Kapitel
Engelke schlug unten im Flur zweimal an einen alten, als Tamtam fungierenden Schild, der an einem der zwei vorspringenden und zugleich die ganze Treppe tragenden Pfeiler hing. Eben diese zwei Pfeiler bildeten denn auch mit dem Podest und der in Front desselben angebrachten Rokokouhr einen zum Gartensalon, diesem Hauptzimmer des Erdgeschosses, führenden, ziemlich pittoresken Portikus, von dem ein auf Besuch anwesender hauptstädtischer Architekt mal gesagt hatte: sämtliche Bausünden von Schloß Stechlin würden durch diesen verdrehten, aber malerischen Einfall wieder gutgemacht.
Die Uhr mit dem Hippenmann schlug gerade sieben, als Rex und Czako die Treppe herunterkamen und, eine Biegung machend, auf den von berufener Seite so glimpflich beurteilten sonderbaren Vorbau zusteuerten. Als die Freunde diesen passierten, sahen sie – die Türflügel waren schon geöffnet – in aller Bequemlichkeit in den Salon hinein und nahmen hier wahr, daß etliche, ihnen zu Ehren geladene Gäste bereits erschienen waren. Dubslav, in dunkelm Oberrock und die Bändchenrosette sowohl des preußischen wie des wendischen Kronenordens im Knopfloch, ging den Eintretenden entgegen, begrüßte sie nochmals mit der ihm eignen Herzlichkeit, und beide Herren gleich danach in den Kreis der schon Versammelten einführend, sagte er: »Bitte die Herrschaften miteinander bekannt machen zu dürfen: Herr und Frau von Gundermann auf Siebenmühlen, Pastor Lorenzen, Oberförster Katzler«, und dann, nach links sich wendend, »Ministerialassessor Rex, Hauptmann von Czako vom Regiment Alexander.« Man verneigte sich gegenseitig, worauf Dubslav zwischen Rex und Pastor Lorenzen, Woldemar aber, als Adlatus seines Vaters, zwischen Czako und Katzler eine Verbindung herzustellen suchte, was auch ohne weiteres gelang, weil es hüben und drüben weder an gesellschaftlicher Gewandtheit noch an gutem Willen gebrach. Nur konnte Rex nicht umhin, die Siebenmühlener etwas eindringlich zu mustern, trotzdem Herr von Gundermann in Frack und weißer Binde, Frau von Gundermann aber in geblümtem Atlas mit Marabufächer erschienen war, – er augenscheinlich Parvenu, sie Berlinerin aus einem nordöstlichen Vorstadtgebiet.
Rex sah das alles. Er kam aber nicht in die Lage, sich lange damit zu beschäftigen, weil Dubslav eben jetzt den Arm der Frau von Gundermann nahm und dadurch das Zeichen zum Aufbruch zu der im Nebenzimmer gedeckten Tafel gab. Alle folgten paarweise, wie sie sich vorher zusammengefunden, kamen aber durch die von seiten Dubslavs schon vorher festgesetzte Tafelordnung wieder auseinander. Die beiden Stechlins, Vater und Sohn, placierten sich an den beiden Schmalseiten einander gegenüber, während zur Rechten und Linken von Dubslav Herr und Frau von Gundermann, rechts und links von Woldemar aber Rex und Lorenzen saßen. Die Mittelplätze hatten Katzler und Czako inne. Neben einem großen alten Eichenbüfett, ganz in Nähe der Tür, standen Engelke und Martin, Engelke in seiner sandfarbenen Livree mit den großen Knöpfen, Martin, dem nur oblag, mit der Küche Verbindung zu halten, einfach in schwarzem Rock und Stulpstiefeln.
Der alte Dubslav war in bester Laune, stieß gleich nach den ersten Löffeln Suppe mit Frau von Gundermann vertraulich an, dankte ihr für ihr Erscheinen und entschuldigte sich wegen der späten Einladung: »Aber erst um zwölf kam Woldemars Telegramm. Es ist das mit dem Telegraphieren solche Sache, manches wird besser, aber manches wird auch schlechter, und die feinere Sitte leidet nun schon ganz gewiß. Schon die Form, die Abfassung. Kürze soll eine Tugend sein, aber sich kurz fassen, heißt meistens auch, sich grob fassen. Jede Spur von Verbindlichkeit fällt fort, und das Wort ›Herr‹ ist beispielsweise gar nicht mehr anzutreffen. Ich hatte mal einen Freund, der ganz ernsthaft versicherte: ›Der häßlichste Mops sei der schönste‹; so läßt sich jetzt beinahe sagen: ›Das gröbste Telegramm ist das feinste‹. Wenigstens das in seiner Art vollendetste. Jeder, der wieder eine neue Fünfpfennigersparnis herausdoktert, ist ein Genie.«
Diese Worte Dubslavs hatten sich anfänglich an die Frau von Gundermann, sehr bald aber mehr an Gundermann selbst gerichtet, weshalb dieser letztere denn auch antwortete: »Ja, Herr von Stechlin, alles Zeichen der Zeit. Und ganz bezeichnend, daß gerade das Wort ›Herr‹, wie Sie schon hervorzuheben die Güte hatten, so gut wie abgeschafft ist. ›Herr‹ ist Unsinn geworden, ›Herr‹ paßt den Herren nicht mehr, – ich meine natürlich die, die jetzt die Welt regieren wollen. Aber es ist auch danach. Alle diese Neuerungen, an denen sich leider auch der Staat beteiligt, was sind sie? Begünstigungen der Unbotmäßigkeit, also Wasser auf die Mühlen der Sozialdemokratie. Weiter nichts. Und niemand da, der Lust und Kraft hätte, dies Wasser abzustellen. Aber trotzdem, Herr von Stechlin – ich würde nicht widersprechen, wenn mich das Tatsächliche nicht dazu zwänge -, trotzdem geht es nicht ohne Telegraphie, gerade hier in unsrer Einsamkeit. Und dabei das beständige Schwanken der Kurse. Namentlich auch in der Mühlen- und Brettschneidebranche…«
»Versteht sich, lieber Gundermann. Was ich da gesagt habe… Wenn ich das Gegenteil gesagt hätte, wäre es ebenso richtig. Der Teufel is nich so schwarz, wie er gemalt wird, und die Telegraphie auch nicht, und wir auch nicht. Schließlich ist es doch was Großes, diese Naturwissenschaften, dieser elektrische Strom, tipp, tipp, tipp, und wenn uns daran läge (aber uns liegt nichts daran), so könnten wir den Kaiser von China wissen lassen, daß wir hier versammelt sind und seiner gedacht haben. Und dabei diese merkwürdigen Verschiebungen in Zeit und Stunde. Beinahe komisch. Als anno siebzig die Pariser Septemberrevolution ausbrach, wußte man’s in Amerika drüben um ein paar Stunden früher, als die Revolution überhaupt da war. Ich sagte: Septemberrevolution. Es kann aber auch ’ne andre gewesen sein; sie haben da so viele, daß man sie leicht verwechselt. Eine war im Juni, ’ne andre war im Juli, – wer nich ein Bombengedächtnis hat, muß da notwendig reinfallen… Engelke, präsentiere der gnädigen Frau den Fisch noch mal. Und vielleicht nimmt auch Herr von Czako…«
»Gewiß, Herr von Stechlin«, sagte Czako. »Erstlich aus reiner Gourmandise, dann aber auch aus Forschertrieb oder Fortschrittsbedürfnis. Man will doch an dem, was gerade gilt oder überhaupt Menschheitsentwicklung bedeutet, auch seinerseits nach Möglichkeit teilnehmen, und da steht denn Fischnahrung jetzt obenan. Fische sollen außerdem viel Phosphor enthalten, und Phosphor, so heißt es, macht ›helle‹.«
»Gewiß«, kicherte Frau von Gundermann, die sich bei dem Wort »helle« wie persönlich getroffen fühlte. »Phosphor war ja auch schon, eh die Schwedischen aufkamen.«
»Oh, lange vorher«, bestätigte Czako. »Was mich aber«, fuhr er, sich an Dubslav wendend, fort, »an diesen Karpfen noch ganz besonders fesselt – beiläufig ein Prachtexemplar -, das ist das, daß er doch höchstwahrscheinlich aus Ihrem berühmten See stammt, über den ich durch Woldemar, Ihren Herrn Sohn, bereits unterrichtet bin. Dieser merkwürdige See, dieser Stechlin! Und da frag’ ich mich denn unwillkürlich (denn Karpfen werden alt; daher beispielsweise die Mooskarpfen), welche Revolutionen sind an diesem hervorragenden Exemplar seiner Gattung wohl schon vorübergegangen? Ich weiß nicht, ob ich ihn auf hundertfünfzig Jahre taxieren darf, wenn aber, so würde er als Jüngling die Lissaboner Aktion und als Urgreis den neuerlichen Ausbruch des Krakatowa mitgemacht haben. Und all das erwogen, drängt sich mir die Frage auf…«
Dubslav lächelte zustimmend.
»… Und all das erwogen, drängt sich mir die Frage auf, wenn’s nun in Ihrem Stechlinsee zu brodeln beginnt oder gar die große Trichterbildung anhebt, aus der dann und wann, wenn ich recht gehört habe, der krähende Hahn aufsteigt, wie verhält sich da der Stechlinkarpfen, dieser doch offenbar Nächstbeteiligte, bei dem Anpochen derartiger Weltereignisse? Beneidet er den Hahn, dem es vergönnt ist, in die Ruppiner Lande hineinzukrähen, oder ist er umgekehrt ein Feigling, der sich in seinem Moorgrund verkriecht, also ein Bourgeois, der am anderen Morgen fragt: ›Schießen sie noch?‹«
»Mein lieber Herr von Czako, die Beantworung Ihrer Frage hat selbst für einen Anwohner des Stechlin seine Schwierigkeiten. Ins Innere der Natur dringt kein erschaffener Geist. Und zu dem Innerlichsten und Verschlossensten zählt der Karpfen; er ist nämlich sehr dumm. Aber nach der Wahrscheinlichkeitsrechnung wird er sich beim Eintreten der großen Eruption wohl verkrochen haben. Wir verkriechen uns nämlich alle. Heldentum ist Ausnahmezustand und meist Produkt einer Zwangslage. Sie brauchen mir übrigens nicht zuzustimmen, denn Sie sind noch im Dienst.«
»Bitte, bitte«, sagte Czako.
*
Sehr, sehr anders ging das Gespräch an der entgegengesetzten Seite der Tafel. Rex, der, wenn er dienstlich oder außerdienstlich aufs Land kam, immer eine Neigung spürte, sozialen Fragen nachzuhängen, und beispielsweise jedesmal mit Vorliebe darauf aus war, an das Zahlenverhältnis der in und außer der Ehe geborenen Kinder alle möglichen, teils dem Gemeinwohl, teils der Sittlichkeit zugute kommende Betrachtungen zu knüpfen, hatte sich auch heute wieder in einem mit Pastor Lorenzen angeknüpften Zwiegespräch seinem Lieblingsthema zugewandt, war aber, weil Dubslav durch eine Zwischenfrage den Faden abschnitt, in die Lage gekommen, sich vorübergehend statt mit Lorenzen mit Katzler beschäftigen zu müssen, von dem er zufällig in Erfahrung gebracht hatte, daß er früher Feldjäger gewesen sei. Das gab ihm einen guten Gesprächsstoff und ließ ihn fragen, ob der Herr Oberförster nicht mitunter schmerzlich den zwischen seiner Vergangenheit und seiner Gegenwart liegenden Gegensatz empfinde, – sein früherer Feldjägerberuf, so nehme er an, habe ihn in die weite Welt hinausgeführt, während er jetzt »stabiliert« sei. »Stabilierung« zählte zu Rex’ Lieblingswendungen und entstammte jenem sorglich ausgewählten Fremdwörterschatz, den er sich – er hatte diese Dinge dienstlich zu bearbeiten gehabt – aus den Erlassen König Friedrich Wilhelms I. angeeignet und mit in sein Aktendeutsch herübergenommen hatte. Katzler, ein vorzüglicher Herr, aber auf dem Gebiete der Konversation doch nur von einer oft unausreichenden Orientierungsfähigkeit, fand sich in des Ministerialassessors etwas gedrechseltem Gedankengange nicht gleich zurecht und war froh, als ihm der hellhörige, mittlerweile wieder frei gewordene Pastor in der durch Rex aufgeworfenen Frage zu Hilfe kam. »Ich glaube herauszuhören«, sagte Lorenzen, »daß Herr von Rex geneigt ist, dem Leben draußen in der Welt vor dem in unsrer stillen Grafschaft den Vorzug zu geben. Ich weiß aber nicht, ob wir ihm darin folgen können, ich nun schon gewiß nicht; aber auch unser Herr Oberförster wird mutmaßlich froh sein, seine vordem im Eisenbahnkupee verbrachten Feldjägertage hinter sich zu haben. Es heißt freilich: ›Im engen Kreis verengen sich der Sinn‹, und in den meisten Fällen mag es zutreffen. Aber doch nicht immer, und jedenfalls hat das Weltfremde bestimmte große Vorzüge.«
»Sie sprechen mir durchaus aus der Seele, Herr Pastor Lorenzen«, sagte Rex. »Wenn es einen Augenblick vielleicht so klang, als ob der ›Globetrotter‹ mein Ideal sei, so bin ich sehr geneigt, mit mir handeln zu lassen. Aber etwas hat es doch mit dem ›Auch-draußen-zu-Hause-Sein‹ auf sich, und wenn Sie trotzdem für Einsamkeit und Stille plädieren, so plädieren Sie wohl in eigner Sache. Denn wie sich der Herr Oberförster aus der Welt zurückgezogen hat, so wohl auch Sie. Sie sind beide darin, ganz individuell, einem Herzenszuge gefolgt, und vielleicht, daß meine persönliche Neigung dieselben Wege ginge. Dennoch wird es andre geben, die von einem solchen Sichzurückziehen aus der Welt nichts wissen wollen, die vielleicht umgekehrt, statt in einem Sichhingeben an den einzelnen, in der Beschäftigung mit einer Vielheit ihre Bestimmung finden. Ich glaube durch Freund Stechlin zu wissen, welche Fragen Sie seit lange beschäftigen, und bitte, Sie dazu beglückwünschen zu dürfen. Sie stehen in der christlich-sozialen Bewegung. Aber nehmen Sie deren Schöpfer, der Ihnen persönlich vielleicht nahesteht, er und sein Tun sprechen doch recht eigentlich für mich; sein Feld ist nicht einzelne Seelsorge, nicht eine Landgemeinde, sondern eine Weltstadt. Stöckers Auftreten und seine Mission sind eine Widerlegung davon, daß das Schaffen im Engen und Umgrenzten notwendig das Segensreichere sein müsse.«
Lorenzen war daran gewöhnt, sei’s zu Lob, sei’s zu Tadel, sich mit dem ebenso gefeierten wie befehdeten Hofprediger in Parallele gestellt zu sehen, und empfand dies jedesmal als eine Huldigung. Aber nicht minder empfand er dabei regelmäßig den tiefen Unterschied, der zwischen dem großen Agitator und seiner stillen Weise lag. »Ich glaube, Herr von Rex«, nahm er wieder das Wort, »daß Sie den ›Vater der Berliner Bewegung‹ sehr richtig geschildert haben, vielleicht sogar zur Zufriedenheit des Geschilderten selbst, was, wie man sagt, nicht eben leicht sein soll. Er hat viel erreicht und steht anscheinend in einem Siegeszeichen; hüben und drüben hat er Wurzel geschlagen und sieht sich geliebt und gehuldigt, nicht nur seitens derer, denen er mildtätig die Schuhe schneidet, sondern beinah mehr noch im Lager derer, denen er das Leder zu den Schuhen nimmt. Er hat schon so viele Beinamen, und der des heiligen Krispin wäre nicht der schlimmste. Viele wird es geben, die sein Tun im guten Sinne beneiden. Aber ich fürchte, der Tag ist nahe, wo der so Ruhige und zugleich so Mutige, der seine Ziele so weit steckte, sich in die Enge des Daseins zurücksehnen wird. Er besitzt, wenn ich recht berichtet bin, ein kleines Bauerngut irgendwo in Franken, und wohl möglich, ja, mir persönlich geradezu wahrscheinlich, daß ihm an jener stillen Stelle früher oder später ein echteres Glück erblüht, als er es jetzt hat. Es heißt wohl: ›Gehet hin und lehret alle Heiden‹, aber schöner ist es doch, wenn die Welt, uns suchend, an uns herankommt. Und die Welt kommt schon, wenn die richtige Persönlichkeit sich ihr auftut. Da ist dieser Wörishofener Pfarrer – er sucht nicht die Menschen, die Menschen suchen ihn. Und wenn sie kommen, so heilt er sie, heilt sie mit dem Einfachsten und Natürlichsten. Übertragen Sie das vom Äußern aufs Innere, so haben Sie mein Ideal. Einen Brunnen graben just an der Stelle, wo man gerade steht. Innere Mission in nächster Nähe, sei’s mit dem Alten, sei’s mit etwas Neuem.«
»Also mit dem Neuen«, sagte Woldemar und reichte seinem alten Lehrer die Hand.
Aber dieser antwortete: »Nicht so ganz unbedingt mit dem Neuen. Lieber mit dem Alten, soweit es irgend geht, und mit dem Neuen nur, soweit es muß.«
*
Das Mahl war inzwischen vorgeschritten und bei einem Gange angelangt, der eine Spezialität von Schloß Stechlin war und jedesmal die Bewunderung seiner Gäste: losgelöste Krammetsvögelbrüste, mit einer dunklen Kraftbrühe angerichtet, die, wenn die Herbst- und Ebereschentage da waren, als eine höhere Form von Schwarzsauer auf den Tisch zu kommen pflegten. Engelke präsentierte Burgunder dazu, der schon lange lag, noch aus alten, besseren Tagen her, und als jeder davon genommen, erhob sich Dubslav, um erst kurz seine lieben Gäste zu begrüßen, dann aber die Damen leben zu lassen. Er müsse bei diesem Plural bleiben, trotzdem die Damenwelt nur in einer Einheit vertreten sei; doch er gedenke dabei neben seiner lieben Freundin und Tischnachbarin (er küßte dieser huldigend die Hand) zugleich auch der »Gemahlin« seines Freundes Katzler, die leider – wenn auch vom Familienstandpunkt aus in hocherfreulichster Veranlassung – am Erscheinen in ihrer Mitte verhindert sei: »Meine Herren, Frau Oberförster Katzler« – er machte hier eine kleine Pause, wie wenn er eine höhere Titulatur ganz ernsthaft in Erwägung gezogen hätte -, »Frau Oberförster Katzler und Frau von Gundermann, sie leben hoch!« Rex, Czako, Katzler erhoben sich, um mit Frau von Gundermann anzustoßen, als aber jeder von ihnen auf seinen Platz zurückgekehrt war, nahmen sie die durch den Toast unterbrochenen Privatgespräche wieder auf, wobei Dubslav als guter Wirt sich darauf beschränkte, kurze Bemerkungen nach links und rechts hin einzustreuen. Dies war indessen nicht immer leicht, am wenigsten leicht bei dem Geplauder, das der Hauptmann und Frau von Gundermann führten und das so pausenlos verlief, daß ein Einhaken sich kaum ermöglichte. Czako war ein guter Sprecher, aber er verschwand neben seiner Partnerin. Ihres Vaters Laufbahn, der es (ursprünglich Schreib- und Zeichenlehrer) in einer langen, schon mit anno 13 beginnenden Dienstzeit bis zum Hauptmann in der »Plankammer« gebracht hatte, gab ihr in ihren Augen eine gewisse militärische Zugehörigkeit, und als sie, nach mehrmaligem Auslugen, endlich den ihr wohlbekannten Namenszug des Regiments Alexander auf Czakos Achselklappe erkannt hatte, sagte sie: »Gott…, Alexander. Nein, ich sage. Mir war aber doch auch gleich so. Münzstraße. Wir wohnten ja Linienstraße, Ecke der Weinmeister – das heißt, als ich meinen Mann kennenlernte. Vorher draußen, Schönhauser Allee. Wenn man so wen aus seiner Gegend wieder sieht! Ich bin ganz glücklich, Herr Hauptmann. Ach, es ist zu traurig hier. Und wenn wir nicht den Herrn von Stechlin hätten, so hätten wir so gut wie gar nichts. Mit Katzlers«, aber dies flüsterte sie nur leise, »mit Katzlers ist es nichts; die sind zu hoch raus. Da muß man sich denn klein machen. Und so toll ist es am Ende doch auch noch nicht. Jetzt passen sie ja noch leidlich. Aber abwarten.«
»Sehr wahr, sehr wahr«, sagte Czako, der, ohne was Sicheres zu verstehen, nur ein während des Dubslavschen Toastes schon gehabtes Gefühl bestätigt sah, daß es mit den Katzlers was Besonderes auf sich haben müsse. Frau von Gundermann aber, den ihr unbequemen Flüsterton aufgebend, fuhr mit wieder lauter werdender Stimme fort: »Wir haben den Herrn von Stechlin, und das ist ein Glück, und es ist auch bloß eine gute halbe Meile. Die meisten andere wohnen viel zu weit, und wenn sie auch näher wohnten, sie wollen alle nicht recht; die Leute hier, mit denen wir eigentlich Umgang haben müßten, sind so diffizil und legen alles auf die Goldwaage. Das heißt, vieles legen sie nicht auf die Goldwaage, dazu reicht es bei den meisten nicht aus; nur immer die Ahnen. Und sechzehn ist das wenigste. Ja, wer hat gleich sechzehn? Gundermann ist erst geadelt, und wenn er nicht Glück gehabt hätte, so wär’ es gar nichts. Er hat nämlich klein angefangen, bloß mit einer Mühle; jetzt haben wir nun freilich sieben, immer den Rhin entlang, lauter Schneidemühlen, Bohlen und Bretter, einzöllig, zweizöllig und noch mehr. Und die Berliner Dielen, die sind fast alle von uns.«
»Aber, meine gnädigste Frau, das muß Ihnen doch ein Hochgefühl geben. Alle Berliner Dielen! Und dieser Rhinfluß, von dem Sie sprechen, der vielleicht eine ganze Seenkette verbindet und woran mutmaßlich eine reizende Villa liegt! Und darin hören Sie Tag und Nacht, wie nebenan in der Mühle die Säge geht, und die dicht herumstehenden Bäume bewegen sich leise. Mitunter natürlich ist auch Sturm. Und Sie haben eine Pony-Equipage für Ihre Kinder. Ich darf doch annehmen, daß Sie Kinder haben? Wenn man so abgeschieden lebt und so beständig aufeinander angewiesen ist…«
»Es ist, wie Sie sagen, Herr Hauptmann; ich habe Kinder, aber schon erwachsen, beinah alle, denn ich habe mich jung verheiratet. Ja, Herr von Czako, man ist auch einmal jung gewesen. Und es ist ein Glück, daß ich Kinder habe. Sonst ist kein Mensch da, mit dem man ein gebildetes Gespräch führen kann. Mein Mann hat seine Politik und möchte sich wählen lassen, aber es wird nichts, und wenn ich die Journale bringe, nicht mal die Bilder sieht er sich an. Und die Geschichten, sagt er, seien bloß dummes Zeug und bloß Wasser auf die Mühlen der Sozialdemokratie. Seine Mühlen, was ich übrigens recht und billig finde, sind ihm lieber.«
»Aber Sie müssen doch viele Menschen um sich herum haben, schon in Ihrer Wirtschaft.«
»Ja, die hab’ ich, und die Mamsells, die man so kriegt, ja, ein paar Wochen geht es; aber dann bändeln sie gleich an, am liebsten mit ’nem Volontär, wir haben nämlich auch Volontärs in der Mühlenbranche. Und die meisten sind aus ganz gutem Hause. Die jungen Menschen passen aber nicht auf, und da hat man’s denn, und immer gleich Knall und Fall. All das ist doch traurig, und mitunter ist es auch so, daß man sich geradezu genieren muß.«
Czako seufzte. »Mir ein Greuel, all dergleichen. Aber ich weiß vom Manöver her, was alles vorkommt. Und mit einer Schläue… nichts schlauer als verliebte Menschen. Ach, das ist ein Kapitel, womit man nicht fertig wird. Aber Sie sagten Linienstraße, meine Gnädigste. Welche Nummer denn? Ich kenne da beinah jedes Haus, kleine, nette Häuser, immer bloß Bel-Etage, höchstens mal ein Oeil de Boeuf.«
»Wie? was?«
»Großes rundes Fenster ohne Glas. Aber ich liebe diese Häuser.«
»Ja, das kann ich auch von mir sagen, und in gerade solchen Häusern hab’ ich meine beste Zeit verbracht, als ich noch ein Quack war, höchstens vierzehn. Und so grausam wild. Damals waren nämlich noch die Rinnsteine, und wenn es dann regnete und alles überschwemmt war und die Bretter anfingen, sich zu heben, und schon so halb herumschwammen, und die Ratten, die da drunter steckten, nicht mehr wußten, wo sie hin sollten, dann sprangen wir auf die Bohlen rauf, und nun die Biester raus, links und rechts, und die Jungens hinterher, immer aufgekrempelt und ganz nackigt. Und einmal, weil der eine Junge nicht abließ und mit seinen Holzpantinen immer drauflosschlug, da wurde das Untier falsch und biß den Jungen so, daß er schrie! Nein, so hab’ ich noch keinen Menschen wieder schreien hören. Und es war auch fürchterlich.«
»Ja, das ist es. Und da helfen bloß Rattenfänger.«
»Ja, Rattenfänger, davon hab’ ich auch gehört – Rattenfänger von Hameln. Aber die gibt es doch nicht mehr.«
»Nein, gnädige Frau, die gibt es nicht mehr, wenigstens nicht mehr solche Hexenmeister mit Zauberspruch und einer Pfeife zum Pfeifen. Aber die meine ich auch gar nicht. Ich meine überhaupt nicht Menschen, die dergleichen als Metier betreiben und sich in den Zeitungen anzeigen, unheimliche Gesichter mit einer Pelzkappe. Was ich meine, sind bloß Pinscher, die nebenher auch noch ›Rattenfänger‹ heißen und es auch wirklich sind. Und mit einem solchen Rattenfänger auf die Jagd gehen, das ist eigentlich das Schönste, was es gibt.«
»Aber mit einem Pinscher kann man doch nicht auf die Jagd gehen!«
»Doch, doch, meine gnädigste Frau. Als ich in Paris war (ich war da nämlich mal hinkommandiert), da bin ich mit runtergestiegen in die sogenannten Katakomben, hochgewölbte Kanäle, die sich unter der Erde hinziehen. Und diese Kanäle sind das wahre Ratteneldorado; da sind sie zu Millionen. Oben drei Millionen Franzosen, unten drei Millionen Ratten. Und einmal, wie gesagt, bin ich da mit runtergeklettert und in einem Boote durch diese Unterwelt hingefahren, immer mitten in die Ratten hinein.«
»Gräßlich, gräßlich. Und sind Sie heil wieder rausgekommen?«
»Im ganzen, ja. Denn, meine gnädigste Frau, eigentlich war es doch ein Vergnügen. In unserm Kahn hatten wir nämlich zwei solche Rattenfänger, einen vorn und einen hinten. Und nun hätten Sie sehen sollen, wie das losging. ›Schnapp‹ und das Tier um die Ohren geschlagen, und tot war es. Und so weiter, so schnell wie Sie nur zählen können, und mitunter noch schneller. Ich kann es nur vergleichen mit Mr. Carver, dem bekannten Mr. Carver, von dem Sie gewiß einmal gelesen haben, der in der Sekunde drei Glaskugeln wegschoß. Und so immerzu, viele hundert. Ja, so was wie diese Rattenjagd da unten, das vergißt man nicht wieder. Es war aber auch das Beste da. Denn was sonst noch von Paris geredet wird, das ist alles übertrieben; meist dummes Zeug. Was haben sie denn Großes? Opern und Zirkus und Museum, und in einem Saal ’ne Venus, die man sich nicht recht ansieht, weil sie das Gefühl verletzt, namentlich wenn man mit Damen da ist. Und das alles haben wir schließlich auch, und manches haben wir noch besser. So zum Beispiel Niemann und die dell’Era. Aber solche Rattenschlacht, das muß wahr sein, die haben wir nicht. Und warum nicht? Weil wir keine Katakomben haben.«