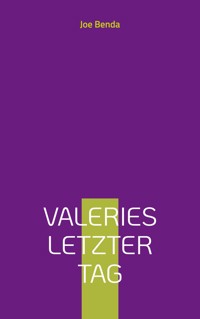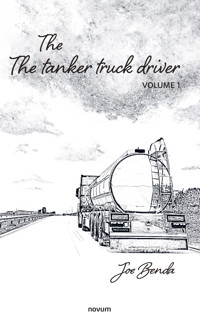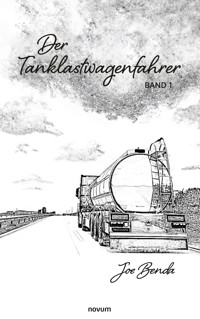
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: novum Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Alle Personen und Örtlichkeiten sind fiktiv. Die Handlungen stammen zum großen Teil aus wahren Begebenheiten. Für die Haupt- und Nebenfiguren ergibt sich oft nach anfänglichem Scheitern eine neue Entwicklung, mit der sie selbst nicht gerechnet haben, die aber für sie sehr günstig ist. Dem Tanklastwagenfahrer gelingt es nach seinem Lebensmotto "Augen zu und durch", seine konfliktreichen familiären Verhältnisse zu befrieden. Der Heizungsinstallateur begeht im Arbeitsverhältnis Straftaten, fliegt raus und schafft es nach weiteren zwischenzeitlichen Niederlagen, in gleicher Branche eine Firma zu leiten. So oder ähnlich ergeht es auch den anderen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 477
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Impressum
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie.
Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://www.d-nb.de abrufbar.
Alle Rechte der Verbreitung, auch durch Film, Funk und Fernsehen, fotomechanische Wiedergabe, Tonträger, elektronische Datenträger und auszugsweisen Nachdruck, sind vorbehalten.
© 2025 novum publishing gmbh
Rathausgasse 73, A-7311 Neckenmarkt
ISBN Printausgabe: 978-3-99146-775-5
ISBN e-book: 978-3-99146-776-2
Lektorat: Solaire Hauser
Umschlagfotos: www.pixabay.com
Umschlaggestaltung, Layout & Satz: novum publishing gmbh
www.novumverlag.com
Vorwort
„Alles andere als Alltagstrott: ein Heizölauslieferungsfahrer,
ein Anwalt, ein Unternehmer, ein Richter, Gerichtsverfahren,
Ehekrisen, Immobilienskandale. Personen jedweder Couleur
werden mit Veränderungen und Ereignissen konfrontiert,
die ihr Leben nachhaltig beeinflussen.“
Kapitel 1
Das Mittagessen in der Richterfamilie
Hans-Peter (Name sowie alle anderen Namen fiktiv) ist Richter beim Landgericht. Er ist Vorsitzender einer Strafkammer. Er hat noch wenige Dienstjahre, dann wird er von diesem Staat als Ruheständler versorgt werden.
Er hat einen sechsundzwanzigjährigen Sohn, Kevin, dieser studiert Theater- und Schauspielwissenschaften.
Einmal im Monat, sonntags, oder auch zweimal im Monat geht der Richtersohn zu seinen Eltern nach Hause zum Mittagessen. Das lässt sich die Frau des Hauses nicht nehmen. Ein- oder zweimal im Monat möchte sie, wie in alten Zeiten, die Familie und den Sohn bekochen.
Die Frau des Hauses und Frau des Richters ist Petra. Sie ist ein Jahr älter als ihr Mann. An solchen Tagen darf sich Kevin auch etwas aussuchen.
Eines Sonntages (es gibt Sauerbraten mit Rotkohl und Klößen) geraten Vater und Sohn wieder einmal in eine Diskussion. Es geht um eine Gerichtsverhandlung, der der Sohn als Zuschauer beigewohnt hat. Der Sohn fragt den Vater, wonach er die Angeklagten beurteilt.
Vater: „Wie schon? Nach der Aktenlage natürlich.“
Sohn: „Sonst nichts?“
Vater: „Natürlich auch nach dem persönlichen Eindruck und nach der Einlassung in der Hauptverhandlung – kurzum nach dem Inbegriff der Hauptverhandlung § 261 StPO inklusive Beweisaufnahme, Zeugen usw. Warum?“
Sohn: „Wie? Ist das alles?“
Vater: „Ja. Was soll denn sonst noch sein?“
Sohn: „Du kannst doch einen Menschen nur beurteilen, wenn du Vergleichsmöglichkeiten hast.“
Vater: „Wie? Verstehe ich nicht. Habe ich doch.“
Sohn: „Hast du nicht!“
Vater: „Wieso nicht?“
Sohn: „Weil du viel zu wenig über den Angeklagten weißt. Ich gebe dir ein Beispiel, lieber Vater. Wenn z. B. der Angeklagte in der X-Straße wohnt und ein Diebstahl zu beurteilen ist und die X-Straße hat 220 Hausnummern, und er wohnt mit 219 anderen in der Straße, er ist der Einzige, der geklaut hat, reicht dir das dann als Vergleichsmöglichkeit? Obwohl du die 219 anderen Bewohner der Straße nicht kennst?“
Vater: „Natürlich.“
Sohn: „Und wenn die X-Straße 450 Hausnummern hat, was ist dann?“
Vater: „Was soll das? Worauf willst du hinaus?“
Sohn: „Ich will darauf hinaus, dass du zu wenig über die Angeklagten weißt. Habe ich doch gerade schon gesagt.“
Der Ton wird schärfer.
„Und wie ist das mit dem Vergleich des Verhaltens deines Angeklagten mit den Einwohnern der ganzen Stadt, die immerhin 600 000 betragen? Machst du dir darüber Gedanken?“
Vater: „Was soll das? Natürlich nicht.“
Die Mutter wird nervös. Sie kennt das schon. Gleich geraten die beiden richtig aneinander.
Kevin kann die Skepsis für den Beruf des Vaters nur noch schwer zurückhalten.
Sohn: „Okay. Anderes Thema.“
Petra ist erleichtert.
Sohn: „Wie viele Fehlurteile hast du in deinem Berufsleben gefällt?“
Vater: „Was soll das?“
Sohn: „Sag es doch einfach.“
Vater: „Natürlich keins.“
Sohn: „Das glaubst du doch selber nicht.“
Hans-Peter, der Richter, stammelt etwas zusammen vom Handeln nach freier Überzeugung, Ergebnis der Beweisaufnahme etc.
Sohn: „Soll ich dir sagen, wie das ist?“
Petra versucht einzugreifen.
Petra: „Junge, red’ nicht so respektlos mit deinem Vater!“
Sohn: „Je mehr Fehlurteile du gesprochen hast – oder willst du etwa sagen, dass du dir immer sicher warst –, desto mehr wirst du auch in Zukunft Fehler machen und diese in Kauf nehmen.“
Vater: „Wieso?“
Sohn: „Weil das deine Art der Gewissensberuhigung ist. Du verurteilst einfach immer mehr Leute, als du eigentlich freisprechen müsstest.“
Vater: „Kannst du dich deutlicher ausdrücken?“
Der Sohn nennt zwei Beispiele aus dem Hauptverhandlungstag, in dem mehrere Termine stattgefunden haben.
Der Richter muss zustimmen, dass die Beweislage wackelig war.
Sohn: „Warum hast du die beiden Angeklagten dann nicht freigesprochen?“
Vater: „Weil mehr für eine Verurteilung sprach als dagegen.“
Sohn: „Blödsinn. Weil der Satz ‚im Zweifel für den Angeklagten‘ von dir, wenn nicht sogar von der ganzen Justiz schlechthin mit Füßen getreten wird und seine Gültigkeit eingebüßt hat.“
Jetzt reicht es dem Richter.
Der Vater beendet die Diskussion. Er faselt etwas herum von „keine Ahnung vom Leben“, „rotzlöffelartige Argumentation“ etc.
Auch die Mutter löst die Tafel auf. In den nächsten Wochen wird es wohl kein Sonntagsmittagessen geben.
Kapitel 2
Der Tanklastwagenfahrer
Marco ist dreiundvierzig Jahre alt. Er ist von Beruf Tanklastwagenfahrer und beliefert Privathaushalte und gewerbliche Haushalte mit Heizöl.
An einem Spätsommertag im Jahre 2016 geht Petra mit dem Hund in der Südstadt spazieren. An einem Wohnhaus, vor dem ein Tankwagen mit Heizöl steht, ist eine Diskussion im Vorbeigehen nicht zu überhören. Die dortige Frau des Hauses hat zwar eine Lieferung bestellt, will den Fahrer aber wieder wegschicken.
Sie kann die Stunden in Anspruch nehmende Lieferung gerade nicht gebrauchen. Das Ordnungsamt ist gekommen zusammen mit einem TÜV-Prüfer. Es soll der technische Zustand der Öl-Heizungsanlage überprüft werden.
Jedenfalls hat heute Marco keinen Einsatz im Privateinfamilienhaus. Es kann hier heute keine Befüllung der Tankanlage stattfinden. Dies führt dazu, dass Marco seine Tour zweieinhalb Stunden früher beendet und nach Hause fährt, um am nächsten Morgen seine Tour von zu Hause aus fortzusetzen, da die Termine schon bestimmt sind und die Abnehmeradressen auch.
Er muss nur wenige Kilometer nach Hause fahren. Er wohnt in der Ruhrgebietsstadt E., wo es unter mühevollen Entbehrungen gelungen ist, ein kleines Einfamilienreihenhaus zu bauen, das er in bescheidenem Wohlstand mit seiner Frau und dem fünfjährigen Sohn bewohnt.
Er freut sich auf seinen Fünfjährigen, mit dem er die unverhoffte Freizeit am Nachmittag verbringen möchte und ruft extra nicht zu Hause an, damit es eine Überraschung ist, dass er früher nach Hause kommt.
Nach kurzer Zeit dann der erste Ärger; er wird angehalten. Lkw-Kontrolle.
Der erste Polizeibeamte kontrolliert den Fahrtenschreiber und findet bereits erste Ungereimtheiten bei den Lenkzeiten.
Der zweite – ungewöhnlich technisch versiert – beißt sich am Lkw fest.
Er findet in circa 30 Minuten an die dreizehn Mängel am Fahrzeug.
Dies geht über Mängel an der Hydraulik der Bremskraftverstärkung über Beleuchtungsmängel bis hin zum Datum der Runderneuerung der Reifen.
Marco erhält eine Mängelkarte und eine Anzeige. Er ist nicht Halter – dies ist sein Arbeitgeber –, aber als Fahrer haftet er trotzdem und dies ebenso.
Er setzt seine Fahrt fort mit sichtlich gedrückter Stimmung.
Er parkt den Lkw da, wo er immer parkt in der unbebauten Seitenstraße, dort am Straßenrand in der Einfamilienhaussiedlung. Er packt Rucksack, Henkelmann, Thermoskanne (alles leer) und geht die letzten Meter zu seinem Haus in der Einfamilienhaus-Reihensiedlung.
Da fällt ihm ein Mittelklassewagen mit auswärtigem Kennzeichen auf; circa drei Hausnummern von seiner entfernt.
„Merkwürdig“, denkt er. „Wer soll denn das sein? Der Wagen ist doch hier völlig fremd.“
Hier in der Straße kennt doch jeder jeden, und man redet auch über alles. Abends sitzt man ja schließlich auch noch immer, weil man sich gut kennt, beim Grillabend zusammen.
Als er auf sein Haus zugeht, öffnet sich die Tür, und ein Typ kommt zügigen Schrittes heraus.
„Seltsam“, denkt Marco noch, „na ja, vielleicht hat meine Frau ja einen Vertreter bestellt. Versicherung oder so. Der Versicherungsvertreter soll vielleicht das gesamte Paket mal überarbeiten: Hausrat, Haftpflicht und was man alles so braucht. Sie hat einmal davon gesprochen.“
Der Typ drückt sich schnell an ihm vorbei. Ein von Marco seit jeher verhasstes Männerparfüm (Davidoff) steigt ihm im Vorbeigehen in die Nase.
Er betritt sein Haus. Als er über die Haustürschwelle geht, denkt er noch, wie hoch seine Aversion gegen Davidoff ist. „Davidoff ist ein Herrenparfüm für verwöhnte kleine Bubis aus der Südstadt, die mit pastellfarbenen Umhängepullovern vom Tennisplatz herunterkommen“, denkt er.
Im kleinen Vorflur zum Wohnzimmer der gleiche Mief.
Marco ahnt Fürchterliches.
Er geht erst gar nicht ins Wohnzimmer, in die Küche, sondern gleich die Treppe, die vom Flur abgeht, nach oben zum Schlafzimmer. Im Schlafzimmer ist seine Frau gerade mit Ankleideprozeduren beschäftigt. Das Bett zerwühlt, im Schlafzimmer derselbe Parfümgeruch.
Seine Frau erschrickt zu Tode.
In Sekundenbruchteilen wird ihr Gesicht aschfahl, die Augen schreckgeweitet.
Für Marco bricht eine Welt zusammen. Er sieht alles zusammenbrechen, was er lange entbehrungsreich und mühsam aufgebaut hat.
Seine Frau will an ihm vorbei.
Er stellt sich ihr in den Weg.
Der Schlag katapultiert die Frau bis ans andere Ende des sechzehn Quadratmeter großen oder auch kleinen Schlafzimmers. Wimmernd bleibt sie an der Wand in einer seltsam gebückten Haltung, teils hockend, teils liegend, in verkrampfter Haltung, in der sie verharrt.
Marco erkennt, dass die Situation noch weiter eskalieren könnte. Um Schlimmeres zu verhüten, rennt er nach draußen und läuft zwei Stunden um den Häuserblock herum.
„Mein Gott, was habe ich gemacht?“, denkt er ununterbrochen. Er hat den Zerfall seiner kleinen Welt nicht nur nicht gebremst, sondern er hat ihn sogar beschleunigt.
Als er zurückkommt, erfährt er von Nachbarn, dass seine Frau vom RTW, stark blutend am Kopf, insbesondere im Augenbereich, abgeholt worden ist. Auch die Polizei soll da gewesen sein.
Der Kleine soll ohnehin ab mittags bei der Nachbarin, Britta T., zur Aufsicht gewesen sein. Sie ist mit seiner Frau befreundet.
Angesichts der Gesamtumstände, die sich der Polizei vor Ort geboten haben, hat diese den Bereitschaftsdienst des Jugendamtes herbeibeordert. Die haben den Kleinen in Obhut genommen.
Im folgenden Strafverfahren kommt Marco noch einigermaßen glimpflich davon. Ein halbes Jahr auf Bewährung wegen Körperverletzung.
Seine Frau verweigert die Zeugenaussage, § 52 StPO.
Die Verurteilung erfolgt anhand der Polizeiberichte und der ärztlichen Atteste und aufgrund von Marcos allerdings geständiger Einlassung.
Aber dies ist erst der Anfang. Jetzt geht es erst richtig los.
Die Frau kehrt nicht mehr ins Haus zurück und nimmt vorübergehend mit dem kleinen Sohn bei ihrer besten Freundin und Nachbarin Britta Wohnsitz.
Im folgenden Wohnungszuweisungsverfahren nach dem BGB erhält sie für zwölf Monate das im gemeinsamen Eigentum stehende Einfamilienhaus zur alleinigen Nutzung mit dem Sohn zugesprochen.
Die Richterin lässt ihn und seinen Anwalt kaum zu Wort kommen. Der Beschluss ergeht nach ganz kurzer Anhörung, und dies bedeutet für den Tanklastwagenfahrer, er muss die Hauslasten alleine tragen und selbst draußen bleiben.
Hinzu kommt, dass in der Folgezeit die Frau den Besuchskontakt mit dem Fünfjährigen komplett verweigert. Auch dafür muss er vor Gericht kämpfen. Die Kindesmutter boykottiert, wo sie nur kann.
Im anschließenden Prozess und Gerichtstermin betreffend das Besuchsrecht fabuliert sie laut ausschweifend und unzutreffend von nicht hinreichender Vater-Sohn-Beziehung („Der war doch immer nur weg“ usw.).
Schließlich erstreitet Marco einen Beschluss. Vierzehntätiges Besuchsrecht von 10 bis 18 Uhr samstags ohne Übernachtung.
Er mietet sich ein zweiundzwanzig Quadratmeter großes Apartment in der Innenstadt in einem trostlosen 60-Parteien-Mietshausblock in Grau und trifft mit größtenteils alleinstehenden Mietern, Alkoholikern, Drogenabhängigen, Rausgeflogenen, Autisten, Randfiguren dieser Gesellschaft zusammen.
Aber er muss der vom Gericht bestellten Umgangsrechtspflegerin wenigstens glaubhaft machen, dass er für den Besuchskontakt einen eigenen Wohnsitz hat und nicht auch noch im Lkw schläft!!
Der Beschluss wird von der Frau unterwandert, wo es nur geht; „Kind ist krank, Kind will nicht usw. usw.“. Ärztliche Atteste werden sogar vorgelegt.
Es vergehen sieben Monate, ohne dass er seinen Sohn auch nur einmal gesehen hat.
Dann der nächste Hammer: die Unterhaltsklage. Er soll bei seinem Einkommen von 2 350 netto circa 1 200 Euro Unterhalt inklusive Kindesunterhalt zahlen.
Er soll also von den verbleibenden 1 100 bis 1 200 Euro noch die gesamten Hauslasten tragen, die Hypothek, die Grundbesitzabgaben, die Gebäudeversicherung und die Wasserversorgung etc.
385 Euro kostet das Apartment, für ihn bleiben 100 bis 200 Euro, ohne dass er auch nur ein einziges Brötchen gegessen hat. Für die Unterhaltsklage kommt es nun zum Gerichtstermin.
Die Richterin erklärt, Marco habe als ausgebildeter Lkw-Fahrer die tarifliche Möglichkeit, 2 900 Euro netto zu verdienen, und schreibt ihm dieses Einkommen fiktiv zu. „Fiktiv“, wie es bei den Juristen heißt. Damit geht die Unterhaltsklage in der stattgehabten Form durch. Bei diesem fiktiven Einkommen können ja die Hauslasten „bequem“ ebenfalls gezahlt werden.
Der Beschluss erlegt ihm auch die Kosten für dieses Gerichtsverfahren auf.
Sein Dispositionskredit von 4 000 Euro ist bis auf 3 380 Euro ausgeschöpft.
Was er verdient, darf er abgeben. So steuert er in eine unsichere Zukunft.
Kapitel 3
Die Frau des Tanklastwagenfahrers
Als sich die Wogen etwas geglättet haben (vier Tage Krankenhaus, tiefe Platzwunde, Gehirnerschütterung, Thoraxprellung durch den Sturz, vierzehn Tage Wohnsitz bei der Freundin), bleibt die Frau des Tanklastwagenfahrers ständig in Kontakt mit ihrem Freund und Besucher an diesem schicksalhaften Tag.
Sie hat ihn getindert, wohl zunächst mehr aus Langeweile, da ihr Mann fast nur noch mit seinem Lkw unterwegs war mit zahlreichen Überstunden.
Sie sieht ihre eigenen Anteile an der negativen Entwicklung der letzten Zeit und dass sie fremdgegangen ist, aber … „Wenn der doch nie da ist?“
Eines Tages, nachdem sie das Haus wieder nach Abschluss des Wohnungszuweisungsverfahrens bezogen hat, findet ein Gespräch mit der „Affäre“ über eine mögliche gemeinsame Zukunft statt.
Das Gespräch verläuft desaströs.
Der Mann reagiert nicht im Ansatz so wie erhofft.
Die zahlreichen Ausreden haben alle in etwa die gleiche Tendenz. Es heißt sinngemäß immer „Wir haben so nicht gewettet“, „Das war nicht geplant“, „Wir wollten keine feste Bindung, sondern nur schöne Stunden hier und dort“ etc.
Die Aussicht, fest gebunden zu sein und auch die Mitverantwortung für ein fünfjähriges Kind zu übernehmen, das nicht einmal seins ist, schreckt den Mann rundum ab.
„Man hat sich gegenseitig ‚ertindert‘. Warum kann man es nicht auf dieser Ebene belassen?“, fragt er.
Die Frau ist geschockt anlässlich des ruinös verlaufenden Gesprächs.
„Oh Mann, der Schuss ist wirklich nach hinten losgegangen“, denkt sie. Die kleine heile Welt ist kaputt und der „Lückenschluss“ streikt schon, bevor es überhaupt ernsthaft angefangen hat. Das ist wirklich ernüchternd.
Sie setzt ihn empört an die Luft.
Ein paar Tage überlegt sie selbst, wie es denn nun weitergehen soll.
Ohne Mann will sie nicht, dafür ist sie zu sehr an den Freuden des Lebens interessiert. Aber so einen, der nichts als Ausreden hat?
So geschieht erst mal gar nichts. Wohl aufgrund allgemeiner Verunsicherung.
Der Kampf ums Besuchsrecht für den Sohn zermürbt auch sie mehr und mehr.
Ihre Anwältin hat ihr außerdem erklärt, dass sie sich nach dem neuen Unterhaltsrecht in absehbarer Zeit um Arbeit bemühen muss, sonst erhält sie selbst keinen Trennungs- bzw. Geschiedenenunterhalt.
Das ist ja nun auch keine Perspektive. In ihren alten Beruf will sie nicht zurück. Sie war ja froh, dieses Arbeitsfeld los zu sein.
Gelegenheitsjobs, etwa Gastronomie, kommen nicht infrage. Sie hat keine Lust, sich von männlichen Gästen herumkommandieren und sich noch auf den Arsch hauen zu lassen, inklusive die üblichen anderen plumpen Annäherungsversuche, denen eine gut aussehende Frau in der Gastronomie ausgesetzt ist.
So wird es eng.
Sie sieht auch, dass es mit dem Boykott der Vater-Sohn-Besuche wohl so nicht weitergehen kann. Der Kleine hat einen Anspruch auf seinen Vater und auch auf die stattfindenden Besuche. Er fragt auch zunehmend nach dem Papa.
Ihre Anwältin hat sie zudem vorgewarnt, dass ihr Gebaren, die Besuchskontakte zu unterlaufen, mit dem Entzug des Sorgerechts enden könnte, weil dies eine Missachtung des Kindeswohls ist.
So lässt sie dann schonnach elf Monaten (!) den ersten Besuch und die Abholung des Kindes für vier Stunden zu („Bitte nicht so viel und nicht so lange“). Dabei soll der Kontakt nur draußen stattfinden, Spielplatz etc., schließlich ist es Sommer.
Das Kind ist nach vier Stunden, so ordnet sie an, pünktlich(!) zurückzubringen. Abholung und Übergabe an der Haustür.
Mit rasendem Puls geht der Vater zum verabredeten Zeitpunkt zum gemeinsamen Haus.
Den Lkw hat er an derselben Stelle wie immer geparkt (in der unbebauten Seitenstraße). Er klingelt. Die Tür geht auf. Mutter und Kind stehen in der Tür. Marcos Puls beschleunigt sich weiter.
Sein Kehlkopf wird von den heftigen und schnellen Pulsschlägen erschüttert.
Sein Anwalt hat ihm viel von der schnellen Entfremdung eines Kindes in diesem Alter vom Vater erklärt und ihn davor gewarnt, zu viel zu erwarten. Der Sohn, immer noch an der Hand der Mutter, steht in der Mitte des Eingangsflurs des Hauses.
Mit fester, ja schon fast resoluter Stimme, aber nicht in vorwurfsvollem Ton, ruft der Kleine: „Papa“. Pause. Noch mal. Neuer Anlauf: „Papa“. Pause. Neuer Anlauf „Papa … ich find’ das so doof …“ wieder Pause. „Ich find’ das so doof“, wiederholt er, wieder Pause, „dass du nicht mehr hier wohnst.“
Der Vater ist fassungs- und sprachlos. Auch die Mutter bleibt sichtlich nicht ungerührt.
Immerhin lässt die Mutter zu, dass beide (natürlich ebenfalls auf Aufforderung des Kleinen) in sein Kinderzimmer gehen, weil er dem Vater neue Spielsachen zeigen will. Der Sohn ist inzwischen sechs Jahre alt. Der Geburtstagsbrief, den der Vater geschickt hat, und das Geburtstagsgeschenk wurden nicht beantwortet. Hat die Mutter dies alles zurückgehalten?
Freudig zeigt der Kleine dem Vater neu erworbene Spielsachen, auch das Geschenk des Vaters findet sich darunter.
Der Vater kann sich kaum konzentrieren. Er ist vorsichtig. Es gibt nach einer Dreiviertelstunde gemeinsamen Spielens im Kinderzimmer sogar Kaffee und fast wieder vertraute Gespräche mit der Mutter, dennoch ist Marco zurückhaltend.
Es muss schon so sein, dass er das Gefühl haben muss, seine Frau will ihn wirklich zurück. Es soll nicht ein Sechsjähriger das Gerüst zusammenhalten. Dies würde einen kleinen Jungen ja wohl auch völlig überfordern, und dies wäre auch nicht seine Aufgabe.
So geht das die Folgemonate. Schließlich parkt der Lkw wieder mindestens jeden zweiten, wenn nicht sogar jeden Tag, auch über Nacht an derselben Stelle wie immer … in der unbebauten Seitenstraße.
Kapitel 4
Der Geschäftsführer
Der Geschäftsführer (GF) ist Siegfried T. Er ist Geschäftsführer einer Firma für Getriebe und Motorteile für Lkws und Maschinen, An- und Verkauf und bundesweiter Vertrieb. Er ist verheiratet und hat einen Sohn und eine Tochter von drei und neun Jahren.
An einem warmen, sonnigen Mai-Morgen des Jahres 2015 ist er einundfünfzig Jahre alt und freut er sich auf das geplante Date mit seiner jugendlichen, hochattraktiven achtundzwanzigjährigen „Affäre“, die er, wo immer er nur kann, hofiert und unterstützt.
Für etwa zwölf Uhr sind sie verabredet. Er hat zudem für die Übernachtung ein Zimmer gebucht. Vorher wollen sie noch einen Tagesausflug verbringen. Die Freundin hat aber auch nichts ausgelassen, um seine Vorfreude zu steigern. Über WhatsApp hat sie am Morgen noch Fotos von sich an ihn mit Reizwäsche versandt.
Allerdings hat er vorher noch einen Termin mit seiner Hausbank. Es geht um den Geschäftskredit. Er hat zwölf Angestellte, Vollzeit und 450 Euro-Jobber. Die Produktions- und Lagerhalle kostet noch mal 6 000 Euro im Monat.
Die Firma brummte bis vor circa eineinhalb Jahren, als ein Großkunde weggebrochen ist.
Seitdem hat Siegfried Mühe, die monatlichen Kosten hereinzuholen. Vier Leute musste er entlassen.
Aber mit „der Bank an seiner Seite“ macht er sich keine allzu großen Sorgen. Wenn ihn auch ein leicht mulmiges und dumpfes Gefühl beschleicht, wenn er an den Geschäftskredit denkt.
Er wird monatlich „gerated“, wie es in der Bankensprache heißt. Seine KK-Kreditlinie beträgt zurzeit 75 000 Euro. Dies ist für Wareneinkauf und laufende Kosten dringend erforderlich.
Die Absicherung erfolgt ausschließlich über den wechselnden Warenbestand. Mit anderen Worten: Die Absicherung ist unzureichend.
Für das monatliche Gespräch betreffend das Rating hat die Steuerberatung die erforderlichen Unterlagen umfassend vorbereitet. Er hat alles dabei.
Seit den Finanzkrisen der Vergangenheit überlassen Banken nichts mehr dem Zufall (Nipponkrise 1998, New Economy 2003, Goldman Sachs, Lehman Brothers, Hypo Real Estate 2008/2009/2010, Zusammenbruch der West LB usw. usw.).
Der Kreditsachbearbeiter empfängt ihn mit einem Gesichtsausdruck, als hätte es über Nacht in beiden Familien je vier Sterbefälle gegeben.
Nach den Begrüßungshöflichkeiten wird es im Raum gefühlte vier Grad Celsius kalt. Der Sachbearbeiter erklärt ihm unmissverständlich und sofort zur Sache kommend, dass der Vorstand beschlossen hat, die Kreditlinie zu reduzieren.
Den GF schaudert es.
Es stimmt, dass es Vorboten gab. Der Sachbearbeiter hat in jedem Monatsgespräch verkündet, mit der Wiederholungsfrequenz einer Gebetsmühle: „Der Kontokorrent macht mir Sorgen, der Kontokorrent macht mir Sorgen, der Kontokorrent macht mir Sorgen.“
Siegfried hat es nicht ernst genug genommen.
Nun steht die Mitteilung im Raum.
Unnachgiebig.
Gnadenlos.
Unwiderruflich.
Keine Diskussion zulassend.
Die Reduzierung erfolgt von 75 000 Euro auf 25 000 Euro. Circa 38 000 Euro sind binnen vierzehn Tagen zurückzuzahlen.
Das wars.
Ende.
Aus.
Diese flüssigen Mittel hat der GF nicht. Einbringliche aktuelle Forderungen in dieser Höhe schon gar nicht.
Ein lukrativer Auftrag ist erst in vier Monaten in Sicht.
Aber sicher ist auch das nicht.
Er verabschiedet sich in aller Form höflich und verlässt die Bank.
Das Einfamilienhaus der Ehefrau, das nur ihr gehört, könnte er als zusätzliche Sicherheit anbieten, aber das möchte er nicht. Außerdem hätte sie nicht zugestimmt. Schon gar nicht, nachdem die ersten seiner „Eskapaden“ aufgeflogen sind. Denn er ist nicht gerade der treueste Ehemann.
Er sagt der Achtundzwanzigjährigen ab, die voller Enttäuschung tobt. Er macht einen Waldspaziergang, um den Kopf freizubekommen. Er merkt, dass ein Insolvenzantrag naht und dieser möglicherweise nicht zu umgehen ist.
Kapitel 5
Der Gaswasser-Installateur
Die Frau des Richters, Petra, hat im Badezimmer des Hauses ein kleines Problem. Der Warmwasserzulauf in der Badewanne ist undicht und leckt.
Der Klempner, der jahrelang kam, hat seinen Betrieb aus Altersgründen aufgegeben.
Sie sucht in den Gelben Seiten einen anderen. Der erscheint auch. Er stellt sich höflich vor.
Der Gaswasser-Installateur arbeitet 60 Stunden die Woche und am Ende des Monats meistens für „Nüsse“. Dennoch liebt er seinen Beruf. Er kann sich keinen anderen Job vorstellen. Er liebt es, wenn er den Kunden technische Zusammenhänge und die Funktionsweise der Heizkessel erklären kann und dafür anerkennende Blicke erhält.
Er ist in Begleitung eines neunzehnjährigen Azubis türkischer Herkunft namens Hassan.
Hassan ist seit zwei Jahren in Ausbildung beim Gaswasser-Installateur und hat in einigen Wochen seine Prüfung. Diese wird er mit Bravour bestehen.
Ein bekannter Berufskollege hat die Verbindung des Gaswasser-Installateurs (GWI) zu Hassan hergestellt. Mit den Worten „Der sucht Ausbildung“, „Ein wirklich ordentlicher Junge“.
Der Kollege hatte nicht zu viel versprochen. Hassan wurde dem GWI von Tag zu Tag sympathischer. Er liebte ihn schon fast wie seinen eigenen Sohn.
Dieser eigene Sohn ist vierundzwanzig und arbeitet auch im Betrieb und hat den Beruf beim GWI gelernt. Ein paar Mal ist er mit Hassan aneinandergeraten wegen fachlicher Fragen. Jetzt geht es so einigermaßen. Er empfindet immer noch eine Resteifersucht, wenn er sieht, wie der GWI Hassan mitunter bevorzugt und besonders betreut.
Eines Tages kommt ein Anruf vom Kunden. Ein Reparaturauftrag, den Hassan (schon inzwischen Geselle) ausgeführt hat, ist nicht mangelfrei. Eine Duscharmatur, die er bei einem Kunden gewechselt hat, tropft immer noch.
Der Sohn des GWI fährt hin und erledigt die Reklamation.
Dabei stellt sich heraus, dass nicht eine neue Armatur eingebaut worden ist, wie berechnet mit 180 Euro netto (inklusive Firmenaufschlag), sondern eine billige gebrauchte „Flohmarkt-Armatur“, die dort höchstens 10 Euro kostet.
Da kaum davon auszugehen ist, dass Petra oder ihr Mann, der Richter, diese Armatur ausgebaut haben und die gebrauchte Armatur eingebaut haben, sagt der Sohn des GWI erst mal nichts und wechselt wieder anstandslos die Armatur.
Er steht in immer wieder aufkommender Rivalität zu Hassan, will ihn aber auch nicht „in die Pfanne hauen“ und sagt dem GWI erst mal nichts. Er nimmt sich aber vor, Hassan bei Gelegenheit zur Rede zu stellen.
Zwei Wochen passiert nichts.
Dann folgt Anruf auf Anruf von Kunden, insgesamt an die zweiundsiebzig Reklamationen.
Immer dasselbe Schadensbild, das der Sohn des GWI, der die Reparaturen und Reklamationen abarbeiten muss, jedes Mal zur Kenntnis nehmen muss.
Gebrauchte Steuergeräte für Heizkessel, gebrauchte Armaturen statt neue, gebrauchte Ausdehnungsgefäße statt neue; alles billiges Flohmarktzeug bzw. bei Ebay gebraucht gekauftes Material. Dieses wurde anstelle der um ein Mehrfaches teureren neuen Ersatzteile eingebaut. Alles waren von Hassan ausgeführte Aufträge, Gesamtschaden überschlägig an die 40 000 Euro.
Hassan hat sich sogar dazu verstiegen, gebrauchte Heizkessel anstatt neuer Kessel einzubauen, wenn Heizkessel zu ersetzen sind in der aberwitzigen Vorstellung, dass der Bezirksschornsteinfeger dies nicht bemerken wird.
Anwalts- und Gerichtskosten für die Gewährleistungsschreiben durch Rechtsanwälte sind nicht mitgerechnet. Dass Hassan unbemerkt in einer gemieteten Garage ein Gebraucht-Ersatzteillager angehäuft hat, aus Ebay-Kleinanzeigen, Flohmärkten etc., wie sich im Strafverfahren unmittelbar daraufhin ergibt, kommt nebenbei auch noch heraus.
Hassan hat die gebrauchten Teile eingebaut, die mitgebrachten und von seiner Firma berechneten Neuteile unterschlagen, wiederum als Neuteile mit geringem Nachlass verkauft und so einen „Gewinn“ in zweiundsiebzig Fällen von zusammen etwa 35 000 Euro gemacht.
Er erhält unmittelbar die Kündigung von seinem Arbeitgeber, die er vor dem Arbeitsgericht nicht angreift.
Das Strafverfahren läuft noch und wird parallel durchgeführt.
Der GWI übergibt seinem Sohn vorübergehend die Leitung der Firma. Er braucht acht Wochen, um die Sinnkrise zu überstehen.
Kapitel 6
Der Fitnesstrainer
Lena, die achtundzwanzigjährige Affäre des GF, will sich nun ganz auf ihre eigentliche Beziehung konzentrieren. Was soll das alles auch bringen, ihr „Gönner“ ist ja jetzt pleite?
Versiegt aber die Geldquelle, ist für sie auch die außereheliche Beziehung obsolet geworden.
Kein Shoppen mehr, keine außerplanmäßigen Geldzuwendungen, um Gefälligkeit im sexuellen Bereich zu fördern, damit ist der GF für sie uninteressant geworden. Er kann nicht mehr aushelfen bei „kleineren oder größeren Geldproblemen“, Bankschulden etc. Damit besteht für sie kein Interesse mehr an dieser außerehelichen Beziehung.
Ihr eigentlicher Partner, Joey, ist gleichaltrig und von Beruf Abschleppwagenfahrer im befristeten Teilzeitverhältnis. Nebenher ist er Trainer in einer Fitnessstudiokette auf 450-Euro-Basis.
Ihr Göttergatte hat nur einen Fehler, er ist rasend eifersüchtig.
Eines Tages kontrolliert er ihr Handy. Die Katastrophe ist unausweichlich. Auf WhatsApp findet er den ungelöschten Chat mit dem GF inklusive der abgesandten Nachrichten mit Fotos etc.
Die Szenen, die er ihr nun täglich macht, sind beispiellos. Er kontrolliert sie pausenlos. Schließlich hält sie es nicht mehr aus und trennt sich.
Was nun beginnt, ist ein grenzenloses Stalking.
Sie kommt buchstäblich nicht mehr zur Ruhe. Nach dreimaligem Wechsel ihrer Mobiltelefonnummer ändert sich nichts.
Auf dem Weg zu ihrem Auto passt er sie ab und schwört ihr seine bedingungslose Liebe. An ihrem Arbeitsplatz taucht er auf.
Schließlich klettert er nachts auf ihren Balkon (zweite Etage). Er erreicht den Balkon über das Regenfallrohr, an dem er sich hochhangelt. Unmittelbar am Balkon liegt ihr Schlafzimmer. Er möchte sie so gerne einmal sehen, sei es schlafend und das Bett sehen, das er bis vor Kurzem mitbelegen durfte.
Er wird beim Heraufklettern von Nachbarn beobachtet, die ihn für einen Einbrecher halten.
Polizei und Feuerwehr holen ihn vom Balkon wieder herunter.
Er wird, nachdem er gegen die Unterlassungsverfügung und das Kontaktverbot, das im Eilverfahren ergangen war, ohnehin fortlaufend verstoßen hat, nunmehr zu sechs Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt. Außerdem hat er acht Monate Zeit, um achtzig Arbeitsstunden als Küchenhilfe im Knappschaftskrankenhaus abzuarbeiten.
Nicht eine Arbeitsstunde leistet er ab, sodass die Bewährung widerrufen wird.
Was nun?
Nach Hause kann er nicht.
Die Frist zum Strafantritt ist terminlich schon deutlich überschritten.
Mehrfach hat er versucht, seine Wohnung aufzusuchen und ist in sicherer Entfernung vom Haus wieder umgekehrt, als er Streifenwagen gesehen hat.
Zu seiner Ex-Frau kann er natürlich auch nicht.
Schon gar nicht kann er zu seinen Kumpels aus dem Fitnessstudio.
Auf diese ist kein Verlass. Das weiß er nur zu gut. Es „verbindet“, wenn man diesen Begriff überhaupt wählen kann, mit ihnen allenfalls das Training.
Schließlich erinnert er sich an einen guten Schulfreund. Zwei Jahre haben sie gemeinsam die Schulbank gedrückt. Beide elf- und zwölfjährig, von 2005 bis 2007.
Dann haben sie sich durch Schulwechsel, Umzug etc. aus den Augen verloren. Trotzdem wach ist es aber immer noch, das Gefühl, dass es einmal jemanden gab, mit dem er „durch dick und dünn“ gehen und gemeinsam auf Bäume klettern konnte.
Dieses Gefühl lässt sich immer noch spüren. Noch heute fühlt der Kumpel von damals die raue Rinde der Äste, die er ergriffen hat, um langsam jeden Baum zu erklimmen.
Über andere ehemalige Schulkollegen bekommt er die Anschrift heraus.
Er packt das Nötigste und macht sich auf den Weg.
Kevin, der Richtersohn, staunt nicht schlecht, wer da an einem Samstagabend um 22:40 Uhr im Türrahmen steht. Seine Wiedersehensfreude ist zwar durchaus verhalten, aber die Faszination, dass der alte Kumpel sich noch mal meldet, überwiegt dann doch.
Die beiden plauschen fast zwei Stunden über alte Zeiten. Diese zwei Stunden werden zu gefühlten zehn Minuten. Es ist knapp 0:30 Uhr, da schellt es Sturm. Aufgrund eines Hinweises stehen zwei Polizeibeamte vor der Tür. Uniformiert.
Sie stehen unnachgiebig im Türrahmen, begehren Einlass und bringen zum Ausdruck, dass es „kein Entrinnen“ aus der Situation gibt.
Damit ist die Flucht des Fitnesstrainers zu Ende. Joey hat einfach keine Chance.
Die Beamten stehen im Raum. Das Klicken der 8 steht unmittelbar bevor.
Da fällt der Blick des ersten Beamten auf einen vom Fitnesstrainer mitgebrachten Rucksack, aus dem etwas herausschimmert, das wie eine Kunststoffpalette weißer Dragees aussieht.
Der Aufforderung, diesen Rucksack zu öffnen, kommt der Fitnesstrainer zögerlich nach.
Zum Vorschein kommen an die 700 Tabletten Anabolpräparate. Die wollte der Fitnesstrainer doch noch im Fitnessstudio verkaufen. Das lohnte sich im Allgemeinen durchaus.
Nun geht alles ganz schnell. Verstärkung wird angefordert und die ganze Wohnung durchsucht.
Acht Beamte drehen in der Wohnung des Richtersohns „das Unterste nach oben“. Auch die zaghafte Frage nach einem Durchsuchungsbeschluss wird nur einsilbig beantwortet. „Brauchen wir nicht. Gefahr in Verzug.“ Dies sind die Worte des Einsatzleiters PHK Naworski.
Es wird nichts gefunden, außer dass in dem zweiten vom Fitnesstrainer mitgebrachten Rucksack noch einmal 2 000 Pillen Viagra und Cialis aufgefunden werden. Auch diese lohnen sich zum Weiterverkauf.
Das war doch so praktisch, denn der Lieferant im Internet war doch derselbe, so die Motivation des Fitnesstrainers zur zusätzlichen Bestellung.
Alle Beteuerungen des Richtershns, mit all dem überhaupt nichts zu tun zu haben, fruchten – erwartungsgemäß – nicht. Zumal im Hinblick auf den zweiten Rucksack sich sowohl der Richtersohn als auch der Fitnesstrainer inzwischen gegenseitig beschuldigen.
Der Richtersohn muss einsehen, dass seine Beteuerungen, den Kumpel seit 2005, als man gemeinsam auf Bäume geklettert ist, nicht mehr gesehen zu haben, unter den gegebenen Umständen wenig glaubwürdig sind.
Am frühen Morgen lässt man ihn aus dem Polizeigewahrsam heraus anrufen.
Am Sonntag am 05:20 Uhr morgens klingelt beim Richter das Telefon.
Kapitel 7
Wie geht es Hassan jetzt?
Hassan ist nun erst einmal arbeitslos. Das Arbeitsamt hat ihm eine Zwölf-wöchige Sperrzeit aufgedrückt. Rechtliche Schritte sind dagegen aussichtslos, da er die Beendigung des Arbeitsverhältnisses schuldhaft herbeigeführt hat. Sein Anwalt hat ihm unmissverständlich erklärt, dass es in einem solchen Fall nur reduzierte Sozialgesetzbuch-II-Leistungen gibt.
So entsteht nun eine echte Durststrecke.
Und nun auch noch der Schadenersatzprozess.
Sein Anwalt hat ihm erklärt, dass auch ein Privatinsolvenzverfahren nichts nützen dürfte, weil sogenannte unerlaubte Handlungen vorliegen und die Gläubiger beantragen können, die Restschuldbefreiung nach der Wohlverhaltensperiode zu versagen.
Aber zuerst kommt der Strafprozess.
Weder der vorsitzende Richter noch sein Anwalt kriegen trotz intensivster Befragung heraus, wo eigentlich das ganze Geld geblieben ist. Denn würde Hassan zur Schadenswiedergutmachung etwas zurückzahlen, könnte er im Strafprozess punkten. Das Geld ist schlicht weg.
Es liegt kein sichtbarer Gegenwert vor. Die Strafe fällt demgemäß drakonisch aus.
Eineinhalb Jahre ohne Bewährung.
Aussicht auf offenen Vollzug nach circa einem Jahr. Das alles für circa 40 000 Euro Schaden, von denen Hassan nicht einmal selbst irgendetwas gesehen hat.
Die Erklärung ist gar nicht so schwer.
Hassan ist mit seinen türkischen Eltern und seiner um ein Jahr älteren Schwester Büsra (inzwischen zweiundzwanzig Jahre alt) 2003 aus der Türkei nach Deutschland gekommen. Hier ist noch der kleine Bruder Taifun (heute acht Jahre alt) geboren.
Der Vater wurde damals denunziert wegen angeblicher Verbindungen zur PKK.
In einer Nacht-und-Nebel-Aktion flüchtete die Familie nach Deutschland. Asylanerkennung hat der Vater nie erhalten, weil er die entsprechenden Beweise nicht vollständig liefern konnte. Immerhin reichte es für den subsidiären Schutz.
Inzwischen ist es etwas besser, weil auch Taifun hier geboren ist.
Den schwersten Stand in der Familie hat allerdings Büsra.
Sie darf trotz Volljährigkeit nach deutschem Recht buchstäblich nichts.
Zwar muss sie kein Kopftuch tragen, wie andere junge Frauen, die aus dem kleinen anatolischen 600-Seelen-Dorf kommen.
Aber Schminken ist bereits tabu.
Der Patriarch ist unnachgiebig.
Kurze Röcke und freizügige Kleidung jedweder Art sind völlig unvorstellbar.
Sex vor der Ehe gleicht einer Naturkatastrophe. Wochentags muss sie um 21 Uhr zu Hause sein, samstags um 22:30 Uhr, was als besondere Vergünstigung gilt.
Sie möchte ausziehen, fühlt sich aber für den Familienfrieden verantwortlich.
Ohne Heirat ist dies kaum möglich. Das entsprechende Erdbeben in der Familie möchte sie sich lieber gar nicht vorstellen.
Eines Tages lernt sie den dreiundzwanzigjährigen Landsmann Abdul kennen. Der ist in Deutschland aufgewachsen und trotzdem von der Vorstellung geprägt, dass in einer Beziehung der Mann das Sagen hat.
Abdul ist entweder arbeitslos oder arbeitet auf 450-Euro-Basis. Er jobbt hier und dort einmal und macht mal dies, mal das. Den Anstandsbesuch bei den Eltern hat er einigermaßen gestemmt.
Abdul möchte unbedingt einen BMW X5 fahren, weiß aber angesichts seiner desolaten beruflichen Situation nicht, wie er das anstellen soll. Die Kiste kostet an die 80 000 Euro und gebraucht immer noch 40 000 Euro.
So kommt es, wie es kommen muss. Er fragt Büsra, die als Zahnarzthelferin 1 400 Euro netto im ersten Berufsjahr verdient, ob sie nicht bei der Santander Bank für ihn bürgt.
So kommt es auch.
Wenige Tage darauf steht der gebrauchte X5 vor der Tür.
Die Monate vergehen.
Nach den ersten traumhaften drei Monaten ziehen erste dunkle Wolken am Beziehungshorizont auf.
Abdul nimmt es mit der Treue nicht so genau. Keine Frau ist vor ihm „sicher“. Es kommt immer wieder zum Streit.
Büsra erwischt Abdul auch mehrmals in flagranti. Dieses Flagranti ist irgendwie überall.
Es wird schlimmer und schlimmer.
Schließlich beendet Abdul die Beziehung, weil er sich eingeengt fühlt, wie er es nennt.
Nun ist die Katastrophe vorprogrammiert.
Natürlich zahlt Abdul auch die Raten für den X5 von seinem Konto nicht mehr, und der Bankeinzug ist nicht möglich.
Der X5 wird sichergestellt und für einen Schleuderpreis von 20 000 Euro durch die Bank verkauft. Anwaltskosten alleine für die Beendigung der Geschäftsbeziehung, Kündigung des Kreditvertrages etc.: mehrere 1 000 Euro.
Die Standkosten beim BMW-Vertragshändler bis zum Verkauf von mehreren 100 Euro sind gleichfalls zu tragen und unterfallen der Bürgschaft. Die AGB des Finanzkaufs sind entsprechend ausgestaltet. Büsra hat jetzt zwei Probleme zu Hause.
Erstens: Sie ist von ihrem Partner sitzen gelassen worden, ohne geheiratet worden zu sein.
Zweitens: Sie hat circa 35 000 bis 40 000 Euro Schulden aus der Bürgschaft.
Sie ist auch mit diesen Schulden sitzen gelassen worden.
Das Fiasko zu Hause ist mit Worten kaum zu beschreiben.
Der Patriarch fährt alle nur denkbaren Machtinstrumentarien aus. Für Büsra wird das Leben zur Hölle.
Wenn sie wenigstens diese verdammten Schulden loswerden könnte. Aber da kommt unerwarteter Geldsegen. Ihr Bruder Hassan befreit sie von den Schulden.
Sie fragt nicht weiter nach.
Eine erhebliche Geldmenge hat er offensichtlich gespart, oder jedenfalls will er nicht sagen, wo er das ganze Geld herhat.
Sie ist über Nacht schuldenfrei.
Die Bürgschaft wird aufgehoben. Büsra ist als Kreditschuldnerin ein plötzlich völlig unbeschriebenes Blatt. So hat sich wenigstens dies zum Guten gewendet. Zwar – dies weiß Büsra nur zu gut – kann Hassan dieses Geld kaum erwirtschaftet haben. Seine Versionen, wo er das Geld herhat, sind vielfältig. Mal will er in der Spielbank gewonnen haben, mal will ihm ein gutes Geschäft gelungen sein, mal will er das Geld sich selber geborgt haben. Da die Versionen immer wieder untereinander variieren, gibt Büsra es irgendwann auf, nach der wahren Herkunft des Geldes zu fragen.
Kapitel 8
Der Anwalt
Der Richter besucht dienstags einen sogenannten Juristenstammtisch. Das lässt er sich nicht nehmen. Ein wenig Austausch muss sein. An diesem einen Tag in der Woche erlaubt er sich auch ein paar Gläschen, vielleicht auch ein paar mehr.
Neulich waren es ein paar zu viel, und er stand an der Straßenbahnhaltestelle, um nach Hause zu fahren. Er konnte sich kaum auf den Beinen halten. Er wurde zufällig von zwei Anwälten gesehen, die ihn gut kennen aus zahlreichen Verhandlungen – nur er hat sie nicht gesehen.
Erstere kamen von einer privaten Party zurück. Sie dachten nur: „Guck mal, der Vorsitzende der vierten Strafkammer. Auch nur ein Mensch …“
In dieser Stammtischrunde nehmen auch Anwälte teil. Unter anderem ein Anwalt, dem er seit geraumer Zeit die Pflichtverteidigungen seines Dezernates großteils zuweist.
Dies klappte immer ganz gut zur allseitigen Zufriedenheit. Das „Arrangement“ besteht darin, dass der Pflichtverteidiger möglichst wenig lästig fällt, mit unangenehmen verfahrensverzögernden Anträgen sparsam ist und nicht „auffällt“. Dies schon aufgrund der geringeren gesetzlichen Vergütungen.
Nur einmal gab es einen bemerkenswerten Vorfall. Ein Angeklagter stand nach den Schlussvorträgen auf und äußerte laut: „Verehrtes Gericht, ich möchte bemerken, ich fühle mich hier nicht durch den Staatsanwalt angeklagt, sondern durch meinen Anwalt …“
Was solls. Schwamm drüber. Der Anwalt kann es nicht jedem recht machen.
Bis Anfang der 2000er-Jahre war der Anwalt als Vorstandsassistent bei der Deutschen Bank beschäftigt.
Schon damals und in den Folgejahren häuften sich die Skandale um dieses Institut. Beihilfe zur Steuerhinterziehung u. a. m. Es gab damals schon Millionenschadenersatzprozesse.
Im Zuge der ersten Personalabbaumaßnahmen traf es auch ihn, den Vorstandsassistenten und auch andere.
Unverdrossen machte er sich selbstständig. Es geht seitdem kontinuierlich bergauf.
Die Kanzlei boomt seit circa vier Jahren. Er schafft es in den Mandantengesprächen relativ schnell, Vertrauen aufzubauen. Die Mandanten verlassen sein Büro regelmäßig in durchaus besserer Verfassung, als sie gekommen sind. Er schafft es sogar, verlorene Prozesse als gewonnene zu verkaufen.
Inzwischen leitet er auch Seminare für Fachanwaltsfortbildungen. Die Erfolge fliegen ihm zu. Seine langjährige Angestellte ist zuverlässig wie eine Maschine. Sie feiert nie krank, arbeitet selbstständig und im Übrigen für zwei und macht ihn sogar wohlwollend auf Fehler aufmerksam, die er dann rechtzeitig dankbar korrigiert.
Auch privat verläuft es super. Er ist Vater eines sieben- und eines neunjährigen Kindes, während seine Frau den Haushalt schmeißt. Vor Kurzem hat er eine Eigentumswohnung mit Gartennutzungsanteil gekauft.
Seinen Jugendtraum hat er sich auch erfüllt: einen Triumph TR6, Baujahr 1974 mit 2,5-Liter-Maschine, ockergelb, Vollcabriolet.
Er erntet sogar anerkennende Blicke seiner Berufskollegen, wenn er damit bei Gericht vorfährt.
Dann wird es schlechter. In der zweiten Tageshälfte kann er sich kaum noch aus seinem ergonomischen Schreibtischstuhl erheben. Er schleppt sich zur Gästetoilette seines Büros und glaubt, den Weg (gerade mal acht Meter) nicht zu schaffen. Er fragt sich, wo all dies herkommt. Er ist gerade einmal Mitte Fünfzig und arbeitet doch gar nicht körperlich. Er fühlt sich außerdem in gesteigerter Weise allein, was nichts mit Einsamkeit zu tun hat. Er war schon als Jugendlicher gern allein. Es ist irgendwie etwas anderes. Es ist eine Steigerung. Er fühlt sich „weggesperrt“, wie Isolationshaft, aber er ignoriert die Symptome und schiebt sie aufs Alter.
Diese Selbstberuhigung funktioniert vortrefflich.
Eines Tages rumpelt es in seinem Büro im Aktenraum. Seine Angestellte sieht erschrocken nach. Der Anwalt sitzt auf dem Fußboden. Ein Leitertritt ist gerade offensichtlich umgefallen oder er mit diesem Leitertritt gestürzt. Einige Akten liegen verstreut auf dem Boden.
Er sitzt dort und starrt vor sich hin ohne die Bereitschaft oder die Fähigkeit, aufzustehen. Der herbeigerufene Notarzt kann ad hoc keinen Befund feststellen. Er leistet Erste-Hilfe-Maßnahmen.
Aufgrund des zusammenhanglosen Gebrabbels und der verwaschenen Sprache wird ein Gefäßverschluss vermutet. Er erhält gefäßerweiternde und blutverdünnende Medikamente und wird fünf Tage im Krankenhaus untersucht ohne auch nur den geringsten Befund.
Nach wie vor geht er mit schleppendem Gang wie ein alter Mann und kann keinem Gespräch folgen. Die Immobilität ist frappierend. Das unkoordinierte Gewäsch, das er von sich gibt, schockt seine Frau, die nur zu kurzen Besuchen erscheint, um Wäsche zu bringen etc.
So geht das über eine Woche stationär und noch weitere drei Tage.
Als die Ärzte keinen Befund stellen können, holt der soziale Dienst des Krankenhauses die Kostenzusage seiner privaten Krankenversicherung ein, und er wird überwiesen und in eine psychosomatische Klinik verfrachtet.
Dort angekommen, verträgt er die Medikamente nicht. Seine neue Freundin „Zyprexa“ hat einfach zu viele Nebenwirkungen.
Er wird umgestellt auf Atosil. Damit geht es etwas besser. Drei Monate Aufenthalt sind zunächst vorgesehen.
In der Holzwerkstatt kommt er nicht klar. Er kann nicht mit Holz. Er kommt in die Modellbauabteilung. Das geht besser.
In den Therapiesitzungen meldet er sich immer öfter zu Wort. Er streitet sich sogar mit den jeweiligen Therapeuten, was seine Beliebtheit beim Personal nicht gerade steigert. Er diskutiert über die therapeutischen Vorgaben und stellt den gebetsmühlenhaft immer wiederholten Satz der Therapeuten, „Sie leben im Hier und Jetzt“, infrage.
Kapiert so ein Therapeut eigentlich überhaupt nicht, dass Gegenwart und Zukunft und Vergangenheit ein Puzzle aus verschiedenen Bauteilen sind und dass all dies nichts damit zu tun hat, dass man Sinnfragen stellt bezüglich vergangener Ereignisse?
Wie dämlich sind diese Therapeuten wirklich? Er wird wütend.
Nach zehn Wochen wird er entlassen.
Er muss versprechen, die Medikamente nur in Absprache mit dem weiterbehandelnden Arzt zu reduzieren bzw. nicht abrupt abzusetzen, sondern „auszuschleichen“.
Nach und nach nimmt er sich vor, sein Büro wieder aufzusuchen. Momentan ist er noch zu Hause.
Die Anwaltskammer hat für die Monate einen Vertreter eingesetzt. Der hat natürlich so gut wie nichts getan oder nur das Nötigste, und das viele Geld, das er für den bezahlen muss – denn die Kosten werden von der Anwaltskammer natürlich nicht gestellt –, wird wohl kaum durch einen Gegenwert ausgeglichen werden.
Die Überlegung, den alten Beruf gegebenenfalls überhaupt nicht mehr auszuüben, hat er sehr schnell wieder verworfen.
Das geht eben nicht. Er hat viel zu viel zu bezahlen.
Er geht zu Fuß und mit öffentlichen Verkehrsmitteln eines Tages los, um sein Büro aufzusuchen. Auto fahren kann er noch nicht.
Der TR6 steht in der Garage. Er hat ihn poliert und ein neues Softtop bestellt.
Auf halbem Wege kehrt er um.
Zwei Tage später der nächste Versuch.
Er kommt fast bis zur Haustür des Büros.
Aber noch 40 Meter fehlen.
Er kehrt doch wieder um.
Dies ist aber schon eine Fortentwicklung. Er konnte zunächst das Haus gar nicht verlassen. Nachdem er die Medikamente natürlich absprachewidrig gegen den Rat seiner Ärzte abrupt abgesetzt hat, kommen wieder diese ekelhaften Angstzustände. Er musste schrittweise üben, das Haus wieder zu verlassen.
Erst 100 Meter von zu Hause entfernen.
Dann 200, 500 Meter und einen Kilometer. Diese schrittweise Steigerung klappte ganz gut.
Die private Krankentagegeldversicherung (Verdienstausfallversicherung) stellt bereits nach drei Monaten die Zahlungen ein. Sie behauptet, nicht mehr zuständig zu sein, da er berufsunfähig ist. Er solle einen Berufsunfähigkeitsantrag stellen. In diesem Zusammenhang kommen ständig Anrufe von einem Versicherungsvertreter der privaten Krankentagegeldversicherung. Der drängelt, wann er denn endlich wieder gesund wäre. Es würde schon viel zu lange gehen, dass sein Verdienst aufgefangen werden müsste. Insbesondere soll er zu einem Vertrauensarzt der Versicherung, um dort unter Beweis zu stellen, dass er nicht berufsunfähig ist, sondern weiterhin eine Gesundungsprognose besteht.
Der Anwalt erinnert sich, dass er selbst Mandanten auf Frage immer wieder davon abgeraten hat, derartige Versicherungen abzuschließen, weil daran mittel- und langfristig ausschließlich der Versicherer verdient.
Schließlich klappt es, das Büro aufzusuchen. Er lässt sich eine Übergabe durch den durch die Anwaltskammer bestellten Vertreter gewähren. Informationen über die Sachstände der einzelnen Akten erhält er und nimmt sich vor, nun wieder regelmäßig zu erscheinen. Erst zwei, dann vier Stunden täglich, dann ganztags.
Seine Pillen hat er gegen jeden ärztlichen Rat schon vor Wochen auf den Müll geworfen.
Aus einem Ratgeber hat er einfache Meditationstechniken gelernt. Sein Beruf hat ihm den Zugang zu so etwas immer unmöglich gemacht. Nach anfänglichen Schwierigkeiten klappt es ganz gut, und er nimmt sich in diesem Zusammenhang zweimal täglich eine Auszeit von 45 Minuten und schafft es, den Kopf frei zu machen und die Techniken umzusetzen.
Früher hätte er bei so etwas Schuldgefühle empfunden, „den Mandanten eineinhalb Stunden tägliche Arbeitszeit zu stehlen und gar nicht zur Verfügung zu stehen“. Heute lässt ihn der von seiner Angestellten vollgeschriebene Telefonzettel über unerledigte Anrufe kalt. Fast empfindet er so etwas wie Schadenfreude, weil er während der selbst verordneten Auszeiten nicht erreichbar war.
Zu eindringlich sind die Erfahrungen der letzten Monate. Er möchte so etwas nicht noch einmal erleben.
Kapitel 9
Die Beziehung des Richtersohns
Kevin (Kapitel 1), der Sohn des Richters, lebt seit drei Jahren mit seiner Partnerin zusammen. Er selbst studiert im sechsten Semester Theater- und Schauspielwissenschaften. Seine Frau Andrea ist ein Jahr älter, nämlich siebenundzwanzig Jahre alt und Grundschullehrerin.
Die beiden verstehen sich gut, wenn auch der Alltag inzwischen dabei ist, sie beide zu „fressen“.
Eines Abends sitzen sie vor dem TV und betrachten eine Gameshow auf RTL. Es geht darum, dass vier Ehemänner eine Kletterwand hinaufklettern müssen, auf dem Weg zur entsprechenden Höhe von mehreren Metern noch andere Aufgaben erledigen müssen, oben angekommen ebenfalls eine Aufgabe erledigen müssen und dann wieder herunterklettern müssen. Dies selbstverständlich jeder so schnell er kann, wobei die Ehefrauen unten stehen, coachen und jede eine Wette abgegeben hat, wer denn wohl der Erste wird bzw. in welcher Zeit der jeweilige Ehemann die Aufgaben erledigt.
Auf dem Fernsehsofa knirscht es aufgrund des Konsums von Salzstangen und Salzbrezeln, während die Frau des Richtersohns beiläufig fast tonlos in einer Werbepause erklärt (Ton während der Werbepause auf null gedreht): „Ich will ein Kind.“
Das hat Wirkung.
Totenstille im Raum. Der Sohn des Richters sieht seine Frau an, als käme sie direkt vom Mars, Jupiter, Kepler oder irgendeinem anderen Planeten.
Umständlich fängt er an, herum zu stammeln.
„Wie bezahlen, mein Studium, fühle mich noch nicht reif“ usw. usw. etc. pp.
Es entwickelt sich eine Diskussion. Die Frau erklärt, sie arbeite ja schließlich zwar im Anstellungsverhältnis als Grundschullehrerin, verbeamtet ist sie noch nicht, verdient daher weniger, aber sie würde am Anfang beide bzw. drei Personen schon durchbringen. Er könnte in Ruhe sein Studium zu Ende bringen.
Kevin tut das nur bedingt gut.
Zwar fühlt er sich ein wenig geschmeichelt, dass seine Partnerin so viel von ihm hält, dass sie ihn sogar zum Vater ihrer Kinder auserwählt hat, aber all das ändert nichts daran, dass er völlig überfordert ist.
Er bremst, allerdings ohne richtig „Nein“ zu sagen. Er will sie ja auch nicht verprellen. Schließlich vertagen beide die Überlegung auf das Wochenende.
Die nächsten Sonntage verlaufen alle nach dem gleichen Schema. Pünktlich nach dem ersten Frühstückskaffee spricht seine Partnerin das Thema an, während er bremst.
Sie garniert die Argumente mit den verschiedensten Gesichtspunkten (biologische Uhr tickt, ihre Eltern bauen auch Druck auf etc. pp).
Seine Bedenken, ob das Ganze nicht doch zu verplant erscheint, weist sie im Ansatz zurück.
So geht das an die fünf Monate („Zyklen“) ohne irgendein Ergebnis. Auch entsprechende „Bemühungen“ finden schon eifrig statt, während auch keine Verhütungsmittel mehr eingesetzt werden. Dies alles allerdings nach fünf Zyklen ohne Ergebnis. Andrea läuft zum Gynäkologen und lässt sich untersuchen. Ergebnis: alles in Ordnung, kein Befund. Weiteres Ergebnis: Es muss an ihrem Mann liegen.
Erneut ein Fernsehabend.
RTL-Programm läuft, regelmäßig unterbrochen durch entsetzlich nervtötende Werbesendungen, in denen auf einhämmernde Weise der Zuschauer manipuliert werden soll, etwas Bestimmtes zu kaufen, zu konsumieren oder zu tun. Dies alles noch unterbrochen durch Vorschauen auf diverse Filme, Serien, Möglichkeiten zu streamen und anderes mehr.
Am Abend bringt die Frau das Gespräch auf das Thema, dass er zum Urologen soll, eine Sperma-Probe abgeben. Als Kevin ablehnt, zieht Andrea alle denkbaren Register.
„Solange es dir wichtiger ist, Peinlichkeiten zu vermeiden als unsere familiäre Zukunft, lässt das ja tief blicken“ usw. usw.
Und schließlich kann er ihren berechtigten Kinderwunsch ja nicht – grundlos, denn sie will ja sogar weiter arbeiten nach dem Erziehungsjahr, und Oma und Opa werden ja sogar helfen – zurückweisen. Also wird es ja wohl daran liegen, dass er „keine Verantwortung übernehmen möchte“ usw. etc. pp.
Diese Art zu „argumentieren“ bleibt über die Monate nicht ohne Wirkung.
Erneut wird „geübt“. Was allerdings über Monate ausbleibt, ist die Schwangerschaft.
Der zweite Strich auf dem Sichtfenster des Schnelltests aus der Apotheke, er will sich einfach nicht zeigen.
Schließlich berechnet die potenzielle Mutter die Empfängnistage und lässt den Wunschvater an drei Tagen der Woche (sogar die Uhrzeit hat sie berechnet) zum terminierten Zeugungsakt antreten. „Terminficken“ sozusagen. Auch das macht Kevin mit. Er wundert sich, dass er das überhaupt hinbekommt (Auch diese Bemühungen sind vergebens).
„OK“, denkt Kevin, „es geht also nicht ohne Urologenbesuch.“
Er erhält einen Termin in der darauffolgenden Woche. Nach 20 Minuten Wartezeit ruft ihn eine der beiden jungen Arzthelferinnen (beide nicht unattraktiv) heraus, geleitet ihn zu einer Kabine, drückt ihm einen Becher und vier pornografische Hefte in die Hand. Er soll Bescheid sagen, wenn er „so weit“ ist.
Kevin verzieht sich in die Kabine.
Nun ist er drin.
Aber nicht nur in der Kabine.
Auch in einem Geschehensautomatismus, von dem er nicht mehr rekonstruieren kann, wie er eigentlich da reingekommen ist.
Denk immer daran – und dies ist ohnehin sein Lebensmotto –, bei allem, was du gerade tust, was du da tust.
Die innere Stimme wiederholt den Satz.
Es gesellen sich weitere Stimmen dazu.
Ein regelrechter Chor wiederholt die eben genannte Ermahnung.
Kevin verlässt die Kabine und wirft den Becher mit einer lässigen Handbewegung ebenso wie die Hefte auf den Empfangstresen. Der Becher klappert den Aufsatz herunter, tickt auf dem Tisch auf, sodass die beiden jungen Arzthelferinnen erschrocken zurückweichen in der Erwartung, nun wohl eine weißliche Flüssigkeit abzubekommen.
Aber der Becher ist furztrocken.
In der Tür blickt Kevin noch einmal zurück. Er stellt fest, dass beide jungen Arzthelferinnen gar nicht so attraktiv sind, wie er es am Anfang bei Betreten der Arztpraxis empfunden hat.
Im Hinausgehen – die Praxis ist in der zweiten Etage – und die Treppe heruntergehend, überlegt er noch, wie wäre das eigentlich nach der ärztlichen Gebührenordnung abgerechnet worden? Was berechnet ein Arzt nach GOÄ (Gebührenordnung der Ärzte), wenn er einen Patienten zum Wichsen in die Kabine schickt? Er lässt die Antwort auf sich beruhen, ärgert sich aber doch ein bisschen, dass er den Arzt nicht gefragt hat.
Am Abend zu Hause lässt Kevin im gemeinsamen Wohnzimmer eben auf dem selbigen Fernsehsofa die Katze aus dem Sack. Der Katalog der Vorwürfe wird durch seine Frau unmittelbar angestimmt und will nicht so schnell abreißen.
Im gleichen Atemzug erklärt seine Frau die Trennung.
Wie ein geprügelter Hund verlässt Kevin die Wohnung.
„Alles, weil ich nur Übungsmunition geladen habe?“, denkt er noch bei sich.
Kapitel 10
Ein weiteres Mittagessen in der Richterfamilie
Die Familie findet sich wieder zusammen (Kapitel 1). Auch der Sohn des Hauses ist anwesend. Es gibt Rinderbraten mit Kartoffeln und Blumenkohl. Die Unterhaltung plätschert so dahin. Die Familie spricht über dies und das. Kevin kommt schließlich wieder auf das Thema vom letzten Mal.
Sohn: „Vater, wie ist das denn jetzt mit den Fehlurteilen?“
Vater: „Was meinst du?“
Sohn: „Kommen die vor oder nicht?“
Vater: „Nicht auszuschließen. Wo Menschen arbeiten, werden Fehler gemacht.“
Sohn: „Aber die häufen sich doch mit der Zeit.“
Vater: „Natürlich nicht. Ich arbeite sorgfältig.“
Sohn: „Ich kann immer noch nicht verstehen, warum du die Angeklagten, von denen wir letztes Mal gesprochen haben, nicht freigesprochen hast. Es geht nicht darum, dass du nicht sorgfältig arbeitest oder ich Entsprechendes vermute.“
Vater: „Worum denn?“
Sohn: „Du hast Schuldgefühle, weil du weißt, dass du Fehlurteile gefällt hast.“
Vater: „Verstehe ich nicht. Was meinst du jetzt wieder? Ich hatte in dem betreffenden Moment, das ist die Verhandlung, von der du die ganze Zeit sprichst, die Überzeugung, dass mein Urteil richtig ist. Inbegriff der Hauptverhandlung nennt man das. Es ist eine Überzeugung zu gewinnen über Verurteilung oder Nicht-Verurteilung des Täters, die nicht hundertprozentig sicher sein kann, aber den denkbaren Zweifeln Schweigen gebietet. So ist die Definition.“
Sohn: „Hört sich toll an. Aber ich werde dir erklären, warum sich die Häufigkeit von Fehlurteilen bei jedem Strafrichter steigert.“
Vater: „Bin gespannt.“
Sohn: „Du wirst aufgrund der Anzahl deiner Berufsjahre Angeklagte immer mehr zu Unrecht beschuldigen und damit verurteilen. Dies tust du, um deine eigenen Schuldgefühle loszuwerden.“
Mutter: „Juuunge …“
Sohn: „Das ist Psychologie in Grundzügen, Vater. Das kannst du sogar im Internet nachlesen.“
Vater: „So hört es sich nicht an.“
Die Mutter wird nachdenklich.
Sohn: „Ist doch ganz logisch. Du hast Schuldgefühle, weil du damit rechnest, dass du eine ganze Reihe Fehlurteile gefällt hast. Du wusstest es nicht besser. Du hast den Zeugen geglaubt und nach den Jahren wirst du immer unsicherer, ob das immer richtig war.“
Vater: „Du kennst dich ja gut aus in der Arbeit eines Richters.“
Der ironische Unterton in der Stimme ist nicht zu überhören.
Sohn: „Durch die Anzahl der Fehlurteile hast du immer mehr eigene Schuldgefühle aufgebaut.“
Vater: „Soso.“
Sohn: „Und weißt du, wie man Schuldgefühle am besten kompensieren kann?!“
Vater: „Du wirst es mir gleich verraten.“
Sohn: „Indem man immer mehr dazu übergeht, andere zu beschuldigen.“
Vater: „Was soll das heißen?“
Sohn: „Ganz einfach: Du wirst immer mehr Angeklagte zu Unrecht beschuldigen und sie daher auch zu Unrecht verurteilen, um deine eigenen Schuldgefühle loszuwerden.“
Wieder einmal ist die Sonntagsstimmung komplett im Eimer.
Das Gesicht des Richters versteinert.
Die Mutter hebt die Tafel auf.
Im Abräumen des Geschirrs denkt die Mutter noch, dass da vielleicht sogar etwas dran sein könnte. Könnte es so dazu kommen, dass die Richter dazu übergehen, Angeklagte lieber zu verurteilen als freizusprechen? Sozusagen „in dubio contra reum“. Sie verwirft den Gedanken kurzfristig wieder. Diese Diskussionen zwischen Vater und Sohn führen zu nichts. Trotzdem werden sie immer wieder und immer wieder geführt.
Kapitel 11
Der KOK
KOK ist die Abkürzung für Kriminaloberkommissar.
Der KOK (Tobias) ist die zuständige Vernehmungsperson für Hassan. Er soll die Einlassung für Hassan umfassend zur Vorbereitung der Anklageschrift protokollieren und auch Hintergründe erfragen.
Denn Hassan macht zurzeit keinen Gebrauch von seinem Beschuldigtenaussageverweigerungsrecht.
Der KOK ist bereits über dreißig Jahre alt.
Er könnte schon in wenigen Jahren Kriminalhauptkommissar (KHK) werden, wenn er nicht so viele schwarze Flecken in seiner Personalakte hätte. Angesicht so mancher eigensinniger Berufsauffassung und auch einiger heftiger Ermittlungspannen ist die Regelbeförderung möglicherweise gefährdet.
Und er hat noch ein Problem: Er sympathisiert mitunter zu viel mit den Beschuldigten. Er will ihnen immer helfen, anstatt sie zu überführen. Manche tun ihm einfach zu leid.
Hinzu kommt schleppende Aktenbearbeitung. All dies macht ihm das Leben in seinem Job nicht gerade leichter.
Zurzeit beißt er sich an Hassan die Zähne aus.
Der will einfach nicht sagen, was er mit dem Erlös aus den Unterschlagungen und Betrugsaktionen gemacht hat, an die 40 000 Euro, sogar noch etwas mehr.
Hassan hat keine Kosten. Er wohnt zu Hause, muss kein Kostgeld abgeben, hat keine teuren Anschaffungen getätigt, ist nicht spiel- oder drogensüchtig. Es ist zum Auswachsen, aber es ist aus Hassan einfach nichts herauszubekommen.
Der KOK will dem sympathischen jungen Türken irgendwie helfen (ein Umstand, auf den ja auch der Gaswasser-Installateur hereingefallen ist).
Aus diesem Grunde bearbeitet Tobias den Fall zunächst einmal schleppend und lädt Hassan inzwischen zum dritten Mal zur verantwortlichen Vernehmung vor. Inzwischen häufen sich aber auch Anfragen und Erinnerungen der Staatsanwaltschaft, wo diverse Akten bleiben, wann sie erledigt sind und warum die Fristen immer überschritten werden. Irgendwann reicht es dem Dienstvorgesetzten des KOK. Er stellt ihn zur Rede.
Dieser lässt eine freiwillige Begehung seiner Wohnung zu.
In der Wohnung wird zwar nichts gefunden, wohl aber im Keller: sechzig unerledigte Akten. Im Kofferraum seines Autos noch einmal dreißig. Die Verfahrensverzögerungen dadurch sind erheblich. Auch im Fall von Hassan ist eine Verfahrensverzögerung von locker drei Monaten entstanden.
Der KOK wird vom Dienst beurlaubt bis zur weiteren Klärung und Entscheidung. Er beantragt seine Versetzung. Darüber ist noch nicht entschieden.
Tobias überlegt, wenn er rausfliegt, wird er sich vor dem Verwaltungsgericht Gelsenkirchen gegen die Kündigung wehren.
Kapitel 12
Ein verlockendes Angebot?
Oberstaatsanwalt S., Kriminaloberrat B. und Kriminaldirektor Z. beginnen sich für Hassan (Kapitel 5, 7) zu interessieren.
Hassan ist nach Verbüßung seiner Haft arbeitslos. Er lebt in den Tag hinein und ist damit beschäftigt, denselben irgendwie totzuschlagen. So bimmelt eines Tages sein Handy mit unterdrückter Nummer.
Ein männlicher Anrufer fragt, ob er sich mit Hassan treffen könnte.
Hassan: „Wieso? Wer bist du?“
Anrufer: „Tut zurzeit nichts zur Sache. Also hast du nun Zeit oder nicht?“
Hassan wird neugierig. Besonders ereignisreich ist sein Leben zurzeit nicht, und finanziell ist sowieso alles völlig verdorben.
Der Verlauf seines letzten Arbeitsverhältnisses vor der Haft ist alles andere als eine Referenz für die Zukunft.
So stimmt er zu. Vielleicht wird es ja ganz spannend. Mal sehen, was der Anrufer will.
Als Treffpunkt wird der Außengastraum des Imbisses Burger King an der Hans-Böckler-Straße in Essen ausgemacht um 11 Uhr am nächsten Tag.
Der Anrufer erklärt, er wird draußen sitzen und ihm Handzeichen geben.
So weit, so gut. Zum vereinbarten Zeitpunkt trifft Hassan auf einen Mittdreißiger in Jeans, T-Shirt und mit Stoppelhaarschnitt.
Er setzt sich dazu. Der andere setzt ihm bereits gekauften Kaffee vor und stellt sich mit „Markus“ vor.
Weiter führt er aus: „Ich will nicht lange drumherum reden, ich kenne dich und deine Situation.“
Hassan glotzt den anderen verständnislos an.
Markus: „Hast du Interesse, für die Polizei zu arbeiten?“
Hassan: „Was soll das? Ich bin nicht mal deutscher Staatsangehöriger.“
Markus: „Das meine ich nicht.“
Hassan: „Was denn?“
Markus: „Es gibt andere Wege, für die Polizei zu arbeiten.“
Hassan: „Ich verstehe kein Wort.“
Markus: „Ich will’s dir erklären.“
Markus erklärt, ein sogenannter VP-Führer zu sein.
Hassan glotzt nur.
Bedeutet: VP sind nach den Richtlinien der Staatsanwaltschaft Vertrauenspersonen, die in potenziell kriminelle Kreise eingeschleust werden und der Polizei Informationen liefern.
„So“, denkt Hassan, „VP-Führer bist du also, Markus willst du heißen. Du heißt bestimmt in Wirklichkeit ganz anders.“
Hassan: „Ich soll ein Schnüffler werden? Ein Spitzel?“
Markus: „Wenn du’s so nennen willst.“
Hassan: „Was habe ich mit solchen Jobs zu tun?“
Markus: „Wir (auch meine Vorgesetzten) kennen deine Situation.“
Hassan: „Na und, ich komme aus der Scheiße schon wieder heraus.“
Markus: „Wie viele Schulden hast du?“
Hassan: „Circa 70 000. Kann auch mehr sein.“
Markus: „Was heißt das? Auch mehr? 80 000, 90 000 oder 100 000?“
Hassan: „Kann schon sein. Durch die ganzen Zeugengelder und Verfahrenskosten ist das Ganze so hochgeschnellt.“
Markus: „Wir wollen Klartext reden. Der KD (Kriminaldirektor) hat deine Strafakte vorliegen. Wenn du für uns arbeitest, sind bis zu 3 000 Euro pro Monat für dich drin. Cash!
Und das Jobcenter oder andere Leistungsträger erfahren nichts.“
Hassan wird nachdenklich.
Die Aussicht, aus den Schulden rauszukommen, die Eintönigkeit seines Lebens in letzter Zeit zu überwinden, ist verlockend.
Hassan: „Wie soll das Ganze aussehen?“