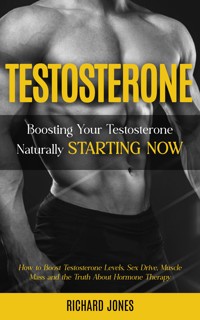11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Seit vielen Jahrhunderten ranken sich Legenden um die sagenhafte Macht der Tempelritter. Da taucht eines Tages im Büro des Privatermittlers Peter Moriati ein Mann auf, der ihn um einen ungewöhnlichen Gefallen bittet. Zu spät bemerkt Moriati, dass er sich auf der Suche nach einem uralten Schriftstück mitten im Strudel von Ereignissen befindet, die nicht nur sein Weltbild für immer verändern werden. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt, denn eine mächtige Organisation innerhalb des Vatikan versucht ebenfalls mit allen Mitteln das geheimnisvolle Schriftstück in ihren Besitz zu bringen und schreckt dabei auch nicht vor Mord zurück.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 547
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Richard Jones
Der Templer Codex
Eines Tages bekommt der Privatermittler Peter Moriati Besuch von einem dubiosen Mann, der sich als Eduardo Monte vorstellt.
Ein zunächst harmlos erscheinender Suchauftrag entpuppt sich als gefährliches Abenteuer.
Zusammen mit seinem Freund, Professor Richard Schneider, bemerken sie recht schnell, dass sie in einen Strudel von Ereignissen geraten, der ihr Weltbild für immer verändern wird.
Ein seit Jahrhunderten verschollener Codex birgt enormes Sprengstoffpotential für die katholische Kirche und gefährdet deren Existenz.
Denn jenes Schriftstück enthält Beweise, die die Kirche unbedingt unter Verschluss halten möchte.
Richard Jones
Der Templer Codex
Gibt es mehr als eine Wahrheit?
Ein Local-Thriller
Impressum
Texte: © 2021 Copyright by Richard Jones
Umschlag:© 2021 Copyright by Richard Jones
Verantwortlich
für den Inhalt:Richard Jones
Druck:epubli – ein Service der Neopubli GmbH, Berlin
Folgende historisch relevante Persönlichkeiten finden sich in diesem Buch wieder:
Bernhard von Clairvaux (*um 1090 auf Burg Fontaine-lès-Dijon bei Dijon; † 20. August 1153 in Clairvaux bei Troyes)
Zisterziensermönch und bedeutendster Kleriker seiner Zeit
Stephan Harding (*um 1059 in Dorset, England; † 28. März 1134 im Kloster Cîteaux)
Abt des Zisterzienserordens in Citeaux und ein katholischer Heiliger
Hugo von Payns (*um 1070 in Payns; †24. Mai 1136)
Gründungsmitglied und erster Großmeister des Templerordens.
Andreas von Montbard (* um 1103; † 17. Januar 1156 in Jerusalem)
Fünfter Großmeister des Templerordens und einer der neun Gründer des Ordens.
Gottfried von Saint Omer (auch Godefridus de Sancto Andemardo, Gaufred, Godefroi)
Flämischer Ritter und Gründungsmitglied des Templerordens
Balduin II. (* vor 1080; † 21. August 1131)
Von 1118 – 1131 König von Jerusalem
Garmond von Picquigny (auch Warmund oder Gormond; † 1128 in Sidon)
Französischer Prälat und Lateinischer Patriarch von Jerusalem von 1118 bis 1128
Matthäus von Albano (gestorben 1134) Franzose, Benedektinermönch und Kardinal sowie päpstlicher Legat.
Vorsitzender des Konzils von Troyes am 13. Januar 1129
Innozenz II. (vorher Gregorio Papareschi di Guidoni; * vor 1088 in Rom; † 24. September 1143 in Rom) war Papst von 1130 bis 1143.
Er bestätigte durch die Bulle »Omne datum optimum« die Gründung des Templerordens.
Robert de Craon († 13. Januar 1147)
Zweiter Großmeister des Templerordens (1136 – 1147). Er folgte Hugo von Payns.
Balian von Ibelin, auch Balian von Nablus (* frühe 1140er-Jahre; † 1193)
Ein führender Baron im Königreich Jerusalem, während der Belagerung von Saladin.
Saladin (* um 1137/1138; † 3. März oder 4. März 1193)
Eroberte im Oktober 1187 Jerusalem von den Kreuzfahrern zurück.
Jacques de Molay (* zwischen 1240 und 1250 in Molay; † 11. oder 18. März 1314 in Paris)
Letzter Großmeister des Templerordens.
Clemens V., ursprünglich Bertrand de Got, (* zwischen 1250 und 1265; † 20. April 1314)
War vom 5. Juni 1305 bis zum 20. April 1314 Papst der katholischen Kirche. 1309 verlegte er die päpstliche Residenz nach Avignon.
Philipp IV., genannt der Schöne (* 1268; † 29. November 1314)
Aus der Dynastie der Kapetinger war von 1285 bis 1314 König von Frankreich und als Philipp I. König von Navarra.
Prolog
Jabal al-Tarif, nordöstlich von Nag-Hammadi
Nach dem Bau des Assuan-Staudammes im Jahre 1902 blieb die natürliche Überschwemmung des Nils, der Lebensader Ägyptens aus.
Für die Fellachen, jene Bauern, die am Nil lebten, war es unumgänglich, ihre Felder weiterhin zu düngen, um der ohnehin lebensfeindlichen Umgebung zu trotzen.
Einer von ihnen war der junge Muhammed Ali. Er gehörte zum in der Gegend einflussreichen Samman-Clan. An diesem milden Dezembermorgen schickte man ihn, zusammen mit seinem Cousin, Abou bin Hamman und einigen anderen jungen Bauern los, um den Dünger, Sabach genannt, zu besorgen. Dies war Aufgabe der Jungbauern.
Muhammed Ali war seit dem gewaltsamen Tod seines Vaters das Haupt des Clans. Die durch die Ermordung resultierende Blutfehde rief immer wieder die örtliche Polizei auf den Plan.
Die Suche nach dem Sabach gestaltete sich schwierig, zumal alle bekannten Orte in der Gegend bereits abgesucht worden waren. Daher begab er sich mit Abou auf den Weg in ein abgelegenes Tal, namens Jabal al-Tarif. Dort, so hatte er gehört, gab es offenbar noch Sabach.
Nach dem Mittag hatten sie bereits einige Vorkommen entdeckt und aufgesammelt, doch das reichte hinten und vorne nicht.
Während er den Kamelen frisches Wasser aus einer nahegelegenen Quelle holte, bemerkte er, wie sich Abou an einem Stein abarbeitete. Argwöhnisch betrachtete er das Tun. Auch die anderen jungen Bauern sahen dem Treiben belustigt zu und hatten ihren Spaß.
»Was schaust du so blöd«, brummte Abou in seine Richtung. »Hilf mir lieber den Stein hier beiseitezuschieben. Ich glaube, darunter finden wir noch was.«
Muhammed trank einen Schluck aus dem ledernen Trinkbeutel und begab sich zu Abou.
»Bist du sicher hier Sabach zu finden? Ansonsten lohnt sich die Plackerei nicht. Ich schwitz schon beim Zusehen.«
»Du schwitzt bereits, wenn du das Wort Arbeit hörst«, frotzelte Abou. »Und jetzt schieb mit mir den blöden Stein beiseite.«
Mit einigem Kraftaufwand schafften es die beiden, den Stein vom besagten Fleck zu bewegen. Daraufhin griffen sie nach ihren Schaufeln und fingen an zu graben. Kurze Zeit später gesellten sich die anderen Bauern zu ihnen hinzu. Da stieß Abou mit der Schaufel auf einen roten Tonkrug.
»Was ist denn das?«, fragte er erstaunt.
Im Nu hatten sich die Bauern um das irdene Gefäß versammelt und begutachteten den Fund.
»Los schlag drauf. Mal sehen, was drin ist«, rief einer der Bauern.
»Stopp! Nicht! Was, wenn ein Dschinn in diesem Tonkrug wohnt?«, rief einer aufgeregt dazwischen. »Wer vergräbt denn sonst so weit außerhalb des Dorfes einen Krug. Bestimmt, um böse Geister in Zaum zu halten.«
Es folgte eine Diskussion, der Muhammed belustigt zuhörte. Er griff nach der Schaufel und schlug auf den Krug ein, sodass dieser in tausend Einzelteile zerbarst.
»Da habt ihr euren Dschinn«, sagte er und deutete auf den Inhalt.
Dieser bestand aus einigen mit Leder zusammengebundenen Papyruskodizes.
»Na ja, war weder ein Dschinn und schon gar kein Gold«, murmelten einer der Bauern enttäuscht.
»Was fangen wir mit dem Zeug an?«, erkundigte sich Abou.
»Wenn es keiner von euch will, dann nehm ich es mit«, meinte Muhammed. Auf irgendeine Art würde er die Schriften bestimmt gewinnbringend an jemanden verscherbeln.
Von den anderen widersprach keiner. Was fing man als Bauer auch mit solchen Kodizes an. Zumal die meisten von ihnen weder lesen noch schreiben konnten. Niemand hatte die geringste Ahnung, was sie da in Händen hielten.
Nachdem Muhammed wieder im Dorf ankam, ging er in seine Hütte und legte seinen Fund auf den Tisch neben den Ofen.
Seine Mutter Umm Ahmad begrüßte ihn flüchtig. Seit der Ermordung des Vaters war er das Oberhaupt der Familie und hatte für sie zu sorgen. Das gelang ihm, der er nicht einmal dreißig war, eher mäßig. Ihn zog es hinaus in die weite Welt. Nach Kairo oder Luxor. Hauptsache raus aus diesem tristen Dasein. Erschwerend kam hinzu, dass ihn die örtliche Polizei beobachtete, da er sich mit dem Mörder seines Vaters im Clinch befand. Derartiges sahen die Behörden nicht gern. Und Muhammed wartete nur auf eine günstige Gelegenheit, dem Bastard die Kehle aufzuschlitzen.
Bei diesem Gedanken fiel ihm ein, dass es möglicherweise nicht sinnvoll war, die Schriften im Haus zu lagern, zumal die Polizei mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit bald wieder bei ihm vorbeischauen würde. Doch wer kam für die Aufbewahrung in Frage? Im Dorf niemand. Den meisten von ihnen traute er nicht über den Weg, und sie ihm ebenso wenig. Er überlegte. Dann fiel ihm ein, dass sein Vater ihn in jungen Jahren immer wieder zu einem koptischen Priester, der in einem kleinen, abgeschiedenen Kloster nicht weit vom Dorf lebte, mitgenommen hatte.
Er kam von draußen wieder herein und stellte erschrocken fest, dass einige der Schriften fehlten.
In der Hütte saß seine Mutter neben dem Ofen und buk Fladenbrot.
»Was?«, rief er entsetzt. »Du hast nicht etwa. ...?«
»Du meinst das Papier da auf dem Tisch?«, unterbrach sie ihn. »Doch, habe ich. Es eignet sich bestens zum Anfeuern. Wo hast du das gefunden?«
Muhammed schlug die Hände vors Gesicht. Sofort rannte er an den Tisch und riss die restlichen gebundenen Kodizes an sich.
»Du hast kein Recht, das zu verbrennen. Womöglich ist das eine Menge wert.«
Sie lachte.
»Sohn, das, was wertvoll ist, wird gerade im Ofen gebacken.« Umm Ahmad zeigte auf das Fladenbrot.
Er schüttelte mit dem Kopf. Seine Mutter hatte seit einiger Zeit diese merkwürdigen Anzeichen von Vergesslichkeit. Hoffentlich wurde es nicht schlimmer. Allerdings war schnellstmögliches Handeln das Gebot der Stunde. Er entschloss sich, baldmöglichst den Priester aufzusuchen und die Kodizes bei ihm zu verwahren. Fürs Erste zumindest, bis er wusste, an wem er sie gewinnbringend verkaufen könnte.
Vielleicht waren diese Schriften für ihn der Weg in eine bessere Welt.
Wenige Tage später ergab sich für Muhammed Ali die Gelegenheit. Seine Mutter, die den Fund beinahe im Feuer verbrannt hätte, bat ihn besagtem Priester, die bestellten Fladenbrote zu bringen.
Basilius Abd al-Masih war ein grauhaarigerer, dürrer Mann, mit einem überlangen Ziegenbart. Seine Alter vermochte man auf Ende sechzig schätzen, es konnten aber ebenso zehn Jahre mehr oder weniger sein. Muhammed Ali kannte ihn seit Kindertagen. Er vermittelte zwischen den verfeindeten Sippen, die sich in einer Blutfehde befanden. Seinem diplomatischen Geschick war es zu verdanken, dass es noch kein Massaker gegeben hatte und der Mord am Vater von Ali bis dato der Einzige, wenn auch ärgerliche, Todesfall in der Gegend war.
Muhammed klopfte an die schwere Holztür des Klosters, welches einsam in der kargen Landschaft, zehn Kilometer nordwestlich seines Dorfes sein Dasein fristete. Warum sich die Mönche dieser Religion immer die unwirtlichsten Gegenden aussuchten, und in völliger Abgeschiedenheit lebten, erschloss sich ihm nicht.
Am Eichentor öffnete sich eine kleine Luke und ein Mönch streckte sein Gesicht heraus.
»Was ist euer Begehr?«, erkundigte er sich.
»Ich möchte zu Abt Basilius. Sag ihm, Muhammed Ali ist hier.«
Ohne zu antworten, schloss sich die Luke wieder. Zehn Minuten später wurde, unter Ächzen und Knarren, das Tor geöffnet.
»Muhammed, ich grüße dich. Erzähl, wie geht es dir«, empfing ihn der Abt. »Du hattest mit Sicherheit eine beschwerliche Reise. Tritt ein, mein Sohn.«
Er ließ die üblichen Begrüßungsfloskeln über sich ergehen und kam dann recht schnell auf den Punkt.
»Basilius, wir haben beim Graben nach Dünger etwas gefunden, von dem ich glaube, dass es viel wert ist. Wenn es deine Zeit erlaubt, schau es dir an und sag mir dann, ob ich damit ein paar Pfund verdienen kann.«
Der Abt nahm ihm die Lederbündel aus der Hand.
»Die sehen alt aus. Wo hast du die her?«
»Beim Graben ist mein Cousin auf einen alten Tonkrug gestoßen. Darin lagen diese Schriften. Was schätzt du, sind die wert?«
»Das kann ich dir nicht sagen.« Er sah sich einige der Schriftrollen an. »Mitunter findet man einen Sammler, der für die Sachen Geld bezahlt. Hör zu, mein Cousin kommt heute Abend zu Besuch. Möglicherweise weiß der mehr. Lass mir die Kodizes da, dann zeig ich sie ihm.«
Er nickte.
»In Ordnung. Aber versucht nicht, mich zu bescheißen. Das kommt bei mir nicht gut an«, hob er mahnend seine Stimme.
»Muhammed, ich bin ein Diener Gottes. Glaubst du allen Ernstes, ich würde dich betrügen? Noch dazu, wo deine Mutter mich immer mit diesen köstlichen Fladenbroten versorgt?«
»Allah sieht alles.«
»Gott gleichermaßen«, lachte der Abt.
Am Abend des gleichen Tages stattete ihm sein Cousin Raghib Andrawus einen Besuch ab. Jener war zurzeit in der Stadt, um dort seinen halbseidenen Geschäften nachzugehen.
Am Abend saßen beide im Büro des Abtes und ließen sich die Flasche Whisky, die Raghib mitgebracht hatte schmecken.
»Ein edler Tropfen«, lobte Basilius. »Wo hast du den her?«
»Den hab ich von einem Händler aus Schottland erstanden.«
»Kannst du mir mehr von dem besorgen?«
Er nickte zustimmend, während er das Glas auf den Tisch stellte. Dabei fielen Raghib die Kodizes auf, die Muhammed am Nachmittag bei Basilius deponiert hatte.
»Was ist das?«, erkundigte er sich und griff nach dem Lederbündel.
»Ach, das hat mir ein Bauer heute gegeben. Der wollte wissen, ob sie was wert sind. Du kennst dich mit den Sachen ein bisschen aus. Was bekommt man dafür?«
Da brauchte man Raghib nicht zweimal fragen. Längst hatte seine Spürnase angeschlagen.
Er schaute und blätterte die Kodizes durch. Unvermittelt stockte er. Irgendetwas ließ ihn innehalten. Einige der Schriften waren in Latein und Altgriechisch verfasst. Ein Text jedoch erregte seine Aufmerksamkeit. Auf den ersten Blick war es eine Aneinanderreihung von Zahlen und aramäischen Buchstaben. Doch Raghib kannte sich aus. Die Nummern hatten eine Bedeutung, das wusste er. Die alten Juden nutzten Zahlen, um wichtige und geheime Botschaften zu verschlüsseln. Eventuell fand sich jemand der Interesse an diesen Texten hatte. Die Europäer waren ganz scharf auf diese Art von alten Schriften.
Basilius schien abgelenkt, denn er saß das Glas mit Whisky anstarrend in seinem Sessel und dachte nach. Raghib jedoch war in Gedanken bereits in Kairo und arbeitete seine Kaufinteressenten durch.
»Die Schriften hier sind faszinierend. Ich kann unmöglich allein entscheiden, ob die was wert sind. Dazu müsste ich sie in Kairo von einem Fachmann untersuchen lassen. Meinst du, er überlässt sie mir für einen guten Preis?«
»Ich weiß nicht«, zauderte Basilius, der an die Worte Muhammeds dachte. »Der Bauer hat sie mir eigentlich anvertraut.«
Raghib überlegte kurz.
»Ich geb dir 500 Pfund für die Schriften. In Ordnung?«
Für ihn wäre das ein lohnendes Geschäft, lächelte er in sich hinein. Würde sich ein Interessent aus Europa finden, die investierten 500 Pfund hätten sich mehr als verdoppelt rechnete er sich im Kopf aus.
Basilius überlegte.
»500 Pfund? Klingt angemessen. Machen wir es so.«
Somit wechselten die später als Nag-Hammadi-Schriften bekannten Kodizes in jener Dezembernacht den Besitzer. Es wäre allerdings besser gewesen, man hätte den Tonkrug nie entdeckt.
Der Mann lag, nur mit Hemd und Unterhose bekleidet auf einer Pritsche in einem abgedunkelten Raum. Der Kopf tat ihm weh und wegen des monotonen Klopfens hatte er eine gefühlte Ewigkeit nicht geschlafen.
Essen und Trinken wurden ihm nunmehr seit drei Tagen verweigert und langsam, aber sicher geriet er an seine physischen und psychischen Grenzen.
Erneut öffnete sich die Tür.
»Dann wollen wir mal wieder«, rief der Mann höhnisch und grinste dabei. »Vielleicht kommst du ja heute zu der Einsicht, das Reden Gold und Schweigen Silber ist.«
Er packte ihn, zog in unsanft von der Pritsche hoch und band ihm die Hände auf den Rücken. Dann führte er ihn durch einen Gang in einen anderen Raum. Dort stand in der Mitte ein Tisch. Auf diesen wurde er gelegt. Nun fing die Prozedur von neuem an. Es war seit Tagen derselbe Ablauf.
Der Mann legte ihm ein nasses Tuch auf das Gesicht. Die Panik kroch wieder in ihm hoch. Er vermochte, obwohl er sich dagegen strebte, nicht handeln. Das Gefühl der Angst war stärker.
»Bevor wir anfangen, frage ich vorsichtshalber nochmal nach. Sie ersparen sich die ganze Prozedur. Und uns ebenfalls. Wir wollen einen Namen. Nur einen Namen.«
»Ich weiß nichts«, presste er mühevoll hervor, obwohl sein Körper ihn anflehte, endlich diesen verdammten Namen zu sagen.
»Er wird nicht reden«, zuckte der Mann gleichgültig mit den Schultern und wandte sich an den anderen, der in der Ecke saß und eine Zigarette rauchte.
»Dann fangen wir an«, erwiderte der lapidar.
Der andere kniete sich mit seinem Gewicht auf die Brust des unter ihm liegenden Opfers und tröpfelte mit einer kleinen Gießkanne langsam Wasser auf den nassen Lappen.
Der Mann fing an zu zucken und versuchte sich verzweifelt zu wenden. Jedoch es half nichts. Er hatte das Gefühl jeden Moment zu ertrinken, obwohl sein Peiniger nur wenig Wasser auf den nassen Lappen tropfen ließ. Das Tuch auf dem Gesicht und die Knie auf seiner Brust gaben ihm den Rest. Er verlor das Bewusstsein.
Als er erwachte, lag er wieder auf der Pritsche in seiner Zelle. Das Licht brannte und das monotone Klopfen holten in langsam in die Realität zurück.
Er war zäh und man hatte ihn auf solche Situationen vorbereitet. In der Theorie klang das alles wesentlich leichter, wie es sich in Wirklichkeit anfühlte. Er wusste, selbst wenn er ihnen den Namen nannte, lebend würde er dieses Verlies nicht mehr verlassen. Ihm blieb keine Wahl. Sie würden seinen Willen brechen. Das war das Ziel einer Folter. Die einen gaben eher auf, andere später. Aber aufgeben taten sie alle.
Er fasste einen letzten Entschluss.
Sie hatten ihm einen Zettel und einen Kugelschreiber auf den kleinen Tisch neben der Pritsche gelegt. Für den Fall, dass er es sich überlegte.
»Wenn du nicht mit uns reden willst, kannst du es ja aufschreiben«, meinte der eine spöttisch, nachdem sie ihn entführten.
Wie lange er bereits in diesem Loch gefangen war, wusste er nicht mehr. Irgendwann einmal hatte er das Gefühl für die Zeit verloren. Waren es drei Tage oder eine Woche? Zweifelsohne wurde er vermisst, aber ob man ihn suchte, geschweige denn finden würde. Und wenn ja - wann? Nein es half nichts, er musste diesen Weg beschreiten. Es stand zu viel auf dem Spiel und er wollte nicht derjenige sein, der das Geheimnis verraten hatte. Nein, diesen Triumph gönnte er ihnen nicht. Mit seinen letzten klaren Gedanken fasste er einen Plan.
»Scheiße!«, schrie der Mann, als er die Tür zu dem Raum öffnete, hinter der sich ihr Gefangener befand. Er sah ihn regungslos liegen. Die rechte Hand hing schlaff über der Pritsche. Auf dem Boden eine riesige Blutlache.
Der Tote schien zu lächeln. Auf irgendeine Weise hatte er es geschafft, sich die Pulsadern aufzuschneiden.
Er sah sich um. Auf dem kahlen grauen Boden lag ein zerbrochener Kugelschreiber, blutverschmiert.
Der Tote hatte sich in seiner Verzweiflung mehrmals die abgebrochene Spitze in die Venen gerammt.
Er kniete an der Seite und hob den rechten Arm hoch.
»Hat dieses verdammte Arschloch uns doch tatsächlich einen Strich durch die Rechnung gemacht. Hoffentlich schmorst du in der Hölle. A vaffanculo!«
»Was fluchst du denn hier rum?«, wollte der andere wissen, der im Türrahmen stand.
»Siehst du das nicht, du Vollidiot. Der ist tot.«
»Klar seh ich das«, gab er trotzig zurück.
»Na, da werd ich doch fluchen dürfen. Oder wie gedenkst du jetzt an die Namen zu kommen, geschweige denn das Buch? Hä?«
Der andere zuckte ungerührt mit den Schultern und wies ihn mit dem Kopf auf den kleinen Tisch.
»Hat der da was notiert?«, erkundigte er sich.
In der Tat sah es so aus, als hätte der Mann, den sie im Auftrag entführt hatten etwas aufgeschrieben, denn der Block lag nicht mehr an der Stelle, wo er ihn vor ein paar Tagen hingelegt hatte. Erstaunlich dachte er. Doch das Papier war unbeschrieben.
»Leer!«, schimpfte er und warf den Block wutentbrannt an die Wand. Der andere hob ihn auf.
»Stimmt«, erwiderte er. »Es scheint, als ob er vor seinem Tod etwas aufgeschrieben hat. Es ist auf den Block durchgedrückt. Mit einem Bleistift könnte ich es schraffieren. Vielleicht finden wir raus, was er geschrieben hat.«
»Dann steh hier nicht blöde rum, sondern mach«, herrschte er ihn an. Dass ihr Opfer es geschafft hatte, unter ihrer Aufsicht Selbstmord zu begehen, würde ohne Zweifel Konsequenzen für sie haben, es sei denn der Trottel würde tatsächlich die Schrift auf dem Block sichtbar machen können. Anscheinend hatte er vor seinem geplanten Ableben etwas aufgeschrieben, den Zettel dann jedoch wieder vernichtet. Er schaute in seinen Mund und fand einige Papierreste.
Trotzdem lachte er.
»Netter Versuch, alter Mann. Aber ganz so bescheuert sind wir nicht.«
Er stand wieder auf und verließ den Raum, um nach seinem Kompagnon zu sehen. Der saß an einem Tisch und hatte einen Bleistift gefunden. Man sah, wie er mit der Hand auf dem Block das Papier schraffierte. Und siehe da, da stand ein Name
.
Eduardo Monte, Rommel.
»Das hätte der alte Narr bequemer haben können«, seufzte der Mann und rieb sich die Schläfen. Auch an ihm waren die letzten Tage nicht spurlos vorübergegangen. Ihr Opfer erwies sich als äußerst zäh und das nötigte ihm einen gewissen Respekt ab. Letztlich hatte es ihm nichts geholfen. Jeder redete zu einem Zeitpunkt und wenn es, wie bei ihm, aus dem Jenseits war.
Sie hatten nun einen Namen. Eduardo Monte. Ein unangenehmer Gegner. Unberechenbar und nicht zu durchschauen. Im Laufe der Jahre waren sie sich einige Male begegnet. Stets hatte ihm Monte ein Schnippchen geschlagen. Diesmal nicht. Er grinste. Nein, dieses Mal war er ihm einen Schritt voraus. Jetzt musste er handeln, und zwar schnell. Sie hatten ihr Ziel, das Buch zu beschaffen nicht erreicht, dessen ungeachtet hatten sie einen Namen. Das war jedoch nur die halbe Miete, wie man in Deutschland zu sagen pflegte.
Für Peter Moriati fing dieser Tag an wie jeder andere. Der Wecker holte ihn wieder einmal viel zu früh aus dem Reich der Träume.
Mit halboffenen Augen und nicht ganz bei der Sache schlurfte er ins Bad, um sich den notwendigen morgendlichen Aktivitäten zu widmen. Nebenbei blubberte die Kaffeemaschine, die er auf dem Weg angeschaltet hatte, munter vor sich hin.
Nach der ersten Tasse Kaffee fuhr er in sein Büro, das sich am Anfang der Königsstraße, jener belebten Einkaufsmeile im Herzen von Stuttgart befand. Der Verkehr und die Fahrt verliefen wie jeden Morgen langsam und zäh. Gegenüber seinem Büro baute und werkelte man seit Jahren an dem neuen Bahnhof, der nach wie vor die Gemüter der Schwaben erhitzte. Peter war in dieser Beziehung außen vor. Mit seinen Investigationen hatte er genug Arbeit und konnte sich mit solchen für ihn unwichtigen Themen nicht beschäftigen.
Seit er seinen Dienst bei der Kriminalpolizei vor einigen Jahren quittiert und sich mit privaten Ermittlungen einen Namen erarbeitet hatte, lief es für ihn, was die finanzielle Seite anging. Waren es am Anfang kleine Engagements, so sprach es sich recht zügig herum, dass er schnell, effizient und zuverlässig seine Klientel zufrieden stellte.
Somit blieb es nicht aus, dass die Aufträge umfangreicher wurden und er alsbald über ein Büro in der Königsstraße verfügte. Was selbstredend dazu führte, dass sein Kundenstamm zunahm. Denn wer sich Geschäftsräume auf dieser Flaniermeile im Herzen der Landeshauptstadt leisten konnte, der hatte es, so die landläufige Meinung der Stuttgarter zu etwas gebracht.
Peter Moriati betrat sein Büro mit Blick auf den Schlossgarten. Seine Schreibkraft, die er benötigte, um sich den lästigen Schreibkram und allzu aufdringliche Kunden vom Hals zu halten, saß längst hinter dem Tresen und tippte auf der Tastatur.
»Guten Morgen Anette, sind die Rechnungen im Fall Hoffmann raus?«, erkundigte er sich und griff dabei gleich noch eine Tasse Kaffee ab, die auf dem Tresen stand.
Anette grinste ihn an.
»Meinst Du die für Herrn oder Frau Hoffmann?«
Er lächelte zurück.
»Für beide.«
Dann verschwand er hinter der Glastür in seinem Büro.
Über diesen Fall musste er in letzter Zeit immer wieder schmunzeln. Besagte Frau Hoffmann hatte ihn beauftragt, ihren Mann zu überwachen, denn sie befürchtete eine Affäre. Da sie sich, was die Bezahlung anging, nicht lumpen ließ, willigte er ein. Einem blöden Zufall hatte er es zu verdanken, dass der observierte Ehegatte ihn enttarnte. Anstatt ihm nachtragend zu sein, handelten beide Männer einen Deal aus. Herr Hoffmann, seinerseits beauftrage ihn, entlastende Fotos zu knipsen. Dafür zahlte er ihm einen deutlich höheren Betrag wie dessen Gemahlin. Peter willigte ein, auch weil ihm die Gattin nicht gerade sympathisch war, was ihre dominante, herablassende Art anging und er somit ein latentes Verständnis für den Ehemann aufbrachte.
Er hatte leichtes Spiel und gut verdientes Geld. Peter, von jeher eher sparsam erzogen, konnte mit den üppigen Einkünften seines Berufes recht gut leben. Den einzigen Luxus, den er pflegte, war ein Mercedes E Klasse T Modell mit einem sonorig brummenden V8 Motor, der so manchem Sportwagen die Rücklichter zeigte. Ansonsten wohnte er in einer mit dem für einen Junggesellen nötigsten eingerichteten Wohnung am Rande von Stuttgart.
Seine Freizeit verbrachte er, bei passendem Wetter meist mit ausgedehnten Radtouren auf die nahe gelegene Schwäbische Alb.
Er fuhr seinen Computer hoch und sah sich seinen heute überschaubaren Terminkalender an, da klingelte sein Telefon.
Anette war am anderen Ende der Leitung.
»Ich habe jemanden, der heute gern noch ein Gespräch mit dir wünscht. Kann ich zusagen?«
Peter überlegte. An sich gab der Kalender die Zeit her. Warum nicht.
»Wann?«, fragte er.
»Gegen elf Uhr. Das wäre in anderthalb Stunden.«
»In Ordnung. Lass dir von ihm sagen, was er will, und leg mir dann eine kurze Notiz auf meinen Schreibtisch.«
Nachdem das geklärt war, entschloss er sich, unten beim Bäcker an der Ecke eine Butterbrezel zu holen, denn ihn überkam ein latentes Hungergefühl.
Pünktlich um elf Uhr war der von Anette angekündigte Termin, in Form eines Mannes mit schwarzen, akkurat nach hinten gekämmten Haaren gekommen. Das Alter schätzte Peter auf Anfang bis Mitte fünfzig.
Er trat in sein Büro, reichte ihm die Hand und stellte sich vor: »Guten Tag Herr Moriati. Schön, Sie kennenzulernen. Mein Name ist Eduardo Monte. Es freut mich, dass ich so schnell einen Termin bei ihnen erhalten habe. Sie haben sicher einiges an Arbeit.«
Peter erhob sich leicht von seinem Stuhl, begrüßte Monte ebenfalls und wies ihm mit einer Handbewegung einen Platz ihm gegenüber zu.
»Kaffee oder Tee?«, fragte er ihn.
»Wenn Sie einen Tee hätten, wäre ich zufrieden«, antwortete Monte.
Peter rief Anette und bat um einen Tee für seinen Gast sowie eine Tasse Kaffee für ihn. Dann lehnte er sich zurück.
»Herr Monte, was genau kann ich für Sie tun?«
Er sah auf den Notizzettel, den ihn Annett auf den Schreibtisch gelegt hatte.
»Ich bin auf der Suche nach jemanden und komme da nicht weiter. Ich bin mir nicht mal sicher, ob die besagte Person noch lebt«, fing Monte an. »Daher hoffe ich, dass Sie mir weiterhelfen.«
Peter musterte sein Gegenüber. Irgendetwas stimmte mit dem Mann nicht. Ihn umgab die Aura des Undurchsichtigen.
»Was haben Sie denn bereits unternommen, um diese Person, wie heißt sie nochmal, zu finden?«
Monte ging nicht auf die Frage ein und zählte ihm das Übliche auf. Für Peter war schnell klar, weshalb er seine Dienste in Anspruch nahm.
»Sie wollen nicht, dass ein großes Aufheben um ihre Nachforschungen gemacht wird«, konfrontierte er ihn mit seiner Vermutung.
»Denn wenn Sie die besagte Person finden wollen, brauchen sie nicht zwingend meine Dienste, noch dazu wo ich in Stuttgart nicht gerade der billigste private Ermittler bin. Darüber haben Sie sich im Vorfeld sicherlich erkundigt«, fügte er gewieft hinzu. Den guten Ruf galt es zu pflegen.
»Das habe ich in der Tat«, lächelte Monte feinsinnig. »Mir geht es in erster Linie darum, die Person zu finden. Und ja, Sie haben recht, ich möchte kein ein großes Aufheben veranstalten.«
»Sie wollen mir nicht sagen, warum Sie diese Person suchen?«, hakte Peter nach.
»Noch nicht«, erwiderte sein Gegenüber kurz angebunden.
Peter nannte ihm seinen Tagessatz und die dazugehörigen Spesen. Ohne mit der Wimper zu zucken, willigte Monte ein, zog einen Umschlag mit Geld aus seiner Jacke und legte ihn auf den Schreibtisch. Dann stand er auf und wandte sich zum Gehen.
»Einen Augenblick, Herr Monte«, rief Peter ihm nach. Der Mann blieb stehen und drehte sich um.
»Den Namen brauche ich noch.«
»Steht alles in dem Umschlag mit drin. Ich melde mich wieder, wenn Sie die Person ausfindig gemacht haben.«
Dann ließ er Peter stehen und schloss die Tür hinter sich.
»Was war denn das für ein komischer Kauz«, ereiferte sich Anette.
Peter öffnete derweil den Umschlag und schaute nach dem Geld. Es war weit mehr als der vereinbarte Tagessatz.
»Auf jeden Fall jemand, der gut zahlt und Ergebnisse erwartet. Also mach ich mich mal an die Arbeit. Solche Kunden lässt man nicht warten.«
Er sah sich den beiliegenden Zettel an, auf dem ein Name stand nur:
Gustav Rommel, der Jüngere von beiden
Dabei ein Foto, welches einen Mann am Fuße der Pyramiden in Ägypten zeigte. Die Aufnahme war schwarzweiß und der Qualität nach musste es älter sein. Er wendete das Bild und fand ein Datum: Mai 1952.
Ein Anfang, mehr nicht. Den Mann auf dem Foto schätzte er auf Ende zwanzig, eventuell älter. Daneben stand ein kleiner Junge mit kurzen Hosen und Kniestrümpfen. Er trug einen Sonnenhut und blinzelte verschmitzt in die Kamera. Der Mann, dem Aussehen nach sein Vater, schaute recht ernst drein.
Auf Bildern ließ sich das Alter der Menschen nicht wirklich einschätzen. Der kleine Junge dürfte, sollte er heute noch leben, über siebzig Jahre alt sein. Was die Suche nicht weniger knifflig gestaltete.
Peter fragte sich die ganze Zeit, wie dieser Monte auf ihn kam. Redselig war jener nicht. Was er dahingehend wertete, dass es hier nicht mit rechten Dingen zuging. Ein Indiz auf der Hut zu sein.
Zunächst einmal galt es herauszufinden, wer dieser Gustav Rommel war, wo wer wohnte und ob er überhaupt noch lebte. Ersteres klärte sich nach wenigen Klicks im Internet.
Der Mann, um den es sich auf dem Foto handelte, war ein pensionierter Pfarrer der St. Dyonis Kirche in Esslingen am Neckar. Er genoss seit einigen Jahren den wohlverdienten Ruhestand, griff der Pfarrei jedoch ab und an hilfreich bei ehrenamtlichen Tätigkeiten unter die Arme.
Peter entschloss sich spontan, dort vorbeizufahren, um sich zu erkundigen. Meist brachte das persönliche Gespräch mehr, denn der anonyme Anruf. Im Übrigen erkannte er anhand der Mimik seines Gegenübers, was in diesem vor sich ging. Das war zuweilen bei den Ermittlungen hilfreich und nicht selten unabdingbar.
***
Esslingen, die Nachbargemeinde von Stuttgart, lag friedlich, flankiert von Weinreben am Ufer des Neckars. Mitten im Herzen der Altstadt stand die im 13. Jahrhundert erbaute St. Dyonis Kirche mit ihren zwei in den blauen Himmel ragenden Türmen, von denen der rechte, eine leichte Neigung aufwies.
Ein Schild an der Tür lotste ihn zu einem Nebeneingang, durch den er in das Innere des altehrwürdigen Gotteshauses gelangte.
Außer ihm hielten sich drei andere Personen, seiner Einschätzung nach Touristen, im Schiff der Kirche auf. Vor dem Altar putzte ein Mitarbeiter den Boden. Peter trat an ihn heran und grüßte freundlich.
»Guten Tag, darf ich kurz stören?«
Der Mann unterbrach seine Reinigungsarbeiten und wandte sich Peter zu.
»Sicher, wie kann ich helfen?«, erkundigte sich der ältere Herr und stützte sich dabei auf seinem Wischmob ab.
»Ich bin auf der Suche nach jemanden, der in ihrer Kirche gearbeitet hat. Kennen Sie einen Gustav Rommel?«
Der Mann stellte sein Reinigungsgerät beiseite und schaute Peter an.
»Sicher kenne ich den Gustav. Wer sind Sie denn? Ein Verwandter?«
Peter legte sich, darin war er ein Meister seines Faches, schnell eine Geschichte zurecht. Mit Verweis auf das Bild vor den Pyramiden log er, dass sein Opa dieses Foto geknipst hätte und er es im Nachlass des Selbigen gefunden habe. Nun wolle er mit ihm reden, um noch mehr über seinen Opa und dessen Reisen herauszufinden.
Der Mann schien die Geschichte zu glauben.
»Dem Gustav geht es derzeit nicht gut. Er wohnt in einem Seniorenheim oben auf der Höhe. Bis vor ein paar Monaten hat er uns trotz des Alters hier in der Kirche geholfen, aber seit seinem Schlaganfall haben wir ihn nicht mehr gesehen. Es wäre ein Wunder, wenn er sich wieder halbwegs erholt.«
Peter ließ sich detailreich erklären in welchem Seniorenheim Gustav Rommel residierte, und stellte fest, dass sich dieses in der unmittelbaren Nachbarschaft zu seinem Domizil befand.
Später Nachmittag
Peter Moriati hatte sein Fahrzeug in der Tiefgarage des nahegelegenen Einkaufszentrums abgestellt und war die wenigen Meter zum Altersheim spaziert, um seinen Gedanken freien Lauf zu lassen. Etwas beunruhigte ihn. Allerdings vermochte er nicht zu konkretisieren, was es war.
Der Besuch bei Gustav Rommel würde hoffentlich mehr Aufschluss bringen. Ihm schwirrte immer wieder der Gedanke im Kopf herum, was dieser Eduardo Monte mit dem älteren Mann gemein hatte. Die zwei passten augenscheinlich nicht zusammen. Möglicherweise war es das, was ihm merkwürdig vorkam.
Am Empfang schaute eine ältere Dame mürrisch in die Landschaft, gewillt jeden abzuwimmeln, der sich ihr näherte. Da musste er seinen ganzen Charme spielen lassen, um zum gewünschten Ergebnis zu kommen.
»Grüß Gott, ich hoffe Sie können mir weiterhelfen. Mein Name ist Peter Moriati und ich bin im Auftrag der St. Dyonis Kirche aus Esslingen hier, um mich nach Pfarrer Gustav Rommel zu erkundigen.«
Die Dame zeigte keine erkennbare Regung und musterte ihn. Schier endlose Sekunden vergingen, die Peter wie eine gefühlte Ewigkeit vorkamen.
»Der Herr Rommel«, setzte sie wider Erwarten freundlich an, »ist zurzeit nicht im Hause, sondern mit der Wandergruppe unterwegs. Die müssten demnächst wieder kommen. Wollen Sie so lange warten?«
Die Frau deutete auf eine Couchgarnitur, die hinter ihnen stand und wartende Besucher zum Verweilen einlud.
»Sehr freundlich«, entgegnete Peter. »Ich nehme das Angebot gern an und warte auf Herrn Rommel. Es freut mich, zu hören, dass es ihm nach seinem Schlaganfall wieder besser geht.«
»Ja, wir haben uns alle darüber gefreut«, stieg die Dame ins Gespräch ein. Wie es schien, hatte Peter die richtige Tonart getroffen.
»Als er zu uns kam, da hatten wir wenig Hoffnung das er sich wieder erholt. Aber es scheint der Herr Rommel verfügt über einen ausgezeichneten Draht nach oben.«
Sie lächelte feinsinnig.
»Da bin ich mir sicher. Er ist ja eine ziemlich robuste Natur«, fuhr Peter fort. Wissen tat er dies freilich nicht. Er kannte ja nur das alte Foto, was bedingt Rückschlüsse auf das Aussehen und Gesundheit von Gustav Rommel in den heutigen Tagen zuließ.
»Sicher. Und ein sehr höflicher, netter Mensch. Wäre schade, wenn ihn der Herrgott zu früh abberuft.«
Sie redete noch, da kamen einige Herrschaften ins Foyer des Altersheims. Das musste, der Kleidung nach zu urteilen, die Wandergruppe sein, von welcher die Rede war.
»Da ist er ja, der Herr Rommel«, sagte sie unversehens. Neben Peter stand ein rüstiger älterer Mann, den er dem ersten Anschein nach bestenfalls auf Ende fünfzig geschätzt hätte.
»Hallo Herr Rommel. Wieder zurück?«, begrüßte die Empfangsdame den älteren Herrn.
»Na ja, wegen mir könnten unsere Touren ruhig etwas länger dauern. Leider geht es ja nicht nur nach mir«, lachte er.
Auf Peter erweckte Rommel nicht den Eindruck, als hätte dieser erst vor einiger Zeit einen Schlaganfall erlitten. Er war kein Mediziner, aber eine derartige schnelle Genesung in diesem Alter hielt er für sehr unwahrscheinlich.
»Und Sie sind?«, holte ihn Rommel unvermittelt aus seinen Gedanken.
»Peter Moriati«, stellte er sich vor. »Ich komme von St. Dyonis in Esslingen. Man schickt mich, um zu sehen, wie es Ihnen geht.«
Rommel sah ihn ein wenig seltsam an und Peter ging bereits davon aus, er würde ihm die Geschichte nicht abkaufen, doch dann erwiderte der: »Na wie sie sehen, geht es mir blendend. Kommen sie mit auf einen Kaffee? Der Kuchen hier ist ebenfalls exzellent. Leider bekommen wir immer nur ein Stück. Man achtet auf unsere Gesundheit. Und das bei dem Altersdurchschnitt. Wenn sie mich fragen, völlig übertrieben. Wir danken eh bald alle ab. Da kommt es auf ein Stück mehr oder weniger nicht an.«
Humor hatte er, das musste Peter ihm lassen.
»Da sagt man als Schwabe nicht nein. Ich trinke einen Kaffee und gebe ihnen mein Stück Kuchen«, bot er ihm generös an.
»Junger Mann, das gefällt mir. Und dann erzählen Sie, was es Neues in der Pfarrei gibt. Ich bin gespannt.«
Peter musste improvisieren. Für ihn war das kein Problem. Er hatte sich längst eine Strategie zurechtgelegt. Auch um mehr über diesen Monte zu erfahren. Ihm war nicht klar, was jenem an dem sympathischen älteren Herrn interessierte.
Wie versprochen überließ Peter ihm sein Stück Kuchen und redete sich bei der Frage nach Details über die Pfarrei damit heraus, erst seit kurzem dabei zu sein. Er erzählte Rommel was davon, dass er gern älteren Menschen helfen wolle, und dieser schien ihm das Gesagte ohne Argwohn abzukaufen.
»Sagen sie Herr Rommel«, lenkte Peter langsam das Gespräch in die gewünschte Richtung, »was haben sie in ihrer Jugend angestellt?«
Rommel stellte die Tasse auf den Tisch und lehnte sich zurück.
»Ich bin weit rumgekommen. Habe die halbe Welt gesehen, junger Mann. Schließlich bin ich dann aufgrund meiner schwäbischen Wurzeln wieder in Esslingen gelandet. Und ich habe es nie bereut.«
»Wo hat es Ihnen am meisten gefallen?«, wollte Peter wissen.
»Das war ohne Zweifel die Zeit in Ägypten«, antwortete dieser. »Anfang der Fünfziger ist das gewesen. Mein Vater war Archäologe und was gibt es für einen kleinen Steppke Schöneres als im größten Sandkasten der Welt zu buddeln. Eine aufregende Zeit dort unten. Das Land, die Menschen und die Kultur haben mich beeindruckt, vielleicht auch meinem späteren Lebensweg bestimmt. Man schaut auf viertausend Jahre Menschheitsgeschichte zurück. Und wenn sie dann vor diesen imposanten Bauwerken, den Pyramiden stehen, da überkommt sie Demut.«
Peter bemerkte, mit welcher Begeisterung der Mann über diese Zeit sprach.
»Haben Sie eine spezielle Erinnerung an Ägypten? Ich meine, weil Sie von diesem Land so schwärmen. Ich war noch nie dort, gebe jedoch offen zu, dass es mich nicht zwingend reizen würde, da den Urlaub zu verbringen, geschweige denn zu leben.«
»Ich schätze Ihre Offenheit, Herr Moriati. Sie sind ein ehrlicher Mensch mit einer eigenen Meinung«, lachte Rommel. »Sie haben Recht, das Land hat mich fasziniert. Zum einen wegen der jahrtausendealten Kultur und weil in gewissem Umfang die Ursprünge des Christentums dort ihre Wurzeln haben. Das wissen die wenigsten von uns heute. Ich habe sehr alte Schriften gesehen und teilweise gelesen. Ein paar von diesen habe ich der St. Dyonis-Kirche überlassen. Die haben sich außerordentlich gefreut, Derartiges zu erhalten.«
Peter fasste sich ans Kinn. Bestand da möglicherweise ein latenter Zusammenhang zwischen der Aussage Rommels und dem Interesse von Eduardo Monte? Er entschloss sich, diesem Gedanken zu einem späteren Zeitpunkt mehr Aufmerksamkeit zu widmen.
Gustav Rommel sah auf die Uhr. »Die Zeit rennt, besonders bei uns Älteren. Wir haben gleich Chorprobe. Da darf ich als Tenor nicht fehlen. Das fällt auf. Aber besuchen Sie uns bald wieder. Es ist angenehm, mit Ihnen zu reden.«
»Danke, dass Gleiche gilt für mich. Wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt.«
Er nahm seinen Kugelschreiber und schrieb ihm seine Telefonnummer auf die Serviette.
»Ist jetzt nicht die feine englische Art«, lachte er, »aber bevor wir lange rumsuchen, tut es das auch.«
Rommel lachte ebenfalls.
»Ach fast hätte ich es vergessen, Herr Eduardo Monte lässt Sie grüßen«, schob Peter betont beiläufig nach.
»Eduardo wer?«, fragte Rommel ungläubig. Ihm schien der Name nicht bekannt zu sein.
»Na, Eduardo Monte. Er war heute Morgen bei mir und bat mich, ihnen Grüße auszurichten.«
»Tut mir leid Herr Moriati, den Mann kenn ich nicht. Aber richten Sie ihm ebenfalls einen Gruß aus. Möglicherweise habe ich Gelegenheit, ihn persönlich kennenzulernen.«
Sprachs und schloss sich den älteren Herrschaften an. Peter begab sich wieder auf den Weg zu seinem Auto. Kurz vor der Tür, er verabschiedete sich gerade von der Empfangsdame, klingelte sein Handy. Am anderen Ende der Leitung war sein langjähriger Freund und Bruder im Geiste Richard Schneider.
»Sag mal, wann gehst du an dein Telefon? Wir haben heute Abend eine Verabredung und du müsstest mich abholen, weil meine Karre wieder nicht anspringt«, polterte dieser sofort los, nachdem er abgenommen hatte.
»Ich war im Seniorenheim und hab mich nach einem Zimmer für dich erkundigt«, gab Peter trocken zurück. »Leider war nur noch im Keller Platz.«
»Was treibst du in einem Altersheim? Suchst du reiche Witwen? Ich war bisher der Meinung, Schnüffler von deinem Format verdienen ihr Geld leichter.«
Peter erzählte ihn von seinem neuen Auftrag und Richards Neugier war geweckt.
»Lass uns beim Abendessen drüber reden. Jetzt beweg erstmal dein Gesäß zu mir, ich habe Hunger.«
Peter seufzte und legte auf. Richard war um einiges älter als er, und sein Mundwerk gefürchtet. Nichtsdestotrotz war er ein geachteter Professor in den Sechzigern, dem man selbiges Alter nicht ansah. Er verfügte über ein umfangreiches Wissen auf dem Gebiet der Mediävistik und hielt nach seiner Pension ab und zu Vorträge an verschiedenen Unis im Land, wofür er sich fürstlich entlohnen ließ.
Sie verband eine jahrzehntelange Freundschaft, die fester hielt als manche Ehen. Böse Zungen behaupteten, Peter und Richard wären wie ein altes Ehepaar. Gleichwohl, beide schätzten sich wegen der offenen Art und das man sich stets aufeinander verlassen konnte.
Sie hatten im Laufe der Jahre die feste Gewohnheit entwickelt, sich einmal im Monat zum Essen zu treffen und über alles Mögliche zu unterhalten. So auch heute.
***
»Was willst du Essen?«, fragte Peter, nach dem sie ein Steakhaus in der Innenstadt aufgesucht hatten und sich einen Rotwein servieren ließen.
»Ich denke, ein Filet Mignon mit Bratkartoffeln tut es fürs Erste«, resümierte Richard.
»Das isst du nur, weil ich heute zahle«, brummte Peter.
»Erraten. Da sieht man wieder, wie scharfsichtig Du bist, wenn´s ums Geld geht. Ein echter Schwabe«, grinste er. »Nun erzähl mal von deinem neuen Fall. Du erlebst ja mehr wie ich.«
Peter tat wie ihm geheißen. Nachdem die Rede auf die Pyramiden kam, wurde Richard, ganz Altertumsforscher, hellhörig.
»Da hat er recht, der Herr Rommel. Es ist erwiesen, dass sich dort unten in Ägypten Teile des heutigen Christentums entwickelt haben. Sagt dir der Begriff Kopten etwas? Das ist eine ethnisch-religiöse Gruppe, die ihren Ursprung im 3. Jahrhundert nach Christus hatte. Später gebrauchte man die Bezeichnung ausschließlich für die dort ansässigen Christen.«
Peter hörte nur mit einem halben Ohr hin, während Richard mit seinen Erläuterungen fortfuhr. Mit Religion hatte er nichts am Hut, obgleich er immer wieder versuchte, sich mehr damit zu beschäftigen. Bislang erfolglos.
»Wie dem auch sei«, unterbrach Peter dessen Ausführungen, »den Herrn Rommel habe ich recht schnell gefunden. Also leicht verdientes Geld.«
Er grinste und nannte ihm den Betrag.
Richard lehnte sich zurück und fuhr sich durch seine angegrauten Haare.
»Und du hast dich nicht gefragt, weshalb der Monte dir eine derart hohe Summe zahlt für einen, sagen wir mal, lapidaren Job?«
Peter dachte kurz nach.
»Es ist zwar nicht meine Aufgabe, zu fragen, warum und wieso.« Er legte eine Pause ein und hielt inne. »Wobei es mich offen gesagt jetzt doch interessiert. Vor allem das Warum.«
»War mir klar, dass Du anbeißt. Ich kenn Dich«, stellte Richard fest. »Und ehrlich gesagt finde ich es komisch. Wären die in einer Altersklasse, würde man vermuten, dass es sich um zwei Freunde handelt, die sich aus den Augen verloren haben - aber so.«
Peter trank einen Schluck Rotwein.
»Du hast recht. Ich sollte tiefer bohren. Mal sehen, was ich über diesen Monte rausfinden kann.«
Sie ließen den Abend ausklingen und nachdem Peter Richard zu Hause abgesetzt hatte, winkte bei ihm der Bettzipfel.
Der nächste Morgen fing nicht anders als der vorherige an. Mit dem Unterschied, dass, während er unter der Dusche stand, sein Telefon klingelte.
»Immer wenn man keine Zeit hat«, grantelte er genervt, zog sich seinen Bademantel über und nahm den Hörer ab. Doch da hatte sein Gegenüber bereits aufgelegt.
»Mist!«, entfuhr es ihm.
Als er im Büro ankam, stellte sich schnell heraus, wer versucht hatte, ihn zu erreichen.
»Guten Morgen Peter«, begrüßte ihn Anette. »Der Herr Monte hat angerufen. Er kommt nachher kurz vorbei, um sich über den Stand der Recherche zu erkundigen.«
»Nach einem Tag? Der hat´s eilig, aber er kann meinetwegen kommen. Ich hab das gestern erledigt. Ging recht schnell. Und genau das würde ich gern mit dem Herrn Monte besprechen. Das war zu einfach.«
»Du denkst, der hat dir ein faules Ei ins Nest gelegt?«, erkundigte sich Anette.
»Das meine ich nicht – das weiß ich. Da steckt mehr dahinter.«
Mit dieser Antwort schnappte er sich die Tasse Kaffee und verschwand in seinem Büro. Monte würde sicherlich wieder um dieselbe Zeit auftauchen wie gestern. Somit hätte er eine knappe Stunde, um Erkundigungen über den Mann einzuholen.
Peter griff zum Hörer.
»Morgen Martin«, sagte er. »Ich brauche deine Hilfe. Kannst du eine Person für mich ermitteln?«
Martin Gerhardt arbeitete bei der Kriminalpolizei in Stuttgart, Peters ehemaligen Arbeitgeber. Selbst nachdem er sich auf dem Sektor der privaten Ermittlungen einen Namen verschafft hatte, riss der Kontakt zu seinen früheren Kollegen nie ab. Kurzum, man half sich gegenseitig.
»Ah, der Privatschnüffler«, begrüßte ihn sein Gegenüber. »Wie läufts denn so?«
Peter erzählte ihm mehr oder weniger detailliert von seinem derzeitigen Auftrag und dem Grund, warum er Informationen über Eduardo Monte benötigte.
»Bei dem Namen werde ich wohl international suchen müssen«, seufzte Martin. »Wird eine Weile dauern. Brauchst du die Info gleich oder sofort?«
»Gleich langt schon zu«, scherzte Peter. »Der Kerl kommt erst in einer knappen Stunde. Bis dahin benötige ich was Brauchbares.«
»Ich geb mir Mühe, aber versprechen kann ich dir nichts«, entgegnete der Kommissar.
Kurz vor dem besagten Termin klingelte Peters Telefon. Am anderen Ende der Leitung war Martin.
»Wie du es erwartet hast, entweder gibt es diesen Eduardo Monte nicht, oder es ist nicht sein richtiger Name. Das kannst du dir raussuchen. Nach allem, was du mir erzählt hast, tippe ich eher auf Letzteres. Was dafürsprechen würde, dass er sich an dich gewandt hat.«
Peter sah sich bestätigt. Etwas stimmte hier nicht. Also war Vorsicht geboten.
»Alles klar, ich weiß Bescheid«, gab er zu Antwort, verabschiedete sich, legte auf und lehnte sich zurück.
Sein Blick wanderte nach draußen in den Schlossgarten. Hier lief etwas im Hintergrund, von dem er keine Ahnung hatte und das fuchste ihn. Andererseits war nicht davon auszugehen, dass Monte ihm reinen Wein einschenken würde, sobald er ihn mit den Vorwürfen konfrontierte.
Er überlegte. Weit kam er nicht, denn einen Moment später stand Eduardo Monte in der Tür.
»Guten Tag, Herr Moriati. Wie geht es Ihnen?«, begrüßte er ihn jovial.
Peter drehte sich mit seinem Stuhl in Richtung der Tür und stellte seine Kaffeetasse auf den Schreibtisch.
»Ah, Herr Monte. Sie wollten sich bestimmt erkundigen, wie es bei der Suche nach Herrn Rommel vorangeht.«
»In der Tat«, antwortete sein Auftraggeber, »deshalb bin ich hier.«
»Wie soll man es am besten sagen«, fuhr Peter fort. »Ich habe Herrn Rommel gefunden.«
Ein zufriedenes Lächeln huschte über Montes Gesicht.
»Gleichwohl« schränkte Peter ein, »ist er gesundheitlich nicht auf der Höhe. Der Mann hat vor kurzem einen Schlaganfall erlitten. Und in dem Alter, Herr Rommel ist über siebzig, können Sie sicher vorstellen, dass da nicht mehr viel zu machen ist.«
Peter wartete auf die Reaktion seines Gegenübers, vermochte jedoch keine Regung in dessen Gesichtszügen erkennen. Gewollt oder nicht.
»Das ist bedauerlich«, antwortete Monte daraufhin. »Kann ich ihn besuchen? In welchem Krankenhaus liegt er denn?«
»Er befindet sich in einem Seniorenheim am Rand von Stuttgart.«
»Die Adresse bitte.« Sein Ton war fordernd.
Peter stand auf und ging um den Tisch.
»Hier haben Sie ihr Geld wieder. Betrachten Sie unsere Zusammenarbeit als beendet.«
Eduardo Monte schaute ihn ungläubig an.
»Was veranlasst sie dazu?«, fragte er.
»Sie verheimlichen mir etwas, und da bin ich ziemlich empfindlich. Ich habe Sie überprüfen lassen. Leider ohne Erfolg. Das heißt, Sie existieren nicht oder haben mir einen falschen Namen genannt.«
Er stützte sich mit beiden Händen am Schreibtisch ab.
Monte, seinerseits nestelte mit dem Umschlag herum. Mit dieser Reaktion hatte er nicht gerechnet. Offensichtlich gab es noch Ermittler, die nicht käuflich waren und eine Berufsehre hatten. Peter Moriati schien einer der wenigen zu sein.
»Sie sind ein Profi, das merkt man«, konstatierte er anerkennend. »Wie haben Sie es herausgefunden?«
»Das war nicht schwer. Zum einen ist der Altersunterschied zwischen Ihnen und der gesuchten Person zu groß, zum anderen war die Summe, die Sie mir geboten haben, schlicht und ergreifend viel zu hoch.«
Monte entspannte sich wieder.
»Chapeau. Sie sind nicht leicht aufs Glatteis zu führen«, meinte er und setzte sich, ohne zu fragen, auf die Couch, die am Fenster stand.
»Das bin ich in der Tat nicht«, antwortete Peter. »Was wollen Sie von diesem Herrn Rommel?«
Monte saß auf der Couch, schlug die Beine übereinander und sah Moriati an.
»Schließen Sie bitte die Tür«, forderte er ihn auf.
Peter gab Anette ein unauffälliges Zeichen und wandte sich Monte zu.
»Und nun legen Sie Ihre Karten auf den Tisch?«
»Das ist nicht leicht zu erklären. Formulieren wir es so: Herr Rommel hat etwas in seinem Besitz das ihm nicht gehört.«
»Handelt es dabei sich denn um Ihr Eigentum?«
»In gewissem Sinne, ja«, gab er zur Antwort. Gleichwohl kam die für Peters Geschmack zu zögerlich.
»Also nein«, konstatierte er treffend. »Wissen Sie, wenn ich Ihnen glauben, beziehungsweise helfen soll, wäre es von Vorteil Sie sagen mir alles. Ohne eine Vertrauensbasis zwischen uns brauchen wir hier nicht weiterreden. Ich bin nicht auf ihr Geld angewiesen und Sie nicht auf meine Hilfe.«
Es herrschte eine gespannte Ruhe. Peter lehnte mit vor der Brust verschränkten Armen am Schreibtisch und fixierte Eduardo Monte mit seinem Blick, was diesem eindeutigen Widerwillen bereitete.
»Na schön, Herr Moriati«, durchbrach er die Stille. »Rommel ist im Besitz eines wichtigen Schriftstückes, eines sogenannten Codex, der meinem Auftraggeber gehört. Ich bin damit betraut diesen wieder zurückzubringen. Der Codex stammt ursprünglich aus Ägypten, genauer gesagt aus der Gegend um Nag-Hamadi.«
»Aha, jetzt kommen wir der Sache näher«, brummte er zufrieden. »Erzählen Sie weiter. Wer ist ihr Auftraggeber?«
»Der Vatikan«, beeilte sich, Monte zu sagen.
Peter zog erstaunt seine Augenbrauen nach oben.
»Soso, die Kirche. Und wie kommt es, dass Herr Rommel unberechtigterweise in dem Besitz dieses Codex ist? Ich meine, der könnte genauso gut ihm gehören und Sie erzählen mir hier die Geschichte vom Pferd.«
»Herr Moriati, manche Vorgänge versteht man nicht auf den ersten Blick. Glauben Sie mir bitte, selbst wenn es Ihnen schwerfällt.«
Peter rieb sich das Kinn und dachte angestrengt nach.
»Sind Sie sich sicher, dass Herr Rommel im Besitz dieses Schriftstückes ist?«
»Nachdem ich jahrelang in dieser Sache recherchiert habe – ja.« Seine Antwort kam überzeugend, dennoch blieb Peter misstrauisch. Monte spielte eindeutig nicht mit offenen Karten und hielt ihm gegenüber Informationen zurück.
»Na schön. Ich möchte vorher einen Freund von mir, einen Professor für Mediävistik zu Rate ziehen, um zu überprüfen, ob Sie die Wahrheit sagen oder nicht. Sie willigen ein, ansonsten helfe ich ihnen nicht.«
»Wenn es Sie weiterbringt«, knirschte Monte. »Aber ich bezahle nur sie.«
»Darüber brauchen sie sich keine Gedanken zu machen. Der ist froh, wenn er was zu tun hat«, wischte Peter dessen Bedenken beiseite.
Peter hatte Richard am Abend des selbigen Tages angerufen und ihm die Geschichte erzählt. Nach einigem Zögern erklärte er sich bereit, ihm zu helfen.
»Guten Morgen Richard«, begrüßte Anette ihn am nächsten Tag, als der mit einem Stapel Papieren unter dem Arm und seiner Lesebrille auf der Nase ins Büro trat.
»Morgen, du alter Bücherwurm«, entgegnete Peter seinen Spezi. »Ich habe dir da drüben einen Tisch und einen Laptop hingestellt. Falls du was Zusätzliches benötigst, lass es mich wissen.«
»Einen Kaffee«, antwortete der.
»Was?«
»Du wolltest wissen, was ich brauche. Einen Kaffee, sonst ist an Arbeit nicht zu denken. Wobei ich mir ehrlich gesagt nicht erklären kann, wozu ich gebraucht werde.«
»Das weiß ich auch noch nicht«, erwiderte Peter leicht genervt, weil sein Computer ihn wieder im Stich ließ, und fügte dann süffisant hinzu: »Aber so habe ich wenigstens Unterhaltung.«
Anette hatte Richard derweil einen Kaffee auf seinen Schreibtisch gestellt, solange der sich provisorisch einrichtete.
»Was ist das überhaupt für ein Codex, von dem dieser Monte erzählt hat?«, erkundigte sich Richard.
»Da lässt er nichts raus. Er sagt nur, er arbeitet für den Vatikan und der Codex ist fälschlicherweise in die Hände von Gustav Rommel gelangt. Auf mich hat er jetzt nicht den Eindruck eines Diebes oder abgebrühten Betrügers gemacht. Ich glaube eher, der alte Mann hat keine Ahnung, was er da sein Eigen nennt. Und ich gehe davon aus, dass Monte mir beziehungsweise uns, das nicht zwingend verraten will.«
»Wir stochern also im Nebel. Ziemlich viel Bohei wegen eines ach so harmlosen Codex«, sinnierte Richard. »Was weißt du denn darüber?«
Peter zuckte hilflos mit den Schultern. Deswegen hatte er ihn ja geholt.
»Nur das in Ägypten nordöstlich von Nag-Hamadi gefunden wurde. Weiß der Geier wo das ist.«
»Nag-Hamadi sagst du? Das kommt mir bekannt vor«, unterbrach ihn Richard. »Lass mich mal nachschauen.«
Er suchte in seinen Unterlagen, tippte etwas in den Laptop ein und wurde alsbald fündig.
Peter versuchte derweil verzweifelt, den drohenden Datenverlust seines Computers zu unterbinden, und rief hilfesuchend nach Anette. Die kam auch gleich, gab ein paar Befehle in die Tastatur und Peters Problem hatte sich in Wohlgefallen aufgelöst.
»Wenn sich alle Probleme mit Mausklicks lösen ließen, wäre mir das arg recht«, brummte er.
»Nag-Hamadi?«, vergewisserte sich Richard und hielt ein Stoß Papiere in der Hand.
»Ich glaube so oder so ähnlich hat sich das angehört«, grübelte Peter.
»In Nag-Hamadi fanden Ende der vierziger Jahre dort ansässige Schneidern in einem Tonkrug eher zufällig einige sehr alte Schriften und Kodizes. Die sind dann über Umwege ins Museum in Kairo gelandet. Man weiß aber nicht genau, ob die Bauern oder Beamten sich nicht einige der Schriften abgezweigt und anderweitig zu Geld gemacht haben. Insoweit könnte, vom zeitlichen Rahmen, der Herr Rommel durchaus im Besitz eines solchen Kodex sein. Möglicherweise hat er ihn auf einen dieser Basare erstanden. Ob der allerdings von unschätzbarem Wert ist, wie dieser Monte behauptet, kann ich erst sagen, wenn ich ihn gesehen habe«, schloss Richard seine Ausführungen.
»Hmm, ich gehe schwer davon aus, dass es sich um keinen gewöhnlichen Codex handelt. Warum sonst sollte der Vatikan so ein reges Interesse daran haben? Und überhaupt, würde mich interessieren, wie der Monte auf den Rommel kommt. Die müssen beide in ihrer Vita eine Schnittstelle haben.«
»Du bist der Privatermittler«, stellte Richard trocken fest. »Finde es heraus.«
Das brauchte man Peter nicht zweimal sagen.
»Wovon du ausgehen kannst. Ich werde den Rommel mit meinen Vermutungen konfrontieren. Wer weiß, manchmal hilft ein offenes Gespräch«, insistierte Peter.
Er wollte sein Vorhaben gerade in die Tat umsetzen und hatte den Hörer schon in der Hand, da erschien, zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt, erneut Eduardo Monte im Büro. Unangemeldet wohlgemerkt.
»Ah, sie sind bestimmt der Herr Schneider«, begrüßte ihn Monte freundlich, als er Richard erblickte.
Der Angesprochene zog seine Brille ab und musterte den hageren Mann.
»Professor Doktor Richard Schneider. Die Zeit muss sein«, tadelte er ihn. »Und wer sind Sie?«
»Entschuldigen sie Professor Schneider. Es war keine Absicht, Ihren Titel zu unterschlagen. Mein Name ist Eduardo Monte.«
Dann wandte er sich Peter zu und grüßte ihn ebenfalls, bevor er sich auf die Couch setzte.
»Wie gehen Sie weiter vor, Herr Moriati?« Er sah ihn entschieden an.
Peter mochte es überhaupt nicht, wenn man ihn in irgendeiner Form unter Druck setzte oder wie Monte meinte, er müsse jetzt das Heft des Handelns in die Hand nehmen und täglich ohne Anmeldung hier hereinspazieren.
»Sie erzählen uns erstmal, um was für einen Codex aus den Nag-Hamadi Papieren es sich da handelt. Dann sehen wir weiter.«
Monte sah ihn fragend an. Mit der Antwort hatte er nicht gerechnet.
Peter stand auf, um sich erneut einen Kaffee einzugießen. Heute Morgen war ihm die Idee gekommen, das anregende schwarze Gebräu aus der Arabica-Bohne in einer Thermoskanne auf seinen Schreibtisch zu stellen. So musste er nicht immer Anette behelligen. Warum er nicht früher auf diese Idee kam, war ihm auch nicht ganz klar.
Im Stillen frohlockte er, dass er Monte mit seiner Aussage augenscheinlich ins Schlingern gebracht hatte.
»Wie kommen sie darauf, dass der Codex, den ich suche zu den Nag-Hamadi-Schriften gehört?«, wandt er sich.
»Weil es zeitlich nah beieinander liegt. Der Fund und der Aufenthalt von Gustav Rommel in Ägypten. Er hielt sich damals in der Nähe auf. Es spricht also einiges dafür, dass der von Ihnen gesuchte Codex aus diesem Fund stammt.«
Er stand auf und ging um seinen Schreibtisch. Dabei ließ er Monte nicht aus den Augen. Der rutschte nervös auf der Couch umher.
»Damit komme ich zum Pudels Kern, wie man so schön sagt: Was ist an diesem Codex so interessant, oder sollte ich besser sagen – brisant? Und erzählen Sie mir nicht, dass Sie im Dienste des Vatikan in irgendeiner wissenschaftlichen Sache unterwegs sind. Das kaufe ich Ihnen nicht ab. Der Codex besitzt eine gewisse Sprengkraft, sonst würde die Kirche nicht jemanden, wie Sie schicken, um ihn wiederzubeschaffen.«
»Einen wie mich?«
In Eduardo Monte arbeitete es. Man sah ihm den inneren Kampf an, den er ausfocht.
Peter ignorierte die Frage.
»Ich höre«, bohrte er weiter. Er war sich sicher, dass er ihn so weit hatte. Vom ehemals großspurigen Auftreten war nichts mehr übrig.
Monte seinerseits schien zu ahnen, dass er auf Peters und Richards Hilfe angewiesen war, wollte er den Codex wiederbeschaffen.
»Na gut«, presste er es mühsam hervor. »Sie haben in gewisser Hinsicht recht. Ungeachtet dessen warne ich sie, wenn sie von nun an mitmischen, muss ihnen bewusst sein, dass ihr Leben in Gefahr ist.«
Peter zuckte mit den Schultern. Da spuckte jemand große Töne, um sich wichtiger zu machen, wie er war. Das kannte er aus seiner Zeit als Polizist. Richard schob seine Lesebrille nervös nach oben. Ihm schien bei dem Gedanken, dass die Sache gefährlich werden könnte, nicht Wohl. Letztlich war die Neugier größer.
»Sind Sie mit dem Begriff der Gematrie vertraut?«
Peter zuckte erneut mit den Schultern und sah zu Richard. Dessen Augen leuchteten bei der Erwähnung des Namens.
»Das ist die Technik der Interpretation von Buchstaben und Zahlen im Hebräischen. Nur wichtige Texte wurden mit dieser Methode verschlüsselt.«, antwortete er, kaute auf seiner Lesebrille und lehnte sich zurück. »Ist das so ein Codex? Ich hatte vor einigen Jahren eine Studentin, die hat sich für dieses Thema begeistert. Leider kam sie nicht weit. Ihre Anfragen wurden vom Vatikan abgeblockt, beziehungsweise ignoriert.«
»Es heißt, dass sich unter den in Ägypten gefundenen Schriften tatsächlich ein Text, den man mittels der Gematrie verschlüsselt hat. Es handelt sich um einen sehr alten Codex, den sogenannten Codex In Vita Aeternitas« erwiderte Monte mit fester Stimme.
»Es gibt dazu eine Legende«, erläuterte Richard, »die besagt, dass die Tempelritter ihn gefunden haben, während sie Jerusalem besetzten. Mit diesem Wissen haben sie den Papst und die Kirche erpresst. Es soll sich dem Vernehmen nach um irgendwelche Auserwählte Gottes handeln. Gleichwohl weiß bis zum heutigen Tag niemand, ob es eine Aufzeichnung dieser Linie gibt und welche Relevanz sie hat. Aber womöglich war dieser Codex In Vita Aeternitas bedeutend genug, sodass der Papst den Tempelrittern derartige Macht und Befugnisse zugestanden hatte. Kann es sein, dass sie ihn suchen?«
Es entstand eine spannungsgeladene Stille, die sich eine gefühlte Ewigkeit hinzog.
»Ja. Dieser Codex gibt uns einen Hinweis auf eine Stammlinie.«
»Und was steht da drin?«, erkundigte sich Peter.
»Namen«, war die kurze und knappe Antwort.
»Namen? Nur das?« Er schaute Eduardo Monte ungläubig an.
»Es ist eine Stammlinie, die bis zum Anfang der Menschheit zurückgeht, mehr nicht.«
»Wirklich?«, argwöhnte Richard. »Warum ist der Codex dann derart bedeutsam für sie? Wenn es nur das ist, den Stammbaum bis Adam und Eva können sie genauso gut in der Bibel nachlesen. Steht im dritten Buch des Evangeliums des Lukas.«
»Sie müssen versuchen, dass aus unserem Blickwinkel zu sehen. Für uns hat dieser Codex eine Bedeutung, die sie vermutlich nicht begreifen werden.«
»Sie halten uns für unterbelichtet, Herr Monte«, antwortete Peter. »Täuschen Sie sich da nicht. Wenn wir etwas nicht verstehen, dann fragen wir nach. Immerhin haben wir einen Professor für Altertum hier im Raum. Der hilft uns aus, falls es Wissenslücken gibt.«
Monte sah, dass es nichts half. Er musste die sprichwörtlichen Hosen runterlassen, auch wenn es ihm nicht schmeckte nun zwei weitere Personen in dieses uralte Geheimnis einzuweihen. Nichtsdestotrotz hielt er sich mit Informationen zurück.
»Und das sollen wir Ihnen abnehmen?«, fragte Peter im Anschluss ungläubig.
»Sie waren derjenige, der es wissen wollte, ob sie es glauben, ist ihre Sache.« Monte schien ob der Antwort von Peter genervt.
»Helfen sie mir nun, an den Codex zu kommen, oder nicht?«, hakte er nach.
Peter sah Richard an. Sein Gesichtsausdruck war eindeutig.
»Gut, Monte«, seufzte er. »Aber sie überlassen es mir, an Rommel ranzukommen. Ich habe bereits mit ihm gesprochen und glaube, dass er mir vertraut. Das Pfund verspiele ich nicht. Des Weiteren wäre es von Vorteil, sie telefonisch zu erreichen. Für den Fall, dass etwas Unvorhergesehenes passiert.«
Eduardo Monte willigte ein und schrieb ihm eine Telefonnummer auf ein Blatt Papier. Dann verabschiedete er sich und verschwand aus dem Büro.
Peter setzte sich wieder an seinen Platz und sah zu Richard rüber.
»Das hättest du alter Sack nicht gedacht, nochmal in so ein Abenteuer einzusteigen«, grinste er.
Der schien mit sich im Reinen.
»Das mir das passiert, dafür danke ich dem Allmächtigen auf Knien. Vielleicht komm ich ja noch zu höheren Weihen«, seufzte er.
»Immer vorausgesetzt, die Story stimmt. Ich hab da meine Zweifel. Der Kerl erzählt uns nicht alles. Nur das, was sich eh nicht verheimlichen lässt. Auf all das wären wir im Laufe der Nachforschungen früher oder später sowieso gestoßen. Nein, Richard, da steckt noch mehr dahinter«, konstatierte Peter.
Er sollte recht behalten.
Peter brachte Richard mit seinem Auto nach Hause. Er ersparte sich die Frage, wie jener heute Morgen den Weg in sein Büro gefunden hatte.