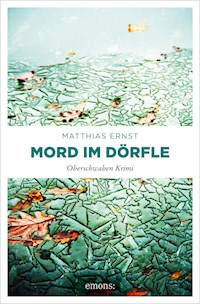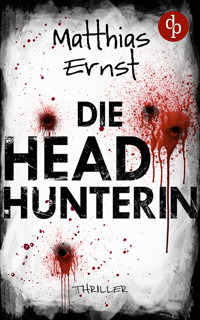5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dp DIGITAL PUBLISHERS GmbH
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Ein nie gesühntes Verbrechen – verborgen in Träumen, die es zu entschlüsseln gilt
Der packende Thriller für Fans von Dan Brown und Nicci French
Als der Schriftsteller Christopher Maddock tot aufgefunden wird, ist das Interesse der Yellow Press enorm. Sie beschuldigt den Londoner Psychotherapeuten John Burgess, einen Behandlungsfehler begangen zu haben, der zum Suizid des Schriftstellers führte. Doch dann wird John ein Tagebuch zugespielt, in dem Maddock seine Albträume notiert hat. Zusammen mit seiner Tochter Poppy beginnt John, die Träume zu deuten und findet Hinweise darauf, dass Maddocks Tod kein Suizid war. Aber Johns Recherchen wecken mächtige Gegner und bald muss er um viel mehr fürchten als nur um den Fortbestand seiner Praxis …
Erste Leserstimmen
„das spannende Thema der Traumdeutung wurde unglaublich packend bearbeitet“
„Bedrückend, fesselnd und kaum aus der Hand zu legen!“
„Thriller-Fans kommen hier voll auf ihre Kosten“
„Pure Gänsehaut beim Lesen, absolute Empfehlung!“
„Voller packender Wendungen, mit denen selbst ich als erfahrener Krimi-Leser nicht gerechnet habe.“
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 599
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Kurz vorab
Willkommen zu deinem nächsten großen Leseabenteuer!
Wir freuen uns, dass du dieses Buch ausgewählt hast, und hoffen, dass es dich auf eine wunderbare Reise mitnimmt.
Hast du Lust auf mehr? Trage dich in unseren Newsletter ein, um Updates zu neuen Veröffentlichungen und GRATIS Kindle-Angeboten zu erhalten!
[Klicke hier, um immer auf dem Laufenden zu bleiben!]
Über dieses E-Book
Als der Schriftsteller Christopher Maddock tot aufgefunden wird, ist das Interesse der Yellow Press enorm. Sie beschuldigt den Londoner Psychotherapeuten John Burgess, einen Behandlungsfehler begangen zu haben, der zum Suizid des Schriftstellers führte. Doch dann wird John ein Tagebuch zugespielt, in dem Maddock seine Albträume notiert hat. Zusammen mit seiner Tochter Poppy beginnt John, die Träume zu deuten und findet Hinweise darauf, dass Maddocks Tod kein Suizid war. Aber Johns Recherchen wecken mächtige Gegner und bald muss er um viel mehr fürchten als nur um den Fortbestand seiner Praxis …
Impressum
Erstausgabe Dezember 2020
Copyright © 2025 dp Verlag, ein Imprint der dp DIGITAL PUBLISHERS GmbH Made in Stuttgart with ♥ Alle Rechte vorbehalten
E-Book-ISBN: 978-3-96817-179-1 Taschenbuch-ISBN: 978-3-96817-367-2 Hörbuch-ISBN: 978-3-96817-186-9
Covergestaltung: Rose & Chili Design depositphotos.com: © zhuzhu, © VadimVasenin shutterstock.com: © MaxyM, © Ilina93 Lektorat: Daniela Pusch
E-Book-Version 25.09.2025, 15:57:32.
Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Sämtliche Personen und Ereignisse dieses Werks sind frei erfunden. Etwaige Ähnlichkeiten mit real existierenden Personen, ob lebend oder tot, wären rein zufällig.
Abhängig vom verwendeten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Unser gesamtes Verlagsprogramm findest du hier
Website
Folge uns, um immer als Erste:r informiert zu sein
Newsletter
TikTok
YouTube
Jetzt auch als Hörbuch verfügbar!
Ein nie gesühntes Verbrechen – verborgen in Träumen, die es zu entschlüsseln gilt.Der packende Thriller für Fans von Dan Brown und Nicci French.
Für Cordula
Prolog
„D’Artagnan muss sterben!“
Athos lehnte sich zurück und beobachtete, welche Wirkung seine Worte auf die beiden Männer in den ledergepolsterten Ohrensesseln hatten. Porthos drehte eine Zigarre mit den Fingern hin und her und fixierte dabei ohne eine sichtbare Gemütsregung die rotglühende Spitze. Aramis dagegen war eine Spur bleicher geworden. Er blinzelte nervös und sein Adamsapfel hüpfte hektisch auf und ab. Sein Handy piepste. Er warf einen Blick darauf, schob es mit zitternden Fingern zurück in die Jackentasche und sagte:
„Nein, das dürfen wir nicht tun. Er ist einer von uns“, stieß er heiser hervor. „Habt ihr es vergessen: Einer für alle, alle für einen?“
„Er war einer von uns“, sagte Porthos, den Blick noch immer auf die Zigarrenspitze gerichtet. „Athos hat recht. Es ist zu riskant. Unser Vorhaben ist in die entscheidende Phase getreten. D’Artagnan könnte alles zum Scheitern bringen. Nun heißt es: Einer gegen alle, alle gegen einen!“
Aramis hob die Hände in einer flehenden Geste. „Ich habe euch doch gesagt, dass ich ihn unter Kontrolle habe!“
„Ich weiß nicht, was du unter Kontrolle verstehst“, knurrte Porthos. „Denn das hier sieht mir viel eher nach einem veritablen Amoklauf aus.“ Er deutete auf den Brief, der vor ihnen auf dem Couchtischchen lag.
„Gebt mir noch eine Chance! Ich rücke ihm den Kopf wieder gerade. Er hatte doch schon häufiger seine Aussetzer. Und trotzdem hat er immer geschwiegen“, bat Aramis.
Athos schüttelte den Kopf. „Ich hatte von Anbeginn an Zweifel an deinem Plan. Um unserer Freundschaft mit D’Artagnan willen habe ich dich gewähren lassen. Doch nun zeigt sich, dass meine Skepsis berechtigt war. Er könnte uns alle ins Verderben stürzen. So kurz vor dem Ziel dürfen wir dieses Risiko nicht eingehen. Wir standen schon einmal vor einer Entscheidung wie dieser. Damals war es der richtige Weg. So wird es auch dieses Mal sein: D’Artagnan muss sterben.“
Aramis senkte den Blick. Er atmete schwer. Seine rechte Hand zuckte.
„Wer soll es tun?“, fragte Porthos.
„Den Urteilsspruch verkünden wir D’Artagnan gemeinsam. Die Strafe kann Grimaud ihm zuteilwerden lassen“, sagte Athos.
Porthos nickte. „Dann bliebe noch der Mitwisser. Um den kümmere ich mich persönlich. Mousqueton ist gerade mit anderen Dingen beschäftigt“, sagte er.
Aramis sah wieder auf. „Wir können doch nicht …“
Porthos hob die Hand und sein Gefährte verstummte. „Keine Sorge, ich werde dem Mann nicht ein Haar krümmen. Lass mich nur machen. Wenn es darum geht, jemanden zum Schweigen zu bringen, gibt es effektivere Methoden als den Tod.“
1. Kapitel: John
„Da liegt dieses Messer auf dem Tisch. Meine Mutter kehrt mir den Rücken zu. Ich bin wütend. So unendlich wütend. Und dann … dann stelle ich mir vor, wie ich das Messer ergreife und es ihr tief in den Hals stoße. Nein, ich stelle es mir nicht nur vor. Ich spüre den Drang, nach dem Messer zu greifen, es zu tun. Es ist so furchtbar!“
Dr. John Burgess musterte seinen Klienten. Sir Edmund Hathaway war ein kleiner, untersetzter Mann mit einem eiförmigen, kahlen Schädel. Er musste nach jedem zweiten Satz die randlose Brille nach oben schieben, da diese auf dem verschwitzten Nasenrücken unweigerlich der Schwerkraft folgte. Seine zitternden Hände steckten in blütenweißen Glacéhandschuhen.
„Jede Nacht träume ich davon, wie ich sie töte. Auf jede nur erdenklich Weise“, fuhr Sir Edmund fort.
Die dicken Tropfen auf seiner Stirn glitzerten und funkelten im Licht der Deckenstrahler. In regelmäßigen Abständen wischte er sich den Schweiß ab. Dazu nahm er jeweils ein frisches Tuch aus einer Plastiktüte auf seinem Schoß, das er nach Gebrauch in den Papierkorb neben dem Stuhl warf.
John notierte etwas auf dem karierten Block, der auf seinen Knien lag. Er spürte, wie sich seine Kiefermuskulatur auf ein Gähnen vorbereitete, und steuerte mit aller Macht dagegen an.
„Und dann wache ich schreiend auf und mein Pyjama ist derart durchgeschwitzt, dass ich die Wäsche wechseln muss. Das geschieht bisweilen drei- oder viermal pro Nacht.“
John nickte. Er beschloss, an dieser Stelle einzuhaken, um seinem Klienten die Möglichkeit zu geben, aus dem Sog der schwarzen Gedanken auszusteigen und sich stattdessen auf die Gegenwart zu fokussieren. Zudem hoffte er darauf, durch eine aktivere Rolle die bleierne Müdigkeit zu vertreiben, die ihn zu überwältigen drohte.
„Wir haben ja schon die letzten Male darüber gesprochen, dass es sich bei den Fantasien, die Sie Ihrer Mutter gegenüber hegen, um Zwangsgedanken handelt. Erinnern Sie sich noch daran?“, fragte er.
Sir Edmunds Augen verengten sich zu zwei schmalen Schlitzen. „Ob ich mich daran erinnere? Natürlich. Ich bin ja schließlich nicht dement.“
„Gut“, sagte John, erfreut darüber, dass es seinem Klienten so rasch gelungen war, von der Angst und dem Ekel, den die Erinnerung an seine Zwangsgedanken hervorgerufen hatte, in eine erdige Gereiztheit zu wechseln. „Wir haben darüber gesprochen, dass die Vorstellung Sie ängstigt, Sie könnten Ihrer Mutter so etwas antun.“
„Sie ängstigt mich nicht nur, sie widert mich an!“, rief Sir Edmund.
„Sie empfinden Angst und Ekel. Diese Gefühle entstehen, weil Sie Ihre Fantasien als eine reale Gefahr bewerten.“
„Aber Sie sind real! Ich habe nicht nur irgendwelche verrückten Gedanken. Ich spüre, wie meine Hand in Richtung der Schublade mit dem Küchenmesser zuckt, wenn ich meiner Mutter gegenüberstehe. Und nicht einmal im Schlaf habe ich Ruhe. Ich träume davon. Jede Nacht. Da muss doch etwas tief in mir sein, das mich dazu drängt, meine Mutter zu töten. Ich kann mir nicht mehr trauen!“
Er schlug die erstaunlich kleinen Hände vor das Gesicht und schluchzte.
„Genau das ist die große Schwierigkeit an Zwangsgedanken“, sagte John. „Sie fühlen sich real an. So real, dass wir zu glauben versucht sind, sie hätten tatsächlich eine tiefere Bedeutung und könnten uns etwas über unsere furchtbarsten und abgründigsten Wünsche erzählen. Aber sie sind nicht real. Sie haben keinen verborgenen Sinn. Sie sind Gedanken. Nicht mehr und nicht weniger.“
John lehnte sich vor.
„Sir Edmund, seit fünfundzwanzig Jahren leiden Sie unter Zwangsgedanken. Sie haben Ihrer Mutter bisher nichts angetan und Sie werden ihr auch zukünftig nichts antun. Genauso wenig, wie Menschen in einer vollbesetzten Kirche plötzlich dem Drang nachgeben, aufzustehen und Obszönitäten von sich zu geben. Zwangsgedanken sind menschlich. Jeder von uns hat sie. Doch niemand führt sie aus.“
„Das können Sie mir nicht garantieren“, sagte Sir Edmund. Er ließ die behandschuhten Hände sinken und schniefte. John reichte ihm ein Kleenex aus dem auf dem Tisch bereitstehenden Spender, da sein Klient die mitgebrachten Tücher in der Plastiktüte ausschließlich für den Schweiß auf seiner Stirn reserviert hatte.
„Natürlich kann ich Ihnen nichts garantieren“, sagte John. „Das ist eine der Schwierigkeiten der menschlichen Existenz. Nichts ist zu hundert Prozent sicher. Sie könnten Ihre Träume und Fantasien in die Tat umsetzen. Genauso wie Sie beim Verlassen meiner Praxis von einem Meteoritenschauer getroffen und getötet werden könnten. Beides ist nicht unmöglich. Aber unwahrscheinlich. Extrem unwahrscheinlich.“
„Und was, wenn ich es doch tue? Obwohl es unwahrscheinlich ist. Ich bin ja nicht irgendwer. In jeder Statistik gibt es Ausreißer. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es Menschen gibt, die die gleichen Gedanken hegen wie ich.“
„Viele Menschen leiden unter Zwangsgedanken und Albträumen“, erwiderte John. „Die Statistiken zeigen, dass bis zu zwei Prozent der Bevölkerung regelmäßig ähnlich belastende Fantasien haben wie Sie. Bei acht Millionen Londonern wären das …“
„160.000. Das habe ich auch schon gelesen. In diesem Selbsthilfebuch, das Sie mir empfohlen hatten. Aber ich glaube Ihnen das nicht.“
John lehnte sich zurück und musterte Edmund. Sie waren an einem kritischen Punkt der Therapie angekommen. Nun würde sich zeigen, ob die Arbeitsbeziehung, die sie in den letzten beiden Stunden aufgebaut hatten, tragfähig genug war, um Hathaway ein realistischeres Therapieziel schmackhaft zu machen.
„Was erwarten Sie von mir?“, fragte John.
„Ich erwarte von Ihnen, dass Sie mir dabei helfen, diese Fantasien loszuwerden. Ich will sie nicht haben. Ich bin kein grausamer Mensch. Ich liebe meine Mutter. Ich …“
Er brach erneut in Tränen aus und John reichte ihm ein weiteres Taschentuch. Sir Edmund schnäuzte sich geräuschvoll.
„Ich kann Ihnen nicht dabei helfen, diese Fantasien loszuwerden“, sagte John.
Hathaways Augen weiteten sich. „Was soll ich dann bei Ihnen?“, fragte er. „Ich bezahle doch nicht 150 £ pro Sitzung, wenn Sie mir nicht helfen können.“
Er erhob sich.
Johns Nackenmuskulatur krampfte sich schmerzhaft zusammen.
„Warten Sie“, sagte er, eine Spur zu laut.
„Warum, wenn das hier nur eine Zeitverschwendung ist?“
John schüttelte den Kopf. „Nehmen Sie bitte wieder Platz!“
Sir Edmund zögerte. John schluckte schwer. Hinter seiner rechten Schläfe erwachte ein unangenehmes Pochen, das er nur zu gut kannte. Vor seinem inneren Auge sah er seinen Klienten schon aus dem Raum eilen. Das wäre nicht nur das Ende ihrer therapeutischen Beziehung. Es wäre eine Katastrophe. Für beide Seiten.
Sir Edmund stand auf halbem Weg zwischen dem Sessel und der Tür. John konnte inzwischen auch auf den Handschuhen Schweißflecke erkennen. Hathaway zeigte eine deutliche Stressreaktion. Es wäre nur zu verständlich gewesen, wenn er geradewegs aus dem Raum gestürmt wäre. Er schloss die Augen und seine bleichen Lippen bewegten sich stumm. Dann trat er einen Schritt auf John zu und setzte sich wieder in den bequem gepolsterten Korbsessel. John entspannte sich. Er spürte, wie seine hochgezogenen Schultern sich langsam senkten.
„In einer Therapie geht es nicht darum, Dinge loszuwerden“, sagte er. „Es geht darum, zu lernen, mit belastenden Erfahrungen zurechtzukommen. Die Zwangsgedanken schränken Ihr Leben ein. Sie nehmen sie als derart bedrohlich wahr, dass Sie ihnen viel Zeit widmen. Das wiederum gibt den Gedanken mehr Raum. Sie wirken noch stärker. Sie lassen Ihnen ja nicht einmal nachts Ihre Ruhe. Und irgendwann übernehmen die Gedanken die Kontrolle über Ihr ganzes Leben.“
„Und genau deswegen will ich sie nicht mehr haben.“
„Das ist verständlich“, sagte John. „Aber es ist kein Ziel, auf das wir hinarbeiten können. Gedanken lassen sich nicht einfach amputieren wie ein Raucherbein.“
„Und was für ein Ziel halten sie stattdessen für realistisch?“, fragte Sir Edmund.
John atmete tief durch. Hathaways Skepsis war mit Händen zu greifen, aber die Art der Frage deutete an, dass er zumindest bereit war, seinen Therapeuten anzuhören. „Zurzeit haben die Gedanken die Kontrolle über Sie. Wir können gemeinsam versuchen, den Spieß umzudrehen und die Kontrolle über die Gedanken zurückzugewinnen.“
Sir Edmund legte den Kopf so schief, dass sein leicht abstehendes linkes Ohr die gepolsterte Schulter des Tweedjacketts berührte.
Das Pochen hinter Johns rechter Schläfe wurde lauter und drängender. Würde Hathaway das Therapieziel akzeptieren? Oder würde er die Behandlung doch abbrechen?
„Ich werde über Ihre Worte nachdenken“, sagte Sir Edmund schließlich und erhob sich. „Dann sehen wir uns morgen zur selben Zeit wieder.“
Johns rechte Augenbraue schoss nach oben.
„Aber … nein“, sagte er. „Unsere Termine finden einmal wöchentlich statt.“
Sir Edmunds Augen verengten sich zu Schlitzen und auf einen Schlag war jede Schwäche, jede Unsicherheit verschwunden.
„Ich werde ganz bestimmt nicht bis nächste Woche warten. Das können Sie vielleicht mit einer dieser alten Schachteln machen, die sich bei Ihnen über ihre Eheprobleme ausweinen, aber nicht mit mir. Entweder Sie geben mir für morgen Früh einen neuen Termin oder ich sehe mich gezwungen, mir einen anderen Therapeuten zu suchen.“
John schluckte schwer. Es drängte ihn dazu, zu widersprechen, eine Grenze zu setzen. Aber damit würde er riskieren, dass Hathaway sich doch noch für einen Abbruch der Therapie entschied. Und das durfte er nicht zulassen.
„Lassen Sie sich bitte von meiner Sprechstundenhilfe einen Termin geben, Sir Edmund“, sagte er schließlich.
Ein zufriedenes Lächeln huschte über Hathaways Mondgesicht. Er holte eine weitere Plastiktüte aus seiner Jacketttasche und entnahm ihr eine Mundschutzmaske. Nachdem er diese über Nase und Lippen fixiert hatte, deutete er eine Verneigung an, wandte sich um und verließ den Raum.
Kaum hatte die Tür geschlossen, sank John in die Polster des Korbsessels. Er atmete tief aus und stieß dabei einen Laut zwischen seinen zusammengebissenen Zähnen hervor, den ein unbeteiligter Beobachter leicht als eingebildeter Fatzke deuten hätte können.
Er fühlte sich schwer. So unendlich schwer. Und dabei war es doch erst Montag. Und der Arbeitstag hatte gerade eben erst begonnen. Fünf weitere Klienten warteten noch darauf, nach den Regeln der Psychotherapeutenkunst behandelt zu werden. Dieser Gedanke drückte ihn tiefer in die weichen Kissen.
John schloss die Augen und versuchte, sich mit einer simplen Übung zu erden. Er atmete ein und dann doppelt so lange wieder aus. Schon nach wenigen Wiederholungen spürte er, wie das Pochen hinter der rechten Schläfe nachließ, die Muskeln im Nacken sich lockerten und der Ärger darüber, von Sir Edmund überrumpelt worden zu sein, abflaute.
Ein Klopfen an der Tür beendete den allzu kurzen Augenblick des Friedens. John öffnete die Augen und rief: „Ja, bitte?“
Ein hübsches, junges Gesicht, das von glänzenden, tiefschwarzen Haaren umrahmt wurde, schob sich durch den Spalt zwischen Tür und Rahmen.
„Linda“, sagte John und erhob sich. „Kommen Sie rein!“
Die Sprechstundenhilfe trat auf ihn zu.
„Was gibt es?“, fragte er.
„Ich habe Sir Hathaway einen Termin am Mittwochvormittag gegeben. Morgen war keiner mehr frei.“
John spürte, wie die Nackenmuskulatur sich erneut verhärtete und die Schultern nach oben strebten.
„Wie hat er reagiert?“, fragte er, bemüht darum, Linda seine Anspannung nicht anmerken zu lassen.
„Naja“, sagte sie und ihre Mundwinkel zuckten in der Andeutung eines amüsierten Lächelns nach oben. „Er hat sich natürlich ein bisschen aufgeplustert hinter seinem Mundschutz. Alter Adel und so. Aber dann habe ich ihm erklärt, dass er in ganz London keinen fähigeren Therapeuten finden wird als Sie. Und dann war er plötzlich wieder so klein, wie er tatsächlich ist.“
John ließ die Schultern sinken. „Danke, das haben Sie gut gemacht. Auch wenn das mit meinen therapeutischen Fähigkeiten eine maßlose Übertreibung war.“
Linda zwinkerte ihm zu. „Der Zweck heiligt die Mittel. Sir Hathaway wird wiederkommen.“
„Ihr Wort in Gottes Ohr“, sagte John.
Linda sah ihn aufmerksam an. „Na, auf Patienten wie ihn könnten Sie doch sicher auch verzichten. Ich meine … ich kenne mich ja nicht aus, aber der wirkt wie eine ziemliche Nervensäge. Müssen Sie sich so jemanden wirklich antun?“
John seufzte. Er rang mit sich, unsicher, ob er dieses Gespräch mit seiner Sprechstundenhilfe führen wollte. Aber es war besser, wenn sie gleich von Anfang an Bescheid wusste.
„Wie lange sind Sie jetzt schon bei uns?“, fragte er.
„Seit drei Wochen“, erwiderte Linda.
John nickte. „Und Dr. Hamilton und ich sind wirklich froh, dass wir so rasch einen Ersatz für Ihre Vorgängerin gefunden haben. Ich selbst habe auch nur fünf Wochen mehr Erfahrung mit dieser Praxis als Sie.“
„Sie sind als neuer Teilhaber eingestiegen, das hat mir Dr. Hamilton schon im Vorstellungsgespräch erzählt.“
John nickte. „Nun, wovon er Ihnen wahrscheinlich nichts erzählt hat, ist die traurige Tatsache, dass ich mich für diese Teilhaberschaft ziemlich hoch verschulden musste. Dr. Hamilton kann sich seine Klienten aussuchen. Ich nicht. Ich bin darauf angewiesen, jeden zu behandeln, der bereit ist, 150 £ pro Stunde zu bezahlen.“
„Oje, dann drücke ich Ihnen die Daumen, dass Sir Hathaway am Mittwoch auch wirklich kommt. Oder dass er wenigstens zu spät absagt. Dann können wir ihm das volle Honorar berechnen.“
John kam nicht umhin, Lindas Äußerung mit einem beifälligen Grinsen zu quittieren, wurde jedoch rasch wieder ernst.
„Ob Sie es glauben, oder nicht“, sagte er. „Mir wäre nicht nur aus finanziellen Gründen daran gelegen, dass Sir Hathaway zu seinem nächsten Termin kommt. Er hat einen hohen Leidensdruck und ich glaube, dass ich ihm helfen kann. Er mag nach außen schroff und snobistisch wirken, aber in seinem Innern geht es ihm gar nicht gut.“
Linda warf ihm einen skeptischen Blick zu. „Na, wenn Sie meinen“, sagte sie. „Ach, übrigens soll ich Sie noch daran erinnern, dass Sie Ihre Tochter Poppy am Bahnhof abholen wollten.“
John schlug sich gegen die Stirn. „Oje, das hätte ich fast vergessen.“
„Naja, dafür haben Sie ja eine Sprechstundenhilfe. Aber machen Sie sich keinen Stress, Sie haben noch fünf Stunden Zeit.“
„Ist Mr. Maddock schon da?“, fragte John nach einem kurzen Blick auf die Uhr. Der nächste Termin war bereits zwei Minuten überfällig.
Linda schüttelte den Kopf.
John spürte, wie das Pochen hinter seine Schläfe wieder zunahm.
„Er wird schon noch kommen. Sie wissen doch, wie diese berühmten Schriftsteller sind. Pünktlichkeit kommt in deren Wortschatz nicht vor“, sagte Linda und lächelte John zu.
Er meinte, eine Spur Mitleid in diesem Lächeln zu erkennen, und das gefiel ihm gar nicht. Ein Teil von ihm sehnte sich danach, alle Arten von Emotionen in Linda zu wecken. Nur eben kein Mitleid.
Draußen läutete das Telefon. Linda eilte hinaus. Er hörte, wie sie sich meldete, den Rest verstand er nicht. Dann klingelte sein Apparat. Er nahm ab.
„Mr. Maddock für Sie“, sagte Linda.
Die Leitung klickte.
„Ja, Burgess“, meldete sich John.
„Oh, gut, dass ich Sie erreiche, Dr. Burgess“, hörte er die weiche Stimme des Schriftstellers sagen. „Es tut mir so leid, aber ich habe unseren Termin heute vollkommen vergessen. Ich werde natürlich für die ausgefallene Stunde aufkommen.“
„Danke, dass Sie sich melden“, sagte John. „Wie geht es Ihnen denn?“
„Ja, es geht. Besser als letzte Woche. Und das ist zum großen Teil Ihr Verdienst. Wenn es jemand schafft, einen Sinn in das Chaos in meinem Kopf zu bringen, dann Sie. Ich setze weiterhin große Hoffnungen in Ihre Fähigkeiten!“
John nickte geistesabwesend und scrollte durch seinen elektronischen Terminkalender.
„Ich sehe, dass wir für kommenden Montag bereits einen Termin vereinbart haben. Ist das in Ordnung? Oder soll ich Sie früher einschieben?“
„Das wird nicht nötig sein. Montag reicht vollkommen aus. Vielen Dank!“
„Gerne“, sagte John. „Auf Wiedersehen.“
Er legte auf und lehnte sich zurück. Ein Blick auf die Uhr zeigte ihm, dass er eine gute Dreiviertelstunde auf seiner Couch entspannen konnte, ehe die nächste Klientin kam. Vielleicht ließ sich diese Woche doch nicht so schlecht an, wie er befürchtet hatte. Er durfte nur nicht vergessen, seine Tochter am Bahnhof abzuholen. Noch während er diesen Gedanken dachte, überwältigte ihn die Müdigkeit und er dämmerte weg.
2. Kapitel: Unity
„Fuck!“
Unity schlug mit der flachen Hand auf den schwarzen Plastikhandgriff der Rolltreppe. Die Rücklichter des abfahrenden Zuges waren eben noch zu erkennen. Wie die glühenden Augen eines Raubtiers in der Nacht starrten sie Unity noch einen Moment lang an, ehe sie sich mit dem abschwellenden Rattern der Wagen in das Dunkel des Tunnels zurückzogen.
Sie schob sich eine besonders widerspenstige Strähne ihres Afros hinter das knallbunte Stirnband und schaute zur Anzeige empor. Der nächste Zug würde in elf Minuten eintreffen. Ein Blick auf ihr Handy zeigte ihr, dass das ihre morgendliche Verspätung auf einen Gesamtwert von fünfunddreißig Minuten anheben würde. Das war selbst für ihre Verhältnisse ein neuer Rekord.
Sie wählte Marcs Nummer. Nach dreimaligem Tuten hörte sie seine Stimme.
„Unity? Wo steckst du denn? Grimson hat schon nach dir gefragt?“
„Grimson?!“ Unitys Stimme überschlug sich. Was wollte denn der Chefredakteur von ihr? Sie war doch nur eine Volontärin. Eine chronisch unpünktliche Volontärin.
„Was hast du ihm gesagt?“
„Keine Panik“, erwiderte Marc.
Er schien zu spüren, wie aufgeregt sie war, und dafür war Unity ihm dankbar. Marc war ein Schatz. Ohne ihn hätte sie wohl schon am ersten Tag die Segel gestrichen. Die Redaktion des Morning Star war eine neue Welt für sie gewesen, voller Faszination, aber auch voller Fallstricke. Es war ein Glücksfall, dass man Marc den Auftrag gegeben hatte, sie einzuarbeiten, und nicht einem der anderen Kollegen, die nur eines noch mehr waren als überarbeitet: unfreundlich.
„Bist du noch dran?“
Marcs Frage riss Unity aus ihren rasenden Gedanken.
„Äh, ja klar. Was will Grimson denn von mir?“
„Das wollte er mir nicht verraten“, sagte Marc. „Du sollst gleich in sein Büro kommen, wenn du auftauchst. Also beeil’ dich ein bisschen!“
„Ich tu, was ich kann! Bye.“
Sie legte auf und schaute wieder auf ihr Handy. Noch acht Minuten, bis der nächste Zug eintraf. Sie überlegte kurz, ob sie die Rolltreppe nach oben nehmen und ein Taxi rufen sollte. Aber bei dem allmorgendlichen Berufsverkehr würde sie an der Oberfläche wahrscheinlich noch länger brauchen als mit der Tube.
Sie schätzte die Entfernung ab. Zwischen Aldgate East und der London Bridge lag eine Meile dicht bevölkerter Gehsteige. Sie konnte also nicht damit rechnen, freie Bahn zu haben, um ihre zu Schulzeiten berühmten Läuferinnenqualitäten unter Beweis zu stellen. Zudem würde sie verschwitzt in Grimsons Büro ankommen und das fände der wahrscheinlich ziemlich daneben.
Was der Chefredakteur wohl von ihr wollte? Ein schrecklicher Gedanke flog sie an. Was, wenn er ihr mitteilen würde, dass sie ihre Siebensachen packen und verschwinden solle? Dass man einen anderen, qualifizierteren Volontär eingestellt hatte und ihre kümmerlichen Dienste nun nicht mehr benötigte?
Kalter Schweiß lief ihr über den Rücken. Sie rief sich ins Gedächtnis, was sie an Leistungen vorweisen konnte. Naturgemäß war das nicht viel, sie war ja erst seit zwei Wochen beim Morning Star. Die kleinen Berichte über eine Kneipenschlägerei in Brixton oder den Kirchenbasar in Southwark hätte eine Schülerin schreiben können.
Die Reportage über das Schwanenpaar, das seit einigen Wochen die Themse zwischen Tower und London Bridge bewohnte und den Touristen als beliebtes Fotomotiv diente, war da schon ein anderes Kaliber. Sie hatte viel Mühe reingesteckt und Marc hatte sie sehr dafür gelobt. Aber reichte das aus, um den kritischen Mr. Jeremy Grimson, den toughesten Chefredakteur in der härtesten Presseszene der Welt, zufriedenzustellen?
Endlich fuhr der Zug ein. Unity stöhnte auf, als sie sah, wie voll er war. Die Türen öffneten sich und sie arbeitete sich in die dichtstehende Menge im Inneren des Wagens vor, was ihr Flüche und auch eine unsagbar dämliche, rassistische Bemerkung eines nach schalem Ale stinkenden Typen eintrug, der wohl glaubte, er könne sich nach dem Brexit nun alles erlauben.
Sie klammerte sich an eines der gelben Plastikrohre und versuchte, den Gestank auszublenden, der sie einhüllte wie eine Pestwolke. Kalter Zigarettenrauch, Schweiß, Deos, Ausdünstungen nach Knoblauch und anderen Gewürzen. Sie hasste die Tube. Um sich von der aufsteigenden Übelkeit abzulenken, las sie den Leitartikel der Times, den eine ältere Dame ihr freundlicherweise entgegenstreckte. Der Chef des Politikressorts rechnete damit, dass Sir James Fitzwilliams Aufstieg zum Premierminister nur noch eine Formsache war. Nun, für diese Vorhersage würde er bei keinem Wettbüro gute Quoten bekommen. Fitzwilliam hatte seit letzter Woche keinen innerparteilichen Gegner mehr. Sir Gregory Rushmore, der Schatzkanzler und Anwärter auf den Posten des PM, war festgenommen worden, weil die Polizei auf seinem privaten Laptop kinderpornografisches Material gefunden hatte. Marc hatte einen vielbeachteten Artikel darüber geschrieben und damit die Verkaufszahlen des Morning Star im Alleingang explodieren lassen. Und woran hatte sie währenddessen gearbeitet? An zwei gähnend langweiligen Vögeln. Die Welt war unfair.
Als sie drei Bahnhöfe später endlich wieder Tageslicht erblickte, atmete sie erst einmal tief durch. Es war zehn vor neun. Wenn sie es bis zur vollen Stunde in Grimsons Büro schaffte, wäre alles gut. Sie würde ihm einfach erzählen, dass sie noch an der Themse gewesen sei, um nach den Schwänen zu schauen.
Unity betrat das Redaktionsgebäude um vier Minuten vor neun. Anstatt auf den Aufzug zu warten, der im zehnten Stockwerk festhing, hastete sie die drei Treppenabsätze bis zu den Räumen des Morning Star hinauf. Sie öffnete die Eingangstür mit ihrem Chip und eilte zu dem Abteil im Großraumbüro, das sie sich mit Marc teilte.
„Gut ausgeschlafen?“, fragte er und der schmale Mund unter seinem dichten, braunen Hipster-Bart verbreiterte sich zu einem Lächeln. Sie wollte ein freundliches Fuck you! erwidern, dann fiel ihr jedoch ein, dass sie Marc trotz seiner angenehmen Umgangsformen noch nicht gut genug kannte, um ihm liebevolle Frotzeleien an den Kopf zu werfen.
„Nein, schlecht aufgehört“, sagte sie stattdessen, stellte ihre Handtasche auf den Minischreibtisch neben den PC und machte sich auf den Weg zum Büro des Chefredakteurs. Ihre Knöchel klopften im Einklang mit den 9-Uhr-Glocken von St. Paul’s gegen die Tür.
Im Raum roch es nach kalter Asche und Kaffee. Grimson saß hinter dem Schreibtisch. Er hatte die Fersen auf eine Ecke des Möbels abgelegt und die altmodische Hornbrille auf die kahle Stirn geschoben. Die Spitzen seines ausladenden Schnurrbarts zuckten auf und ab wie der Stab eines Dirigenten, während der gewaltige Bauch sich im Rhythmus seiner Atemzüge hob und senkte. Er war in die Lektüre eines einzelnen Blattes vertieft. Als er Unity eintreten sah, legte Grimson das Dokument beiseite und nahm die Füße von der Tischplatte.
„Guten Morgen, Miss Wilmore“, sagte er und deutete mit seiner Pranke auf einen Stuhl. „Nehmen Sie Platz.“
Unity versuchte, an der Miene des Chefredakteurs abzulesen, ob er ihr freundlich gesinnt war, oder ob er sie gleich feuern würde. Ihr Herz wummerte in ihren Ohren wie ein heftiger Technobeat.
„Guten Morgen, Sir“, sagte sie und setzte sich Grimson gegenüber. Dieser schob die riesige Hornbrille auf der kleinen Nase zurecht, zwirbelte die rechte Spitze seines Schnurrbarts und musterte sie eindringlich mit schmalen, grauen Augen, die durch die Brillengläser unnatürlich vergrößert wurden.
„Sie sind nun seit zwei Wochen bei uns“, begann er und Unity ergänzte den Satz in Gedanken mit und haben in dieser Zeit unsere Erwartungen leider nicht erfüllen können. Instinktiv wollte sie sich verteidigen, doch Grimson fuhr fort:
„Wie gefällt es Ihnen denn beim Morning Star?“
„Äh… gut“, erwiderte sie, vollkommen aus dem Konzept gebracht, weniger durch die Frage als durch den plötzlich sehr freundlichen Ton des Chefredakteurs.
„Schön, das freut mich. Mir ist zugetragen worden, dass Sie sich bislang engagiert eingebracht haben. Das ist lobenswert.“
Unity fragte sich, wer ihm das wohl gesteckt haben könnte. War es Marc gewesen? Wer sonst? Sie spürte, wie sich ein großer Stein in ihrem Innern zu lösen begann. Ihr Puls schlug nun einen groovigen Motown-Beat an.
„Danke, Sir“, sagte sie.
„Woran arbeiten Sie gerade?“, fragte er.
„An einer Reportage über das Schwanenpaar auf der Themse.“
Er verzog das Gesicht und Unitys Herzschlag nahm sofort wieder an Fahrt auf.
„Sie sind doch sicherlich nicht zum Morning Star gekommen, um über zwei turtelnde Vögel zu schreiben, die zur Zeit Heinrichs VIII. bestenfalls als Hauptgericht von sich reden gemacht hätten.“
Unity schluckte. „Es ist ein Anfang“, erwiderte sie vorsichtig.
Grimson winkte ab. „Es ist der sicherste Weg ins Mittelmaß. Wollen Sie Mittelmaß sein? Ich hätte Sie als ehrgeiziger eingeschätzt. Ihre Bewerbung klingt jedenfalls nicht so, als ob Sie Ihr Lebensziel darin sehen, über des Liebesglück eines Schwanenpaares zu schreiben.“
Er klopfte mit der Handfläche auf eine Bewerbungsmappe, die vor ihm auf dem Schreibtisch lag. Auf Unitys Rücken breitete sich eine Gänsehaut aus, als sie die Mappe als ihre eigene wiedererkannte.
„Natürlich will ich große Reportagen schreiben“, sagte sie. Der Satz gab ihr so viel Mut, dass sie hinterherschob: „Sonst hätte ich mich nicht beim Morning Star beworben, sondern meinen Job als Texterin in der Werbeagentur behalten.“
„Na endlich kommt mal ein wenig Feuer in Ihre Bude“, sagte Grimson. Er lehnte sich zurück und grinste sie an. Die Spitzen seines Schnurrbartes wurden dadurch nach oben gebogen, was ihm das Aussehen eines verrückten Zirkusdirektors verlieh.
Unity fühlte sich jedoch keineswegs entflammt, sondern eher so, als ob sie gerade an einer Ice-Bucket-Challenge teilgenommen hätte. Was wollte der Chefredakteur von ihr? „Okay, jetzt haben wir lange genug um den heißen Brei herumgeredet“, sagte Grimson. „Langer Rede kurzer Sinn: Ich habe einen Auftrag für Sie.“
„Einen Auftrag?“
Unity hatte sich zu spät auf die Zunge gebissen, um zu verhindern, dass sie klang wie ein verdammter Papagei.
„Haben Sie schon einmal etwas von Christopher Maddock gehört?“, fragte er.
„Den Schriftsteller?“
„Ja, genau, gutes Mädchen“, sagte Grimson und zwinkerte ihr zu. „Sie werden mir bitte eine umfängliche Recherche anlegen zu allem, was wir über Maddock wissen müssen. Lassen Sie nichts aus, je schmutziger die Details, desto besser.“
Unity nickte nur. Das Ganze drohte gerade, sie zu überrollen. Erst die Angst, den Job zu verlieren und nun ein Auftrag, der ihr ein unangenehmes Ziehen in der Magengegend verursachte.
„Ich soll nach dunklen Punkten im Leben eines Prominenten suchen?“, fragte sie.
Offenbar hatte Grimson aus ihrem Ton geschlossen, wie wenig begeistert sie war, denn er sagte: „Glauben Sie mir, dreckige Wäsche zu waschen mag Ihnen weniger ehrbar erscheinen als eine nette Reportage aus dem Reich der Tiere. Aber es wird Ihre Karriere deutlich rascher in die Gänge bringen als das liebe Federvieh. Ich zähle auf Sie. Zeigen Sie mir, dass ich richtig gehandelt habe, als ich aus den über vierhundert Bewerbern für das Volontariat ausgerechnet ein jamaikanisches Mädchen aus dem Eastend ausgewählt habe.“
3. Kapitel: Poppy
Poppy stieg aus dem Zug und sah sich um. Sie hatte gehofft, ihren Vater schnell auf dem Bahnsteig zu entdecken. Die vielen Menschen ängstigten sie. Dad wäre ein Fixpunkt, auf den sie zusteuern konnte wie eine Yacht in Seenot, die Kurs auf das Licht eines Leuchtturms nimmt. Doch hier gab es keinen Leuchtturm. Dad war nirgendwo in Sicht.
Jemand rempelte sie an. Beinahe wäre sie über ihren Koffer gestürzt. Mit viel Mühe konnte sie das Gleichgewicht halten. Sie durfte hier nicht stehenbleiben, musste sich dem Strom der Reisenden anvertrauen, die den Bahnsteig in Richtung der Ankunftshalle verließen.
Ob Dad vielleicht dort auf sie wartete? An einer Infoinsel entkam sie dem Menschenschwarm und hielt inne, um noch einmal den Blick suchend schweifen zu lassen. King’s Cross sah an diesem sonnigen Augustnachmittag nicht so aus, wie sie den Bahnhof aus den Harry-Potter-Filmen kannte. Natürlich gab es hier nicht wirklich ein Gleis 9 3/4, das war ihr durchaus bewusst. Aber in den Filmen hatte trotzdem alles ein wenig heimeliger, ja beinahe gemütlich gewirkt.
Die Stahlarchitektur der Bahnhofshalle strahlte eine technische Kälte aus, die sie trotz der sommerlichen Temperaturen frösteln ließ. Und ihr Kopf tat sich schwer damit, die vielen, in alle Richtungen durcheinander wuselnden Menschen, die Geräusche der ein- und ausfahrenden Züge, die blechernen Stimmen der Durchsagen und den Geruch nach Öl, Schweiß und Backwaren in das chaotische Wimmelbild einzuordnen, das sich ihr darbot.
Sie schloss die Augen und atmete tief durch. Dann zog sie ihr Mobiltelefon aus der Tasche und schaute auf das Display. Kein Anruf. Keine SMS. Keine WhatsApp-Nachricht. Sie rief das Telefonbuch auf, tippte auf Dads Namen und hielt sich das Handy ans Ohr. Es tutete dreimal, bis sich die Mailbox meldete.
„Hi Dad, ich bin da“, sagte sie. „Wo bist du? Du wolltest mich doch abholen. Melde dich bitte!“
Poppy schaltete den Vibrationsalarm ein und behielt das Gerät in der Hand, um Dads Rückruf nicht zu verpassen. Was sollte sie bis dahin tun? Sich etwas zu essen kaufen? Sie erwog es kurz, schob den Gedanken aber beiseite. Sie hatte keinen Hunger und das wenige Taschengeld, das sie sich angespart hatte, wollte sie lieber in einem der Londoner Märkte in Klamotten investieren. Und dann musste sie ja auch noch ein Geburtstagsgeschenk für ihre Freundin Rosie besorgen.
Poppy schaute sich um, beobachtete die Menschen und fühlte sich mit einem Mal so einsam wie schon lange nicht mehr. Wenn doch nur Dad endlich käme, um sie abzuholen! Sie spürte, wie ihr die Tränen in die Augenwinkel stiegen und presste die Lippen aufeinander, um nicht laut loszuheulen. Na super, das konnte sie jetzt gar nicht gebrauchen. Was, wenn jemand sie deswegen ansprach? Das wäre sowas von peinlich. Sie wollte nur in Ruhe gelassen werden.
Etwas Rotgelbes huschte in ihr Gesichtsfeld. Es war ein Schal. Ein rotgelber Schal des Hauses Gryffindor. Und er war um den Hals eines kleinen Jungen geschlungen, der einen spitzen, schwarzen Hut trug. Er trippelte neben seiner Mutter her und im Vorübergehen schnappte Poppy auf, wie er zu ihr sagte: „Mummy, wann sind wir endlich bei Gleis 9 3/4?“
Spielte ihre Fantasie ihr etwa einen Streich? Poppy kniff die Augen zu und schaute erneut hin. Der Junge war immer noch da. Spontan heftete sie sich Mutter und Sohn an die Fersen. Sie kam sich dabei ein wenig vor wie Harry Potter an seinem ersten Schultag, der die Suche nach dem mysteriösen Gleis 9 3/4 schon beinahe aufgeben will, als er die Weasleys trifft.
Der Gedanke zauberte ein Lächeln auf ihr Gesicht. Sie stellte sich vor, dass sie nun tatsächlich den Hogwarts-Express besteigen und in der Magierschule zu einer mächtigen Hexe ausgebildet würde. Und dass sie Freunde finden würde. Richtige Freunde. Freunde, die mit einem durch Dick und Dünn gingen.
Sie verließen die Bahnhofshalle und gelangten in ein kleineres Nebengebäude. Hier standen zwei Mädchen in ihrem Alter, die grünschwarze Slytherin-Schals trugen. Eine der beiden hielt einen Zauberstab in der Hand. Poppy widerstand dem Impuls, sich die Augen zu reiben. Das wurde immer verrückter hier.
Mutter und Sohn steuerten auf eine Menschengruppe zu, die sich vor einer Wand der Halle aufgereiht hatte. Zunächst konnte Poppy nichts erkennen, doch als sie näherkam, sah sie, dass ein halber Gepäckwagen aus der rotbraunen Ziegelmauer herausragte. Auf einem darüber angebrachten Schild stand: Willkommen auf Gleis 9 3/4. Ein kleines Mädchen wartete vor dem Wagen, einen gelbschwarzen Hufflepuff-Schal um den Hals. Sie hielt den Griff fest umfasst und schaute zu einem Mann, der eine Kamera auf sie gerichtet hatte. Eine junge Frau in Umhang und mit einem Zauberhut auf dem Kopf zählte bis drei und rief dann: „Und jetzt spring!“
Das Mädchen hüpfte in die Luft und kreischte dabei vor Freude, während die Kamera des Fotografen wild klickte. Schließlich trat die Frau auf die Kleine zu und nahm ihr den Schal ab. Das Mädchen lief jauchzend auf ihre Mutter zu, die neben dem Fotografen gestanden und selbst zahlreiche Bilder mit ihrer Handykamera geschossen hatte. Die Frau im Umhang reichte dem nächsten Teenager in der Schlange den gelbschwarzen Hufflepuff-Schal. Der Junge packte den Griff des Gepäckwagens und das Spektakel wiederholte sich.
Auch die Mutter und der kleine Gryffindor reihten sich ein. Poppy blieb in einiger Entfernung stehen und beobachtete die Wartenden. Es waren Eltern mit Kindern im Alter von vielleicht sechs bis sechzehn Jahren. Die Jungen und Mädchen waren aufgekratzt, konnten es kaum erwarten, ihre fünf Sekunden an dem Gepäckwagen zu erleben und einen Moment lang in die magische Welt einzutauchen. Und ihre Eltern standen stolz daneben.
Wieder traten Poppy die Tränen in die Augen. Sie schaute auf das Handy-Display in ihrer Hand. Nichts. Keine Nachricht. Dad hatte sie vergessen. Ein bitteres Gefühl stieg in ihrer Kehle auf, ein Gefühl, das sie gut kannte. Und angesichts der vielen glücklichen Eltern mit ihren noch viel glücklicheren Kindern wuchs es sich zu einer gewaltigen, schwarzen Welle aus, die sie überflutete. Sie fühlte sich wie eine Ausgestoßene, eine mit der niemand etwas zu tun haben wollte, nicht einmal ihr Vater. Wahrscheinlich hatte er sich wieder so viel Arbeit aufgehalst, dass er den Tag verwechselt hatte, an dem seine einzige Tochter zu ihm kommen würde, um drei Wochen der Sommerferien bei ihm zu verbringen. Vielleicht hatte er aber auch vergessen, dass sie ihn besuchen würde. Vielleicht hatte er vergessen, dass er eine Tochter hatte.
Poppy holte ein Päckchen mit Taschentüchern aus ihrem Rucksack und wischte sich die Tränen aus den Augen. Da fiel ihr Blick auf einen Jungen in ihrem Alter. Er war ziemlich groß und seine Bewegungen wirkten schlaksig. Der Teil seines Gesichts, der nicht von einer riesigen Spiegelreflexkamera verdeckt war, war mit glänzenden Pickeln übersät. Er stand etwas abseits von all den glücklichen Familien und schien genausowenig dazu zu gehören wie Poppy. Plötzlich richtete er das Teleobjektiv seiner Kamera in ihre Richtung. Was sollte das denn? Wollte der Freak sie etwa fotografieren? Poppy zeigte ihm den Stinkefinger und drehte sich rasch um.
Sie ging an der Menschentraube vorbei und sah, dass sich neben dem in der Mauer steckenden Gepäckwagen ein Laden namens Potterworld befand. Sie betrat ihn und sah sich um. Die vielen Andenken, die es dort zu kaufen gab, brachten sie rasch auf andere Gedanken. Eine Viertelstunde später hatte sie einen Großteil ihres Taschengeldes in einen USB-Stick in Form eines Schnatzes, einen Heuler, der kurz, nachdem man ihn anschaltete, ein markerschütterndes Geschrei von sich gab, und eine Nachbildung von Hermines Zauberstab investiert. Und sie hatte eine große Packung Zauberersüßigkeiten für Rosie gekauft. Mit einem breiten Grinsen im Gesicht verließ sie den Laden wieder. Sie überlegte kurz, ob sie noch einmal versuchen sollte, ihren Vater anzurufen, entschloss sich dann aber dagegen. Sie war fünfzehn Jahre alt und sicher nicht dumm. Es wäre doch gelacht, wenn sie es nicht auf eigene Faust zu seiner Wohnung in Clapham schaffen würde.
Sie wandte sich nach rechts und gelangte durch einen Seiteneingang auf eine kleine Nebenstraße. Rasch erkannte sie ihren Irrtum. Sie wollte wieder in den Bahnhof zurückgehen, als plötzlich zwei Männer vor ihr standen. Die beiden jungen Kerle waren in schlabberige Hosen und ausgewaschene T-Shirts gekleidet.
„Na, Schnecke, was machste denn hier?“, fragte einer der beiden. Er hatte eine brennende Zigarette im Mundwinkel hängen, deren glühende Spitze bei seinen Worten auf und ab hüpfte.
„Ich will zur Tube“, erwiderte Poppy, bemüht darum, cool zu klingen, obwohl ihr das Herz bis zum Hals schlug.
„Zur Tube will sie, soso“, sagte der andere, ein schlaksiger Lulatsch, dessen Stimme klang, als ob seine Stimmbänder mit einer Feile bearbeitet worden wären.
„Du bist wohl nicht von hier, Schnecke?“, fragte der andere.
„Nein“, sagte Poppy und wollte an den beiden Männern vorbeigehen. Der Lulatsch trat ihr in den Weg.
„Na, haste nicht was vergessen?“, fragte er.
Sie sah ihn verständnislos an.
„Jetzt guck nich so blöd. Soll ja nich jeder gleich an deinen Kuhaugen merken, dassde vom Land kommst.“
„Lass mich vorbei“, rief sie und zwängte sich durch die Lücke zwischen den beiden Männern hindurch, den Eingang des Bahnhofs als das Ziel vor Augen, das sie unbedingt erreichen musste. In der Halle wäre sie sicher vor weiteren Nachstellungen, so hoffte sie zumindest. Sie hatte es fast schon geschafft, als die Träger ihres Rucksacks sie mit roher Gewalt nach hinten zogen. Sie verlor das Gleichgewicht und fiel auf ihren Koffer.
„Langsam, Schnecke“, sagte der Kerl mit der Zigarette. „Du musst noch Wegezoll zahlen.“
„Wegzoll?“, fragte Poppy.
Der Mann hielt ihren Rucksack gepackt und zog sie daran nach oben wie eine Marionette.
„Du gibst uns nen Kuss. Aber so richtig. Mit Schmackes“, sagte der Lulatsch und ließ dabei seine Zunge über die schmierigen Lippen gleiten. Poppy durchfuhr es heiß und kalt. Sie hatte noch nie einen Jungen geküsst. Und jetzt sollte das hier ihr erster Kuss werden? Sie schüttelte zuerst den Kopf und dann ihren ganzen Körper, um sich aus dem Griff des Rauchers zu befreien, doch es war vergebens. Er schob sie auf seinen Kumpanen zu, der die glänzenden, von kleinen Eiterbläschen gesäumten Lippen spitzte. Sie konnte seinen Atem riechen, eine ekelerregende Mischung aus Pfefferminzbonbons und Knoblauch. Sie versuchte, ihren Kopf wegzudrehen, doch der andere Typ packte sie an den Haaren und jeder Versuch, sich zu bewegen, führte zu irrsinnigen Schmerzen.
„Halt still“, hörte sie den Raucher sagen. „Dann tut’s auch nicht weh.“
4. Kapitel: John
„Auf Wiedersehen, Mrs Ellcott“, sagte John und drückte seiner Patientin die Hand. „Bis nächste Woche dann.“
Sie nickte und sah ihn mit ihren rotverweinten Augen an.
„Danke“, flüsterte sie. „Es hat gut getan, mit Ihnen zu reden.“
„Das freut mich“, sagte er.
Sie trat hinaus in das Vorzimmer und John schloss rasch die Tür. Er atmete tief durch. Geschafft!
Die letzte halbe Stunde der Sitzung hatte er im Autopilotmodus verbracht, weil sich das Pochen hinter seiner rechten Schläfe in eine mittelstarke Migräneattacke verwandelt hatte. Erfreulicherweise hatte Mrs Ellcott nichts davon gemerkt. Sie war zu beschäftigt gewesen, über ihren untreuen Ehemann zu klagen. Wäre er in einer besseren Verfassung gewesen, hätte John wohl versucht, sie von den Schuldzuweisungen ab- und auf ihre eigenen Gefühle hinzulenken. Ihren Mann würde sie nicht ändern können. Sich selbst schon.
Doch die für die therapeutische Intervention notwendige Energie hatte er nicht mehr aufbringen können. Zu sehr war er damit beschäftigt gewesen, gegen die Schmerzen und die zunehmende Übelkeit anzukämpfen. Er kniff die Augen zusammen. Die pochende Pein auf der rechten Kopfseite nahm zu. John ging zu seinem Schreibtisch, öffnete die unterste Schublade und entnahm ihr eine Medikamentenschachtel. Er zog einen Blister hervor und atmete erleichtert durch, als er sah, dass sich noch eine Tablette darin befand. Er drückte das Triptan heraus und schluckte es hinunter.
Dann schob er die auf dem Tischchen neben dem Patientensessel liegenden, gebrauchten Taschentücher in den Papierkorb, griff nach seiner Umhängetasche und trat hinaus in den Vorraum. Ein kleiner Plausch mit Linda hätte ihn möglicherweise ein wenig von seinen Kopfschmerzen ablenken können, aber die Sprechstundenhilfe war gerade am Telefon. Daher winkte er ihr nur rasch zu und verließ die Praxis. Er brauchte ein Bett und zwar schnell. Das Medikament würde der Migräneattacke die Spitze nehmen, aber der Tag war trotzdem gelaufen.
John war froh, dass er einen freien Sitzplatz in der Tube fand. Er hatte große Mühe, klar zu denken, und war sich nicht sicher, ob er es geschafft hätte, die Dreiviertelstunde zu stehen, die die Fahrt mit der Northern Line von der Praxis in Hampstead zu seiner Wohnung in Clapham dauerte.
In Chalk Farm stieg eine junge Frau zu, die eifrig mit dem Handy telefonierte. Sie setzte sich neben ihn und er musste wohl oder übel ihr Gespräch mitanhören. Offenbar hatte sie Probleme mit ihrer Kollegin im Büro, das Wort Zickenterror fiel und noch ein paar recht unflätige Schimpfwörter. Möglicherweise würde die junge Dame von einer Psychotherapie profitieren können, schoss es ihm durch den vernebelten Kopf. Sie würde ihre Kollegin nicht ändern können. Dafür aber lernen, wie sie besser mit ihr zurechtkommen konnte. Doch dafür würde sie sich einen anderen Therapeuten suchen müssen. Eine Therapie bei John würde sie sich nie leisten können.
Ein Gefühl des Bedauerns meldete sich. Die Möglichkeit, in der Praxis einzusteigen, war ein Glücksfall gewesen. Wenn er irgendwann die Schulden abbezahlt hatte, konnte er einen Batzen Geld verdienen. Zum ersten Mal in seinem Leben würde er sich nicht mehr Gedanken darüber machen müssen, wie viel er bei einem Wocheneinkauf ausgab. Oder ob er sich einfach so ein Buch kaufen konnte, dessen Klappentext ihn ansprach.
Die Kehrseite war jedoch, dass er sich dabei einer ganz speziellen Klientel andienen musste. Gutsituiert, mit den Problemen eben dieser gesellschaftlichen Klasse. Natürlich gab es auch dort Menschen mit behandlungsbedürftigen psychischen Erkrankungen wie Depression oder Angststörungen. Aber ein Großteil seiner bisherigen Patienten schien Termine bei ihm absolviert zu haben, weil sie jemanden zum Reden brauchten. Und weil es inzwischen schick war, einen eigenen Psychotherapeuten zu haben. Da war offenbar eine Welle aus den USA herübergeschwappt.
Klienten, die mit beiden Beinen im Leben stehend ins Straucheln kamen, so wie die Frau, die neben ihm zunehmend genervt ein Schimpfwort nach dem anderen ausstieß, würde er nicht mehr behandeln können. Und das bedauerte er zutiefst. Dieser verdammte finanzielle Druck!
Der Schmerz pochte unnachgiebig gegen seine Schläfe. Er schloss die Augen, weil er die grelle Beleuchtung im Innern des Waggons nicht ertragen konnte. Wenn das Triptan doch endlich wirken würde! Er spürte die Übelkeit in seiner Kehle aufsteigen und versuchte, das Gefühl durch vermehrtes Schlucken in den Griff zu bekommen. Ihm war bewusst, dass es falsch war, sich mit diesen Gedanken zu beschäftigen, dass er seine Probleme durch Denken und Grübeln nicht lösen könnte. Dass er es sogar noch weiter verschlimmerte, wenn zu den Gedanken die entsprechenden Gefühle der Verzweiflung, der Mutlosigkeit, der Angst hinzutraten. Das alles stand ihm klar und deutlich vor Augen. Es war sein täglich Brot, diese Dinge mit seinen Klienten zu besprechen, ihnen zu verdeutlichen, wie fruchtlos ihre Grübeleien waren, ihnen Wege zu zeigen, wie sie auf andere Gedanken kommen, wie sie sich ablenken konnten.
Dem Schmerz zum Trotz versuchte John sich an einer Achtsamkeitsübung. Er lenkte seine Aufmerksamkeit auf den Atem, versuchte nicht, besonders tief oder besonders regelmäßig zu atmen, sondern seinen Körper nur dabei zu beobachten, wie er Luft holte, wie der kühle Strom durch seine Nase nach oben stieg bis zu einem Punkt hinter den Augen, von dort aus den Rachen und die Luftröhre passierte, seine Lungen füllte. Wie sein Brustkorb sich weitete, nur um gleich darauf wieder zusammenzusinken. Wie die verbrauchte Luft aus seinen Bronchien gepresst wurde, nach oben stieg auf demselben Weg, den sie beim Einatmen genommen hatte und die Nasenflügel eine Spur wärmer streichelten als zuvor. Er vertraute sich dem ruhigen Rhythmus an, ließ vor seinem inneren Auge das Bild eines Ufers entstehen, von Wellen, die anbrandeten und sich wieder zurückzogen in stetem Wechsel. Und langsam, ganz langsam zog auch die Übelkeit sich zurück.
Ein scharfer Schmerz riss ihn aus seiner Trance.
„Sorry“, sagte ein mit zahlreichen Tüten bepacktes Mädchen, das sich neben ihm niedergelassen und ihm dabei ihren Ellenbogen in die Seite gerammt hatte. John sah sich um. Durch die Fenster des Zuges konnte er Buchstaben erkennen. Charing Cross stand dort. Er erinnerte sich daran, wie er als Jugendlicher zum ersten Mal mit der Tube gefahren war. Damals hatte er zum Bahnhof King’s Cross fahren wollen, war aber aus Versehen in Charing Cross ausgestiegen. King’s Cross. Er schlug sich gegen die Stirn. Verdammt, er hatte vergessen, Poppy abzuholen!
John sprang auf und eilte zur Tür, doch noch ehe er sie erreicht hatte, schlossen sich die Flügel, und der Zug setzte sich in Bewegung. In seiner Verzweiflung schlug John mit der flachen Hand auf die gelbe Haltestange, was ihm einen irritierten Blick der umstehenden Fahrgäste eintrug. Er kramte in seiner Umhängetasche und zog sein Handy heraus. Drei Anrufe in Abwesenheit. Von Poppy. Der Letzte vor 37 Minuten.
Er tippte auf ihren Namen und hielt sich das Gerät ans Ohr. Es tutete nicht einmal, sondern schaltete sofort zur Mailbox weiter. Verdammt! Ein Blick auf den Tube-Fahrplan ließ ihn innerlich aufstöhnen. Er würde mehrfach umsteigen müssen, um nach King’s Cross zu gelangen.
Die folgende Dreiviertelstunde gehörte zu den schlimmsten Erfahrungen seines Lebens. Er versuchte ein Dutzend Mal, Poppy zu erreichen, doch stets wurde er nur zu ihrer Mailbox weitergeleitet. Und jedes neue „Hallo, Sie sind verbunden mit der Mailbox von Elizabeth Burgess“ blies frischen Sauerstoff in die Glut seiner Sorge.
Als er endlich in King’s Cross eintraf, drängte er sich durch das Gewimmel der Leute, setzte seine Ellbogen ein ohne Rücksicht auf die Flüche der Passanten. Und dann, eineinhalb Stunden nach der fahrplanmäßigen Ankunft ihres Zuges stand John an Bahngleis 14. Doch Poppy war nirgendwo zu sehen.
5. Kapitel: Poppy
Poppy biss die Zähne zusammen. Mit aller Kraft versuchte sie, sich aus dem Griff des Rauchers zu lösen, doch es war vergebens. Ihr Rucksack hielt sie so fest wie ein Klettergurt. Sie konnte schon die Körperwärme des Lulatschs spüren, seinen biergesättigten Atem riechen.
„Was ist hier los?“, fragte eine seltsam kratzige Männerstimme.
Der Griff, der sie gehalten hatte, löste sich mit einem Mal und Poppy stürzte zu Boden. Sie sah auf und nahm eine Gestalt wahr, die sich den beiden Männern gegenüber aufgebaut hatte. Es war der schlaksige Junge mit dem Fotoapparat, dem sie vorhin den Stinkefinger gezeigt hatte.
„Was willste denn, du Lauch!“, sagte der lange Lulatsch und spuckte einen ekelhaften, grünen Batzen auf den Asphalt. Er ging auf den Jungen zu und hob drohend die Fäuste. Dieser wich einen Schritt zurück und Poppys Herz sank eine Etage tiefer. So mutig es auch war, zwei älteren Kerlen entgegenzutreten, war ihr Retter chancenlos gegen die beiden Grobiane.
Wie um ihren Gedanken zu bestätigen, traf in diesem Moment die Faust des Lulatschs den Oberarm des Jungen. Dieser schrie auf und trat noch einen Schritt zurück.
„Pass auf, jetzt poliert mein Kumpel dem Lauch gleich die Fresse“, sagte der Raucher.
Poppy spürte, wie eine Welle der Wut durch ihren Körper jagte. Das war einfach zu viel. Erst ließ ihr Vater sie sitzen und dann fiel sie auch noch diesen beiden Ekelpaketen in die Hände. Sie rappelte sich auf, hob das rechte Bein und stieß ihre Ferse dem noch immer hinter ihr stehenden Raucher mit aller Macht gegen das Schienbein. Der Getroffene stieß einen Schrei aus und rieb sich die schmerzende Stelle.
Der Lulatsch hatte in eben diesem Moment zu einem zweiten Schlag angesetzt, doch der Schmerzenslaut seines Kumpans lenkte ihn ab. Er wandte den Kopf und starrte Poppy an. Sein Gesicht war wutverzerrt. Poppy griff nach ihrem Rucksack, um sich notfalls damit zu verteidigen, doch irgendwie musste sich im Eifer des Gefechts der Reißverschluss geöffnet haben, sodass sich der Inhalt auf den Boden ergoss. Eine Wasserflasche kullerte über den Asphalt, das Päckchen mit den Tampons landete zielsicher in einer Pfütze, ihr Handy verlor den Akku und die Tüte aus dem Fanshop platzte auf.
Poppy bückte sich, bekam aber nur den Zauberstab zu fassen. Der Lulatsch hob seine Faust und wollte einen Schritt in Poppys Richtung machen, als ihn etwas Schwarzes an der Schläfe traf. Er sackte in sich zusammen wie eine Luftmatratze, deren Ventil abgerissen war.
Mit weit aufgerissenen Augen starrte Poppy den pickligen Jungen an, der hinter dem Kerl stand. Er hielt den Halsriemen seiner Kamera fest. Das Gehäuse schien intakt zu sein, aber das Teleobjektiv war verbogen und die vorderste Glasscheibe wies einen Sprung auf. Er hielt sich eine Hand vor den Mund und schaute den auf dem Boden liegenden Mann an. Dann hob er langsam den Kopf und ihre Blicke trafen sich. Plötzlich weiteten sich seine Augen.
„Pass auf“, rief er und deutete auf einen Punkt hinter Poppys Schulter.
Sie drehte sich rasch um und sah, dass der Raucher mit erhobener Faust auf sie zustürmte. Instinktiv warf sie sich ihm entgegen und streckte dabei die Hand mit dem Zauberstab aus. Sie traf den Kerl in der Leistengegend und der Schrei, den er dieses Mal ausstieß, war kaum noch als menschlich wahrzunehmen. Er klappte zusammen wie ein Schweizer Taschenmesser und rollte laut jammernd auf dem Boden herum, die Hände auf seine Körpermitte gepresst.
„Los, wir müssen weg“, sagte der Junge.
Poppy stopfte die auf dem Asphalt verteilten Habseligkeiten in ihren Rucksack und warf ihn sich über die Schulter. Der Junge nahm ihren Koffer und gemeinsam rannten sie in das Bahnhofsgebäude hinein und an dem Fanshop und Gleis 9 3/4 vorbei. Erst in der großen Halle hielt er an. Poppy sah sich um. Die beiden Kerle waren nirgendwo zu sehen.
Schweratmend standen sie sich gegenüber und schauten sich an. Die Mundwinkel des Jungen zuckten. Poppy spürte, wie die Anspannung verflog und einer verrückten Heiterkeit wich. Sie grinste. Er tat es ihr gleich. Dann konnte sie nicht mehr anders und prustete los. Lachend standen sie sich gegenüber. Passanten starrten sie an, doch das war ihr egal. Die Erleichterung brach sich ihre Bahn und es war herrlich.
„Danke“, sagte sie, als sie sich schließlich etwas beruhigt hatten. „Wie heißt du eigentlich?“
„Andrew. Und du?“
„Eigentlich Elizabeth. Aber meine Freunde nennen mich Poppy.“
Sie deutete auf seine Kamera und sagte: „Das tut mir leid.“
Er zuckte mit den Achseln. „Besser die Kamera als du.“
Poppy spürte, wie ihr Gesicht angenehm warm wurde.
„Danke“, sagte sie noch einmal. Dann kam ihr ein Gedanke und sie fragte: „Kannst du mir sagen, wie ich am schnellsten nach Clapham komme?“
6. Kapitel: John
Johns linke Hand zitterte so stark, dass sein Zeigefinger das rote Hörersymbol verfehlte. Es war zum Verzweifeln. Er hatte Poppy ausrufen lassen, doch sie hatte sich nicht am Infopunkt gemeldet. Dann hatte er den ganzen Bahnhof abgesucht, aber keine Spur seiner Tochter gefunden. Schließlich hatte er wahllos jedem, dem er begegnete, ihr Bild gezeigt, das er als Hintergrund seines Smartphones eingespeichert hatte. Doch alle hatten nur mit den Köpfen geschüttelt. Eine ältere Frau hatte ihm gesagt, wie leid es ihr täte, dass sie das Mädchen nicht gesehen hätte, und wie sehr sie hoffte und betete, dass er sie finden würde. Da hatte er sich nicht mehr anders zu helfen gewusst, als bei der Polizei anzurufen. Die Worte der Beamtin klangen ihm noch im Ohr: „Wenn Sie Ihre Tochter erst seit zwei Stunden vermissen, können wir leider nichts für Sie tun. Am besten fahren Sie nach Hause, vielleicht ist sie schon dort. Auf Wiederhören.“
Das Schlimmste daran war, dass die Polizistin recht hatte. Er konnte nichts anderes tun. Es war sinnlos, in einer Stadt mit acht Millionen Einwohnern nach einem fünfzehnjährigen Mädchen zu suchen. Nun blieb ihm nichts übrig, als zu hoffen, dass sie den Weg zu seiner Wohnung alleine gefunden hatte.
Die Fahrt nach Hause war die Hölle. Seine Migräne war zwar inzwischen weitgehend abgeklungen, dafür war sein Schultergürtel hart wie Kruppstahl. Er massierte die schmerzenden Muskelstränge, während sein Gehirn sich ein Katastrophenszenario nach dem anderen ausmalte, von denen ein schwerer Autounfall noch die harmloseste Variante war.
Eine Stunde später bog er im Laufschritt in die Honeybrook Lane ein. Er sah Poppy schon von weitem. Sie saß auf dem Treppenaufgang zu seinem Haus, das Gesicht in den Händen vergraben.
„Poppy!“, rief er und im selben Moment durchflutete ihn eine Welle der Erleichterung.
Sie erhob sich und kam auf ihn zu. Er breitete die Arme aus, doch Poppy flüchtete sich nicht mehr in seine Umarmung wie damals, als sie drei Jahre alt gewesen war und sich das Knie beim Spielen im Sandkasten aufgeschlagen hatte.
Sie blieb einen Meter vor John stehen und sah ihn an. Ihre Augen waren rot vom Weinen und auf ihren Wangen hatten zahllose Tränen glänzende Spuren hinterlassen. Ihre Unterlippe bebte, als sie fragte: „Wo warst du?“
Ihre Stimme zitterte leicht. Ob vor Traurigkeit, vor Wut oder vor Enttäuschung, er konnte es nicht sagen.
„Ich habe auf dich gewartet. In King’s Cross“, fuhr sie fort.
John fehlten die Worte. Er war sprachlos vor Scham und Schmerz, seine Tochter in einem derart aufgelösten Zustand vor sich zu sehen.
„Und dann waren da diese zwei Männer“, sagte sie und über den glitzernden Pfad auf ihrer Wange kullerte eine weitere Träne.
Der Schreck fuhr John so abrupt in die Glieder, dass seine Nackenmuskulatur sich noch stärker verkrampfte. Erst der damit verbundene Schmerz weckte ihn aus seiner Sprachlosigkeit. „Was für Männer?“
Poppys Unterlippe zitterte noch ein bisschen stärker. „Zwei so Typen. Ich glaube, die wollten mich ausrauben oder sowas“, hauchte sie.
John trat mit weitausgestreckten Armen einen Schritt auf sie zu, doch Poppy wich zurück.
„Was haben die Kerle dir angetan?“, fragte er. Seine Stimme bebte, während sich sein Bild von Poppy mit allerhand Vorstellungen überlagerte, was diese Typen mit seiner Tochter angestellt haben mochten.
„Nichts“, sagte Poppy. „Ich hatte Hilfe. Ein Junge ist eingeschritten. Er hat mir auch gezeigt, wie ich hierher komme.“
„Ein Junge?“
Johns Stirn legte sich in Falten. „Wie heißt …“
„Das kann dir doch scheißegal sein!“, brach es mit einem Mal aus Poppy heraus.
John zuckte zusammen. „Aber …“, wollte er einwenden, doch seine Tochter fuhr ihm über den Mund.
„Es wäre deine Aufgabe gewesen, mich abzuholen. Aber dir ist wahrscheinlich wieder einmal etwas furchtbar Wichtiges dazwischengekommen.“
„Poppy, bitte …“
„Nein!“, schrie sie.
Ein Fenster am Nachbarhaus öffnete sich und Mrs. Llewellyn von nebenan linste sehr interessiert zu ihnen herüber.
„Poppy!“, rief jetzt auch John und hob die Hände, ehe er sie wieder sinken ließ, die Schultern gleich mit.
Sie hielt inne und sah ihn an. Er konnte es kaum ertragen, die Verletzung in ihrem Blick zu sehen, die Enttäuschung darüber, dass er es wieder einmal versaut hatte.
„Lass uns drinnen weiterreden, okay?“, schlug er vor.
Sie nickte. Er holte den Schlüssel aus der Tasche und öffnete die Tür. Sie traten in den Flur. John atmete tief aus.
„Poppy, es tut mir leid, ich …“
Sie hob die Hand.
„Wo ist mein Zimmer?“, fragte sie.
Er sah sie irritiert an.
„Mein Zimmer“, wiederholte sie. „Oder hast du auch vergessen, dass ich noch nie hier war?“
„Im ersten Stock“, erwiderte er verdattert.
„Okay“, sagte sie und ging auf die Treppe zu, ihren Koffer hinter sich herziehend.
„Soll ich schonmal was zu essen machen?“, fragte John.
„Keinen Hunger“, sagte Poppy, ohne innezuhalten oder sich wenigstens umzudrehen.
„Aber du hast doch sicher seit dem Frühstück nichts mehr gegessen!“
Nun wandte sie sich doch um. „Ich will einfach nur meine Ruhe, okay?“
John schluckte. Es drängte ihn zu einem Widerspruch. Doch stattdessen zwang er sich zu einem Nicken.
„Okay“, sagte er.
Poppy stieg langsam die Treppe hoch. John sah ihr nach, bis ihre Füße aus seinem Blickfeld verschwunden waren. Er stellte seine Tasche ins Wohnzimmer und ging in die Küche, um rasch Nudeln mit Tomatensoße zusammenzurühren.
Eine halbe Stunde später balancierte er einen dampfenden Teller nach oben und klopfte an die Tür zu Poppys Zimmer. Keine Antwort. Er klopfte noch einmal. Wieder nichts. Er stellte die Nudeln vor die Tür und rief:
„Ich habe dir etwas zu essen gemacht. Es steht vor der Tür, falls du Hunger hast.“
Keine Erwiderung. Er wartete noch ein paar Atemzüge lang, dann ging er die Treppe hinunter in die Küche, wo er sich ein Glas Wein einschenkte.
Mit diesem landete er schließlich auf dem Sofa im Wohnzimmer. Es war neben dem leeren Bücherregal das einzige Möbelstück in dem ansonsten kahlen Raum, abgesehen von einem Dutzend nicht ausgeräumter Umzugskartons. John war erst vor knapp vier Monaten von Leeds nach Clapham gezogen.
Vielleicht würde es Poppy Freude bereiten, die Wohnung etwas wohnhafter zu gestalten. Der Gedanke erinnerte ihn schmerzhaft daran, dass zunächst das harte Stück Arbeit vor ihm lag, sich mit seiner Tochter zu versöhnen. Er nahm einen Schluck aus dem Weinglas und setzte es vorsichtig auf dem Dielenboden ab. Dann griff er nach seiner Umhängetasche und holte den Laptop heraus. Er hatte keinerlei Lust, sich mit Patientenakten zu beschäftigen, aber es musste sein.
Vier Wochen zuvor: Auszug aus der ersten Therapiesitzung mit Christopher Maddock
„Nehmen Sie Platz!“, sagte John und deutete auf den Korbsessel.
Christopher Maddock musterte das Möbelstück und setzte sich dann so behutsam darauf, als ob es gleich unter ihm zusammenbrechen könnte. In Anbetracht seines deutlichen Untergewichtes erschien John diese Vorsicht ziemlich absurd. Er ließ sich in die Polster seines eigenen Sessels sinken und fragte:
„Was kann ich für Sie tun?“
Maddock wandte seine dunkelbraunen, von tiefen, violetten Ringen umrandeten Augen dem Therapeuten zu. Er antwortete nicht gleich, schien seine Worte vielmehr mit Bedacht zu wählen.
„Sie wissen, wer ich bin?“, fragte er schließlich.
„Nun, auf Ihrer Patientenakte steht Christopher Maddock“, erwiderte John. „Das ist doch schon einmal ein Anfang.“
Auf dem Gesicht seines Klienten erschien ein schmales Lächeln. „Sie gefallen mir“, sagte er. „Aber jetzt lassen wir einmal die Beschnupperungsrituale weg. Ich habe nicht viel Zeit. Heute Abend geben sie Die Walküre in Covent Garden. Da muss ich mich noch ein wenig frischmachen. In diesem Vogelscheuchenlook lassen die mich sicher nicht in ihre ehrwürdigen Hallen.“
„Wie Sie wollen“, sagte John.
„Ich frage sie noch einmal: Wissen Sie, wer ich bin?“
„Ich vermute einmal, dass Sie von mir hören wollen, dass ich weiß, dass Sie ein bekannter Schriftsteller sind.“
„Das waren ziemlich viele dass in einem furchtbar verschachtelten Satz. Und bekannt ist ein Ausdruck, der es möglicherweise nicht richtig trifft. Berühmt wäre angemessener. Oder berüchtigt.“
„Hat diese Berühmtheit etwas mit Ihrem Anliegen zu tun?“
Maddock lehnte sich zurück. Er faltete die knochigen Hände und legte sie unter sein Kinn.
„Indirekt“, sagte er. „Nur, wenn meine Berühmtheit Sie stört.“