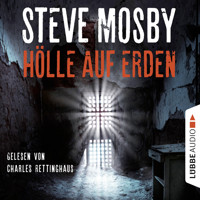6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
14 Briefe, 14 Opfer – 13 Leichen: Gänsehaut-Thrill von Steve Mosby, Englands Meister der abgründigen Spannung Schierer Zufall bringt die Polizei auf die Spur eines Killers, der den Ermittlern jährlich höhnische Post mit Informationen über sein letztes Opfer zukommen lässt. 14 Briefe, 14 tote Frauen – doch es werden nur 13 Leichen gefunden, säuberlich verstaut in Plastikfässern. DI Will Turner ist überzeugt, dass der Mann einen Komplizen haben muss. Außerdem hat er ein sehr persönliches Interesse an dem Fall, von dem niemand erfahren darf. Als plötzlich der Krimiautor Jeremy Townsend auf dem Revier auftaucht und merkwürdige Fragen stellt, vor allem zur Anzahl der Leichenfunde, blickt Will in Abgründe, vor denen er lieber die Augen verschlossen hätte ... »Steve Mosby gehört zu der Handvoll Autoren, die meine Phantasie beflügeln.« Val McDermid
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 465
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Steve Mosby
Der Totschreiber
Thriller
Aus dem Englischen übersetzt von Ulrike Clewing
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
14 Briefe, 14 Opfer – 13 Leichen: Gänsehaut-Thrill von Steve Mosby, Englands Meister der abgründigen Spannung
Schierer Zufall bringt die Polizei auf die Spur eines Killers, der den Ermittlern jährlich höhnische Post mit Informationen über sein letztes Opfer zukommen lässt. 14 Briefe, 14 tote Frauen – doch es werden nur 13 Leichen gefunden, säuberlich verstaut in Plastikfässern. Detective Inspector Will Turner ist überzeugt, dass der Mann einen Komplizen haben muss. Außerdem hat er ein sehr persönliches Interesse an dem Fall, von dem niemand erfahren darf. Als plötzlich der Krimiautor Jeremy Townsend auf dem Revier auftaucht und merkwürdige Fragen stellt, vor allem zur Anzahl der Leichenfunde, blickt Will in Abgründe, vor denen er lieber die Augen verschlossen hätte …
»Steve Mosby gehört zu der Handvoll Autoren, die meine Phantasie beflügeln.« Val McDermid
Inhaltsübersicht
Prolog
Erster Teil
Eins
Zwei
Drei
Vier
Fünf
Sechs
Sieben
Acht
Neun
Zehn
Zweiter Teil
Elf
Zwölf
Dreizehn
Vierzehn
Fünfzehn
Sechzehn
Siebzehn
Achtzehn
Neunzehn
Dritter Teil
Zwanzig
Einundzwanzig
Zweiundzwanzig
Dreiundzwanzig
Vierundzwanzig
Fünfundzwanzig
Sechsundzwanzig
Siebenundzwanzig
Achtundzwanzig
Neunundzwanzig
Dreißig
Einunddreißig
Zweiunddreißig
Dreiunddreißig
Vierter Teil
Vierunddreißig
Fünfunddreißig
Sechsunddreißig
Siebenunddreißig
Achtunddreißig
Neununddreißig
Vierzig
Einundvierzig
Zweiundvierzig
Fünfter Teil
Dreiundvierzig
Vierundvierzig
Fünfundvierzig
Sechsundvierzig
Siebenundvierzig
Achtundvierzig
Neunundvierzig
Fünfzig
Danksagung
Prolog
Es waren einmal zwei Jungen.
Aber es geht auch genauer. Es war vor fünfundzwanzig Jahren, und einer der Jungen war ich. Der andere war mein bester Freund Rob. Es war an einem warmen Tag im August, und wir waren auf Entdeckungstour. Wir waren zehn Jahre alt, mit Fahrrädern und kleinen Rucksäcken unterwegs, die Karte unseres Heimatdorfes im Kopf.
Meine Mutter hatte einen alten, zerfledderten Autoatlas, in dem ich auf langen Autofahrten immer gern blätterte. Für mich waren das damals Erwachsenenkarten, in denen man Erwachsenendinge fand: Kirchen, Gasthäuser und Tankstellen. In der Schule hatte ich all die verschiedenen Symbole für Generalkarten lernen müssen. Ein Kind aber orientiert sich an ganz anderen Wegpunkten. An Straßennamen und offizielle Landmarken dachte ich in dem Alter nicht. Für mich gab es nur den Steinbruch, das Feld, den Killer Hill, den Kalkfelsen, die alte Eiche. Alles Orte, die Erwachsene nicht kannten und die deshalb namenlos geblieben waren. Vielleicht waren es auch nur Legenden, die Kinder sich untereinander erzählten, die Orte waren wichtig, weil wir uns dort getroffen und gespielt haben. Erwachsenenorte waren dort, wo die Erwachsenen hinmussten. Kinderorte entstanden einfach, weil wir dorthin gingen.
Als wir an jenem Tag auf den ruhigen Dorfstraßen unterwegs waren, fuhr Rob immer ein Stück voraus. Ich weiß noch, wie sich der untere Rand seines T-Shirts aufblähte und er sich mit abgewinkelten Armen am Lenkrad festhielt. Seine Klamotten und das Fahrrad waren um einiges teurer als meine, und trotzdem waren wir beste Freunde, und das schon, seit wir vor sechs Jahren in die Schule gekommen waren. Vom ersten Tag an waren wir unzertrennlich. Mit anderen Kindern haben wir uns zwar immer gut verstanden, waren aber trotzdem etwas anders als sie. Wir zwei waren stiller als die anderen Jungen: empfindsamer und nicht so wild. Unsere Eltern waren sehr verschieden – die von Rob hatten viel Geld, meine Mutter nicht –, aber wir Kinder waren uns ähnlich. Auf ewig beste Freunde, hatte meine Mutter eines Tages strahlend gesagt. Das seid ihr für mich. Daran erinnere ich mich, und es war mir nicht einmal peinlich, als sie es sagte. Und auch an jenem Tag im August galt das.
Rob sah sich über die Schulter nach hinten um.
»Brücke?«
»Klar«, sagte ich. »Brücke.«
Die Brücke führte eigentlich nirgendwo hin. Auf einer Seite zum Dorf, auf der anderen zu einem Weg durch die Felder. Wir spielten meistens gleich hinter Robs Haus; dort gab es ein Klettergerüst und eine Rutsche. Die Felder waren unbekanntes Gebiet, das sich bis ins Unendliche zu erstrecken schien. Die Brücke dagegen war ein überschaubarer Ort, und das allein übte einen großen Reiz aus. Beide Flanken waren von einer dicken Mauer begrenzt. Der Weg dazwischen war unbefestigt: ungepflegt und zugewachsen. Rechts und links ging es tief zu den Schienen hinab.
Da fuhren Rob und ich hin und lehnten unsere Räder an die Mauer. Die Welt um uns herum verstummte.
Wir gingen ein kurzes Stück. Steine knirschten unter unseren Füßen. Außer dass man einfach da sein wollte, gab es keinen besonderen Grund, dort zu sein. Auf der Mitte der Brücke blieben wir stehen. Die Mauer reichte uns bis zur Brust. Wenn wir aber die Arme darüberlegten und uns auf der Außenseite festhielten, konnten wir uns über die raue Steinfläche ziehen und hinuntersehen.
»Was meinst du, ob man wohl tot ist, wenn man da runterfällt?«, fragte Rob.
Ich sah hinab. Es war tatsächlich sehr hoch, zwanzig Meter oder sogar mehr. Und der Raum zwischen uns und dem Boden schien von einer unbändigen Kraft erfüllt zu sein. Eingebettet in zahllose kleine Kieselsteine erstreckten sich die Schienen weit bis zum Horizont hin. Zu den Seiten erhoben sich steile, von Farnen und Bäumen überwucherte Böschungen mit hervorstehenden Felsen.
»Worauf du dich verlassen kannst«, antwortete ich.
»Ich weiß nicht. Ich wäre mir nicht so sicher. Vielleicht überlebt man das doch.«
»Aber sicher nicht unversehrt.«
»Nein. Sicher nicht. Und das vermutlich auch nicht lange.«
Während wir immer noch über die Mauer hingen, entdeckte ich zwischen uns eine Schnecke. Die Musterung ihres Hauses faszinierte mich. Ich löste eine Hand, streckte sie nach ihr aus und fuhr mit der Fingerspitze ihre Windung nach. Immer weiter, bis sie sich zu einem kaum erkennbaren schwarzen Punkt verdichtet hatte. Dabei stellte ich mir vor, dass man, wenn man besser sehen könnte und der Finger klein genug wäre, dieser Windung unendlich weit folgen könnte …
»Was machst du da?«, fragte Rob.
»Ich weiß nicht. Ich finde das einfach toll.«
»Du schnippst sie aber nicht weg, oder?«
»Nein«, sagte ich. »Natürlich nicht.«
Blitzartig zog ich die Hand zurück. Niemals wäre mir das in den Sinn gekommen. Trotzdem stellte ich mir vor, wie die Schnecke nahezu gewichtslos durch die Luft trudelt und mit der harten Schale dort unten auf den Steinen aufschlägt. Die Schnecke, dachte ich, würde den Sturz wahrscheinlich gut überstehen. Aber so etwas hätte ich nie getan.
Trotzdem wirkte Rob ernsthaft beunruhigt. So war es das ganze Jahr schon gewesen. In den letzten zwölf Monaten hatte er sich viel mit dem Tod beschäftigt. Im Sommer davor war seine kleine Schwester Mary gestorben, und er war seitdem nicht mehr der Alte. Wir waren immer noch Freunde, aber Rob schien schneller älter geworden zu sein als ich, so dass ich das Gefühl hatte, ihn möglicherweise nie einholen zu können. Er schien die Welt mit anderen Augen zu sehen: als eine Welt voller schlimmer Dinge, Bedrohungen und Gefahren. Alles bereitete ihm Sorgen. Aber weil er mein bester Freund war, sorgte auch ich mich um ihn. Ich wollte, dass es ihm gut ging.
»Natürlich nicht«, sagte ich noch einmal.
Dann sah ich auf und erblickte einen Zug, der aus der Ferne herannahte. Mit beiden Händen suchte ich wieder Halt an der Mauer. Aus der Distanz schien er sich träge und schwerfällig auf uns zuzubewegen, wobei sich die nachfolgenden Waggons einer nach dem anderen hintereinanderreihten. Erst als er die Brücke erreichte und unter ihr hindurchdonnerte, empfand man den Druck und die Wucht, die von der Geschwindigkeit ausgingen.
Zwanzig Meter darüber spürte ich, wie die Luft verwirbelte, zu uns heraufdrängte und die ganze Welt beben und vibrieren ließ. Selbst unter den Armen und in der Brust konnte ich es fühlen. Ein Waggon nach dem anderen – der Zug schien kein Ende zu nehmen, so lang war er. Und plötzlich war er verschwunden und hatte sich mit seinem ohrenbetäubenden Lärm hinter uns in die Ferne zurückgezogen.
Ich drehte mich zu Rob um. Ich war aufgeregt und wollte etwas sagen, als ich sein verängstigtes Gesicht sah. Er hielt sich immer noch am Rand der Brücke fest, sah aber an mir vorbei, und sein Gesicht war blass. Er zitterte am ganzen Körper.
»Was ist los?«, fragte ich.
»Da war jemand.«
Immer noch starrte er rechts an mir vorbei auf einen Punkt hinter mir, und was er sagte, klang so überzeugend, dass ich, als ich mich umsah, fast überrascht war, nichts anderes zu sehen, als dass wir allein waren.
»Wo?«, fragte ich.
»Genau da«, sagte Rob, »genau neben dir.«
Ich sah mich noch einmal um. »Jetzt spinn doch nicht rum.«
»Tu ich nicht. Ich habe ihn gesehen. Einen Mann mit langen Haaren. Da vorn auf der Mauer hat er gesessen und mich direkt angesehen. Und sein Gesicht, Will …«
»Was war damit?«
»Er sah so traurig aus.«
»Wirklich?«
Ich bemühte mich, möglichst beherrscht zu klingen, aber natürlich beängstigte mich das ein wenig. Ich wusste immer, wann er einen Scherz machte, aber das hier war keiner. Ihm war es ernst; was immer er gesehen haben mochte, hatte ihm wirklich Angst eingeflößt. Es war ein strahlender Tag, aber jetzt hatte sich eine Wolke vor die Sonne geschoben und die Welt dunkler werden lassen.
»Vielleicht hat du ja einen Geist gesehen«, sagte ich.
»Ich weiß es nicht.« Kopfschüttelnd ließ er sich von der Mauer herabgleiten. »Vielleicht fange ich an durchzudrehen.«
»Du meinst, du fängst damit erst an?«, setzte ich nach.
»Sehr lustig, Turner. Mit der Nummer solltest du auf Tour gehen.«
»Vielleicht mach ich das auch.«
»Kannst ja deine Anna mitnehmen.«
»Niemals. Warum sollte ich?«
»Weil du in sie verknallt bist.«
Er machte Kussgeräusche, und ich rollte mit den Augen. Anna Hilton war ein Mädchen aus unserer Klasse, und Rob zog mich immer gern mit ihr auf. Ich stritt es zwar immer ab, aber er hatte recht. Ich war über beide Ohren in sie verschossen.
»Niemals«, wiederholte ich.
»Wettfahrt zum Kalkfelsen?«
»Abgemacht.«
Aber als Rob zu der Stelle zurückging, an der wir unsere Fahrräder gelassen hatten, wurde ich auf einmal unschlüssig. Er war etwas größer als ich, wirkte in dem Moment aber eher klein. Und wieder überkam mich das dringende Bedürfnis, ihn beschützen zu wollen. Es sollte ihm gut gehen. Ich wollte, dass er sich wohlfühlte. Ich nahm die Schnecke vom Stein und setzte sie im Unkraut unten vor der Mauer ab. Eine sinnlose Aktion, und Rob hatte sie nicht einmal mitbekommen. Für mich aber fühlte sie sich auf eine seltsame, geheimnisvolle Weise bedeutungsvoll an.
Über jenen Tag oder über den Mann mit dem traurigen Gesicht, den Rob zu sehen geglaubt hatte, haben wir nie wieder ein Wort verloren. Hin und wieder dachte ich daran, besonders dann, wenn ich Rob dabei beobachtete, wie er in Gedanken versunken und offensichtlich beunruhigt in der Ferne etwas sah, das ich weder sehen noch begreifen konnte. Ich glaube, ich habe es damals für eine Art Halluzination gehalten. Einen Tagtraum. Vielleicht eine Pareidolie: ein Trugbild, das entsteht, wenn sich Formen für einen kurzen Moment zu einem Muster, einem Bild oder einem Gesicht zusammenfügen.
Erst viele Jahre später, als der Red-River-Killer in mein Leben trat, fing ich an, mich zu fragen, ob es etwas anderes gewesen war.
Erster Teil
Eins
Im Moment kann sie sich nur Geschichten ausdenken.
Als Kind hat Amanda das immer getan. Wie Kinder das so tun. Den Wirrnissen dieser Welt gegenübergestellt, flüchten sie sich in Fantasien, die sie umgestalten, um sich einen Reim auf alles machen zu können. Was sie erleben, verwandeln sie in eine Geschichte. Sie lassen ihre Spielzeuge miteinander sprechen und untermalen das mit selbstgemachten Geräuschen.
Anders als die anderen Kinder schrieb Amanda ihre Geschichten nieder.
Ihre Mutter faltete buntes A4-Papier in der Mitte, nähte ein paar Seiten zusammen und sagte: Hier hast du ein leeres Buch, Amanda; mach es doch bitte voll für mich. Die Familie war nicht mit Reichtum gesegnet, aber ihre Mutter bestärkte sie in der Vorstellung, dass sich zwischen Buchseiten Welten auftun konnten. Und Amanda war fest davon überzeugt. Sie schrieb Geschichten über andere Planeten, Prinzessinnen, Superhelden und geflügelte Pferde. Ihre Geschichten wurden, wie auch sie selbst, von Mal zu Mal vollkommener. Aber ein Thema veränderte sich nie: Das Gute obsiegte stets über das Böse, und die Unholde in den Geschichten wurden alle bezwungen. Und wenn man sich ihnen entgegenstellte, waren sie nie so furchterregend, wie man zuerst glaubte.
Darüber denkt sie jetzt natürlich anders.
Es ist still und dunkel, während Amanda erneut ihre Handgelenke zu lösen versucht, und wieder gibt der behelfsmäßige Pranger nicht einen Millimeter nach. Der Mann hatte ihn selbst gebaut – oder zumindest umgearbeitet. Vielleicht hat er nur drei Löcher in die Platte eines massiven Esstisches gearbeitet, die Platte dann in der Mitte durchgesägt und Metallscharniere drangeschraubt. Die beiden Löcher an den Seiten sind kleiner; in denen sind ihre Handgelenke fixiert. Im mittleren steckt ihr Hals so schräg, dass ihr Kopf zurückgehalten wird. Sie kniet auf dem rauen Stein des Garagenbodens, nur die Hände und der Kopf sichtbar, als wäre es die makabere Darstellung eines Mahles, das man auf einem rauen, fleckigen Tisch angerichtet hat.
Wie lange sie jetzt schon hier ist, weiß sie nicht.
Ihr bleibt nichts zu tun, außer … Na ja. Sich Geschichten auszudenken.
Sie stellt sich den Weg am Kanal vor, der auch am frühen Abend noch mit gelbem Sonnenlicht gesprenkelt ist. In den Geschichten, die sie sich erzählt, radelt sie zu etwas früherer oder späterer Zeit dort entlang oder meidet ihn ganz. Der Mann macht einen Fehler, und dann kommt jemand, um sie zu retten. Oder der Mann wartet gar nicht im Gestrüpp auf sie.
Was wäre, wenn …?
Sie hätte über die Jahre womöglich aufgehört, Geschichten niederzuschreiben, aber sie weiß, dass sie niemals aufgehört hat, Geschichten zu erzählen, denn so ist es eben bei Erwachsenen. An die Stelle von Kinderspielzeug wären möglicherweise Zeitungsartikel, Werbeanzeigen und Beziehungen getreten, immer noch aber zu neuen Geschichten verbunden, die der Welt einen Sinn verleihen. Als Erwachsene hat sie Geschichten über sich und die Dinge erzählt, die ihr passiert sind, hat sich sinnvolle Konstellationen im vom Zufall geprägten Kosmos ihres Lebens gesucht.
Aber wie bei den meisten Menschen waren die Geschichten, die sie sich erzählt hat, immer Nebenhandlungen oder Unterkapitel. Sie hat bis jetzt nie wirklich über den Schluss nachgedacht: das Ende. Jetzt aber ist es schwer, nicht daran zu denken. Der Mann hat ihr Fotos von den anderen gezeigt: den Frauen, die vor ihr kamen. Sie weiß genau, wie das Ende aussehen wird.
Hoffentlich kommt es bald.
Das Band ist so stramm und so weit oben um die untere Hälfte ihres Gesichts gewickelt, dass sie sich jede Sekunde darauf konzentrieren muss, durch die Nase zu atmen. Wie lange ist es nun her? Nicht seit dem Kanal – das war vor einer Ewigkeit und lässt sich in menschlichen Begriffen wahrscheinlich gar nicht mehr messen –, aber seit sie ihn das letzte Mal gesehen hat? Bestimmt einen Tag. Wahrscheinlich aber noch länger. Sie fühlt sich am ganzen Körper steif; ihr Mund ist ausgetrocknet. Vielleicht wird sie schließlich sterben. Und in dem Dämmerzustand, in dem sie sich befindet, lässt sich die Realität nur schwer von den lebhaften Geschichten trennen, die sie im Kopf immer wieder durchspielt.
Und was für Geschichten!
Am ersten Tag ihrer Gefangenschaft in diesem Haus hat Peter sie gefunden. Eine rührende Geschichte. Sie stellte sich vor, dass Peter einen der Gegenstände packte, mit denen der Mann ihr immer wehtat, und ihm über den Kopf zog. Dann nahm er sie in den Arm und sagte, dass alles in Ordnung sei, dass alles gut werden und niemand ihr jemals wieder etwas tun würde.
Dann Peter zu Hause mit Charlotte, ihrer Tochter. Sie sitzen am Frühstückstisch. Ist Mami noch nicht da? Wo ist Mami? Peter sah traurig aus und war kaum in der Lage zu antworten. Nein, noch nicht, Liebes. Aber hoffentlich bald. Dann klopfte es an der Tür. Es war die Polizei. Sie wurde lebendig gefunden.
In der Dunkelheit und Stille, die sie jetzt umgibt, erzählt sie sich jetzt eine letzte Geschichte.
Das Leben ist eine Verkettung aus Ursache und Wirkung, dem die kleinste Veränderung einen vollkommen anderen Verlauf geben kann. So stellt Amanda sich wieder als das kleine Mädchen vor, das seine Bücherregale betrachtet – für Bücher finden wir immer Geld, Amanda –, und wie sie in der öffentlichen Bibliothek im Schneidersitz auf dem Boden sitzt oder eigene Geschichten niederschreibt. Dieses Mal aber ändert sie in einer davon ein einziges Wort – sogar nur einen Buchstaben – und taumelt in der Gegenwart aus diesem abscheulichen Verlies in den Körper einer ganz anderen Frau. Einer Frau, die ein etwas anderes Leben gelebt hat und ein viel besseres Ende findet als das hier.
Wenn es nur so wäre.
Trotzdem. Jedes Leben hat seine Geschichte, und manche Geschichten bergen Wendungen und Überraschungen. Die Welt hält Geheimnisse unter Verschluss, bis die Zeit reif ist, sie uns offenzulegen.
Das hier ist ein Geheimnis.
Während Amanda dort im Dunkeln hockt, der Vergangenheit nachhängt und sich eine andere Gegenwart ausmalt, zwingt die Konstruktion des Prangers ihren Blick zum Garagentor. Seit fast einem Monat wird sie hier gefangen gehalten, und sie ist seit vielleicht achtundvierzig Stunden ohne Essen und Trinken allein. Jetzt glaubt sie das Ende zu kennen, das ihre Geschichte nehmen wird.
Doch nein, sie kennt es nicht.
Denn in dem Augenblick löst sich die Wand neben dem Garagentor mit einem jähen, ohrenbetäubenden und gewaltigen Knall in seine Bestandteile auf.
Zwei
Es gibt Menschen, die glauben, dass es diese Dinge gibt.
Meine Mutter war so jemand. Sie glaubte an Geister. Als ich noch ein Kind war, erzählte sie mir, dass ein schlimmes Ereignis, das sich an einer bestimmten Stelle zuträgt, dort seinen Abdruck hinterlässt und jemand, der für solche Dinge empfänglich ist, in der Lage ist, das zu spüren. Wie ein Geist, sagte sie – eine Erinnerung, die nicht einer Person, sondern einem Ort innewohnt. Als würden die Häuser, Wege und abgelegenen Pfade, die Schauplatz böser Dinge geworden sind, später immer wieder davon träumen, ohne aufwachen zu können, genau wie jemand in einem Albtraum immer wieder durchlebt, was ihm Furchtbares zugestoßen ist.
Als kleiner Junge glaubte ich das. Als Erwachsener? Eher nicht.
Als Polizist bin ich an viele Stellen gekommen, an denen sich schreckliche Dinge zugetragen haben. Daher kann ich behaupten, dass man es eigentlich nicht spüren kann. Häuser sind nichts anderes als Konstruktionen aus Stein und Zement, in denen sich Einrichtungsgegenstände befinden. Sie wissen nichts, und es ist ihnen auch egal. Menschen wissen etwas, Menschen ist es nicht egal – oder eben doch.
Orten kann eine bestimmte Kraft und eine besondere Bedeutung zugeschrieben werden, aber immer nur nachträglich. Konzentrationslagern haftet daher eine bestimmte Aura an, und aus demselben Grund, wenn auch im kleineren Rahmen, legen Menschen nach einem Unfall Blumen an Laternenmasten ab. Einige Orte, an denen sich Schreckliches oder Trauriges zugetragen hat, werden für immer erhalten und wie Gärten gepflegt. Andere Häuser, in denen Verbrechen begangen wurden, werden irgendwann danach dem Erdboden gleichgemacht, so dass die Straße, in der sie standen, daliegt wie ein Gebiss mit einem ausgeschlagenen Zahn. Wir spüren die Spannung zwischen dem Wunsch, etwas abzureißen und zu vergessen, und dem Bedürfnis, es für immer im Gedächtnis zu behalten. Und das passiert nur, nachdem man von etwas erfahren hat, nicht vorher.
Aber ich selbst habe das schon ein paarmal infrage gestellt: wenn ich vor einem Haus stand, zu wissen glaubte, dass etwas darin nicht stimmte, und die Ahnung dann bestätigt wurde. Bestätigungsfehler nennen einige das, eine Form selektiver Wahrnehmung, doch daran glaube ich nicht so recht. Jedenfalls handelt es sich in den Fällen, die ich meine, um etwas anderes als nur ein ungutes Gefühl. Ein Anflug von Furcht schwingt mit, die einem wie die unangenehme Erinnerung an etwas, das noch gar nicht passiert ist, den Nacken hochkriecht. Im Unterschied zu anderen Polizisten hält irgendetwas in mir an dem fest, was mir meine Mutter erzählt hat, und ich versuche immer zu unterscheiden, ob ein Bestätigungsfehler vorliegt oder nicht, wenn ich so ein Gefühl verspüre.
Und an dem Tag, als Emma und ich zum Haus eines Mannes namens John Blythe kamen, hatte ich es.
Drei Streifenwagen waren schon da, als wir vor dem Haus eintrafen. Ansonsten unterschied es sich in nichts von den Häusern in der Nachbarschaft – oder generell von den Grundstücken, die diese trostlose Gegend der Stadt ausmachten. Vor fünfzig Jahren war dort alles noch Brachland gewesen. Als ich herzog, zehn Jahre liegt das inzwischen zurück, war es in fast drei Quadratkilometer Bauerwartungsland umgewandelt worden, aber schon damals war abzusehen, dass sich die Träume nicht erfüllen würden. Die Straßen sahen alle gleich aus – endlose Reihen kaum voneinander unterscheidbarer Doppelhaushälften, deren Risse, die über die Jahre entstanden waren und sich immer weiter ausbreiteten, zu überspachteln niemand für nötig hielt. Manche Gegenden sind eben so. Egal, was gebaut oder angepflanzt wird, der Boden scheint jedes Gedeihen zu vereiteln.
Ich parkte hinter dem ersten Polizeibus, verschränkte die Arme vor der Brust und beugte mich über das Lenkrad. Es war ein kleines Haus mit zwei Stockwerken und jeweils zwei Räumen. Der Himmel war bedeckt, so dass man von draußen in den beiden oberen Räumen das Licht brennen sah. Die nackten Glühbirnen schimmerten durch die roten Vorhänge hindurch. Die Haustür stand offen, davor ein Officer, die Hände hinter dem Rücken verschränkt.
Und da war es. Das flaue Gefühl, das mir den Nacken hinaufkroch.
Hier stimmt etwas nicht.
Dies als Bestätigungsfehler abzutun war natürlich leicht, denn man hatte uns ja bereits darüber unterrichtet, dass hier etwas nicht stimmte. Mein Blick ging zu den Trümmern der halb in sich zusammengesunkenen Garage neben dem Haus, in denen noch das Wrack des Autos steckte, das sich auf spektakuläre Weise dort hineinmanövriert hatte. Ein gutes Viertel der Außenmauern war bei der Kollision eingebrochen, und das Dach war heruntergestürzt, so dass man fast meinen konnte, die Garage würde wegen dem, was ihr widerfahren war, die Stirn runzeln.
»Was denkst du, Will?«, fragte Emma.
»Noch denke ich gar nichts.«
Sie seufzte leise. Emma und ich waren schon seit Jahren Partner, und sie hatte sich an mich gewöhnt, an meinen Hang zur Selbstreflexion, an meine Launen. Sie hatten sich herumgesprochen und galten in der Abteilung als Charakterzug von mir. Meiner Beliebtheit war das natürlich nicht zuträglich.
»Du fängst jetzt nicht an durchzudrehen, oder?«, setzte Emma nach.
Ich betrachtete das Haus.
»Es kommt mir vor wie ein Gesicht«, bemerkte ich schließlich.
»Wie bitte?« Emma beugte sich ebenfalls vor und sah durch die Windschutzscheibe hinaus. »Das Haus? Klar. Sehen nicht alle Häuser wie Gesichter aus?«
»Pareidolie.«
»Genau.«
Sie hatte recht, aber die Erscheinung war hier besonders auffällig. Einen Moment lang konnte ich gar nichts anderes sehen. Die fahlen, gräulichen Außenwände nahmen die Gestalt toter Haut an; die offene Tür wurde zu einem schmalen Mund; die Lichtpunkte in den oberen Fenstern waren Pupillen, die mich aus leuchtend roten Augen anzustarren schienen. Das Haus sah aus wie ein zur Hälfte im Boden versenkter, vor Schmerz oder Wut schreiender Kopf.
Dann löste sich die Erscheinung wieder auf.
»Keine Angst, ich dreh schon nicht durch.«
»Dir das zu glauben fällt mir schwer. Aber lass uns nachsehen, was los ist.«
Wir stiegen aus, Emma ging vor. Wir hatten zwar denselben Dienstrang, aber sie ging immer voraus. Unser Alter von Mitte dreißig war eines der ganz wenigen Dinge, die wir gemeinsam hatten. Die anderen beschränkten sich darauf, dass wir beide groß und schlank waren. Emma sah gut aus und war selbstsicher. Jeder wurde schnell mit ihr warm, ihr Charisma und ihr zwangloses Auftreten ließen alle annehmen, dass sie für eine höhere Stufe auf der Karriereleiter bestimmt war und sich nicht auf Dauer mit einem Partner wie mir herumschlagen müsste. Von mir kann ich mit Sicherheit behaupten, dass ich weder charismatisch noch charmant war. Wandelte Emma gemessenen Schrittes einher, konnte man meinen Gang eher als schlurfend bezeichnen. Ich bemühte mich immer, möglichst wenig aufzufallen, blieb lieber unbemerkt. Emma sagte einmal, dass ich selbst an einem strahlenden Sonnentag aussehen würde, als zöge ich den Mantel enger, um mich vor dem Regen zu schützen. Man möchte annehmen, dass dich alles bedrückt, hatte sie gesagt. Ich hatte ihr bestätigt, dass sie damit durchaus recht haben könnte. Und als würde es dich unglücklich machen. Auch das stimmte. Auf dem Weg zum Haus bemerkte ich die Reporter, die sich auf der anderen Straßenseite eingefunden hatten. »Können Sie uns schon etwas über die Frau erzählen, Detective?«
Ein Fernsehteam hatte ein Stück weiter angefangen, seine Gerätschaften aufzubauen. In unserer Nähe standen nur die Schreiberlinge von der Lokalpresse. Der Typ, der uns gerade angesprochen hatte, kam mir jedenfalls bekannt vor. Ich irrte mich bestimmt nicht. Instinktiv ging ich auf Emmas andere Seite und zog den metaphorischen Mantel enger um mich.
»Nein«, antwortete Emma freundlich lächelnd. »Wir sind noch keine zehn Sekunden hier, Joe. Ich hätte gedacht, dass Ihrem scharfen journalistischen Blick das nicht entgangen ist.«
Joe bedachte ihre Antwort mit einem Grinsen. Polizei und Presse fordern einander immer wieder zu einer Art Tanz auf – einem gut gelaunten Zerren um Informationen. Alle kennen die Musik und haben die Schritte weiß Gott oft genug geübt, so dass man mit einigen durchaus ein wenig scherzen und herumalbern kann. Aber nicht mit Joe.
»Es handelt sich offenbar um Amanda«, sagte er.
»Wenn Sie das sagen.«
»Man munkelt, sie sei im Krankenhaus.«
»Man munkelt eine ganze Menge, Joe«, rief Emma ihm über die Schulter zu. »Vergessen Sie das nicht, wenn Sie Ihren Artikel schreiben.«
»Es heißt auch, dass sie es nicht schafft.«
Ich blieb stehen und drehte mich langsam um.
Diese Reaktion schien Joe zu gefallen, und wie es aussah, nicht allein, weil er meine Aufmerksamkeit erhalten hatte. Die Vorstellung, dass die Sache tragisch enden könnte, schien ihm sichtlich zu gefallen. Ohne zu wissen, was ich sagen oder tun sollte, trat ich einen Schritt auf ihn zu.
Ich spürte Emmas feste Hand auf meinem Arm.
»Wir müssen weiter, Will.«
Ich fixierte Joe noch einen Moment, wandte mich dann ab und folgte ihr zu dem Officer, der am Absperrband Wache stand.
»Kannst du mir erklären, was das werden sollte?«, raunzte sie mich an.
»Ich weiß es nicht. Vielleicht wollte ich ihm nur klarmachen, dass es um einen Menschen geht, und darum, dass der vielleicht sein Leben verlieren wird.«
»Glaub mir, das ist Joe doch vollkommen egal.«
»Einmal ist immer das erste Mal«, murmelte ich. »Aber woher weiß er eigentlich, wer die Frau ist, und wir nicht?«
»Hat den Finger eben immer am Puls der Zeit, unser Joe. Außerdem gehst du doch nicht im Ernst davon aus, dass uns jeder alles erzählt, oder? Wir leiten hier schließlich nur die Ermittlungen.«
»Auch wieder wahr.«
Etwas an dem, was Joe gesagt hatte, ging mir aber nicht aus dem Kopf. Ich konnte es nicht richtig greifen. Es war, als hörte man jemanden von der anderen Seite eines lauten, überfüllten Raumes seinen Namen rufen, ohne dass man sagen konnte, wer es gewesen war, wenn man sich umdrehte. Und das seltsame Gefühl blieb. Nachdem wir uns mit den Dienstausweisen am Absperrband zu erkennen gegeben hatten, blickte ich wieder zu dem Haus hinauf. Auch jetzt konnte ich mich des Eindrucks nicht erwehren, dass es mich beobachtete.
»Ich würde mir gern zuerst die Garage ansehen«, sagte ich.
»Natürlich.«
Wir gingen an der Seite des Hauses vorbei zur Garage, die daran angrenzte. Die kurze Zufahrt war von Schutt und Scherben übersät. Die meisten Trümmer aber lagen drinnen. Dem Wagen war von hinten kaum etwas anzusehen. Erst die Beifahrerseite und die zusammengeschobene Motorhaube machten das Ausmaß des Schadens deutlich.
Das Fahrzeug – oder dessen Überreste – war ein schwarzer Honda, der gestohlen gemeldet worden war. Eine Polizeistreife hatte ihn an jenem Morgen um kurz nach elf Uhr entdeckt und das Blaulicht eingeschaltet. Der Fahrer zeigte keinerlei Absicht anzuhalten und machte sich sofort aus dem Staub. Dabei war es dem reinen Glück zu verdanken, dass auf der kurzen Verfolgungsjagd niemand zu Tode gekommen war. An dieser Ecke hatte er dann die Kontrolle über das Fahrzeug verloren, war von der Straße abgekommen, in die Ecke der Garage gekracht und hatte dabei einen Teil des Mauerwerks zum Einsturz gebracht.
Der Fahrer selbst war zwar verletzt, befand sich aber in einem stabilen Zustand. Er war festgenommen und ins Krankenhaus gebracht worden.
Zusammen mit der Frau.
Ich trat neben den verunglückten Wagen und ging in die Hocke, genau wie es der Officer getan hatte, der als Erster am Unglücksort gewesen war. Niemand war nach dem Unfall aus dem Haus gekommen, um zu sehen, was passiert war. Der Officer wollte sichergehen, dass sich niemand in der Garage befand. Aber genau da war jemand gewesen.
Ich spähte in den Raum. Eine nackte Glühbirne hing an einem Kabel, das wegen der Neigung des Daches schief von der Decke baumelte. Vor den beiden Wänden, die stehen geblieben waren, standen Metallregale. Mein Blick wanderte über Werkzeuge, Eisen und Heizkörper, Benzinkanister und Farbeimer, undefinierbare Stapel von Metallteilen. Die Garage schien einem Mechaniker zu gehören, wofür nicht zuletzt die Arbeitsgrube sprach, die in der Mitte im Boden eingelassen war. Dort hatte der Officer, nachdem er seine Taschenlampe in das Loch in der Ecke gerichtet hatte, die nackte Frau entdeckt. Sie war geknebelt und in einem selbstgemachten Pranger fixiert worden und sah ihn mit schreckgeweiteten Augen an.
Man munkelt, sie sei im Krankenhaus.
Es heißt auch, dass sie es nicht schafft.
Der Bodensatz der Presse war besser informiert als wir. Ich hatte keine Ahnung, in welcher Verfassung die Frau sich befand. Der ersten Meldung hatte ich nur entnommen, dass sie stark dehydriert und mit deutlich sichtbaren, schwersten Verletzungen aufgefunden worden war.
Mein Blick wanderte von der inzwischen leeren Grube zu den Regalen an den Wänden. Das Werkzeug. Die Eisenteile. Beim Einatmen nahm ich den ekligen abgestandenen Gestank von Körperflüssigkeiten wahr.
»Spurensicherung?«, fragte ich mit ruhiger Stimme.
»Unterwegs.«
Es wurde Zeit, auch ins Haus zu gehen, aber ich sah mich noch einen Moment in der Garage um. Nichts regte sich, doch die Ruhe wirkte seltsam und schwer. Unheilvoll.
Etwas Schreckliches ist hier passiert.
Zu dem Zeitpunkt wusste ich, dass mein Eindruck völlig richtig war. Andererseits aber auch wieder nicht. Nicht so ganz.
Denn ich ahnte nicht, wie schlimm es noch werden würde.
Drei
Während der gründlichen Untersuchung der Räumlichkeiten im unteren Stockwerk konnten wir uns ein genaueres Bild von dem Besitzer machen. Sein Name war John Edward Blythe. Er war siebenundvierzig Jahre alt und arbeitete tatsächlich als Mechaniker bei einer großen Werkstattkette wenige Meilen von dem Haus entfernt. Ein paar Kollegen waren dorthin unterwegs, um ihn festzunehmen.
»Hübsche Behausung«, bemerkte Emma.
»Ach, findest du?«
»Nein, natürlich nicht. An deinem Sinn für Ironie musst du dringend arbeiten.«
Außer der Küche gab es unten zwei große Räume. Beide waren vollkommen verdreckt und so sehr mit Gerümpel zugestellt, dass man sich kaum drehen und wenden konnte. All dem lag eine bedrückende Planlosigkeit zugrunde. In einem normalen Haus hätte es ein Wohnzimmer und ein Esszimmer gegeben. Hier war nicht auszumachen, welcher Raum welchem Zweck diente. In einem stand ein Sofa schräg zur kahlen Wand. Im anderen umringten ein paar ramponierte Sessel mit dem Rücken nach hinten einen Turm verwitterter Kisten, der fast bis zur Decke reichte. Alte Holzstühle waren umgekehrt übereinandergestapelt wie in einer Bar nach der Sperrstunde, und überall lagen Zeitschriftenstapel planlos verstreut. Alles verströmte einen modrig-muffigen Geruch. Verblichene Landschaftsdrucke waren schief an die Wände getackert, als hätte sich das Haus zur Seite geneigt oder demjenigen, der die Bilder angebracht hatte, wäre der Sinn von Bildern verborgen geblieben.
Das alles verstärkte den Eindruck, den ich schon bei unserer Ankunft gewonnen hatte. Was von außen einen halbwegs akzeptablen Eindruck gemacht hatte, entpuppte sich bei näherer Betrachtung eben nur als der äußere Schein – mit dem sich das Haus einigermaßen an die Nachbarschaft anpasste. Auf der anderen Seite der Haustür herrschte nicht nur das pure Chaos, sondern ihm wohnte auch etwas Fremdartiges inne. Gemahnte es von außen an einen halb im Boden versunkenen Kopf, bot sich drinnen der verstörende Einblick dessen, was sich in dem Schädel abspielte. Zerstreut, gestört, gleichgültig. Ein wirrer Versuch von Normalität, der gründlich schiefgegangen war.
Emma schien meine Gedanken zu lesen, als wir die Küche betraten.
»Das sieht schon ein bisschen nach Wahnsinn aus, oder?«, sagte sie.
»Sieht nicht nur so aus, riecht auch so.« Und fühlt sich so an, wollte ich hinzufügen, bevor ich es mir anders überlegte. Dabei hätte Emma mir vermutlich nicht einmal widersprochen.
Fliegen schwirrten um das dreckige Geschirr, das sich auf dem Küchentresen und um die Schränke herum auf dem Boden stapelte. Das Spülbecken war randvoll mit trübgrauer Brühe gefüllt. Wie im übrigen unteren Stockwerk schien auch hier nie saubergemacht oder gelüftet worden zu sein. Ein unangenehmer, fleischiger Geruch hing in der Luft.
Emma deutete in den Raum.
»Was für ein Mensch lebt so?«
»John Blythe offensichtlich.« Ich sah kurz auf mein Handy, ob es neue Nachrichten gab, und steckte es sofort wieder weg, da nichts gekommen war. »Aber wir finden es hoffentlich bald heraus, wenn wir persönlich mit ihm sprechen.«
»Führt die Tür in den Keller? Oder in die Speisekammer?«, fragte Emma.
Ich folgte ihrer Handbewegung. Hinten in der Wand gab es eine Tür, direkt gegenüber der, die in die angebaute Garage führte. Der größte Teil der weißen Farbe war abgeblättert und hatte das schwarze bloße Holz darunter freigelegt; es sah aus, als wäre es in einem Lagerfeuer verkohlt. Das ungute Gefühl verstärkte sich.
»Finden wir es heraus.«
Ich streifte ein Paar Handschuhe über. Noch bevor ich den kalten Türgriff berührt hatte, durchzog ein leises Kribbeln meine Hand. Kaum öffnete ich die Tür, schlug mir ein Schwall abgestandener Luft aus dem Treppenabgang entgegen, der sich dahinter befand. Ich verzog angewidert das Gesicht.
»Keller«, stellte ich fest.
Dann kam der Gestank. Es war derselbe fleischig-ranzige Mief, der in der Küche hing, nur um einiges intensiver. Mir war klar, dass, was immer sich da unten befand, die Quelle war. Das modernde Herz dieser Behausung.
Irgendetwas ist hier ganz und gar nicht in Ordnung.
»O Gott, kannst du …?«
»Du meinst, ob ich das rieche? Ja.«
Ich fand einen Lichtschalter an der Wand gleich neben der Tür. Ich betätigte ihn, worauf eine Glühbirne oben über dem Treppenabsatz aufleuchtete. Das Kabel, an dem sie von der Decke hing, war von dicken Staubfäden umhüllt. Auch unter mir flackerten Lampen auf und erfüllten den Raum mit einem schwachen, diffusen Brummen.
»Will, wir warten besser auf die Spurensicherung.«
Ich nickte. Natürlich sollten wir das. Aber hier einfach stehen bleiben, das konnte ich auch nicht. Ich trat einen Schritt vor auf den staubigen Treppenabsatz. Das Haus fühlte sich jetzt lebendiger an, und ich bekam die alberne Vorstellung nicht aus dem Kopf, dass es mich irgendwie erkannte. Als hätten unterirdisch zwei Getrieberädchen unbemerkt ineinandergegriffen und würden sich gemeinsam drehen.
Mit jeder weiteren Stufe intensivierte sich der Geruch. Ich wusste, was es war. Altes Fleisch und Verwesung. Aber noch etwas anderes war dabei. Weniger ein Geruch als die vage Erinnerung an etwas Fundamentaleres. Was ich da unten finden würde, war klar. Vom Ausmaß jedoch machte ich mir keine Vorstellungen.
Auch als ich unten an der Treppe angelangt war und in den Keller trat, wurde es nicht sofort offenkundig. Der Raum war klein und quadratisch, im Vergleich zum Erdgeschoss des Hauses sauber und ordentlich. Neben der Treppe lag eine Matratze. Hatte John Blythe wirklich hier unten geschlafen? Ansonsten war der Raum leer. Auf der anderen Seite entdeckte ich eine weitere Tür in der Wand.
Auch Emma kam die Treppe herunter. Sie hielt sich einen Arm vor das Gesicht.
»O Gott, was für ein Gestank.«
Ohne zu antworten, ging ich zu der geschlossenen Tür. Ein alter schwarzer Schlüssel steckte im Schloss. Ich drehte ihn um und zog die Tür langsam auf. Ein kleinerer Kellerraum tat sich vor mir auf. Ich trat ein und sah, was dort gelagert wurde.
Fässer.
Es waren vier. Sie waren aus nahezu blickdichtem weißem Kunststoff mit schwarzen Deckeln, die mit kräftigen Metallklammern darauf festgemacht waren. Alle waren gleich groß – um die 50 Liter vielleicht. Durch das Plastik konnte ich erkennen, dass mindestens drei von ihnen mit irgendwas befüllt waren.
Ich hockte mich davor.
»Will …«
»Ich fasse nichts an.«
Ich neigte den Kopf ein wenig und versuchte mir die verschwommenen Formen zu erklären, die ich darin ausmachte. Es gab kein Licht in diesem Raum, so dass ich auf das vor mir stehende Fass einen Schatten warf. Ich nahm die Taschenlampe und richtete ihren Schein auf das Plastik.
Ich musste mich beherrschen, nicht zurückzuweichen. Aus der Nähe sah es aus, als würde sich hinter einer Tür mit Milchglasscheibe eine Ansammlung von Menschen drängeln. Ich bewegte den Lichtkegel und erkannte ein Haarbüschel, das an der Innenwand anlag, eine gespreizte, gegen das Plastik drückende Hand, deren Finger an den Rändern bereits in Auflösung begriffen waren …
Das Herz des Hauses schien mit einem Mal zu schnell zu schlagen.
Es handelt sich offenbar um Amanda.
Draußen war ich so sehr darauf konzentriert gewesen, dem Reporter zu entkommen und zum Tatort gelangen, dass ich gar nicht mehr daran gedacht hatte – an den Namen. Plötzlich fügte sich alles zusammen. Ich wusste wieder, wo ich ihn schon gehört hatte, und verstand, was ich gerade vor mir sah.
Auch, was das bedeutete, begriff ich sofort und sprang auf. John Edward Blythe war nicht hier. Am leichtesten würden wir ihn an seinem Arbeitsplatz festnehmen können, wussten aber nicht einmal, ob er dort überhaupt war.
»Wir müssen raus, zu den Leuten von der Presse.« Ich rannte an Emma vorbei zurück in den Hauptkeller und die Treppe hinauf. »Wir brauchen eine Pressesperre über den Tatort hier.«
Aber dafür war es schon zu spät.
Viel zu spät.
Vier
Es ist nicht entscheidend, wer ihn erwischt.
Das sagte ich mir zwei Stunden später, als Emma und ich im Büro unseres Chefs, DCI Graham Reeves, saßen.
Du musst es nicht sein.
Und das war gut, denn im Augenblick glaubte ich auch nicht, dass ich es sein würde. Reeves war ein dünner, drahtiger Mann von Ende fünfzig mit starken Muskeln und graumeliertem Haar, das er stets auf drei Millimeter kurz geschoren hielt. Beliebt war er in der ganzen Abteilung nicht. Seine Launen ließen sich immer sehr sicher beurteilen, wenn man vom genauen Gegenteil der Stimmung ausging, die er nach außen trug. Je aufgebrachter er nämlich war, umso ruhiger wirkte er – und im Moment schien er verdammt ruhig zu sein, wobei zu vermuten war, dass sich diese Ruhe gegen Emma und mich richtete. Eine bedrohliche Stille herrschte im Raum.
Auch DI James Ferguson war hinzugekommen. Ein großer Mann Ende vierzig, der lässig in seinem Sessel eher hing als saß. Wie eine halbfeste, in den Sessel gegossene Substanz. Ein guter Polizist, nehme ich an, aber auch ein Streber, wenn es um seine Karriere ging. Er hatte die Ermittlungen im Fall der verschwundenen Amanda Cassidy geleitet, und ich bezweifelte, dass er bereit war, sie ausgerechnet jetzt abzugeben, nachdem der Fall plötzlich Dimensionen erreicht hatte, die ihn womöglich eine weitere Stufe der Karriereleiter hinaufbeförderten.
Reeves drehte den Monitor auf seinem Schreibtisch wortlos zu uns um, insbesondere zu Emma und mir. In einem geöffneten Browserfenster lief die Berichterstattung eines Nachrichtensenders. Ich war mir sicher, dass es davon im Moment eine ganze Menge gab. Dieses hier war ein Livestream aus einem Pressehubschrauber, der Bilder von Polizisten zeigte, die in John Blythes Haus ein und aus gingen. Dem roten Schriftbanner am unteren Bildschirmrand war zu entnehmen: amanda cassidy lebend gefunden. IST der red-river-killer identifiziert? Der Ton war ausgeblendet. Aber eines Kommentars hätte es sowieso nicht bedurft, um zu verstehen, worum es ging. Reeves starrte uns mit ausdruckslosem, fast totem Blick an. Ich war mir nicht sicher, ob er überhaupt atmete.
»Ja?«, fragte er schließlich.
Ich überließ es Emma zu antworten, aber das hätte ich unter günstigeren Umständen auch getan. Die Gedanken schossen mir so schnell durch den Kopf, dass ich kaum in der Lage war, sie zu ordnen – und zu vermeiden, dass man es mir ansah. Niemand durfte erfahren, was mich so sehr beschäftigte. Wenn das passierte, lief ich Gefahr, von den Ermittlungen abgezogen zu werden, bevor sie überhaupt begonnen hatten. Und obwohl es nicht entscheidend war, wer ihn schnappte – du musst es nicht sein –, wollte ich das auf keinen Fall.
»Die Lage war schon außer Kontrolle, als wir zum Tatort kamen, Sir«, erklärte Emma.
»Und jetzt?«
»Die Presse hatte Wind von dem Namen bekommen, Sir. Sie kannten ihn bereits.«
»Wie konnte das passieren?«
»Ich weiß es nicht, Sir. Wir hatten keine Informationen, als wir am Tatort eintrafen.«
Reeves ließ die Stille einen Moment wirken, bis er sich an mich wandte.
»Was ist mit Ihnen, Sie Wunderknabe? Haben Sie etwas dazu zu sagen?«
»Eigentlich nicht, Sir.«
»Eigentlich nicht?«
Emma beugte sich vor.
»Detective Turner ist darauf gekommen, Sir. Aber als wir rauskamen, war es schon zu spät.«
»Ich habe Fotos aus dem zweiten Kellerraum gesehen, Detective. So schwer war es doch nicht, die Verbindung herzustellen.«
Das war der schlimmste Teil des Jobs – das Rumgeschiebe und Taktieren –, und in dem Moment war mir klar, dass noch mehr kommen würde. Dass das erst der Anfang war. Wenn die Meldungen stimmten, die ich da auf dem Monitor sah, dann konnten wir uns auf Ermittlungen von immensem Ausmaß einstellen, die sich über das ganze Land erstrecken würden. Und ich wusste nur zu gut, was dann passieren würde. Die Opfer würden allmählich in Vergessenheit geraten, und der Mann, der hinter den Entführungen und Morden steckte, würde zur Trophäe stilisiert. Hunderte von Officers aller Dienstgrade würden sich darum reißen, in die Ermittlungen mit einbezogen zu werden; danach lechzen, die Leitung zu übernehmen; nach Anerkennung gieren; die Verantwortung für jeden Fehler aber skrupellos von sich weisen. John Blythe zu erwischen war eine spektakuläre Angelegenheit, und jeder, der damit befasst war, würde ein möglichst großes Stück davon haben wollen.
Normalerweise hätte mich das alles kaltgelassen. Unter anderen Vorzeichen wäre mir nie in den Sinn gekommen, mich um meinen Anteil zu streiten. Mir würde es am Ende genügen zu wissen, dass der Täter gefasst war. Und das war vielleicht insofern auch jetzt so, als nicht die zu erwartende Anerkennung den Fall so wichtig für mich machte.
Ich schob ein Foto über den Schreibtisch.
»John Edward Blythe«, fügte ich hinzu.
Reeves fixierte mich, und ich musste mich beherrschen, nicht zurückzustarren – es auf einen Wettbewerb ankommen zu lassen. Wenn er vorhatte, Emma und mich von dem Fall abzuziehen, würde er es sicher tun. Ich würde nicht protestieren. Denn dieses Spiel war nur zu gewinnen, wenn man es umging und sich nicht darauf einließ. Ich wartete und ließ Reeves weiter starren, bis er das Foto schließlich zur Hand nahm und es ansah.
Es war eine Porträtaufnahme. Blythe mit schulterlangem, dunklem Haar und harten Gesichtszügen. Sein Blick sendete etwas Gemeines aus – oder vielleicht fehlte auch nur etwas darin. Als wäre ihm die Vorstellung, dass andere Menschen wirklich existierten, vollkommen fremd. Etwas Gefährliches lauerte in ihm, das selbst auf diesem Foto nicht zu übersehen war. Würde man in einem Pub zufällig seinem Blick begegnen, würde man sich vermutlich augenblicklich abwenden.
Reeves schob mir das Foto zurück.
»Ein besonders charmanter Zeitgenosse.«
»Blythe ist zweiundvierzig Jahre alt«, sagte ich. »Er ist eins achtundsiebzig groß und offensichtlich kräftig gebaut. Er hat dunkelbraunes Haar, das er so trägt, wie es auf dem Bild zu sehen ist. Blaue Augen. Abgesehen von seiner Größe, scheint er keine besonderen Merkmale zu haben. Ende 1998 ist er in das Haus gezogen, in dem er jetzt wohnt.«
»Und er arbeitet als Mechaniker?«
»Ja, Sir. In einer Werkstatt nur ein paar Meilen von seinem Haus entfernt. Laut Aussage seines Chefs ist er sehr gut in seinem Job. Er soll den Kollegen erzählt haben, dass Blythe ›es liebt, Dinge zu zerlegen‹.«
»Um Himmels willen. Das gefundene Fressen für die Boulevardpresse. Sie werden sich drauf stürzen.«
Reeves lehnte sich zurück und strich sich mit den Händen über das Haar. Das kurzärmlige Hemd ließ einen Blick auf die Bizepse zu, die sich auf den dünnen Armen wölbten. Seine Wut schien ein wenig verraucht zu sein, zumindest die, die gegen mich gerichtet war. Vermutlich dachte er jetzt darüber nach, was die Presse schreiben würde. Der Medienrummel, den ein so großer Fall auf den Plan riefe, wäre nicht minder unangenehm als das polizeiinterne Kompetenzgerangel, wenn nicht sogar schlimmer. Die Meldungen würden nicht abreißen, alle mit unterschiedlichem Schwerpunkt und Tenor, und die Presse würde schon bald mit dem Finger auf uns zeigen, wenn wir keine Festnahme lieferten. Das war immer so.
Tatsächlich wusste niemand von uns, wie weit wir von einer Festnahme entfernt waren. Den Kollegen, die zur Werkstatt gefahren waren, in der Blythe arbeitete, hatte der Eigentümer gesagt, dass er seinen Jahresurlaub genommen habe und seit der vorletzten Woche nicht zur Arbeit gekommen sei. War der Red-River-Killer entlarvt, wie in der Presse zu lesen war? Höchstwahrscheinlich ja.
Das Problem war, dass wir nicht wussten, wo er sich aufhielt.
»Erste Überprüfungen laufen«, berichtete Emma. »Blythes Kreditkarte und so weiter. Als Letztes hat er am Sonntag an einem Bankautomaten hier im Ort zweihundert Pfund abgehoben. Buchungen von Auslandsreisen gibt es nicht. Sein Name taucht auf keiner Passagierliste auf. Ich denke, als Nächstes …«
»Schießen Sie nicht ein wenig über das Ziel hinaus, Detective Beck?«
»Sir?«
»Es ist nicht Ihr Fall.«
Emma schwieg, aber ich spürte, wie es in ihr brodelte. Sie war ambitionierter als ich, und sie wusste, was dieser Fall bedeutete. Ihr war er genauso wichtig wie mir, nur aus anderen Gründen.
Jetzt erwachte auch Ferguson neben mir aus seinem Dämmerzustand. Die meiste Zeit unseres Gesprächs hatte er mit seinen dicken, über dem Bauch gefalteten Armen nur dagesessen. Amanda Cassidys Entführung war sein Fall gewesen. Nachdem Emma und ich nun die Leichen gefunden hatten, war nicht klar, wem die Leitung des erweiterten Falles zukäme. Ich konnte mir vorstellen, dass Ferguson jetzt Flagge zeigen würde. Und ausnahmsweise begann ich mich darauf einzustimmen, sie niederzureißen.
Reeves aber ließ keinen von uns zum Zuge kommen.
»Detective Turner und Detective Beck, halten Sie es für glaubhaft, dass John Blythe Urlaub macht?«
»Ich weiß es wirklich nicht«, sagte Emma.
Reeves nickte stumm vor sich hin. »Ich könnte es mir durchaus vorstellen. Man muss schließlich auch mal ausspannen, oder? Aber ich gehe davon aus, dass sein Vergnügen bald ein Ende haben wird, wenn das nicht bereits passiert ist. Ich wünsche mir zwar nichts mehr, als dass dies durch seine unverhoffte Verhaftung geschieht, halte es im Moment aber für viel wahrscheinlicher, dass er bis dahin sein Haus in den Nachrichten gesehen hat.«
»Ja, Sir.«
»Vielmehr müssen wir uns die Frage stellen, was dann geschieht. Wird er sich aus dem Staub machen? Und wenn, wohin? Das wissen wir natürlich nicht, weil wir keine Ahnung haben, wo er sich befindet, geschweige denn, wie schnell er ist. Vielleicht bringt er sich um. So was kommt vor.«
Ich schüttelte den Kopf.
»Sie glauben das nicht, Detective Turner?«
»Nein, Sir. Blythe ist nicht der Typ, der sich umbringt, auch wenn es für uns einfacher wäre. Aber er begeht doch nicht zwanzig Jahre lang all diese Morde, ohne entdeckt zu werden, nur um das Messer am Ende gegen sich selbst zu richten. Jedenfalls nicht, wenn er sich nicht dazu gezwungen sieht. Ob er sich lebend schnappen lässt, steht noch auf einem ganz anderen Blatt. Ich gehe eher davon aus, dass er abwarten will, wie sich die Sache entwickelt.«
»Ach ja? Und warum glauben Sie, ihn so gut zu kennen?«
Ich zuckte mit den Schultern. Wissen konnte ich das natürlich nicht. Es ging mir eben durch den Kopf. Reeves sah mich einen Moment prüfend an. Ich konnte mir vorstellen, dass sich mein Ruf für mein ausgeprägtes Bauchgefühl inzwischen bis zu ihm herumgesprochen hatte und er zu denjenigen gehörte, die solchen Dingen mit Verachtung begegneten.
Ich nahm das Foto wieder an mich und hielt es hoch.
»Fürs Protokoll. Wessen Fall es auch immer ist, ich glaube, wir sollten uns damit auf dem schnellsten Wege an die Medien wenden. Zusammen mit seinem Namen. Sein Haus ist sowieso schon in allen Berichten zu sehen. Dass er Wind von seiner Enttarnung bekommt, lässt sich nicht mehr verhindern.«
»Es sei denn, er campiert irgendwo draußen in der Wildnis.«
»Dann wär es auch egal. Wenn wir den Namen mit dem Foto öffentlich machen, erhöhen wir die Chance, dass sich jemand meldet. Irgendjemand muss ihn gesehen haben. Deshalb schlage ich vor, dass wir uns an die Öffentlichkeit wenden.«
Reeves fixierte mich wieder mit seinem Blick, während er überlegte. Name und Foto eines Verdächtigen zu einem so frühen Zeitpunkt herauszugeben war ungewöhnlich. Die möglicherweise umstrittenen Ermittlungen waren erst vor wenigen Stunden aufgenommen worden. Aber die Zeit drängte. Blythe würde sich nicht umbringen, davon war ich überzeugt. Das wiederum bedeutete, dass wir ihn finden mussten, und zwar schnell.
»Okay«, sagte Reeves schließlich. »Dann machen wir uns an die Arbeit.«
»Ja, Sir.«
»Sprechen wir nun über die Zuständigkeit.« Er deutete ein Lächeln an. Ich stellte mir vor, dass er die Situation genoss. Er würde diesen prominenten Fall, der die Öffentlichkeit zwei Jahrzehnte lang in Atem gehalten hatte, zum Abschluss bringen. »Nach außen übernimmt DI Ferguson die Federführung. Sie beide machen mit. Darf ich davon ausgehen, dass Sie einvernehmlich zusammenarbeiten?«
Ich war erleichtert.
»Ja, Sir.«
»Ja, Sir«, sagte Ferguson. »Aber die Frau, die in dem Haus gefunden wurde, ist Amanda. Das war mein Fall. Dabei würde ich es gern belassen. Die Suche nach dem Täter und so weiter.«
Die Entscheidung mochte seltsam erscheinen – kein Ruhmesblatt. Aber ich verstand, worum es ihm ging. Blythe war der Preis, und die Jagd auf ihn war die Story, aber die Aufmerksamkeit der Presse war im Moment voll und ganz auf Blythes Haus gerichtet. Könnte Ferguson sich dort als derjenige präsentieren, der die Zügel in der Hand hielt, dann wäre er der Mann im Fernsehen, derjenige, den man um Stellungnahme bäte. Er würde sich einen Namen machen. Und wenn Blythe gefasst war, würde es die Medien einen feuchten Kehricht interessieren, wer die Arbeit hinter den Kulissen eigentlich getan hatte; die Öffentlichkeit hätte bereits ein Gesicht zu dem Fall.
Emma mochte das vielleicht Unbehagen bereiten, mir nicht.
»Einverstanden«, sagte ich.
»Regeln Sie das bitte untereinander.« Reeves lehnte sich zurück. »Und halten Sie mich über alles auf dem Laufenden.«
»Ja, Sir.«
Beim Verlassen seines Büros dachte ich über meine Verbindung zu dem Fall nach. Über sie. Auch wenn es mir eigentlich egal sein sollte, wer von uns Blythe zur Strecke brachte, war es trotzdem wichtig.
Und ich bin auf jeden Fall dabei, dachte ich.
Ich bin dabei.
Fünf
Im Gehölz um John Blythes kleinen Zeltplatz herum wird es bereits dunkel.
Dabei ist es noch nicht einmal Abend. So ist es hier immer. Die Bäume bilden ein solches Dickicht, dass nur wenig Sonnenlicht zum Boden dringt. Das Unterholz ringsherum liegt im tiefen Schatten. Wenn er hier zeltet, kommt es ihm den ganzen Tag über so vor, als würde die Dämmerung hereinbrechen, und Blythe mag das. Noch lieber ist es ihm, wenn es am Abend um ihn herum stockdunkel ist.
Er atmet tief ein und nimmt den Geruch der Bäume, des Feuers und des Fleisches in sich auf, das vor sich hin brutzelt. Er fühlt sich immer wie zu Hause hier draußen, umgeben von der Natur. Es ist beruhigend, hierherzukommen nach dem, was er tut. Als Kind hat er so viel Zeit in der Wildnis verbracht, dass sie ihm ein warmes Willkommen zu bereiten scheint, wenn er zurückkehrt. Als würde sie ihn umarmen. An Geister glaubt er zwar nicht – denn sonst hätte er bestimmt schon einen gesehen –, kann sich aber die jüngere Ausführung seiner selbst mit überkreuzten Beinen an genau dieser Stelle, an einem älteren Feuer, vorstellen, ein Kind, das die Gegenwart des Mannes spürt, zu dem es einmal werden würde. Verrückt, ja, aber die Verbindung fühlt sich echt an. Vielleicht ist das der Grund, weshalb er hier vor all den Jahren immer mit sich im Reinen war und es sich jetzt als Erwachsener so gut anfühlt, hierher zurückzukommen. Hier schließt sich der Kreis. Zwei Zeitstränge, die sich miteinander verbinden.
Die Frau dürfte inzwischen tot sein, denkt er.
Wahrscheinlich jedenfalls. Blythe ist nie dabei gewesen, wenn die Frauen starben, und weiß deshalb auch nicht, wie lange es dauert. Und nicht, warum es passiert. Er ist fertig mit ihnen, wenn es soweit ist, und es interessiert ihn nicht mehr. Sie sterben. Mehr muss er nicht wissen. Und wenn er von seinem Ausflug nach Hause kommt, macht er das Licht in der Garage an und sieht vor sich, still und regungslos, das gewohnte Bild.
In einem der Häuser, in denen er als Kind gewohnt hat, hatte er eine Ratte als Haustier. Der Käfig stand im fensterlosen Keller, und manchmal ging er erst nach einer Woche oder noch später runter, um ihr etwas zu fressen zu geben. Und jedes Mal, wenn er die Tür aufmachte, hörte er sie herumlaufen. Woche für Woche ging das so – bis er eines Tages nichts mehr hörte. Er weiß noch, wie leer sich die kühle Luft anfühlte, als er die Stufen hinabstieg, und wie die verendete Kreatur klein und gekrümmt in einer Ecke lag. Bei den Frauen ist das nicht anders.
Er stochert behutsam im Feuer herum und wendet ein paar weiße Kohlestücke. Es brennt gut – klein, heiß und hell, er spürt die Wärme im Gesicht – und lässt den Wald um ihn herum noch dunkler erscheinen. Er vernimmt das Zischen des Gasbrenners neben ihm und das Brodeln des Wassers, in dem die Pellkartoffeln hin und her rollen und gegen die Topfwand schlagen. Das Kaninchen, das er gefangen, gehäutet, ausgeweidet und wieder zusammengebunden hat, hängt auf einem Spieß über den Flammen. Er legt den Stock nieder und dreht den Spieß. Fetttropfen stürzen zischend in die Glut. Der Duft sagt ihm, dass das Kaninchen fertig ist. Blythe testet die Kartoffeln und beschließt, dass auch die gar sind. Er nimmt den Blechteller aus dem Rucksack. Nachdem alle Vorbereitungen getroffen sind, macht er sich daran, das Kaninchenfleisch vom Knochen und den zähen Sehnen zu lösen. Alles dampft in der kühlen Luft.
Beim Essen schaltet er seinen Laptop ein. Aus keinem bestimmten Grund hat er einen WLAN-Stick dabei. Er geht gern online, um irgendwelche Dinge im Internet anzusehen. Der Browser öffnet sich automatisch mit der Yahoo-Startseite, so dass er sofort die Schlagzeilen liest. Gleich in den ersten dreien geht es um ihn.
amanda cassidy lebend aufgefunden.
red-river-killer identifiziert?
Polizei bestätigt fund menschlicher überreste IM »hAUS DES GRAUENS«
Das Foto oben auf der Seite zeigt sein Haus.
Unbeeindruckt setzt Blythe seine Mahlzeit fort. Er klickt die Links an und nimmt jeden Artikel ungerührt in sich auf. Dann öffnet er weitere Nachrichtenseiten, um auch dort die Berichte zu lesen und sich ein Bild von dem zu machen, was gerade passiert.
Als er aufgegessen hat, stellt er den Teller neben sich auf den Boden. Die nicht essbaren Teile des Kaninchens beginnen, fest zu werden. Er wischt sich den Mund mit einer Papierserviette ab. Dann die Finger. Vom gelegentlichen leisen Knistern des Feuers abgesehen, ist die Welt um ihn herum absolut still.
Sie haben ihn gefunden.
Den Berichten zufolge war es dem puren Zufall zu verdanken. Unfair auf der einen Seite, andererseits aber liegt auch ein Trost darin. Er ist immer vorsichtig gewesen und könnte es sich kaum verzeihen, wenn er einen Fehler gemacht hätte. Aber das hat er nicht. Es war ein Unfall. Wenigstens das.
Er atmet lang und tief ein.
Nicht um sich zu beruhigen. Wie immer empfindet er auch jetzt keinen Schrecken. Er spürt überhaupt sehr wenig. Seine Lage hat sich verändert, mehr nicht. Es gibt ein neues Szenario, das er verstehen und auf das er sich einstellen muss. Er muss seine Sichtweise und sein Verhalten ändern. Das ist alles. Er hält einen Moment inne und lässt die unterbewusste Maschinerie seiner Gedanken arbeiten, damit er entscheiden kann, was als Nächstes zu tun ist.
Ein wenig ärgert er sich aber eigentlich doch