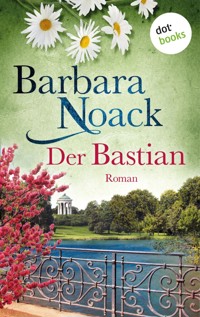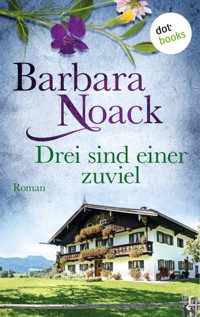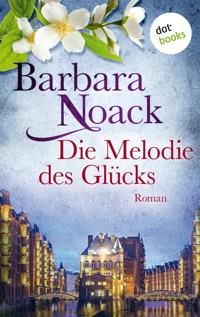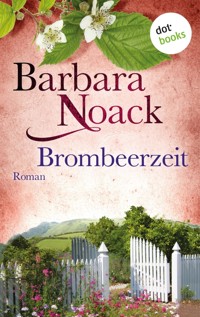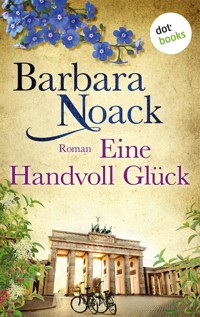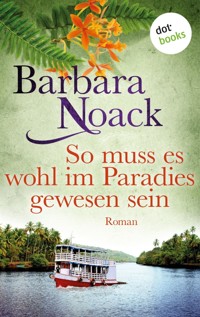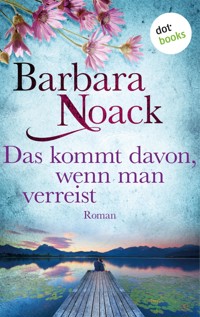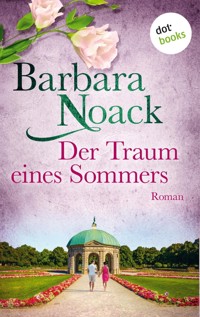
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Melancholisch und bewegend: Der gefühlvolle Roman »Der Traum eines Sommers« von Bestseller-Autorin Barbara Noack jetzt als eBook bei dotbooks. Was ist im Leben wirklich wichtig? Pic ist ein erfolgreiches Model und wird von allen verehrt. Sie reist durch die Welt, doch das schillernde Leben voll Glanz und Glamour wirft Schatten auf ihre junge Seele. Immer mehr beginnt Pic sich zu fragen, wer sie ist und wo sie hingehört. Erst als sie ihrem Nachbarn Felix in einer Nacht unter Sternenhimmel ihre Geschichte erzählt, fühlt sie sich zum ersten Mal wirklich verstanden. Aber können diese Gefühle Bestand haben? Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der bewegende Roman »Der Traum eines Sommers« – ehemals unter dem Titel »… und flogen achtkantig aus dem Paradies« erfolgreich – von Bestseller-Autorin Barbara Noack. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 176
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Was ist im Leben wirklich wichtig? Pic ist ein erfolgreiches Model und wird von allen verehrt. Sie reist durch die Welt, doch das schillernde Leben voll Glanz und Glamour wirft Schatten auf ihre junge Seele. Immer mehr beginnt Pic sich zu fragen, wer sie ist und wo sie hingehört. Erst als sie ihrem Nachbarn Felix in einer Nacht unter Sternenhimmel ihre Geschichte erzählt, fühlt sie sich zum ersten Mal wirklich verstanden. Aber können diese Gefühle Bestand haben?
Über die Autorin:
Barbara Noack, geboren 1924, hat mit ihren fröhlichen und humorvollen Bestsellern deutsche Unterhaltungsgeschichte geschrieben. In einer Zeit, in der die Männer meist die Alleinverdiener waren, beschritt sie bereits ihren eigenen Weg als berufstätige und alleinerziehende Mutter. Diese Erfahrungen wie auch die Erlebnisse mit ihrem Sohn und dessen Freunden inspirierten sie zu vieler ihrer Geschichten.
Nach Vorlage des Drehbuchs wurde Der Bastian im Jahr 1973 als 13-teilige Fernsehserie ausgestrahlt, die in Deutschland alle Rekorde brach und Horst Janson zu großer Popularität verhalf. Daraufhin schrieb Noack die Geschichte zu einem Roman um.
Auch ihre Bücher Die Zürcher Verlobungund Drei sind einer zu viel wurden verfilmt und besitzen noch heute Kultstatus!
Eine Liste der bei dotbooks veröffentlichten Bücher von Barbara Noack finden Sie am Ende dieses eBooks.
***
eBook-Neuausgabe November 2016
Copyright © der Originalausgabe 1969 by Lothar Blanvalet Verlag, Berlin
Copyright © der Neuausgabe 2016 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von shutterstock/Noppasin (Hofgarten), Maridav (Paar)
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH
ISBN 978-3-95824-896-0
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort … und flogen achtkantig aus dem Paradies an: [email protected]
Gerne informieren wir Sie über unsere aktuellen Neuerscheinungen und attraktive Preisaktionen – melden Sie sich einfach für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter.html
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Barbara Noack
… und flogen achtkantig aus dem Paradies
Roman
dotbooks.
Dienstags werden die Mülltonnen des Appartmenthauses geleert. Ab Samstag geht meistens nichts mehr in sie hinein, da kann man noch so drücken und stopfen, sie sind eben voll. Die Deckel lassen sich nicht mehr schließen.
Die Mieter sagen, das liegt am Hauswirt. An seinem Geiz liegt es: zu wenig Tonnen für so viele Parteien. Der Hauswirt sagt, wenn er fünf Tonnen mehr bestellte, wären diese genauso überfüllt wie die bisherigen. Er sagt, mit den Tonnen ist es wie mit dem Einkommen. Es reicht nie, egal wieviel.
Es war Sonntag morgens, so gegen fünf Uhr früh, als Felix mit Marie nach Hause kam.
Sie hatten Nachtleben hinter sich mit Geschäftsleuten aus Castrop-Rauxel, die nicht müde wurden. Aber das werden zugereiste Geschäftsleute ja selten, wenn sie Nachtleben nicht selbst finanzieren müssen.
Es hatte begonnen mit einem Drink im Bayrischen Hof, danach eine Boulevardkomödie, danach russisches Essen, »Blow up« und mehrere Schwabinger Lokale, in denen sie Prominenz von Bühne und Fernsehen zu sehen hofften und leibhaftige Hippies. Dann Striptease (männlich), darüber eine große sittliche Enttäuschung seitens der zugereisten Herren, dann noch ein Bierlokal. Und dann ein Polizeirevier als Folge eines Handgemenges zwischen den angetrunkenen Geschäftsleuten und angetrunkenen jungen Männern, die an ihrem zweistimmig gegrölten »Schönen Westerwald« Anstoß genommen hatten und erst recht an dem Lied von den zitternden, morschen Knochen.
Kurz, Felix und Marie hatten reichlich genug von allem, als sie vor dem Hochhaus aus dem Taxi stiegen.
Marie ging schon vor, ihre Abendschuhe in der Hand, während Felix sich eine Quittung geben ließ.
Es war ein schöner Morgen. Er zwitscherte anzüglich rein und ausgeschlafen in den hohen Pappeln, die Sonne kam um die Hausecke, und der Himmel hatte sein ganz frühes, verwaschenes Blau. An sich sollte man jetzt aufstehen. Man nahm es sich immer wieder vor…
Der Dieselmotor des Taxis verklang hinter der nächsten Straßenecke. Felix’ Schritte kamen hinter Marie her, brachen plötzlich ab.
»Schau mal«, sagte er, »schau dir das an!«
»Ich hab’s schon gesehen.«
Sie gingen auf den von Jasminbüschen kaschierten Müllplatz neben der Garageneinfahrt zu.
Eine der Tonnen stand mit runtergeklapptem Deckel da. Aus ihrem plumpen Hals blühte ein Strauß. Ein geradezu phantastischer Strauß.
Mit allen Köpfen nach oben.
Wo man doch die Sträuße, die ihre Pflicht als Zimmerschmuck erfüllt haben, kopfüber in die Mülltonnen stopft, damit sie nicht rundherum zerblättern und verwehen.
Dieser Strauß aber war nicht welk. Er spreizte sich frisch und stark nach allen Seiten und adelte also sein kommunales, innerlich stinkendes Gefäß.
»Schau dir das an«, sagte Felix, euphorisch in seinem verträglich gestimmten Suff, »schau dir das an, Marie. Eine blühende Mülltonne am Sonntagmorgen. Und was da alles drin ist! Riech bloß man den Goldlack und die Nelken.«
»Nein«, sagte sie leidend, »ich kann nicht.«
»Was ist das hier – Ginster?«
»Liebling, mir ist leider schlecht.«
»Das hat Zeit, Marie. Komm, hilf mir –« Er versuchte, auch die anderen Insassen des Straußes mit Namen anzureden: »Schwertlilien, Wacholder, Narzissen, Margeriten …«
Olivenzweige, Geranien, Iris, blühende Disteln.
Lavendel, Bougainvillea.
Weiße, rosa und rote Bauernrosen, überlappend und barock – Gräser.
»Marie, was ist das hier? Ist das Thymian? Marie! Wo bist du denn?«
Sie lehnte jämmerlich und geduldig vor der gläsernen Haustür. Wie eine ausgesperrte Katze. Es ging ihr wirklich nicht gut.
Arme, zusammengeschnurrte Marie. Gestern abend waren die zugereisten Herren reichlich wild nach ihrer dunklen, ein wenig melancholischen Ballerinenschönheit gewesen. Jetzt tat sie bloß noch leid.
Felix rupfte den Zweig, den er für Thymian hielt, aus dem Tonnenstrauß und trug ihn auf sie zu. »Das kommt davon, wenn man alles durcheinander ißt und trinkt.« Er küßte ihre weiche Wange. »Wenn ich dir einen Rat geben darf, steck dir den Finger in den Hals.« Und fand den Hausschlüssel nach gründlichem Suchen durch all seine Taschen schließlich in ihrem Portemonnaie.
Im Lift, auf der raschen Fahrt zum achten Stock, standen sie sich gegenüber. Ein bißchen Blick und ein bißchen Lächeln.
Marie dachte: Das verdammte Oberlicht. Ich muß aussehen wie meine Großmutter. Nicht wie die nette, wie die andere.
Felix gähnte, in seinen aufgeschlagenen Mantelkragen geduckt. Dann fiel ihm der abgerupfte Zweig ein. Er zog ihn einmal unter seinen kleinen, heftigen Nüstern vorbei: »Ich halt’s für Thymian. Riech du.«
»Thymian riecht wie Erbsensuppe, und mir ist schlecht.«
»Riech trotzdem, Marie!« Wie rücksichtslos ein junger Mann sein konnte, der selbst keinen schlimmen Magen hatte.
»Es ist Rosmarin«, seufzte sie.
»Rosmarin? – Verstehst du, was frischer Rosmarin in unserer Mülltonne zu suchen hat?«
»Nein. Es ist mir auch völlig egal.«
Der Fahrstuhl hielt im achten Stock. Ganz außen lag Felix’ Appartment, eine Zweizimmer-Eigentumswohnung, die ihm eine begüterte Tante für eine milde Miete überlassen hatte, solange er in München lebte.
Ein Wohnraum ohne Gardinen, alles Blick, so weit man wollte. Bei Föhn sah man die Berge. Die Wände selbstgestrichen in pompejanischem Rot.
Ein überladener Zeichentisch, ein schwarzes Ledersofa, das ihn in Schulden gestürzt, ein weißer Tisch, den ihm Marie geschenkt hatte, vier einzelne, beim Trödler erstandene Stühle, außerdem zwei mit Leder bezogene Logensessel in Empireform aus einem ehemaligen Residenztheater. Ihre Rückenlehnen trugen noch die Nummernschilder aus Emaille – 6 und 7. Auf 7 pflegte Felix zu sitzen. Nummer 6 war Maries Stuhl, wenn sie ihn besuchte.
An den Wänden pinnten Kostümentwürfe und Skizzen für Theaterdekorationen und wichtige Telefonnummern und Plakate und eine Skizze, die Felix einmal von Marie gemacht hatte, als er sich sehr nach ihr sehnte.
An der Tür zum Schlafzimmer, vor den Bücherregalen, stand ihr Gepäck offen. Gleich nach der Ankunft gestern abend hatte sie ihr Dinnerkleid und ein paar Abendschuhe herausgenommen.
Außerdem gab es noch ein altmodisches, orange und grün gestrichenes Klavier, das als Ablage für Bücher, Schlüssel, Platten und Briefe benutzt wurde. Felix räumte den Inhalt seiner Hosen- und Jackentaschen auf die Tasten.
Marie ging sofort ins Bad. Im Medikamentenkasten fand sie zwischen Gummibändern, einer verstaubten Augenklappe, leeren Pillenröhrchen und einer angebrochenen Glemadurdose zwei Tabletten Alka Seltzer.
Während sie darauf wartete, daß die beiden Tabletten im Zahnputzglas zischend versprudelten, bemerkte sie die angetrockneten, verschmutzten Seifenreste im Waschbecken, die Flecken auf dem Spiegel darüber, Staub überall, auf dem Fensterbrett neben dem Klo zwischen angebrochenen Werbepackungen von Waschmitteln einen eselsohrigen Band Isaak Babel, eine Wäschereiquittung und einen ungeöffneten Brief von der Bank.
Marie stellte fest: Ich habe hier eine Menge zu tun.
Sie trank die aufgelösten Tabletten, zog nach dem Duschen Felix’ Bademantel an und ging in den Wohnraum.
Auf dem Tisch trockneten die Rosen von ihrem letzten Besuch vor zwei Wochen. Bei Rosen ging es noch, bei Astern war es schlimmer. Da stank das Wasser so schnell.
Marie liebte Felix lange und verständnisvoll genug, um sich nicht darüber zu wundern. Es störte sie auch nicht mehr die Art, wie er seine Kleider beim Ausziehen über das ganze Zimmer verteilte. Felix stieg nun einmal aus allem achtlos aus und ließ es so liegen, wie er ausgestiegen war – na und? Seine Achtlosigkeit war eine strahlende und daher verzeihlich.
Vor einem Jahr hatten sie sich im Theater kennengelernt. Felix sollte das Bühnenbild ausführen, das Marie entworfen hatte. Er war ein reichlich vergammelter junger Mann in ausgebeulten Kordhosen, selten rasiert. Zum Friseur ging er nur immer dann, wenn seine seriöse Familie die Stadt München auf der Durchreise streifte. Die Familie war damals lange nicht dagewesen, als Marie ihn kennenlernte. Die Zusammenarbeit mit ihm war wegen seiner Eigenwilligkeit schwierig. Auf den Gedanken, in ihm ihren zukünftigen Liebhaber zu sehen, kam sie keinen Augenblick. Erstens war er viel zu jung für sie, noch nicht einmal dreißig, und zweitens hatte Marie nicht die Absicht, ihr Privatleben durch ein Abenteuer noch mehr zu komplizieren.
Am Tage ihrer Abreise aus München saß in der Halle des Hotels, in dem sie abgestiegen war, ein ordentlicher junger Mann mit frisch geschnittenen Haaren in seinem Sonntagsanzug, mit Hemd und Schlips, der über den Knien einen Geigenkasten hielt. Er feixte ihr entgegen und war Felix, bis zur Unkenntlichkeit zivilisiert.
»Da haben Sie sich aber was ausgedacht«, lachte Marie. »Warum?«
»Ich kenne Sie jetzt acht Tage und finde Sie wundervoll. Ich glaube sogar, daß ich Sie ein bißchen liebe. Darf ich Sie küssen?« fragte er freundlich und direkt.
Marie war gerührt. Vor allem über den Geigenkasten. Er enthielt einmal Wäsche zum Wechseln, seinen Rasierapparat, die Zahnbürste und Boulekugeln.
Es war ein Samstag. Marie fuhr nicht nach Hause, sondern mit Felix an einen See. Sie lernte von ihm Boule spielen und erlebte das Geschenk, mit vierzig Jahren so jung zu sein wie mit zwanzig.
Felix lag nackt und sichtbar erleichtert darüber, endlich liegen zu dürfen, auf den breiten Matratzen, die den Boden seines Schlafzimmers zu drei Vierteln ausfüllten und sein einziges Mobiliar ausmachten. Zum Schlafen waren sie zwar etwas hart, zum Lieben jedoch ideal dank ihrer geräumigen Lautlosigkeit. Er sah ihr zwischen aufgestützten Armen, auf dem Bauch liegend, entgegen.
Er hatte einen seiner verblüffend schönen Augenblicke.
Er freute sich auf Marie.
»Wie geht’s dir, Liebling?«
»Miserabel, Liebling.« Sie legte sich sehr vorsichtig in seinem Bademantel neben ihn. »Ich habe zwei Alka Seltzer genommen. Ich hoffe, sie wirken bald – so oder so.«
Felix nahm seinen Bademantel auseinander und Maries Brüste in seine Hände. Er küßte sie mit der Behutsamkeit, die einem Kranken zusteht.
»Es war ein ziemlich scheußlicher Abend – aber du warst fabelhaft –«
Sie schob seinen Kopf, dessen Haar sich wie schwarzes Gefieder anfühlte, von ihrer Brust, denn jetzt vertrug sie absolut keinen Druck auf sich.
»Geht’s dir so schlecht? Wart mal, ich muß da irgendwo was für den Magen haben.«
Er stand auf und stieg über ihren flach ausgestreckten leidenden Körper hinweg, bestrebt, sich so rasch wie möglich eine gesunde Marie zu verschaffen, die man berühren konnte.
Er verschwand im Wohnraum und kam nicht wieder. Darüber schlief sie ein. Hinter den grünen Vorhängen, vor dem geöffneten Fenster, sangen die Vögel.
Felix suchte überall nach Magentabletten. Zuletzt sah er im Jackett seines einzigen »guten« Anzugs nach, das über dem Logensessel Nr. 7 hing. In einer Tasche fand er Kleingeld, eine Packung Reißnägel und Taxiquittungen. In der anderen ein Loch im Futter und den zerdrückten Zweig Rosmarin vom Strauß aus der Mülltonne.
Felix kam plötzlich ein Gedanke, der ihn besorgte. Es mußte nicht, aber es konnte immerhin sein. Er holte das Telefon so leise wie möglich aus dem Schlafzimmer, stöpselte es im Wohnraum neben dem Fenster ein und ließ sich auf dem Boden nieder. Den Apparat auf seinen Knien balancierend, drehte er eine Nummer. Nach dreimaligem Tuten wälzte sich eine Frauenstimme aus tiefem Schlaf an den Hörer. Zuerst ans falsche Ende. Ein Glas fiel um. »Ja.«
»Picayune?«
»Felix?« Sie stöhnte, elend vor Schlaf. »Was ist denn?« Jedes Wort machte ihr Mühe.
»Nichts. Gar nichts«, sagte er erleichtert. »Ich wollte bloß wissen, ob du okay bist.«
»Und deshalb weckst du mich?«
»Ich war plötzlich in Sorge.«
»Du? Wieso? Wie spät is’n das überhaupt?«
»Weiß nicht genau. Hab’ keine Uhr da. Es könnte halb sechs sein.«
»Halb sechs?« Die Stimme fuhr ihn plötzlich hochtourig an. »Sag mal, piept es bei dir? Ich hab’ zwei Schlaftabletten im Bauch!«
»Wieviel?« fragte er wachsam.
»Zwei Stück!«
»Bestimmt nicht mehr?«
»Nei-en!«
»Dann ist ja alles in Ordnung.« Er war sehr erleichtert. »Entschuldige meinen Anruf. Schlaf schnell weiter.«
»Wieso – hallo, Felix, bist du noch dran? – Felix, wieso hast du gefragt?«
»Bloß so. Ich dachte – wegen dem Strauß in der Mülltonne.«
»Ach, deshalb. Das war so ’ne Laune von mir. Wie kommst du überhaupt darauf, daß es meiner war?«
»Erstens ist lauter Zeugs drin, was bei uns hier nicht wächst, und zweitens kenne ich niemand außer dir, der es fertigbringt, so was Schönes wegzuschmeißen. – Wann bist du zurückgekommen?«
»Gestern nachmittag.«
»Na, und – alles in Ordnung?«
»Jaja.«
»Alsdann – bis morgen. Ich glaube, ich muß auch mal schlafen.«
Er hängte ein und dachte noch einen Augenblick über Picayune nach, während sein Zeigefinger den Staub vom Telefon malte. Ihre Stimme hatte verloren geklungen. Aber das mochte an den Schlaftabletten liegen. Wenn er zwei Pillen nahm und geweckt wurde, klang er auch nicht gerade sonnig.
Felix legte sich neben Marie auf die Matratzen. Sie hatte den Kopf auf die Seite gerollt und schlief unter der duftigen Welle frisch gewaschenen kastanienbraunen Haars, das die Spuren des beginnenden Alters auf ihrem Gesicht zudeckte. Marie in Ruhestellung erinnerte immer ein bißchen an eine Primaballerina, die gerade »Schwanensee« oder etwas ähnlich Poetisch-Verstaubtes ohne sichtbare Muskelanstrengung durchschwebt hatte. Ihre Figur wirkte wie von einem Schnürkorsett geformt – ein voller Busen, eine Taille zum Umspannen, sanfte Hüften.
Felix strich über ihren Arm.
»Marie – Marie – Liebling –« Er hoffte, daß sie aufwachen würde, und schlief darüber selbst an ihrer Schulter ein.
Dann schrillte das Telefon.
Marie hörte es in ihrem Traum von einem fremden Haus, dessen Türen und Fenster sich nicht schließen ließen. Auf der Terrasse davor saß ein toter alter Mann in einem Rollstuhl, und riesige schwarze Fledermäuse umkreisten ihn. Der Rollstuhl fuhr von ganz allein in das leere Zimmer, in dem sich Marie halbtot graulte. Es war der Traum eines verdorbenen Magens.
Das Telefon erlöste sie. Marie hörte im Halbschlaf, wie Felix leise fluchend und Morddrohungen ausstoßend über sie hinwegstieg und ins Wohnzimmer tappte.
»Was ist denn los?« schimpfte er in den Hörer.
»Ich bin’s«, sagte Picayune mit klagender Stimme. »Du hast mich geweckt. Jetzt kann ich nicht mehr einschlafen. Komm rüber, ja? Ich muß mit jemand sprechen, sonst werd’ ich verrückt.«
»Jesus«, seufzte er, »weißt du, wie spät es ist?«
»Bitte, Felix!«
»Wir haben eine harte Nacht hinter uns. Mein Vetter aus der Stahlbranche hat mir seine Geschäftskunden aufgehalst, weil er selbst nicht mit ihnen ausgehen konnte. Ich wollte nicht nein sagen, schließlich hat er mir seinen alten Fernseher geschenkt. Die Kunden wollten partout was Tolles erleben. Marie war mit. Ich fürchte, sie verzeiht mir diesen Abend nie.«
»Ach so, Marie ist da.« Picayune kroch hörbar in sich selbst zurück. »Das hab’ ich nicht gewußt. Entschuldige mich bei ihr, ja? Bis morgen.«
Ihre Stimme gefiel ihm ganz und gar nicht.
»Also gut, ich komme«, sagte er, »aber nur ’ne Viertelstunde. Mach mir einen starken Tee.«
Felix holte seinen Bademantel, den vorher Marie getragen hatte, aus dem Schlafzimmer.
»Du kannst mich ruhig ansprechen«, sagte sie, ohne die Lippen zu bemühen. »Ich bin wach.«
»Es war Picayune. Ich gehe auf einen Tee zu ihr. Kommst du mit?«
»Gottes willen«, stöhnte sie, »bloß nicht rühren! – Trinkt ihr immer um diese Zeit Tee?«
»Es scheint irgendwas los zu sein.« Er ging noch einmal in die Knie und küßte sie. »Bin gleich wieder da. Bestimmt.«
Picayunes Wohnung grenzte an Felix’ Appartment. Sie war die größte im achten Stock und das, was man als luxuriös bezeichnet. Alles teuer und alles in Beige. Da die Möbel aus dem Einrichtungsgeschäft stammten, in dem »man« arbeiten ließ, unterschieden sie sich kaum von anderen eleganten Wohnungen.
Die Tür war angelehnt.
Picayune rief aus der Küche: »Tee ist gleich fertig. Ich mach’ dir ’ne Stulle, ja?«
Auf der Diele standen noch ihre unausgepackten Koffer.
»Guck mal, ob wir draußen sitzen können oder ob’s noch zu kalt ist.«
Felix ging ins Wohnzimmer und sah auf die Terrasse. »Die Sonne ist herum!« rief er zur Küche.
Auf einem Glastisch neben dem Sofa hatte Picayune ein großes Bild von sich im Silberrahmen aufgestellt.
Picayune auf einer Wiese voller Wind und biegsamer Margeriten. Sie stand breitbeinig da in hohen, weichen Stiefeln. Aus dem Kopftuch wehten ihre Haare in hellen, fast weißen Strähnen, an die vergilbten Mähnen camarguischer Pferde erinnernd. Picayune ganz jung und fröhlich und unbeschwert. Ein Mädchen zum Träumen.
»Nimm ’n paar Decken mit raus«, sagte sie hinter ihm.
Felix sah sich nach ihr um und erschrak.
Ihr kleines, flaches Tatarengesicht mit den schrägen Augen wirkte verheult, nervös, zittrig.
»Nun starr mich nicht so an. Nimm mir lieber den Tee ab«, sagte sie ungeduldig und vermied seinen Blick. Sie wußte wohl, wie schlimm sie aussah.
Marie hatte manchmal morgens denselben Blick zur Seite. Wie ein kleines Kind, das glaubt, nicht gesehen zu werden, wenn es die Augen zumacht.
Er trug das Tablett auf die Terrasse hinaus und rückte die Liegen mit den vom Nachttau feuchten Polstern in die blasse Wärme der Morgensonne.
Als Picayune herauskam, trug sie ihre größte Sonnenbrille.
»Wo ist dein Freund?«
Sie überhörte seine Frage. »Zucker fehlt.«
»Ist er verreist?«
»Nein.«
»Tot?«
»Wie kommst du’n darauf?«
»Du siehst so aus, als ob.«
»Nein«, sagte sie, »tot ist er nicht.«
Die Stadt unter ihnen war rauchblau im Schatten und honiggelb in der Sonne. Zwischen Dächern mit bizarren Antennenwäldern das junge Maigrün der Baumkronen und graue, vereinsamte Straßen. Parkende Wagen. Geöffnete Schlafzimmerfenster. Eine Stadt am frühen Sonntagmorgen.
Picayune rollte sich auf ihrem Stuhl zusammen. Sie ergab sich ins Frieren, weil sie plötzlich keine Kraft mehr hatte, den einen Handgriff nach der wärmenden Decke zu tun. Sie war starr, ganz wehrlos. Fertig.
»Nimm dir Tee, Felix.«
Er stand noch einmal auf und wickelte ihren dünnen Körper ein. Er faßte sich an wie der Körper eines abgezehrten kranken Tieres.
»Mädchen, was ist denn bloß los mit dir?« Felix setzte sich neben sie und löffelte heißen Tee in sie hinein. Der Tee war schwarz wie Nescafé und gallebitter. Es fehlte Picayune bei allem das rechte Maß.
»Ich mach’ so viele Fehler. Ich mach’ alles falsch in diesem Leben. Woran liegt das bloß? Kannst du mir das mal sagen, Felix?
Manchmal glaube ich, ich bin zu schnell gewachsen. Ich hab’ nichts richtig verkraftet. Aber schlecht bin ich nicht, oder?«
»Nicht schlecht«, sagte er, »bloß verkorkst.«
Solange er sie kannte, strapazierte sie ihren Körper und ihre Nerven und ihr Gefühl, sie schonte höchstens ihren Verstand.
Ihr Magen revoltierte.
Um ihre fotogene Magerkeit zu erhalten, lebte sie ausschließlich von Zitronen, Steaks, Zigaretten und verschlang Mengen von Tabletten gegen alles mögliche. Die anstrengende Arbeit, ihre aufregenden Liebesgeschichten und die geradezu hysterische Angst vor Flügen über das Meer hatten ihre Nerven geschafft.
Jeder, der sie kannte und mochte, gab ihr gute Ratschläge, Felix auch. Alle sagten: »So geht’s nicht weiter mit dir, du klappst noch eines Tages völlig zusammen. Denk an deine Zukunft. Friß nicht so viele Tabletten. Laß die Zigaretten. Denk an Karlinchen. Tu was für deine Gesundheit. Laß Saint-Tropez sausen, geh lieber ins Sanatorium. Wenn du so weitermachst…«
Also redeten sie schlau und eindringlich auf Picayune ein. Picayune hörte ihnen aufmerksam zu, zeigte sich dankbar, gab allen völlig recht, feilte dabei ihre Nägel, goß Drinks nach und war fest entschlossen, sämtliche Ratschläge zu befolgen.
Aber sobald ihre von guten Freunden künstlich aufgeputschte Vernunft nur einen unbewachten Augenblick lang aus- und dafür ihr Gefühl wieder einsetzte, war es eben passiert.
Picayunes Gefühle entsprangen einem großzügigen, liebebedürftigen Herzen und voll entwickelten Sinnen. Sie konnte weder mit sich selbst noch mit dem vielen Geld, das sie verdiente, umgehen. Ihre Hände waren lang, dünn, gotische Hände. El-Greco-Hände, die nichts festhalten konnten. Sie waren zum Schenken geschaffen.
»Wird Marie auch nicht eifersüchtig sein, wenn du länger fortbleibst?«
Trotz ihres elenden Zustands benutzte Picayune einen schonenden Tonfall, wenn sie von Marie sprach. Es war die hörbare Rücksichtnahme einer jungen Frau gegenüber einer älteren, der sie keinen Schaden zufügen möchte, der Armen.
»Ich habe ihr angeboten mitzukommen. Aber sie wollte nicht«, sagte er kurz.
Picayune kroch bis zu den Ohren in die Decke hinein. Ihre Heuschreckbrille spiegelte leichte weiße Wolken am Himmel wider, die darauf schließen ließen, daß dieser Sonntag nicht so wundervoll bleiben würde, wie er begonnen hatte.
»Marie hat’s gut«, seufzte sie Richtung Himmel.