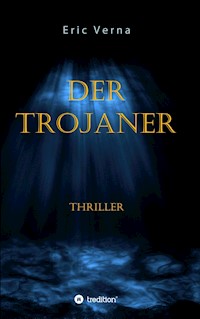
10,90 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
1964, auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges. Eine Postkarte mit einer verschlüsselten Botschaft setzt den englischen Investigationsjournalisten Peter Hall auf die Spur eines der bestgehüteten Geheimnisse seit dem Ende des 2.Weltkriegs: Deutsche Wissenschaftler, welche beiderseits des Eisernen Vorhangs an Geheimprojekten des Dritten Reiches weiterarbeiten. Die Suche nach Beweisen mündet in eine Jagd über den halben Erdball - und Peter Hall erkennt, dass am Ende eine obskure Macht die Fäden zieht, welche selbst die höchsten politischen Instanzen in Ost und West durchdringt. Zwei Jahre zuvor stand die Welt am Rande eines nuklearen Weltkriegs. Eine Eskalation könnte jederzeit das Ende eines fragilen Friedens bedeuten...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
www.tredition.de
Eric Verna
Der Trojaner
www.tredition.de
© 2013 Eric Verna
Umschlagsillustration: fotolia
Verlag: tredition GmbH, Hamburg
ISBN: 978-3-8495-7289-1
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheber-rechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zu-stimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbrei-tung und öffentliche Zugänglichmachung.
PROLOG
PILSEN, TSCHECHOSLOWAKEI – MAI 1945
In den hohen, weiß gekachelten Laborräumen der Forschungs- und Entwicklungsabteilung der Skoda-Werke lag eine nervenzermürbende Stille. Die Amerikaner hatten der Belegschaft jegliches Reden untersagt. Zwei mit Maschinenpistolen bewaffnete Soldaten standen breitbeinig vor der Tür und stellten sicher, dass die Anordnung eingehalten wurde.
Professor Rudolf Berger, ein hünenhafter Mann Mitte Vierzig, rückte im Minutentakt seine Brille zurecht, um dann seine Hände wieder tief in die Taschen seines Laborkittels verschwinden zu lassen. Unsicher blickte er um sich. All diese jungen Männer. Ehrgeizige, strebsame Talente, denen eine glanzvolle Zukunft vorbestimmt war. Aber jetzt, wo sie wie versteinert vor ihren Arbeitstischen und Zeichenpulten standen, lag in ihren Augen eine seltsame Hilflosigkeit, die beinahe kindlich anmutete.
Dies war ein Tag, an dem ein jeder auf sich selber gestellt war. Heute würden Berger und die anderen Vorgesetzten ihren Schützlingen nicht helfen können.
Eine weitere Viertelstunde verstrich. Professor Berger kam sie vor wie Stunden. Dann endlich waren Schritte zu hören. Unmittelbar darauf wurden die beiden Türflügel aufgestoßen. Ein Mann, eskortiert von zwei Soldaten, trat in das grelle Licht des Raumes. Seine wachen Augen funkelten aus dem Schatten der Hutkrempe hervor wie polierte Manschettenknöpfe. Mit einer laschen Handbewegung wedelte er den Rauch seiner Zigarre aus dem Gesicht. Ihm folgte Dr. Mannheim nach, Ingenieur für Elektrotechnik. Der Mann drehte sich um, tippte Mannheim kumpelhaft auf die Schulter und gab ihm mit einer Geste zu verstehen, sich zurück in die Reihe der Belegschaft zu begeben. Dann ließ er seinen Blick mit zusammengekniffenen Augen durch die Runde schweifen.
Plötzlich hellte sich sein Gesicht auf. Er nahm die Zigarre aus dem Mundwinkel und sagte in freundlichem Ton und fast akzentfreiem Deutsch: „Professor Berger, darf ich Sie bitten?“
Berger musterte den Mann mit dem rundlichen Gesicht, der schiefen Nase mit verstohlener Skepsis. Dennoch musste er sich eingestehen, dass der Mann mit seiner ruhigen Stimme auf befremdliche Art gewinnend wirkte. Er trug einen dunkelbraunen, komplett zugeknöpften Ledermantel - keine Uniform und keine Abzeichen, die seine Funktion oder seinen militärischen Rang preisgegeben hätten. Militärgeheimdienst, war Berger sofort durch den Kopf gegangen, als er ihn vor einer Stunde das erste Mal gesehen hatte.
Er löste sich aus der Reihe seiner Mitarbeiter und ging langsam auf den Amerikaner zu. Auf halber Höhe kreuzte Dr. Mannheim seinen Weg. Die beiden blieben einen Moment stehen und starrten sich an, als versuchte jeder, die Gedanken des anderen zu erraten. Mannheim war von den Amerikanern über eine Stunde lang verhört worden. Jetzt, zurück im Labor, waren seine fahlen, von einer Brandnarbe gezeichneten Gesichtszüge wie erstarrt.
„Nichts, was sie nicht schon wussten!“, zischte er seinem Kollegen Berger hinterher, als dieser weiterging.
„Professor!“, tönte es sogleich von der Tür her. „Kommen Sie, wir haben nicht ewig Zeit!“
Der Amerikaner streckte Berger schon von Weitem die Hand entgegen. Mit theatralischer Geste hob er seinen Hut und wiederholte, was er schon vor einer Stunde gesagt hatte: „Sehr erfreut, Herr Kollege. Mein Name ist Dr. Sam Pollack, wissenschaftlicher Berater des Befehlshabers hier. Folgen Sie mir.“ Er machte auf dem Absatz kehrt und schritt energisch auf die Tür zu, die zugleich von den beiden Wachmännern geöffnet wurde.
Es war allen Wissenschaftlern der Skoda-Werke klar, dass sich die Alliierten für die deutschen Forschungsprojekte interessieren und sie als legitime Kriegsbeute betrachten würden. Was aber die Zukunft der Forscher betraf, gab es kaum mehr Anhaltspunkte als die Gerüchte, welche hinter vorgehaltener Hand kursierten. So solle sich etwa Wernher von Braun, der Vater der revolutionären V2-Rakete, in Bayern zusammen mit weiteren Stabsmitgliedern den Amerikanern angeboten haben. Während die einen überzeugt davon waren, dass die Alliierten einem wie von Braun den roten Teppich ausrollen würden, hielten es andere für völlig undenkbar, dass von Braun, dessen Waffen Tausenden Zivilisten das Leben gekostet hatte, vor dem Kriegsgericht verschont bleiben würde. Sicher war nur eines: Die Zukunft war nicht absehbar, und ein jeder war auf sich alleine gestellt.
Auch Professor Berger hatte seine Vorbereitungen getroffen. Als er von zwei GI’s mit Maschinenpistolen flankiert durch die Gänge der Anlage ging, waren seine Gedanken bei den Mitgliedern der hiesigen Kadermannschaft. Sie alle waren Eingeweihte in Angelegenheiten, die der strengsten Geheimhaltung unterworfen waren. Wer von ihnen würde reden? Wer würde zum Verräter werden? Gab es überhaupt noch etwas zu verraten? Berger wurde mit jedem Schritt, den er tat, nervöser.
Obschon sein Verhör unmittelbar bevorstand, arbeitete Bergers Gehirn mit analytischer Klarheit. Einige der am Institut versammelten Wissenschaftler und Techniker gehörten zu den Besten auf ihren Gebieten, und die meisten von ihnen würden versuchen, ihre Haut teuer zu verkaufen. Andere würden es schwerer haben und zuerst einmal vor der Aufgabe stehen, die Amerikaner von ihren Fähigkeiten und ihrem Wert zu überzeugen. Zu welchen Mitteln würden sie wohl greifen? Hochstapelei und Denunziation? Es musste schließlich allen klar sein, dass die Aussichten düster waren für jene, die nicht vor den Alliierten Geheimdiensten punkten konnten. Sie würden in Kriegsgefangenschaft geraten oder von den Russen aufgespürt werden. Oder beides. Berger zog den Schluss, dass vermutlich ein Großteil der Forschungsgeheimnisse verraten werden würde.
Raketentechnik, Strahltriebwerke, Windkanäle. Berger war dies im Grunde alles egal. Er war Wissenschaftler, kein Ideologe, und Parteimitglied war er seinerzeit nur aus formalen Gründen geworden. Wäre da nur nicht dieses eine Projekt auf dem Spiel gestanden. Das Rüstungsministerium hatte es mit der höchst möglichen Geheimhaltungsstufe versehen - kriegsentscheidend. Nun, dieser Krieg war entschieden. Doch das Potential dieser Technologie war in einem Masse überragend, dass Berger nur einen Begriff dafür fand: Totale Macht. Über das Projekt besaß außer ihm nur eine einzige Person detaillierte Kenntnisse - sein Kollege Werner Mannheim. Der Gedanke daran trieb dem Professor den Schweiß auf die Stirn. Was um Himmels Willen hatte Mannheim den Amerikanern gesagt?
Berger folgte Dr. Pollack in den Aufenthaltsraum. Bis zum gestrigen Tag hatten die Mitarbeiter hier in ihren Arbeitspausen Kaffee getrunken, Karten gespielt und geplaudert. Jetzt hatten die Amerikaner darin ein improvisiertes Büro eingerichtet, und bis auf einen einzigen waren alle Tische entfernt und in den Flur hinaus gestellt worden. Er sah stapelweise Aktenmappen, Ordner und ein Telefon. Auf dem Boden standen Leichtmetallkisten, und an eine Wand war eine riesige Landkarte aufgezogen worden. Dr. Pollack bedeutete Berger, auf einem Stuhl Platz zu nehmen und setzte sich auf die andere Seite des Tisches. Der Stuhl ächzte unter dem Gewicht des massigen Professors. Ein Soldat schloss die Tür von außen. Das Verhör begann.
Berger war bereit. Jetzt galt es vor allem, Zeit zu gewinnen, und irgendwie noch einen Weg zu finden, sich mit Mannheim abzusprechen. Doch dazu würde es nicht kommen.
Die beiden würden sich nie wieder begegnen.
Am Abend desselben Tages saß Donald Putt hinter seinem Schreibtisch und starrte ungläubig auf den Telefonapparat. Der stellvertretende General des Geheimdienstes der US Air Force nahm einen großen Schluck aus dem Cognacschwenker, ließ sich tief in seinen Sessel sinken und schloss die Augen. Wie eingebrannt widerhallten Sam Pollacks euphorische Worte in seinem Schädel: „Volltreffer, General - Sie werden nicht glauben, wen wir für uns gewinnen konnten!“ Er presste die Lippen zusammen und ballte triumphierend seine Hand zur Faust, bevor er sich erleichtert wieder zurücklehnte. Die Operation war im Begriff, ein spektakulärer Erfolg zu werden. Und zweifellos waren er und sein Mann, Dr. Sam Pollack, diejenigen, welche heute die Sensation des Tages dazu beigesteuert hatten.
Putt griff nach einem Aktenstapel und breitete ihn langsam und bedächtig vor sich auf dem Schreibtisch aus. Er strich sich über das Kinn und betrachtete die Auslage. Die Dokumente waren alle gleich, unterschieden sich nur durch eine Nummer und einen Namen. Er nahm eine der Akten vom Tisch und hielt sie sich ganz nahe vors Gesicht. Leise murmelte er den Namen auf dem Etikett vor sich hin und ließ ihn sich genauso genüsslich auf der Zunge zergehen wie den nächsten Schluck Cognac, zu dem er ansetzte.
MANN-HEIM…MANN-HEIM…
TEIL I
1. KROATISCHE KÜSTE – JUNI 1965
Dann eben zum Engelsriff, dachte sich der junge Engländer. Warum auch nicht. Er drehte den Gashebel des Außenbordmotors bis zum Anschlag auf und peilte die drei markanten Felsen an, die dem Riff den Namen gaben. Nach Meinung der lokalen Fischer lag hier vor der Südküste der Insel Krina ein ergiebiges Revier für Zackenbarsche, und schließlich würde sich kein seriöser Naturfotograf die Gelegenheit entgehen lassen, in Küstennähe Großfische vor die Linse zu bekommen. Das Boot kämpfte gegen die frontal anrollenden Wellen an und kam nur mühsam vorwärts. Gischt spritzte über die Bugplanken ins Innere des Bootes. Der Engländer schüttelte sich die blonden Strähnen aus dem Gesicht und beugte sich vor, um die Pressluftflasche am Wegrollen zu hindern, als das Boot von einer hohen Welle angehoben wurde. Zu seinen Füssen lag sein Taucheranzug, und in einer dunkelblauen Sporttasche seine erst vor wenigen Wochen erstandene Calypsophot-Unterwasserkamera samt Blitzgerät.
Seine Tarnung als Naturreporter war ihm in den paar Wochen, die er nun schon auf der Insel Krina verbrachte, zu einer zweiten Haut geworden. Als er sich nach seiner Ankunft nach einem Apartment umgesehen hatte, hatte er behauptet, als Fotoreporter für das National Geographic Magazine angereist zu sein. Irgend einen Grund hatte er vorschieben müssen, denn als allein reisender junger Mann, noch dazu als russisch sprechender Engländer, wäre er kaum als gewöhnlicher Tourist durchgegangen. Obschon die Insel seit der Eröffnung des Flughafens Dubrovnik vor wenigen Jahren zu den aufstrebenden Touristenzielen gehörte - sein ungewöhnlich langer Aufenthalt hätte über kurz oder lang unangenehme Fragen aufgeworfen.
Die Wahl als Naturreporter war naheliegend gewesen. Bis vor wenigen Wochen hatte er tatsächlich als Journalist auf der Gehaltsliste des Londoner Daily Mirror gestanden. Einige Zeit hatte seine falsche Fassade ganz gut funktioniert, doch das zunehmende Interesse der Dorfbewohner an seiner Tätigkeit lenkte immer mehr Aufmerksamkeit auf seine Person - das genaue Gegenteil dessen, was er sich von seinem Aufenthalt auf der Insel erhofft hatte. Einige der Einheimischen dachten wohl, sie könnten auf die eine oder andere Weise an eine Scheibe seines vermeintlich unbeschränkten Spesenbudgets herankommen, oder sie würden in dem renommierten Magazin auf einem Foto verewigt werden - am liebsten mit stolzgeschwellter Brust neben einem kapitalen Schwertfisch, oder vor dem schicken Café im Hafen, das für die kommende Sommersaison extra einen neuen Anstrich erhalten hatte.
Eines Tages hatte er Besuch von einem unscheinbaren, untersetzten Mann namens Milan Borak erhalten. Der Polizeichef hatte auf durchaus charmante Art versucht, ihn in ein zwangloses Gespräch zu verwickeln, doch seine unruhigen Augen hatten nicht verhehlen können, dass er gekommen war, bei dem Fremden einmal richtig auf den Busch zu klopfen. Der Engländer war standhaft geblieben und hatte nichts preisgegeben, was auf den wahren Grund seines Aufenthalts hingedeutet hätte. Doch wenn er sich jetzt an die Worte erinnerte, die der Kommissar beim Weggehen gesagt hatte, lief es ihm kalt den Rücken hinunter: Ich weiß, dass Sie nicht der sind, für den Sie sich ausgeben. Danach hatte der Kommissar zuerst auf sein Ohr, und dann mit zwei abgespreizten Fingern auf seine wachsamen Marderaugen gezeigt und gesagt: Ich höre alles. Ich sehe alles.
Dies war der Beginn einer schleichenden Paranoia gewesen. Plötzlich waren sie überall: Die lauernden Blicke. Die langen Schatten. Der junge Fremde wusste, wenn der Polizeichef ein Spitzel war, dann saß er auf dieser kleinen Insel fest wie in einem Gefängnis. Der Polizeichef würde immerzu wissen, wann und wo er sich gerade aufhielt. Würde er nicht auch das Telefon im Apartment abhören und die Post ins Ausland überprüfen können? Doch dann wieder: Bildete er sich dies alles nicht bloß ein? War nicht gerade der blockfreie Staat Jugoslawien ein Ort, wo er vor den Geheimdiensten aus Ost und West einigermaßen sicher war?
Eines Tages werden sie dich finden, spukte es immer öfter in seinem Kopf. Ohne Ankündigung. Sie werden dich verschleppen und nach den Methoden des KGB auseinandernehmen. Vielleicht haben sie auch die Postkarte abgefangen.
Eine Touristin, die in einer Taverne eine Ansichtskarte schrieb, hatte ihn auf die Idee gebracht, wie er unbemerkt auf sich aufmerksam machen konnte. Vor ein paar Tagen hatte er seinem Freund Peter Hall eine Postkarte geschickt. Eine ganz normale Ansichtskarte mit einer kitschigen Hafenszene, einige Grußworte. Alles ganz unverfänglich. Einzig Peter Hall würde sie stutzig machen. Hall würde zweimal hinschauen, und er würde verstehen.
Und falls ihm in der Zwischenzeit etwas zustoßen würde, wäre Hall in der Lage zu finden, weswegen er sich hier versteckte: die Botschaft Professor Bergers.
Als das Engelsriff in Sicht kam, stellte er den Motor aus und kletterte über die Sitzplanke nach vorne zum Bug. Er ließ das Boot noch eine Weile treiben, bis er den Grund des Riffs erkennen konnte, dann hievte er den Anker hoch. Er warf ihn über Bord und vertäute das Seil - nicht ahnend, dass er soeben die Stelle seines baldigen Todes markiert hatte.
2. LENINGRAD – FÜNF WOCHEN ZUVOR
Das Foyer des Palladium Hotels am Nevsky Prospekt glich einem aufgescheuchten Ameisenhaufen, in dem sich unzählige Stimmen zu einer monotonen Geräuschkulisse vermengten. Die gesamte Weltpresse hatte sich eingefunden, um Zeuge dessen zu werden, was die Sowjetregierung als neuerlichen Meisterakt seines Volkes angekündigt hatte: Der Astronaut Alexej Leonow hatte vor wenigen Tagen als erster Mensch den Weltraum betreten.
Mit dieser Sensation war es der UdSSR wieder einmal gelungen, im Wettlauf mit den Amerikanern um die Vorherrschaft im Weltraum die Nase vorn zu behalten. Und die sowjetische Führung wollte sich die Gelegenheit nicht entgehen lassen, diesen Meilenstein vor den Augen der Welt als Sinnbild für die Überlegenheit des kommunistischen Systems gegenüber dem Kapitalismus gebührend zu feiern. Die Presseleute wohnten in dem luxuriösen Hotel aus dem neunzehnten Jahrhundert, dessen klassizistischer Stil den Pomp und Charme der Zarenzeit aufleben ließ, und in dessen Ballraum die Präsentation der Russischen Akademie der Wissenschaften in Kürze beginnen würde. Eigentlich hatte die Sowjetregierung in den Jahren, in denen aus St. Petersburg Leningrad geworden war, etliche Bestrebungen unternommen, dem Venedig des Nordens ein sozialistisches Gesicht zu verpassen, und das Zentrum entlang des Nevsky Prospekts war das pure Gegenteil stalinistischer Ästhetik - ein Widerspruch, den sich manch einer der geladenen Gäste mit einer Konzession der Regierung an die Vorlieben und Gepflogenheiten ihrer westlichen Gäste erklärt haben mochte.
Edward Stewart stand in der Warteschlange vor dem Portal, das ins Auditorium hineinführte. Ein Koloss in dunkelgrauer Uniform tastete die Leute von oben bis unten ab, während ein anderer mit argwöhnischer Miene die Ausweisfotos überprüfte und ein dritter Sicherheitsbeamter eine Liste mit Namen durchforschte.
Der junge Journalist hatte den Boden Russlands mit gemischten Gefühlen betreten. Eigentlich wäre dieses Land für ihn ein Stück Heimat gewesen, aber die Blutsbande stand unter keinem guten Stern. Es war das Land, aus dem seine Mutter vor fast vierzig Jahren geflüchtet war, ein Land, dessen Geschichte geprägt war von unsäglichem Leid, von Unterdrückung, Ausbeutung und Unmenschlichkeit. Die sprichwörtliche russische Seele, die ihm seine Mutter durch die Werke der großen russischen Dichter nahe gebracht hatte, war mit ihrem Tod für immer verstummt. Geblieben war die Fratze jenes totalitären Regimes, das Stalin mithilfe von Angst und Terror, Gewalt und Verblendung errichtet hatte. Seine gesichtslosen, uniformen Marionetten waren omnipräsent. Apparatschiks. Stewart betrachtete die Geschehnisse um ihn herum mit einer Mischung aus Faszination, Mitleid und Verachtung. Nein, mit ihnen, den Sowjets, hatte er nichts gemein.
Mit dreiunddreißig Jahren war er bereits zu einem viel beschäftigten Berichterstatter für Osteuropa und den Balkan geworden, und seit einigen Jahren bekleidete er einen festen Korrespondentenposten beim Londoner Daily Mirror. Ein respektabler Erfolg, über den sich Stewart allerdings nie so richtig freuen konnte - denn einerseits war er damit bei der wenig anspruchsvollen Yellow Press hängen geblieben, und andererseits fühlte er sich im Grunde zu etwas anderem, gar unpolitischem, hingezogen: dem Reisejournalismus und der Naturfotografie.
Nachdem er die Leibesvisitation hinter sich hatte, betrat Stewart das Auditorium. Das Täferwerk an den Wänden und die reichen Stukkaturen an der Decke zeugten von einer Zeit, als der Kongresssaal seinem ursprünglichen Zweck als Ballsaal diente. Die nüchterne Bestuhlung erinnerte Stewart an seine Studentenzeit. Damals hatten die Professoren über römische Geschichte referiert. Es lag in der Luft, dass das, was ihn heute erwartete, um nichts weniger seinen Weg in die Geschichtsbücher finden würde.
Er ging zu den vorderen Sitzreihen und setzte sich auf einen freien Platz. Es dauerte noch etwa zehn Minuten, dann wurde das Saallicht gedämpft, und ein untersetzter Mann in grauem Anzug betrat das Podium. Er begab sich ans Rednerpult und beugte das Mikrofon zurecht. Die Pressekonferenz konnte beginnen.
Der Funktionär des Politbüros der kommunistischen Partei begrüßte die internationale Presse und verkündete mit hallender Stimme das Programm. Danach wurden die grauen Vorhänge hinter dem Redner zur Seite gezogen. Sie gaben den Blick auf eine Leinwand frei.
Im Saal wurde es dunkel, dann wurde es still.
Der Lichtstrahl eines Filmprojektors durchdrang den Saal. Untermalt von den schweren Streichern der siebten Symphonie von Schostakowitsch glitten die Zuschauer direkt in den Weltraum hinein. Das grobkörnige Bild verstärkte den Eindruck von Authentizität, und ein erstes, ehrfürchtiges Raunen belegte, dass der Auftakt gelungen war. Eine plärrende Stimme, die dem Publikum eröffnete, es wäre im Begriff, einem historischen Augenblick beizuwohnen, mischte sich dazu. Die Szene wechselte. Ein gutes Dutzend Männer saßen mit Kopfhörern vor Schaltpulten in einer Kommandozentrale. Einer von ihnen beugte sich zu einem Mikrofon vor: „Pjatje…Tschetirje…Tri…Dwa…Adin…Nol…“
Unter Feuer, Rauch und einem ohrenbetäubenden Tosen startete die Woschod-Rakete, löste sich schwerfällig vom Boden und stieg dann immer schneller werdend in den nachtschwarzen Himmel empor. Ein Bildflimmern, dann waren die Astronauten zu sehen, die in ihrer Raumkapsel saßen und durch das Funkgerät verzerrte, unverständliche Worte mit der Kontrollbasis austauschten. Paukenwirbel, dramatisches, grelles Blech. Und dann: Schnitt. Die Musik setzte aus. In absoluter Stille glitt die Kapsel durch das All, während die Erde aus dem unteren Bildrand verschwand. Plötzlich öffnete sich wie von Geisterhand die Luftschleuse der Raumkapsel. Durch das Funkgerät ertönte eine aufgeregte Stimme, gleichzeitig wurde eine Übersetzung eingeblendet: „Hier spricht Diamant Eins. Ich bin soweit. Ich werde jetzt rausgehen…“
Nun war die Kapsel von außen zu sehen. Das Publikum hielt den Atem an, als ein Astronaut der Raumkapsel entschlüpfte und dabei so hilflos wirkte wie ein Neugeborenes an seiner Nabelschnur.
„Diamant Eins an Morgenröte: Alles läuft bestens. Unter mir sehe ich die Wolken. Und das Meer… und den Kaukasus!“ Der Astronaut lachte, während er gemächlich in die Bildmitte schwebte. Auf seinem Helm prangten die Buchstaben CCCP, im Hintergrund war, weit unter ihm, die Erde zu erkennen.
„Ich sehe den Kaukasus direkt unter mir!“, rief er erregt.
Die Musik setzte wieder ein, mit hellen Fanfaren. Nach einem Moment verkündete die durchdringende Stimme des Kommentators euphorisch: „Die Sowjetunion präsentiert den ersten Menschen im Weltraum: Alexej Archipowitsch Leonow…! Der erste Mensch im Weltraum: Alexej Leonow!“
Das Publikum war begeistert. Einige sprangen vor Begeisterung von den Stühlen auf, einzelne Rufe traten aus der Geräuschkulisse hervor. Der Begeisterungssturm hielt an, während die Vorhänge wieder zugezogen wurden und die Lichter im Saal angingen.
Die Bilder waren sensationell. Noch nie zuvor war es einem Menschen gelungen, den freien Weltraum zu betreten. Edward Stewart beobachtete gespannt die Reaktion der Leute, als ihn jemand von hinten her antippte.
„Hey, Ed!“
Er drehte sich um und blickte in das breite Grinsen eines Mittdreißigers mit zerzausten Locken. „Bruno Hartweger! Du hier?“
Das Grinsen seines Kollegen wurde noch breiter. Er beugte sich vor und sagte, während er mit einem Auge zwinkerte: „Immer da, wo es die beste Unterhaltung gibt – genau wie du!“
Stewart lachte auf, dann nickte er mit dem Kopf in Richtung Bühne. „Unglaublich, nicht wahr? Haben sie es den Yankees also mal wieder gezeigt!“
Hartweger stieß einen Pfiff aus und schüttelte die Hand, als hätte er glühende Kohle berührt. „Die werden vielleicht toben! Zuletzt Juri Gagarin als erster Mensch im Weltraum, und jetzt das hier.“
„In der Tat nicht gerade Präsident Johnsons Glückstag. Auf jeden Fall…“
Stewart wurde jäh übertönt von der Stimme des Sprechers am Rednerpult, der die Leute gestenreich zur Ruhe bat. Als sich die Aufregung einigermaßen gelegt hatte, machte der Funktionär einen Schritt zur Seite, riss die Arme hoch und rief: „Alexej Leonow!“
Unter frenetischem Applaus betrat ein junger Mann in hellblauer, reich dekorierter Uniform die Bühne. Der Parteifunktionär umarmte den strahlenden Helden und führte ihn ans Mikrofon. Leonow bedankte sich für den Applaus, um gleich darauf von den Reportern mit Fragen bombardiert zu werden. Mit der Ruhe eines Mannes, der die Herausforderung seines Lebens gemeistert hatte, stand er da und begann, seine Eindrücke der eben beendeten Woschod 2-Mission zu schildern. An seiner Seite stand ein Übersetzer, der wohl mehr ein Aufpasser war, und mit einem gequälten Lächeln im Gesicht intervenierte, wenn ihm eine Frage zu sowjetkritisch erschien. Ausweichend verwies er auf die Referate des wissenschaftlichen Stabes der Mission, die im Anschluss folgen würden.
Eine dreiviertel Stunde nach Leonows Auftritt war die Pressekonferenz mit einem Schlussreferat des Präsidenten der sowjetischen Akademie der Wissenschaften zu Ende gegangen, und der Ansager war ein letztes Mal ans Mikrofon getreten und informierte die Pressefotografen über die Möglichkeit, im Anschluss in einem gesonderten Raum Aufnahmen von Leonow und den Referenten zu machen. Stewart erhob sich von seinem Sitz und legte im Vorbeigehen die Hand auf Bruno Hartwegers Schulter.
„Dann will ich mal. Man sieht sich vielleicht später noch in der Lobby.“
Wenig später fand er sich im ersten Stock des Hotels in einem Saal ein, der wesentlich kleiner war und mit einem dunkelroten Teppich und langen, grünen Vorhängen ausgestattet war. Auf einer kniehohen Bühne standen Alexej Leonow, sein Kommandant Pawel Beljajew, zwei technische Leiter der Woschod 2-Mission und der Präsident der Akademie der Wissenschaften. Neben den Geehrten war ein mannshohes Modell des Raumschiffs aufgestellt, und an der Rückwand hingen Fotos der Raumkapsel, von Leonow und seinem Bordteam, sowie von der Erde aus der Weltraumperspektive. Die Männer aus der Bühne lächelten selbstbewusst und schüttelten sich für die Kameras die Hände. Einer der Fotografen fragte Leonow, ob er nicht in seinem Raumanzug - eine der technischen Innovationen der Mission - posieren könne.
„Amerikanski?“, scherzte Leonow in Anspielung darauf, es könnte sich ein Spion unter den Fotografen befinden, und alle Anwesenden stimmten in sein Lachen ein.
Nach einer Viertelstunde wurden die Fotografen aufgefordert, den Saal zu verlassen. Die Sicherheitsbeamten hielten die Türflügel auf und verabschiedeten die Fotografen mit einem Kopfnicken. Edward Stewart war im Begriff, seine Kameraausrüstung zusammenzupacken, als ihn ein anderer Fotograf anrempelte. Der Mann entschuldigte sich feierlich, dann bückte er sich und hob etwas vom Boden auf.
„Gehört das Ihnen?“ Er hielt eine Filmdose in die Luft. Noch ehe Stewart etwas sagen konnte, machte der Mann einen Schritt zur Seite und stellte die Dose auf einen Tisch.
Der hat’s aber eilig, dachte sich Stewart und ging hinüber, um sich die Filmdose anzusehen. Sie war leer. Er schüttelte den Kopf und war im Begriff, sich abzuwenden, als er ein merkwürdiges Geräusch, eine Art Zischen, hörte. Als er sich umdrehte, sah er, dass direkt neben dem Tisch eine unscheinbare Nebentür war, die einen Spalt breit offen stand. Und dann sah er den Kopf eines Mannes mit strähnigem, weißem Haar, der ihm mit gepresster Stimme etwas zuzurufen versuchte.
„Sie! Sie da!“ Sein Gesicht war gerötet, die Augen hinter den runden Brillengläsern weit aufgerissen. Stewart war überrascht, denn er erkannte den Mann: Es war der Physiker Viktor Tschernenko, der Wissenschaftler, der im Namen der Akademie ein Referat über die technischen Herausforderungen der Mission gehalten hatte. Und jetzt versuchte der Mann, der vollkommen aufgelöst schien, ihn durch den Türspalt herbeizuwinken.
Stewart schaute um sich. Die letzten Fotografen waren gerade dabei, den Saal zu verlassen, und niemand schien Notiz davon zu nehmen, was hier am Rande des Geschehens vor sich ging. Er näherte sich der Tür mit der Frage auf den Lippen, worum es denn ginge, als der andere ihn bereits am Ärmel packte und hinüber in den Nebenraum zog. Schnell schlug der Wissenschaftler, ein Mann mit der Statur eines Hünen, die Tür ins Schloss und warf sich mit dem Rücken davor. Breitbeinig und mit abgespreizten Armen stand er da, als wolle er den Leibhaftigen höchstpersönlich am Eindringen hindern.
„Sie müssen mir helfen!“, keuchte der Professor. auf seiner Stirn liefen Schweißperlen zu einem Rinnsal zusammen.
Entgeistert starrte Stewart ihm in die Augen. „Was zum Teufel…“
„Hier! Nehmen Sie das!“ Tschernenko stürzte regelrecht auf Stewart zu, drückte ihm mit beiden Händen etwas in die Hand, dann sprang er sofort wieder vor die Tür. „Sie müssen dies der US-Botschaft übergeben! Es steht alles auf dem Spiel!“ Der Alte brachte diese Worte nur mühsam unter einem Husten hervor. In diesem Augenblick wurde von der anderen Seite an die Tür gepoltert. Dumpfes Rufen drang in den Raum. Der Professor stemmte sich mit aller Kraft gegen die Tür, auf die nun richtiggehend eingeschlagen wurde. Stewart schreckte zurück.
„Sehen Sie zu, dass Sie hier rauskommen!“, rief ihm Tschernenko zu. „Schnell! Gehen Sie…“ Seine Worte brachen in dem Moment ab, als die Tür nachgab. Er wurde in den Raum geworfen, strauchelte, dann kippte der massige Körper des Mannes nach vorne und stürzte zu Boden. Zwei Männer stürmten in den Raum. Der Erste hielt eine Waffe in der Hand, die er sofort auf Stewart richtete.
„Sie bleiben, wo Sie sind!“, herrschte er ihn an.
Stewart war wie versteinert. Seine Augen fixierten voller Entsetzen den Lauf der auf ihn gerichteten Pistole. „Was zur Hölle…“, stammelte er.
„Mund halten!“ Mit wenigen Schritten war der Mann hinter ihm. „Los, zurück in den Saal!“ Stewart spürte einen eisernen Griff an der Schulter. Der Mann stieß ihn durch den Türstock und schlug die Tür hinter ihm zu.
Stewart vernahm die gedämpften Laute eines aufgeregten Wortwechsels. Dann hörte er Schüsse. Erst einen, dann nochmals zwei in schneller Folge.
Am frühen Abend saß der Schweizer Auslandskorrespondent Bruno Hartweger mit den anderen Presseleuten in der Lobby des Palladium Hotels. Die Fotografen und Reporter unterhielten sich in kleinen Gruppen angeregt über die neuesten Ereignisse und spekulierten über deren politische Folgen. Die Stimmung war aufgekratzt, und es war absehbar, dass manch einer auf seine Trinkfestigkeit geprüft werden würde, wie überall, wo das Pressezentrum in räumlicher Nähe zu den Hotelbars lag.
Hartweger hatte einen Platz an der Bar mit gutem Überblick. Nach Edward Stewart hatte er sich über die Länge von zwei Drinks vergeblich umgeschaut. Als er allerdings eine füllige, extravagant gekleidete Dame um die fünfzig eintreten sah, leerte er den Rest seines Camparis mit einem großen Schluck hinunter, stellte das Glas auf den Tresen und rutschte vom Hocker. Er zupfte sein Jackett zurecht und ging zu ihr hinüber.
„Louise!“, rief er und breitete die Arme aus. Die Angesprochene drehte sich erwartungsvoll um und lachte herzhaft auf.
„Bruno!“, gab sie zurück, wobei sich ihre tiefrot geschminkten Lippen zu einer Spitze formten. Auch Hartweger musste unmittelbar lachen, als er seinen Namen in französischem Akzent hörte. Sie packte ihn und drückte ihn an ihren ausladenden Busen.
Die beiden gingen in den Speisesaal und setzten sich an einen freien Tisch. Nachdem sie eine Fischspezialität und ukrainischen Wein bestellt hatten, vertieften sie sich sofort in ein reges Gespräch, das sich selbstredend um ein einziges Thema drehte: Den Wettlauf der Supermächte um die Eroberung des Weltalls.
Gegenüber den Russen hatten die Amerikaner in den vergangenen Jahren stets das Nachsehen gehabt. Mit Sputnik 1, dem ersten künstlichen Satelliten, hatten die Sowjets vor bald zehn Jahren die gesamte westliche Welt geschockt und damit den Startschuss dafür abgegeben, was Historiker später Space Race nennen würden. Hinter dem sportlich klingenden Namen stand ein knallharter Krieg der Ideologien, der die Weltraumfahrt für beide Seiten zu einer Angelegenheit von höchster nationaler Priorität machte. Sputnik 1 war nur die erste einer Reihe von Demütigungen, welche Russland mit ihrem vermeintlich rückständigen und unterlegenen kommunistischen System den USA verpasste. Nur einen Monat später war die Hündin Laika als erstes Lebewesen in den Weltraum geschickt worden. Dann folgte mit Juri Gagarin der erste bemannte Weltraumflug überhaupt. Walentina Tereschkowa war die erste Frau im All, und vor einem knappen halben Jahr war erstmals eine mehrköpfige Raumfahrtmission gelungen. Eine Rekordjagd, die sich innerhalb von lediglich vier Jahren abspielte.
1961 hatte John F. Kennedy ein ehrgeiziges Ziel verkündet, das alles bisher Dagewesene in den Schatten stellen sollte: Noch in diesem Jahrzehnt sollte ein Amerikaner den Mond betreten. Ein Zwischenziel bestand darin, einen Astronauten ins freie All zu schicken. Jetzt war ihnen Russland mit Alexej Leonow auch darin zuvorgekommen. Die USA kassierten eine erneute Blamage, Russland hatte einen neuen Helden.
Louise Bertrand, eine Analystin der Agence France-Presse, vermutete hinter den prestigeträchtigen Unternehmungen der Supermächte mehr als Entdeckereifer und übersteigerten Patriotismus. Sie war überzeugt, dass die bemannte Raumfahrt nur dazu diente, die massiven Kosten für die Entwicklung zuverlässiger Raketen in der Öffentlichkeit zu legitimieren. Dahinter würde in Tat und Wahrheit ein ganz anderes und weit weniger friedliches Ziel stehen: Der Transport von Atomsprengköpfen.
„Reine Propaganda!“, rief sie und verwarf ihre in schillernden Farben beringten Hände. „Einfach lächerlich, diese pseudowissenschaftlichen Referate! Es ist immer dasselbe: Man gibt vor, den Fortschritt der Zivilisation voranzutreiben, dabei geht es in Wirklichkeit nur darum, die eigene Vormachtstellung zu behaupten.“ Sie warf sich lachend in den Stuhl zurück und fügte an: „Das erinnert mich übrigens an meine zwei Neffen, die sich gerne darum streiten, wer die größere Sandburg bauen kann.“
Hartweger pflichtete ihr grinsend bei. „Dennoch muss man neidlos anerkennen: Eine unglaubliche Leistung! Natürlich lässt man uns über die technischen Details im Ungewissen, aber das ist ja auch irgendwie verständlich, wenn man bedenkt, …“ Er kniff die Augenbrauen zusammen und blickte finster über den Tisch. „…dass wir doch alle Spione sind!“
Bertrand lachte schallend. Sie erhob ihr Glas und rief feierlich: „Na dann…auf Leonow! Sa sdorovje!“
„Auf Leonow!“
Irgendwann, nachdem der Barmann sich auch durch gutes Trinkgeld nicht länger dazu hatte bestechen lassen, weitere Drinks auszugeben, ließ sich Hartweger in sein Hotelbett im zweiten Stock fallen. Seine trinkfeste Kollegin hatte darauf bestanden, ihm noch einen letzten Schlummertrunk auszugeben. Weitere Kollegen waren mit derselben großzügigen Absicht dazugekommen, und Hartweger verfluchte sie alle. Als seine Augenlider schwer wurden, und ihm die Ereignisse des Tages wie in einem Kaleidoskop durch den Kopf schwirrten, dachte er an die Begegnung mit seinem alten Bekannten Edward Stewart, und er fragte sich, ob dieser womöglich noch am Abend abgereist sei.
Nichts wäre Edward Stewart lieber gewesen, als sein albtraumhaftes Erlebnis mit einem guten Kollegen wie Bruno Hartweger teilen zu können. Als er jedoch den Kongresssaal verlassen und sich in sein Hotelzimmer zurückgezogen hatte, war sein Schicksal bereits im Begriff, eine ungeahnte Wendung zu nehmen.
Professor Tschernenko hatte ihm ein dreimal gefaltetes Briefpapier in die Hand gedrückt. Schon nach einem flüchtigen Überfliegen hatte Stewart erkannt, dass er in den Besitz von etwas gekommen war, das sein Leben verändern würde. Dies war sie - die große Chance, auf die er immer gehofft hatte.
Er war wie benommen von der Erkenntnis, dass ihn die zufällige Begegnung mit dem Professor geradewegs in eine machtvolle Position katapultiert hatte. Wie auch immer er sich nun verhalten würde, es würde weit reichende Konsequenzen haben. Mit seinem Handeln würde er mehr bewirken können als Legionen von Politikern. Er brauchte sich bloß zu entscheiden, das Richtige zu tun. Es war so einfach.
Vierundzwanzig Stunden später hätte Stewart alles dafür gegeben, den größten Fehler seines Lebens rückgängig machen zu können.
Aufgewühlt und fest entschlossen hatte er kurz nach der Konferenz vom Pressezentrum aus ein Telegramm nach London geschickt. Es ging an eine Person mit Namen Robert Kellings, und bestand aus lediglich einer Zeile:
Vier Spalten auf Titelseite reservieren
Dies war ein Code. Stewart signalisierte damit, dass er Kellings etwas anzubieten hatte, und zwar etwas von höchster Brisanz. Denn Kellings Posten als Redakteur beim Londoner Büro der Associated Press, einer der größten internationalen Presseagenturen, war in erster Linie Tarnung. In erster Linie war er Führungsoffizier der CIA und hatte die Aufgabe, Journalisten anzuwerben und sie als Kontaktperson zu unterstützen. Junge, leidenschaftliche und motivierte Leute. Leute wie Edward Stewart.
Später dann, in der Nacht, hatten sich die ersten Zweifel eingeschlichen. Warum gerade ich? Wieso ließ mich das Wachpersonal gehen, nachdem es mich zusammen mit dem Professor erwischt hatte? Stewart hatte sich in rationalen Erklärungen versucht, doch sein Bauchgefühl sprach eine andere Sprache. Irgendetwas stimmt hier nicht. Der Mann, der ihn angerempelt hatte, und die leere Filmdose auf den Tisch gestellt hatte, genau dort, wo die Nebentür zu sehen war. War das nicht ein Trick? Und was war mit den Schüssen? Schließlich hatte er nicht gesehen, dass der Professor erschossen wurde. Zu viele Zufälle, zu viele Ungereimtheiten.
Je länger die Nacht dauerte, desto mehr reifte aus einem vagen Gefühl die Überzeugung: Dies war ein abgekartetes Spiel. Und irgendjemand hatte ihm bei diesem Spiel eine besondere Rolle verschrieben. Er beschloss noch in dieser Nacht, bei seinem Zwischenhalt auf dem Flughafen in Paris am nächsten Tag irgendetwas zu unternehmen, das ihm wenigstens etwas Zeit verschaffte.
Am folgenden Tag gegen Mittag stand Stewart am Tresen eines überfüllten Bistros am Flughafen Paris-Orly und schlürfte seinen Kaffee. Nachdem er bezahlt hatte, nahm er sein Gepäck und schaute sich nach einem Telefon um. Er folgte den Piktogrammen auf den Hinweistafeln.
Vor dem Apparat stellte er sein Gepäck auf den Boden und suchte in der Innentasche seines Jacketts nach einem Adressbüchlein. Rasch blätterte er die Seiten durch bis er den Eintrag R.K. fand. Er starrte auf die daneben stehende Nummer wie ein Wahrsager auf seine Karten. Ein letztes Zögern, dann griff er beherzt zum Hörer, warf etwas Kleingeld in den Automaten und wählte die Nummer.
Das Gespräch war von kurzer Dauer. Stewart wusste in dem Moment, als er den Hörer einhängte, dass er eine irreversible Entscheidung von größter Tragweite getroffen hatte. Mit seinem alarmierenden Telegramm hatte er die sprichwörtlichen schlafenden Hunde geweckt. Jetzt, nachdem er Kellings mitgeteilt hatte, dass er sich geirrt hatte, würde er seinen Vorgesetzten gegen sich haben. Dies bedeutete, dass er auf der Stelle seine Spuren verwischen und von der Bildfläche verschwinden musste. Und zwar so lange, bis er wenigstens ansatzweise aufgeklärt hatte, was sich an der Pressekonferenz in Leningrad tatsächlich abgespielt hatte.
Er machte sich auf zur Busstation, um zum Gare de Lyon zu gelangen, unwissend, dass seine Reise ihn quer durch Frankreich, durch halb Italien und über das Meer nach Jugoslawien führen würde. Unwissend, dass dies die letzte Reise seines Lebens sein würde.
3. LONDON – JUNI 1965
Der Schweiß rann Peter Hall in Strömen von der Stirn. Er wischte sich hastig mit dem Zipfel seines T-Shirts über das Gesicht, dann fasste er den Tennisschläger wieder mit beiden Händen und begab sich in Position.
„Satz - und Matchball Franklin!“, tönte es aus den Lautsprechern der Tennisanlage im Westen von London. Von den Sitzreihen starrten einige Dutzend Augenpaare auf das Geschehen, das sich an diesem frühen Abend auf dem Turnierplatz des Holland Park Tennisclubs abspielte.
Eine hübsche, wohlproportionierte Frau Ende Zwanzig war von ihrem Sitz am Spielfeldrand aufgesprungen und rief auf den Platz hinaus: „Nicht nachlassen, Peter!“
Peter Hall warf ihr einen verärgerten Blick zu, als sein Gegner gerade zum Aufschlag ausholte. Der Ball donnerte exakt in die Ecke des Feldes und sprang in flachem Winkel nach hinten ab. Stolpernd erreichte Hall den Ball gerade noch und schlug ihn blindlings zurück. Der Ball flog und flog und beschrieb eine perfekten Fluglinie, die von einem anschwellenden „Ooh!“ der Zuschauer begleitet wurde und die in einer unerreichbaren Platzierung haarscharf an der Seitenlinie endete. Ein Glücksschlag.
„Einstand“, verkündete der Schiedsrichter. Die junge Frau kreischte vor Begeisterung.
Hall gelang es, einen weiteren Angriff abzuwehren und das Game für sich zu entscheiden. Der Schiedsrichter zeigte Aufschlagwechsel an. Es gab eine kurze Pause, dann begaben sich die Spieler zurück auf das Feld. Franklin ging in Abwehrstellung, Hall richtete sich an der Grundlinie auf. Er hob den Schläger und visierte mit zusammengekniffenen Augen die andere Spielhälfte an.
„Peter, du schaffst es!“, rief die Frau erneut und strich sich aufgeregt ihre blonden Strähnen aus dem Gesicht.
Hall murmelte etwas, dann warf er den Ball hoch in die Luft und holte mit dem Schläger aus. Sein Körper spannte sich, und er schlug den Ball mit voller Wucht nach vorne. Mit einem pappigen Geräusch platzte der Ball an die Netzkante und fiel zu Boden. Hall schnaubte, nahm einen neuen Tennisball aus der Hosentasche und machte sich an seinen zweiten Aufschlagversuch. Der Ball landete sicher in der gegnerischen Seite, war jedoch viel zu vorsichtig gespielt, so dass sein Gegner kontern und wiederum die Kontrolle über das Spiel erlangen konnte.
Hall erkämpfte sich dank zwei gelungenen Stoppbällen ein weiteres Game. Doch nun lag der Aufschlag wieder bei Franklin, und nach einigen Ballwechseln verkündete der Spielleiter von Neuem die fast aussichtslose Lage: „Satz - und Matchball Franklin!“
„Oh, Peter!“, tönte es wieder von der Seite her.
„Gloria…verdammt!“
Es war zu spät. Hall wurde auf dem falschen Fuß erwischt und blieb wie angewurzelt stehen, als der Ball in seinem Feld aufsetzte. Franklin stieß einen Schrei des Triumphs aus, und das Publikum applaudierte.
Howard Franklin hatte mit einem mustergültigen Ass gewonnen. Der feingliedrige Mann mit dem schmalen Oberlippenbart strahlte und reckte seine Fäuste in die Höhe, während Peter Hall seinen Kopf auf die Brust sinken ließ.
„Sieger der diesjährigen Clubmeisterschaften bei den Senioren: Howard Franklin!“, schallte es über das Gelände, während sich die beiden Kontrahenten am Netz die Hand schüttelten.
„Tut mir leid, Peter!“ Franklin verzog das Gesicht. Dann klopfte er sich auf den Bauch und lachte: „Warst ja auch schon besser im Lot!“
Hall schäumte innerlich. Diese Bemerkung hatte gerade noch gefehlt. Nicht genug damit, dass ihn Franklin einmal mehr knapp geschlagen hatte; er erdreistete sich auch noch, sich über ihn lustig zu machen. Er hielt sich im Grunde für einen sportlicher Verlierer, aber Howard Franklin war ein eitler, chauvinistischer Geck, laut und angeberisch. Gegen Franklin zu verlieren bedeutete mehr, als ein Spiel zu verlieren. Es war eine Demütigung.
Hall schwang sein Handtuch über die Schulter und ging schnurstracks auf die Garderobe zu, wobei er sich alle Mühe gab, den mitleidsvollen Blicken der Leute, insbesondere derer der melodramatischen Gloria, auszuweichen. Überhaupt schauten ihn gewisse Leute an, als würde er aufs Schafott geführt.
„Es ist bloß ein Spiel, oder?“, meinte er zu einer Gruppe älterer Herren. Er konnte nicht wissen, dass der Grund für die Reaktion der anderen darin lag, dass sein Name heute in unrühmlichem Zusammenhang in den Londoner Zeitungen stand. Er war noch an diesem Morgen in München gewesen, wo er sich vergeblich um die Veröffentlichungsrechte an den Memoiren eines kürzlich verstorbenen Industriemagnaten bemüht hatte. Er hatte es gerade noch so auf den Tennisplatz geschafft.
Eigentlich passte der silberne Plymouth Barracuda gar nicht zu einem Mann, der sich gerne unauffällig gab und der die Eitelkeiten der Jugend seit mindestens zwei Jahrzehnten hinter sich hatte. Mit seiner ruhigen Art widersprach er den Erwartungen vieler, denen zu Ohren kam, dass in seinen Adern ein Cocktail aus schottischem und italienischen Blut floss. Und gerade dieses unterdrückte, im Grunde hitzige Temperament, würde nun in dem schnittigen Sportwagen symbolisch zum Ausdruck kommen, meinte einmal sein Freund Walter Bishop mit einem Augenzwinkern.
Für Hall war der Gebrauchtwagen lediglich ein Ersatz für den VW Variant, den seine Exfrau nach ihrer Scheidung vor einem halben Jahr behalten hatte. Den kombiartigen Familienwagen hatten sie sich seinerzeit auf Drängen von Susan zugelegt, die damit signalisierte, wie sie sich ihre gemeinsame Zukunft vorstellte. Eine Familiengründung aber bedeutete für Hall vor allem eines: Ein Dasein hinter dem Schreibtisch. Weg von der Front, weg von seiner Rolle als unbequemer Investigationsjournalist, der unangenehmen Zeitgenossen unangenehme Fragen stellte, und damit immer auch Risiken auf sich nahm. Zwar war das Reisen in ferne Länder in den letzten Jahren weniger geworden, aber für einen Mann, der eine Vergangenheit als Kriegsreporter hatte, war solch ein radikaler Schnitt ganz einfach unvorstellbar. Schließlich war es Susan gewesen, die die Konsequenzen gezogen hatte. Seither war kaum ein Tag vergangen, an dem Hall sich nicht gefragt hatte, ob es nicht doch einen Weg hätte geben können.
Er grübelte über seine Niederlage gegen Franklin nach, während er den Wagen in Richtung Notting Hill steuerte. Letztlich hatte Franklin recht. Er war schon besser in Form gewesen und hatte eindeutig ein paar Kilo zu viel auf den Rippen, auch wenn er von Natur aus robust gebaut war. Zu viel Ärger. Zu viele Drinks. Außerdem hatte sich, seit er sich das Rauchen abgewöhnt hatte, nicht nur seine Kondition gesteigert, sondern auch sein Appetit. Aus seinem Vorsatz, dies durch ein regelmäßiges Lauftraining auszugleichen, war definitiv nichts geworden. Verdammt!
Die Ampel wurde rot, als er die Kreuzung erreichte. Hall richtete den Rückspiegel und zwang seine kurz geschnittenen, vom Duschen noch feuchten Haare zu einem Seitenscheitel. Deutlich traten die grauen Strähnen zutage. Auch in seinen kurz getrimmten Bart schlichen sich immer mehr Anzeichen des Alterns ein. Hall fragte sich, ob er mit seinen einundvierzig Jahren wohl schon zum alten Eisen gehöre.
Ungestüm trat er aufs Gaspedal, als die Ampel auf Grün wechselte. Der Barracuda röhrte auf und schoss nach vorne. Einige Passanten warfen ihm missbilligende Blicke nach. Hall ließ sie an der Heckscheibe abprallen.
Nach eingehender Analyse revidierte Hall sein Urteil und kam zum Schluss, dass es nicht an ihm gelegen hatte. Schließlich waren die Chancen auf den Sieg bis zuletzt da gewesen, körperliche Verfassung hin oder her. Nein, die naheliegendste, vernünftigste und im Grunde genommen einzige Erklärungen hatte einen Namen: Gloria.
Dass die Büroangestellte der Nachrichtenagentur Reuters, für die er als freischaffender Reporter regelmäßig Beiträge schrieb, ein Auge auf ihn geworfen hatte, war an sich nichts Neues. Ebenso wenig neu war allerdings die Tatsache, dass ihre Annäherungsversuche bei ihm noch nie auf Interesse gestoßen waren, was die für seinen Geschmack eindeutig zu schrille Frau eigentlich längst bemerkt haben müsste. Und nun war also diese Gloria ausgerechnet beim Finalspiel der Clubmeisterschaften aufgetaucht, in das er sich seit dem Frühjahr hinauf gekämpft hatte. Und natürlich hatte sie sich ihrem aufdringlichen Naturell entsprechend nicht wie die anderen Zuschauer auf der Tribüne, sondern direkt am Spielfeldrand installiert. Wie hätte sich da einer konzentrieren können.
Den ganzen Tag über war der Himmel verhangen gewesen, aber nun kündigten grauschwarze Wolkenflächen baldigen Regen an. Peter Hall hatte den Wagen geparkt und überquerte die von Platanen gesäumte Straße. Er ging auf einen schmucken Altbau am Lansdowne Walk zu, in dessen zweiten Stock die möblierte Wohnung lag, die er vor einem halben Jahr ohne Rücksicht auf den horrenden Mietzins bezogen hatte.
Er betrat sein Apartment, warf die Schlüssel auf den Esstisch und schlurfte, während er sein Hemd aufknöpfte, hinüber zum Kühlschrank. Er nahm eine Schale mit Eiswürfeln aus dem Eisfach, ließ zwei davon in ein Longdrinkglas kullern und goss einen Schuss Gin darüber.
„Auf uns!“, murmelte er und prostete dem Beefeater zu, der auf der Flasche abgebildet war. Mit einem kräftigen Schluck spülte er das Tennismatch, Howard Franklin und Gloria hinunter.
Dann prüfte er ohne große Erwartungen den Inhalt seines Kühlschranks. Er roch an einer Schale mit vorgekochter Tomatensauce, stellte sie neben den Herd und setzte einen Topf mit Wasser auf. Mit dem Drink in der Hand ging er hinüber zum Küchentisch, auf dem fein säuberlich die Post der letzten zwei Tage aufgestapelt war. Mrs. Sullivan, die Hausmeisterin, hatte sich während seiner Abwesenheit darum gekümmert.
Er hatte sich kaum hingesetzt, als das Telefon klingelte. Widerwillig raffte er sich auf, ging ins Wohnzimmer und nahm den Apparat von der Kommode. Es bellte ihm eine wohlvertraute Stimme entgegen.
„Hall, wo zum Teufel stecken Sie?“
„Wo brennt’s denn, Wilson?“, gab Hall zurück. Er setzte sich auf einen Stuhl, lehnte sich zurück und machte sich auf das Gewitter gefasst, das sein Agent bei der Nachrichtenagentur Reuters nun unweigerlich auf ihn loslassen würde.
„Wo es brennt? Lesen Sie denn auch mal eine Zeitungen, oder schreiben Sie nur?“
Hall wurde hellhörig. Worauf wollte Wilson hinaus? Er musste nicht lange auf eine Antwort warten.
„Nehmen sie zum Beispiel den Guardian, Seite 5!“
Hall wühlte in der Post nach der Zeitung und schlug die Seite auf. Als er die Schlagzeile las, stockte ihm der Atem.
„Hall, sind Sie noch dran?“
„Ich rufe zurück!“ Er ließ den Hörer auf die Gabel sinken und las die vernichtenden Zeilen, die ihn förmlich ansprangen:
Freispruch für Ronald McDougherty in Veruntreuungsaffäre
Ronald McDougherty, Anwärter auf einen Parlamentssitz im Unterhaus und Mitglied der Geschäftsleitung von “One World“, der karitativen Organisation für Kinder in Not, wurde am High Court in erster Instanz von dem Vorwurf freigesprochen, systematisch Spendengelder veruntreut zu haben. Das Verfahren wurde eingestellt, nachdem die Verteidigung nachweisen konnte, dass Teile der belastenden Informationen widerrechtlich beschafft worden waren. Dem renommierten Journalisten Peter Hall, der die kompromittierende Geschichte aufgedeckt hatte, drohe nun ein Verfahren wegen Verbreitung rechtswidrig erlangter Informationen, so Malcolm Berry, der Anwalt des Angeklagten.
„Verdammt!“ Hall schlug mit der Faust auf den Tisch. Dann ließ er sich wieder auf den Stuhl sinken.
Es war ihm bewusst gewesen, dass er sich mit den Hinweisen seines Informanten in eine rechtliche Grauzone begab. Der Fehler war offensichtlich der, dass er dem zuständigen Staatsanwalt, einem integeren, jungen Mann, zugetraut hatte, das Gericht vom öffentlichen Interesse der Sache zu überzeugen und damit eine Güterabwägung im Sinne der Anklage zu erreichen. Damit hätte das Gericht selbst Beweismaterial, das widerrechtlich beschafft worden war, anerkannt. Dass die Sache nun auf ihn und nicht auf seinen Informanten zurückfiel, war die Konsequenz des Anonymitätsschutzes, den er seinem Informanten zugesichert hatte.
„Was für ein Tag“, seufzte Hall. Es drängte sich die Frage auf, ob die Nachrichtenagentur, welche die Exklusivrechte an der Story gekauft hatte, ihn rechtlich decken würde. Dass hieße, das Urteil anzufechten und auf Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe zu plädieren - allerdings mit unabsehbarem Ausgang.
Mal sehen, was Wilson zu sagen hat - schlimmer kann es ja kaum kommen.
Bevor er zum Telefonhörer greifen konnte, klingelte der Apparat von Neuem. Er riss den Hörer von der Gabel und rief in die Muschel: „Was wollen Sie?“
Vom anderen Ende kam konsterniertes Schweigen. Und dann: „Peter?“
Hall benötigte einen Augenblick, um die Stimme zuordnen zu können.
„Ich bin’s, Walter!“
„Entschuldige, Walter. Hör mal, ich…“
Walter Bishop ließ ihn nicht ausreden. Mit ernster Stimme sagte er: „Ich versuche schon den ganzen Tag, dich zu erreichen! Es geht um Ed Stewart. Sag mal, schickt ihr euch gegenseitig Ansichtskarten?“
„Was für Ansichtskarten?“
„Dachte ich’s mir doch. Ich habe hier eine äußerst merkwürdige Postkarte von Ed. Sie ist für dich bestimmt, obwohl er sie hierher geschickt hat.“
„Dann hat er wohl meine Adresse nicht aufgeschrieben.“
„Entweder das, oder er will dir mit dieser Karte etwas Bestimmtes sagen.“
„Wie meinst du das?“
„Nun, der Text ist, sagen wir, etwas eigenartig. Ich denke, es ist das Beste, wenn du dir das mal selber anschaust. Irgendetwas stimmt hier nicht!“
Hall stöhnte innerlich. Es wurde definitiv Zeit, dass dieser unglückselige Tag sich dem Ende neigte.
4.
Robert Kellings saß zu dieser Zeit in einem Pub in der Nähe seines Büros in London. Seine getrübte Stimmung war nach dem ersten Lagavulin, den er zum Entsetzen des Barmanns auf Eis trank, einem Gefühl stoischer Gleichgültigkeit gewichen. Lustlos trommelte er mit den Fingern zu It’s not unusual und der Stimme von Tom Jones, die aus der Jukebox tönte. In seinem Kopf drehte sich alles um einen nicht eingetroffenen Telefonanruf. Er hatte lange genug zugewartet, bis zum heutigen Tag, der allerletzten, immer wieder hinausgeschobenen Frist.
„Dies ist nicht der Reader’s Digest Club, aus dem Sie so mir nichts, dir nichts aussteigen können!“, hatte er den Agenten bei dessen letztem Telefonanruf aus Paris gewarnt. „Wegen Ihrem Telegramm aus Leningrad brütet in Langley ein ganzes Team von Analysten über der Frage, was sie der Agency vorenthalten. Ich weiß nicht, zu welchem Schluss man kommen wird, aber ich versichere Ihnen, die Konsequenzen werden unangenehm sein. Es liegt einfach nicht mehr in meiner Hand, verstehen Sie?“
Es war mehr als eine leere Drohung gewesen, in der Hoffnung, Edward Stewart doch noch zum Einlenken bewegen zu können. Obschon er sich darauf eingelassen hatte, seinem Agenten Zeit für eigene Nachforschungen einzuräumen, arbeitete man jenseits des Atlantiks bereits auf Hochtouren an einem Plan B für den Fall, dass der Mann doch nicht aus freien Stücken mit den Informationen herausrücken sollte, die er offenbar in Russland entdeckt, zugespielt bekommen oder gekauft hatte. Zum jetzigen Zeitpunkt waren alle Stationsleiter in Europa informiert und angewiesen worden, ihn mit allen Mitteln aufzuspüren.
Dass sich Edward Stewart doch noch bei ihm melden würde, war umso unwahrscheinlicher geworden, je mehr Zeit verstrichen war. Und heute war klar: Den Mann konnte er abschreiben. Ausgerechnet Stewart, einen Mann, in den er nicht nur große Hoffnungen gesetzt hatte, sondern den er auch persönlich mochte.
Die fraglichen Informationen waren Kellings ziemlich egal. Er war im Netzwerk der CIA eine eher unbedeutende Nummer und hatte in seiner Rolle als Führungsoffizier selten länger mit einzelnen Fällen zu tun. Sein Job war die Betreuung von verdeckt arbeitenden Agenten und das Weiterreichen von Informationen - was die anderen in Langley damit machten, interessierte ihn kaum, zumal das Meiste sowieso in irgendwelchen Archiven versickerte. Außerdem hielt er wenig von der Idee, Journalisten für die Frontarbeit einzusetzen. Diese Leute waren Amateure und damit Sicherheitsrisiken. Edward Stewart war nur ein weiterer - trauriger - Beweis.
Kellings trank aus und verließ das Lokal. Er schlenderte zurück in sein Büro in der Norwich Street, das nur wenige Blocks entfernt war. Die meisten seiner Kollegen bei der Associated Press, wo er einen offiziellen Posten als Redakteur bekleidete, waren inzwischen längst nach Hause gegangen, und das Großraumbüro wirkte auf seltsame Art verwaist. Es war in diesen Stunden, in denen Kellings seiner ‚Nebentätigkeit‘ nachging.
Er knipste die Tischlampe an und rückte den Bürostuhl zurecht. Es kostete ihn einen Moment der Überwindung, den Hörer abzuheben und die Privatnummer des Stationsleiters in London zu wählen. Nervös tippelte er mit den Fingern auf der Tischplatte, bis sich am anderen Ende jemand meldete. Es war die rauchige, nasale Stimme eines Mannes im mittleren Alter.
„Kellings hier. Ich habe keine guten Neuigkeiten.“ Er spulte einen wohl überlegten Monolog ab. Als er fertig war, erschien ihm der Moment, während dessen er auf eine Reaktion wartete, quälend lang.
Dann endlich antwortete die andere Seite: „Sie sind ab sofort von der Sache entbunden. Unternehmen Sie nichts mehr.“
„Es war nicht abschätzbar, dass…“
„Keine Sorge, Kellings. Ich bin überzeugt, dass Sie getan haben, was Sie konnten. Schicken Sie umgehend das Dossier dieses Stewart in die Botschaft.“
Kellings versprach, dem Auftrag gleich am nächsten Morgen nachzukommen und hängte auf. Er schlüpfte in seine Jacke, knipste das Licht aus und verließ das Büro.
Er trat auf die schmale Straße vor dem Bürogebäude, blieb kurz stehen und blickte in den Himmel. Er legte einen Finger an seine Hutkrempe.
Mach’s gut, armer Teufel, wo immer du bist.
5.
Peter Hall beeilte sich, seinen Wagen zu erreichen, ehe er vollends durchnässt wurde. Als er eine halbe Stunde später den Plymouth in einer Seitenstraße der Charing Cross Road parkte, goss es bereits wie aus Kübeln. Hall schlug seinen Jackenkragen hoch und stürzte in fast lebensgefährlicher Manier über die stark frequentierte Straße.
Der Häuserblock aus dem letzten Jahrhundert beherbergte zahlreiche Geschäfte. Eines davon hatte ein schmales, spärlich beleuchtetes Schaufenster, in dem durch einen Schleier von Regen die Umrisse von Büchern erkennbar waren. Über der Eingangstür hing ein Schild, auf dem in goldenen Buchstaben auf dunkelgrünem Grund geschrieben stand:
Willis & Bishop Science Books
Hall sprang mit einem Satz unter das winzige Vordach. Das Regenwasser spritzte nach allen Seiten, als er sich die Schultern abwischte.
Mit ihrem antiken Interieur hatte die Buchhandlung das schummerige Ambiente einer Alchemistenkammer. Erst bei genauem Hinsehen wurde deutlich, dass die Regale und Auslagen bis unter die Decke vollgestopft waren mit modernster wissenschaftlicher Literatur. In der Tiefe des schlauchartigen Ladens stand ein massiger, alter Holztisch mit einer Registrierkasse und einem Ständer mit Werbeprospekten. Von dort her vernahm Hall zwei Stimmen. Die eine, markig und nasal, ließ ihn schmunzeln.
„Es kommt darauf an. Ich würde Ihnen empfehlen, mit James Cook anzufangen. Er machte die britische Expansion nach Osten überhaupt erst möglich.“
Er ging über den knarrenden Holzboden nach hinten. Dort stand ein dünner Mann von etwa fünfzig Jahren. In seinem abgetragenen Wolljackett und dem wilden Haarkranz, der seinen langen Schädel umfasste, sah Walter Bishop aus wie der Archetyp des Büchernarrs, der das Tageslicht nur selten zu sehen bekommt. Sein buschiger Oberlippenbart und ebenso buschige Augenbrauen betonten noch das kauzige Aussehen. Bishop legte ein dickes Buch auf den Verkaufstresen und ließ die Schublade der Registrierkasse aufspringen.
Eigentlich war Bishop gar kein Buchhändler, wie viele seiner Kunden dachten, die sich von ihm und seinem fast schon enzyklopädischen Wissen beraten ließen. Im Grunde genommen war der promovierte Historiker ganz einfach an seinem ehemaligen Studentenjob hängen geblieben. Dem Akademiebetrieb hatte er unmittelbar nach Erlangung der Doktorwürde den Rücken zugekehrt, frustriert und verärgert über den rückständigen, undurchdringbaren Hochschulmief, an dem jeglicher Aufklärungsgedanke vorbeigegangen war, wie er es auszudrücken pflegte. Obschon nie ein Hehl aus dieser Einstellung machte, wurde er von Fachkollegen immer mal wieder zu Gastvorträgen eingeladen.
Bereits zu Studentenzeiten hatte ihm die Anstellung in Arthur Willis‘ Buchhandlung ein Nebeneinkommen versichert. Seit sich sein ehemaliger Chef allmählich in den Ruhestand zurückgezogen hatte, führte Bishop den Laden mehr oder weniger im Alleingang. Einzig wenn er hin und wieder einer wissenschaftlichen Arbeit nachging und dafür tagelang in historischen Archiven verschwand, wurde er von Willis oder seiner Frau Julia im Laden vertreten.
Bishop schob die Geldscheine in die Kasse, verabschiedete sich von seinem Kunden und verfolgte über den Rand seiner Brille hinweg dessen Weg zur Tür. Erst als das Türglöckchen bimmelte, glätteten sich seine Stirnfalten, und er atmete hörbar auf.
„Na endlich, Peter! Ich weiß nicht, was ich von all dem halten soll…“ Bishop rückte den Stuhl weg vom Tisch und zog eine Schublade auf. Er nahm eine Ansichtskarte heraus, die er Hall entgegenstreckte. „Hier, die ist gestern angekommen. Von Ed Stewart. Was sagst du dazu?“
Hall betrachtete die Karte mit zusammengekniffenen Augenbrauen. Sie zeigte in übersättigten Farben einen Fischerhafen mit Booten und aufgehängten Fangnetzen. Das Motiv hätte von irgendwo am Mittelmeer stammen können, wenn nicht unten rechts gestanden hätte:
Lijana – Willkommen in Kroatien
Hall sah sich die Rückseite an.
„Siehst du?“, sagte Bishop. “Sie ist für dich bestimmt, aber geschickt hat er sie hierher.”
Hall zuckte ratlos mit den Schultern. „Lieber Peter…“, begann er zu lesen.
Krina ist eine wahrhaft idyllische Insel und teilweise noch völlig unberührt – genau so muss sich „Robert the Bruce“ einst gefühlt haben!
Meine Fotoreportage über die Meeresfauna kommt gut voran, und die neue Calypsophot macht sich hervorragend. Wie lange ich noch bleibe, ist also ungewiss.
Es grüßt Dich Ed
„Wirklich sehr eigenartig.“ Hall verzog die Mundwinkel.
„Was ist das für eine Reportage? Ich denke, er ist Politjournalist. Und recht erfolgreich dazu, soviel ich weiß.“
„Nun ja, Reisereportagen und Naturfotografie sind so eine Art Hobby von ihm. Aber ich habe keinen blassen Schimmer, wieso er mir davon berichtet - noch dazu mit einer Ansichtskarte.“
„Es geht offensichtlich um etwas anderes als um Fische und Korallen. Er will dir damit etwas sagen. Du kennst ihn doch sehr gut - was könnte er damit meinen?“
Hall nickt nur und zupfte nachdenklich an seinem Bart. „Was war das mit diesem Robert the Bruce?”
Bishop klopfte auf ein dickes Buch mit grünem Einband, das auf dem Tresen lag. „Robert der Erste, auch genannt Robert the Bruce, König von Schottland 1306 bis 1329, war ein schottischer Nationalheld, der seinerzeit im Unabhängigkeitskampf auf die Insel Rathlin fliehen musste“, sprudelte er hervor. „Von dort aus hat er der Legende nach den schottischen Widerstandskampf gegen die Engländer geplant - müsstest du als Schotte eigentlich wissen.“
„Halbschotte“, entgegnete Hall trocken. „Wenn ich deine Vorlesung richtig verstanden habe, dann geht es im Kern darum, dass Robert the Bruce auf die Insel Rathlin geflüchtet ist.“
Bishop nickte bedeutungsvoll. „Eben. Es ist metaphorisch gemeint, eine Allegorie.“
„Ist es das, was Ed uns sagen will? Dass er sich auf der Flucht befindet? Flucht wovor?“
„Das weiß der Himmel.“ Die beiden schauten sich nachdenklich an. Nach einer Weile fügte Bishop an: „Jedenfalls scheint Ed zu hoffen, dass dich dieser Text misstrauisch machen würde. Dass du Fragen stellen und die richtigen Schlüsse ziehen würdest.“
“Wenn dies ein Hilferuf ist, wenn Ed da unten in der Klemme steckt…” Hall begann, auf dem knarzenden Boden hin- und herzulaufen. Auf einmal blieb er stehen und schnippte mit den Fingern. “Dann macht es auch Sinn, dass er die Karte hierher in die Buchhandlung geschickt hat. Er weiß, dass ich oft tagelang weg von zu Hause bin und es sicherer ist, wenn er sich bei dir meldet. Du könntest entweder wissen, wo ich bin, oder nach mir suchen!”
„Was schlägst du vor? Was sollen wir tun?“
Peter Hall war bereits dabei, seine Jacke zuzuknöpfen und sich nach der Ladentür umzudrehen. „Ich muss da hin, Walter. So schnell wie möglich!“
6. KROATISCHE KÜSTE – JUGOSLAWIEN





























