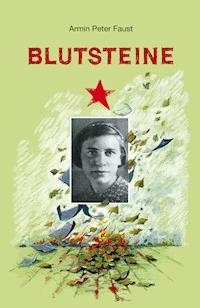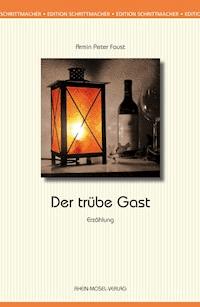
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Rhein-Mosel-Vlg
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Edtion Schrittmacher
- Sprache: Deutsch
Der namenlose Protagonist dieser Erzählung ist Lehrer, leidet aber nicht an dem modischen Burn-out-Syndrom, er leidet an den Widersprüchlichkeiten seiner bürgerlichen Existenz. So glückt ihm kein einziger Abschnitt seines Lebens und das Bewusstsein, nur ein 'trüber Gast auf der dunklen Erde' zu sein wächst, auch wenn der Alt-68er auf Nietzsches Spuren in der dünnen Luft von Sils Maria oder im letzten 'sozialistischen Paradies', in Havanna, diese aufzuheben versucht. Er gleicht seinem Lieblingsvogel, dem Stieglitz, der zwar seinem Gefängnis entflogen ist, aber nun ratlos auf seinem Käfig sitzt. –
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 193
Veröffentlichungsjahr: 2011
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Printausgabe gefördert durch das Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur Rheinland-Pfalz
Die Edition Schrittmacher wird herausgegeben von Marcel Diel, Sigfrid Gauch, Arne Houben, Thomas Krämer.
© 2007 eBook-Ausgabe 2011 RHEIN-MOSEL-VERLAG Zell/Mosel Brandenburg 17, D-56856 Zell/Mosel Tel.: 06542-5151, Fax: 06542-61158 Alle Rechte vorbehalten ISBN 978-3-89801-769-5 Korrektorat: Marcel Diel
Armin Peter Faust
Der trübe Gast
Erzählung
Edition Schrittmacher Band 11
RHEIN-MOSEL-VERLAG
(1. Teil)
»Dort ein Gefühl, vom Eiswind herübergeweht, das sein tauben-, sein schnee- farbenes Fahnentuch festmacht.« (Paul Celan)
»Es gibt Stunden, in denen ich mich freue auf eine Zeit, in der es nichts mehr geben wird, woran ich mein Herz hängen könnte.« (Marlen Haushofer)
für Adalbert † und Elise †
Er zerkrümelte die Herbstblätter, die er in einer euphorischen Phase seiner Recherche-Reisen auf den verschiedenen Friedhöfen gesammelt hatte. Eins nach dem anderen zerdrückte er die knisternden Gebilde und ließ sie in den mit Papierfetzen halb gefüllten Korb unter seinem fleckigen Schreibtisch fallen. Sie hatten etwas von Naturüppigkeit und Farbluxus in seine Bücherhöhle gebracht, hatten sich aber allmählich angstvoll eingerollt, so als könnten sie dem Anspruch, durch ihre warmen Farben den Sammler aufzuheitern, nicht weiter gerecht werden, und waren sich auch farblich immer ähnlicher geworden: die Platanenblätter vom Cimetière de Thiais, Route Nationale No. 7, neben dem Krematorium aufgelesen, die roten Ahornblätter von dem Flecken an der Loire, wo der fromme Walahfrid Strabo sein Leben unfromm ausgehaucht hatte, und die sattgelben Birkenblätter vom kleinen Wannsee, Kleists großem Grab. Das Rot, das Gelb und das zarte Braun hatten sich in ein Einheitsgraubraun verwandelt und dies war zum Wecken von heiteren Herbstassoziationen unbrauchbar geworden. Die Farbfreude hatte sich verflüchtigt und in der letzten Zeit hatten sie auf den Mappen und Manuskriptblättern gelegen und ihrem Sammler signalisiert, sich zu beeilen, zu Ende zu kommen, bevor die Wintermelancholie, der jedes Jahr wiederkehrende Schneehass, ihn stumm und stumpf machen würde.
Er hatte beharrlich dagegen angekämpft, hatte seine stoischen Anlagen mobilisiert und der Maler in ihm hatte die bunten Zeugnisse vor dem endgültigen Verfall mit Aquarellfarbe bannen, die herbstliche Heiterkeit konservieren wollen, aber der Versuch war misslungen: Wie die Produkte eines Farbenblinden hatten die Blätter auf dem gehämmerten Papier gestanden; er hatte sie weggepackt und seither nie mehr angeschaut.
Der Unart, mit seinen Niederlagen zu kokettieren, hatte er nicht nachgegeben und auch jetzt, nach der Zerstörung des Vergleichsmaterials, holte er die Blätter nicht aus der Mappe. Er wollte die braungraue Erinnerung nicht wieder auffrischen. Zu vieles war noch zu erledigen.
Er sah zum Fenster hinaus. Das mit Birkenrinde verkleidete Futterhaus, in das er schon vorbeugend Körner eingefüllt hatte, war offen nach allen Seiten, aber nur eine Schar Meisen hatte bisher davon Gebrauch gemacht und lustlos in den Körnern gescharrt.
Die Stieglitze, seine Lieblingsvögel, ließen auf sich warten. Vielleicht würden sie überhaupt nicht mehr kommen, denn ihr Rückzugsgebiet, ein kleines, verwachsenes, mit Dornengestrüpp umgrenztes Wäldchen war verschwunden; Bauplätze waren dort entstanden und normal hässliche Häuser.
Der Lärm der Baumaschinen und später der Rasenmäher war dazugekommen und hatte die Vögel vielleicht in die Resignation getrieben. Und vielleicht – so dachte er diese Einsicht weiter – vielleicht gab es für die Vögel noch mehr Lärm in dieser Welt und sie verzichteten auf alte Gewohnheiten und kamen nicht mehr wieder, vergaßen das Brüten, verlernten das Fortpflanzen.
Überall lag schmutziger Schnee: aufgehäuft an den Rändern der Gehsteige, zwischen den geparkten Autos und auf den Flachdächern der riesigen Garagen. Die Stieglitze blieben aus. Die Garagen blieben. Nun ja.
Er schob den Papierkorb wieder an seinen Platz, denn er hatte ja einen, trat vor das Bücherregal, wo auf den staubigen Vorsprüngen der Regalbretter die widerstandsfähigeren Überreste seiner 48 Lebensjahre ausgebreitet vor sich hin lagen.
Man konnte diese Gegenstände nicht zerkrümeln wie die Herbstblätter; sie setzten den Melancholien zäheren Widerstand entgegen als das farblos gewordene Laub. Sie markierten Lebensstationen eines Aufsteigers.
Er nahm in einer jähen Anwandlung, einem Erinnerungsdruck, sein Hochzeitsbild vom Regal, jenes bescheidene Schwarz-Weiß-Foto in dem albernen Fichtenrähmchen, und betrachtete es lange und doch verständnislos. Es brachte keine Erleuchtung; die Rückblende bewegte nichts. Er kam dem Geheimnis der beiden abgebildeten Menschen nicht näher. Verschlossen grinsten die beiden jungen Leute ihn an. Fremd stand er sich selbst gegenüber.
Er stellte das Foto verständnislos und kopfschüttelnd wieder an seinen Platz, setzte sich auf seinen Bürostuhl, der im allgemeinen Durcheinander des Zimmers wie ein Aufruf zur Nüchternheit wirkte, und ließ Zeit vergehen.
Hastig schlug er dann plötzlich ein Buch über Kierkegaard auf, las ein paar Sätze, ohne Zusammenhänge herstellen zu können, bückte sich nach einer Staubfussel auf dem abgeschabten Teppich, beseitigte eine Spinnwebe vor dem Regal, riss wie von einer plötzlichen Eingebung gelenkt den Papierkorb mit dem zerkrümelten Laub an sich und rannte in Hausschuhen durch den Schnee zur Mülltonne. Er hatte Mühe, den mit einer Eiskappe versehenen Deckel zu öffnen. Als es ihm schließlich gelang, sah er, dass jemand ein paar neue Schuhe hineingeworfen hatte. Er betrachtete, nein, er starrte auf das schwarzglänzende Paar, aber es gelang ihm wiederum nicht, irgendeinen Zusammenhang zu anderen Wahrnehmungen dieses Wintervormittags herzustellen: weder zu Kierkegaard noch zu dem Hochzeitsbild oder den ausbleibenden Stieglitzen. Er kippte – wie um sich von diesem unlösbaren Rätsel loszureißen – den Inhalt seines Papierkorbs über die weggeworfenen Schuhe und raschelnd und knisternd füllten die Laubreste die Hohlräume der Tonne. Er stülpte den Eishut wieder darüber und ließ das Geheimnis auf sich beruhen.
Wieder vor dem Schreibtisch sitzend, kam ihm ein Bild vor Augen, das ihn vor Jahren beim Besuch eines winzigen Provinz-Museums beeindruckt hatte: Ein Kind stand vor einem ausgestopften Fuchs, bückte sich plötzlich und begann liebevoll das staubige Fell zu streicheln. Dabei blickte es zu einem Paar auf, als wollte es für seine Tat gelobt werden. Aber es wurde nicht gelobt; die beiden Erwachsenen, wohl die Eltern des Kindes, zerrten es weiter, so als würden sie irgendwo etwas Wichtiges versäumen.
Als die drei Besucher den Raum verlassen hatten, kniete er selber nieder und tat es dem Kind nach.
Niemand sah ihm dabei zu und er selbst hatte keine Erklärung für sein Handeln.
Und auch jetzt, mit einem Abstand von mehr als drei Jahren, blieb ihm dieses kindliche Verhalten rätselhaft.
Er blickte zu dem fertigen Manuskript hinüber: Dort lag es auf der Klappe des Familien-Sekretärs neben den Glockenbecherresten, die er an einer Baugrube in Mainz-Weisenau aufgelesen hatte, und dem verrosteten Hammer aus dem Harz. In der Gegend von Schierke und Elend hatte er ihn in einem ausgetrockneten Bachbett und einer glücklicheren Zeit gefunden: Goethes Mineralogen-Hammer hatte er den rostigen Eisenklumpen genannt, es aber niemandem gesagt. Ja, sein Manuskript, nun war es fertig geworden. Nicht gut, aber fertig und er wollte es Anfang Dezember an seinen Doktorvater abschicken, damit dieser es im Januar begutachten und das Rigorosum ansetzen könnte, denn er wollte an einer Familientradition festhalten, wonach alles Wichtige – Gutes und Schlimmes – im Januar passierte, wenn das Jahr wieder zunahm, der Winter vertrauter und die Melancholien seltener geworden waren.
Er blätterte das Manuskript noch einmal an, las die ein oder andere zufällig aufgeschlagene Stelle, ohne den Zusammenhang herzustellen und den Sinn zu erkennen. Und hätte er nicht hie und da noch ein vergessenes Komma mit dem Schwarzstift eingefügt, er hätte sie für das Produkt eines Fremden halten können. Kalt und positivistisch kam ihm seine eigene Arbeit vor. Er hatte Material zusammengetragen, hatte wie eine Arbeitsbiene letzte Poeten-Worte und -Werke nach charakteristischen Wendungen abgeklopft, ja sogar intime letzte Briefe hatte er unter die Augen bekommen, verstört hingeworfene Abschiedssätze voll Bitterkeit und mit fahriger Handschrift, aber er war dem Ziel nicht in dem Maße näher gekommen, wie er sich das in der naiven Begeisterung früherer Jahre ausgemalt hatte. Die Schar der Dichter-Selbstmörder war stetig gewachsen, sodass er die Stoffmassen reduzieren und einige Autoren aussortieren musste, um den Überblick nicht zu verlieren. Dem großen Warum kam er nicht auf die Spur und auch die Reisen zu den Gräbern, zu den letzten Wohnungen und Schaffensstätten, hatten keine konkreten Ergebnisse gehabt: Ihre Geheimnisse hielten sie zäh und egoistisch fest.
Und er hatte sich von seinem Professor trösten lassen müssen, dass ein Zusammenstellen des Materials, ein Sichten und Ordnen der Motive und Lebenszeugnisse bereits eine honorige Leistung sein könne.
Dieser Trost war billig, denn er durchschaute das Wohlwollen seines alten Lehrers, in dessen Doktorarbeit er einmal geblättert und auf deren Korrekturrändern er bissige Anmerkungen von Kollegen und kritischen Jungwissenschaftlern gelesen hatte, von denen der Ausdruck »Faktenhuberei« noch einer der mildesten war. Wie – wenn überhaupt – würden sie bei ihm lauten! Er wog seine Arbeit, seinen aufgehäuften Bienenstock noch einmal in den Händen und befand sie selbst trotz der Fülle als zu leicht. Er ließ sie klatschend auf die Schreibtischplatte fallen und ging ein paarmal im Zimmer auf und nieder. Fast feindlich behielt er sie im Auge: Für dieses Bündel Eitelkeit hatte er seine Familie geopfert, seine Dienstpflichten in der Schule vernachlässigt und doch nicht jenen Frieden mit sich selbst erzeugt, der ihn erhobenen Hauptes und mit in sich selbst zurückgenommenem Stolz der letzten Prüfung entgegengetragen hätte.
Und diese stand nun an. Sollte er aufgeben, fliehen? All die Jahre war das nicht seine Art gewesen. Allen Prüfungen hatte er sich mit jugendlicher Naivität gestellt, hatte die Lücken glücklich übersehen und die Fallgruben, die sich manchmal während der Prüfungen aufgetan hatten, mit Charme und rhetorischem Geschick übersprungen, sodass am Ende immer ein unerwartet gutes Resultat herausgekommen war. Er hatte eine gewisse Behändigkeit im Lügen und Verschleiern von Unfähigkeit entwickelt, die ihn fast stolz gemacht hatte, die aber eigentlich nicht seinem Wesen, seiner ehrlichen Haut entsprachen.
Aber jener naive Optimismus des Aufsteigers, jene Unverfrorenheit der Anfangsjahre war ihm abhanden gekommen. Er war nicht mehr der von sich selbst überzeugte Parzival, der in die Welt der Wissenschaften geeilte heitere Simplizissimus, der lustvoll praktizierende Chaot, der alles zum Besten wenden konnte. Ja, selbst der nüchterne Status eines Amateur-Stoikers, den er zur Selbstcharakterisierung seiner ersten Dienstjahre insgeheim und nur für sich geprägt hatte, traf nicht mehr zu. Jene hilfreiche Gelassenheit, die von seinen Kollegen wohl eher als Gleichgültigkeit angesehen wurde, ließ sich nicht mehr erzeugen.
Und wieder – wie so oft in den letzten Jahren – stellte sich urplötzlich das Bewusstsein wieder ein, auf dünnem Eis zu wandeln, die Knack- und Knistergeräusche schon zu vernehmen, die dem Einbruch in das schwarze Wasser angsterzeugend vorangingen.
Und hatten ihn in der Vergangenheit immer wieder Menschen, die es ehrlich und gut mit ihm meinten, vor dem endgültigen Einbruch in das Eis, auf welches ihn Eitelkeit und Selbstüberschätzung geführt hatten, gerettet, mit offenen Armen und guten Ratschlägen, so konnte er in der jetzigen Lebensphase nicht mehr mit dieser Hilfe rechnen. Er hatte sie nach und nach durch Kränkung und Vernachlässigung verprellt und aus seinem Lebenskreis gedrängt. Und er hatte sich dem Gefühl hingegeben, seine Aufgabe, sein Werk, woran er anfangs fest und unerschütterlich geglaubt hatte, schaffe den Ausgleich für die Verluste im Menschlichen.
War es also seine Arbeit, die ihn einsam gemacht hatte, so musste sie gut geworden sein, um diesen Damm zu bauen, um ihn von der gefährlich knisternden Fläche ans sichere Ufer zu führen.
Aber an jener Kompensation, an jener Rettung begann er mehr und mehr zu zweifeln. Und diese Zweifel gipfelten hin und wieder und in den dunkelsten Stunden in Rache- und Vernichtungsgelüsten.
Einmal ertappte er sich dabei, dass er seine Arbeit unter das Altpapier mischen wollte, ein andermal sah er sie schon im Kaminfeuer knisternd zerfallen, aber immer war er vor diesem letzten Schritt zurückgeschreckt und hatte sich und sie in einer geradezu wilden Arbeitsphase vor sich selbst gerettet: Aus der Lähmung folgte die Aktion, fast ein physikalisches Gesetz. Aber dieser Mechanismus funktionierte auch nicht mehr in dieser letzten Phase. Er fand nicht den Mut, so viel Feigheit aufzubringen, wie das Aufgeben gefordert hätte.
Und so steckte er nach einem kurzen Nachtspaziergang den Blätterpacken in das ausgepolsterte Kuvert, klebte die Lasche rasch und hastig zu, so als hätte er einen Rückfall zu befürchten, warf das ausgestopfte und frankierte Bündel auf die Schreibtischplatte, an der er es innerhalb zweier Jahre zuerst optimistisch, später zweifelnd, schließlich verzweifelt produziert hatte, und hieb mehrfach aufseufzend mit der Faust darauf, so dass sein Hund, von dem ungewohnten Lärm aufgescheucht, herbeieilte, um seinem Herrn verständnislos mit seinen Hundeaugen in die Menschenaugen zu starren – und dann wieder resignierend wegzuschleichen: Er hatte keine Aufsteiger-Attitüden; er war sein Hundeleben zufrieden.
Die Pudelmischung, die ihm, dem einsamen Lehrer, an einem stürmischen Herbsttag bei einer Wanderung über die abgeernteten Felder zugelaufen und nicht mehr von seiner Seite gewichen war, nahm mit tierischer Gelassenheit die Änderungen der Lebensgewohnheiten seines Herrn wahr: So, wenn er, vom Dienst heimkommend, immer öfter eine Dose Hundefutter aus der Stellage nahm, die Deckellasche aufriss, ihm die Hälfte des Inhalts in den Napf kippte und er die andere Hälfte hastig in sich hineinlöffelte oder wenn er auf seinen immer länger werdenden Nachtspaziergängen ihm, dem Tier, die Sternbilder zu erläutern versuchte: den Orion, die Venus, den Großen Wagen mit dem Reiterlein, und erklärte, wie man durch Verlängern der hinteren Wagenachse den Polarstern ermitteln könne. Was interessierte einen Hund der Polarstern!
Auch in dieser Nacht waren sie unterwegs gewesen, ein zweites Mal, denn nun hatten sich auch die Schneewolken verzogen, der Himmel war klar und sternenbedeckt, als Herr und Hund auf dem Weg zum Briefkasten waren. Und obwohl der Hund lieber in seinem Korb geblieben, geträumt und verdaut hätte, trottete er doch lustvoll neben seinem Herrn her und hörte sich seine Belehrungen an. Denn auch auf diesem Spaziergang ging es um die Sterne. Er habe in seinen ersten zwanzig Lebensjahren – wie er vor sich hin murmelnd gestand – keinen Stern angeschaut, auch nicht als er verliebt war. Er habe als junger Mensch immer nur die Erde im Blick gehabt und fest auf ihr gestanden, der Anziehungskraft und der Heimat gewiss. Lächerlich wäre er sich vorgekommen, wenn er die Sterne angestarrt hätte, damals als junger Ehemann oder später als Vater seinen Kindern gegenüber. Vor seinem Hund wollte er diesen Spleen nicht mehr verbergen. In letzter Zeit hörte ihm nämlich nur noch der Hund zu, wenn er von der Ewigkeit sprach und von der großen Gleichgültigkeit der Sterne den Menschen gegenüber. –
Das Kuvert klackte in den Hohlraum des Kastens, der Deckel schwang noch etwas nach und verursachte ein Geräusch, das Endgültigkeit signalisierte. Nun war die Sache auf den Weg gebracht und wohin er führte, wussten weder Herr noch Hund in dieser Dezembernacht.
Zeit verging. Und kurz vor Weihnachten fand er sein Kuvert wieder im Briefkasten vor. Er ließ einen halben Tag vergehen und öffnete erst gegen Abend im Beisein seines Hundes und mit einer inneren Beklemmung, die seine Hände zittern ließ, das Paket.
Er blätterte das Konvolut auf, sah die vielen Bleistiftanmerkungen, erkannte die etwas zittrige Handschrift seines alten Professors und entnahm schließlich dem kurz gefassten Begleitbrief die Zusage, dass seine Arbeit als Dissertation zunächst aufgenommen sei und er sich in den nächsten Tagen um Zweitkorrektor und Prüfer für das Rigorosum bemühen möchte.
Seine Zweifel hatten sich also nicht bestätigt. Er setzte sich an seinen Schreibtisch, unterdrückte den angefangenen Seufzer und lächelte unvollkommen vor sich hin. Sein Blick löste sich nach einer Weile vom Manuskript und ging interesselos zum Fenster hinaus in die Zweige der kahlen Lärche, die wie ein Drahtgeflecht vor dem verschneiten Winterwald stand. Seine Gefühle und Gedanken bekamen Richtung und Profil: Ein Selbstbildnis würde er augenblicklich malen, denn die Spuren dieses eben erfahrenen Glücksmomentes mussten festgehalten werden. Er hatte solche Regungen in den letzten Jahren nur selten in seinem Gesicht aufspüren können, auch wenn er stundenlang in den Spiegel geblickt hatte.
Nun, da er den verstaubten Malkasten aus dem Regal zog, seine Lieblingskassette in den Rekorder steckte, um mit Brechts Ballade von der Hanna Cash seinen Glücksmoment zu steigern und zu konservieren, wünschte er sich insgeheim nur noch, der Stieglitz möchte sich in den verschneiten Zweigen vor dem Fenster zeigen oder zum Futterhäuschen kommen, denn so ein bunter Vogel hatte er im Leben immer sein wollen. Er hatte einmal in jungen Jahren in einem holländischen Museum ein Bild von Carel Fabritius gesehen, das einen solchen Vogel auf seinem winzigen Käfig sitzend dargestellt hatte, so als wollte das Tier dem Betrachter demonstrieren: Schau, ich habe mein Gefängnis verlassen und nun die Möglichkeit, in der Freiheit mein buntes Federkleid zu Markte zu tragen oder in mein Gefängnis zurückzukehren und die hingestreuten Brosamen zu picken und Wasser aus dem winzigen Tröglein zu trinken für den Rest meines Lebens! Und zwischen diesen beiden Möglichkeiten schien der Vogel sich entscheiden zu wollen, als ihn der Maler mit flottem Pinsel in diesem Moment für immer und ewig bannte.
Sein Vogel ließ sich jedoch nicht vor dem Fenster blicken, solange er aus zögerlich hingesetzten Braun- und Grauflecken – Lehrergrau nannte er im Unterricht und vor seinen Schülern immer diesen Farbton – sein eigenes Bildnis formte. Auch diesmal, aus dem besagten Glücksimpuls heraus, gelang ihm der bunte Vogel nicht, obwohl er, einer inneren Eingebung folgend, mehr Farbe in sein blasses Gesicht hineinsah als gewöhnlich.
Er war kein Vogel und die Alternative, in eine karge und gefährliche Freiheit zu entfliegen oder in seine selbstgewählte, allerdings wohlig eingerichtete Gefängnisexistenz zurückzukehren, hatte er schon vor Jahren fahren lassen und das Türchen von innen geschlossen.
Und in der Folgezeit, in mehr als zwanzig Dienstjahren bildete er sich ein, innerhalb der Gitterstäbe gebraucht zu werden. Zuerst war er stolz auf seine Brauchbarkeit gewesen, später litt er eher darunter und in den letzten Jahren fühlte er sich unbegrenzt missbrauchbar. Zwar hatte er auch in den euphorischen Anfangsjahren nach dem Referendariat nie in pädagogischer Selbstzufriedenheit seinen Dienst versehen und sich die Höhe seiner Pension ausgerechnet, auch konnte er nicht auf Anhieb sagen, wie viel er verdiente, im Gegenteil, er hatte sich stets kleine Seitentürchen hin zur Wissenschaft oder Kunst offengehalten, um vielleicht, wenn der Leidensdruck der Brauchbarkeit zu groß würde, durch diese zu entschlüpfen. Doch waren diese Schritte zu spät und zu zögerlich gemacht worden, sodass er sich eher verzettelte im Schülertheater, in winzigen, schlecht besuchten Ausstellungen und in wissenschaftlichen Aufsätzen, die in armseligen Broschüren und provinziellen Vierteljahresschriften vielleicht von einer Handvoll Leuten zur Kenntnis genommen wurden.
So hatte er sich zwar manch buntes Federchen ins Haar gesteckt, aber der Wind der Gewöhnlichkeit hatte sie hinweggepustet, als wären sie nie gewesen. Der graue Alltag erlaubte keine Musenkontakte, weder mit Kalliope noch mit Melpomene oder Thalia, und im täglichen Grabenkampf mit seinen Schülern war die gefährliche Einsicht gewachsen, dass es geradezu das Ziel der meisten Schüler geworden war, all das von sich fernzuhalten, was er geistig zu bieten hatte.
Wie eine Schwindelware war ihm schließlich der Lehrstoff vorgekommen und er hatte zuletzt sogar so etwas wie Verständnis für die Abwehrhaltung seiner Schüler entwickeln müssen und kleine, illegale Auswege gesucht. Aber sich in diesen Zustand einzugewöhnen oder sich darin gar wohlzufühlen, war ihm nie mehr gelungen.
Als seine Familie sich aufzulösen begann, hatte er für kurze Zeit einen unbürgerlich-gewaltsamen Befreiungsschlag in Erwägung gezogen, aber sich dem Trunk oder der Droge hinzugeben und seinen Ausstieg aus dem Pädagogendasein damit zu provozieren, kam ihm dann doch zu albern vor. Und sich in Professor-Unrat-Manier aus dem bürgerlichen Leben zu verabschieden, sich dem Tingeltangel an den Hals zu werfen oder einen pornographischen Bestseller zu schreiben, dazu fehlte ihm das erotische Talent.
So blieb ihm lediglich die Möglichkeit, sich wissenschaftlich halbwegs über Wasser zu halten, sich mit der Muse Klio auszusöhnen und hier den letzten Absprung zu wagen.
Einmal im Leben wollte er noch auf dem offenen Käfig sitzen, verloren und verschüttet gegangene Alternativen in sein Blickfeld rücken und neue Wege gehen, wohl ahnend, dass der Traum zum Trauma werden könnte.
Das Selbstbildnis war fertig. Er wusch die Pinsel aus und stellte die Skizze zur Besichtigung an die Rückenlehne des Schaukelstuhls, in dem er fast nie geschaukelt hatte; seine Selbstliebe reichte nicht aus, sich diese Leichtigkeit zu gönnen.
Mit zusammengekniffenen Augen starrte er nun zu dem leise hin- und herschaukelnden Blatt hinüber und konstatierte den fast erwarteten Fehlschlag: Der Optimismus, den er in das zerfurchte, bärtige Gesicht hineinbringen wollte, hatte sich offenbar in leise Selbstironie verwandelt während des Malprozesses. Unter der Hand sozusagen. Und obwohl hier bei dieser Arbeit die eigene Hand eine ganz andere – vielleicht wichtigere – Rolle zu spielen hatte als bei der Formung von Sätzen einer wissenschaftlichen Arbeit, waren der Vorgang und vor allem die Ergebnisse von ähnlicher Beschaffenheit: Die Realisierung wich von der Intention ab, nicht erheblich oder gar meilenweit, aber doch schmerzlich merkbar. Und diese unbekannte Größe war wohl eine seiner leidvollen Lebenskonstanten. Denn auch in anderen Tätigkeitsbereichen klafften das Wollen und das Vollbringen auseinander und kein zähes Ringen, keine Wiederholung und mühevolle Einübung hatten den Abstand verkleinern, geschweige denn beseitigen können.
Vielleicht hatte er zu viel gewollt und zu wenig vermocht: in wissenschaftlicher und künstlerischer, vor allem aber in menschlicher Hinsicht.
Dennoch weigerte er sich innerlich, diese unbekannte Größe Versagen zu nennen, denn die fast verzweifelten Übungen waren ja noch nicht an ein Ende gekommen, an ein Ende, wo keine Ausrede und kein Ausweg mehr möglich war und das in letzter Konsequenz gegen sich selbst gerichtet sein musste.
Aber so weit war er noch nicht.
Vorläufig war ihm nur ein Selbstbildnis misslungen, die Bannung einer winzigen Euphorie, das Festhalten eines guten Moments, einer Sekunde der fünf Glücksminuten, die Goethe selbstironisch einmal für sich und sein Leben verbucht hatte.
Er klappte den Deckel des Malblocks über die Tempera-Skizze und stellte den Block an seine Stelle, für den nächsten Versuch, die nächste Glückssekunde griffbereit. Am nächsten Tag riss er das Blatt ab, datierte es lieblos und deponierte es in der Dachschräge, wo die Bilche hausten.
Mehr als 30 Selbstbildnisse waren so nach und nach in die dunkle Dachschräge der Rumpelkammer gewandert. Und hatten die Portraitversuche seiner Anfangsjahre mit jugendlichem Mutwillen die Tiefpunkte seines Lebens dokumentiert und mit Leid andeutenden verschatteten Augen und willkürlich gesetzten Stirnfalten kokettiert, so waren die Bilder seiner mittleren Jahre zunächst eher von milder Ironie, später von Sarkasmus und Selbstverspottung geprägt. Den Wendepunkt markierte ein Selbstbildnis, das er im Jahr seiner Scheidung gemalt und das er insgeheim als seinen Abschied vom Bürgertum angesehen hatte: Vor dem nackten Oberkörper hielt er die Palette, auf der nur eine Lache schwarzer Farbe zu sehen war, eine Clownsnase in Zinnoberrot verunzierte seine eigene und der rotgeschminkte Mund war zum Anspucken des Betrachters geschürzt. Doch dieses Bild hatte bisher außer seinem Hund und den Bilchen niemand zu Gesicht bekommen. In den Selbstbildnissen der letzten Jahre, als er schon in seine zähe Arbeit verstrickt war, hatte er den wenigen Glücksmomenten aufgelauert, aber sie nur selten wirklich bannen können. So waren auch diese bildlichen Zwischenbilanzen mehr oder weniger zu Dokumenten seines Scheiterns geworden.
Er tat deshalb auch gut daran sie nicht allzu oft anzuschauen. Dennoch dachte er selbst in seinen depressiven Phasen nicht daran, diese Lebensbilanzen in Flammen und Rauch aufgehen zu lassen, und die Tizian-Lösung, die Bilder einst um sein Sterbebett herum zu versammeln, um sich dafür öffentlich zu schämen, erschien ihm, dem Autodidakten, dann doch zu pathetisch. Ja, diese Bescheidenheit schien fast an Hochmut zu grenzen, und Hochmut war nie seine Sache gewesen, eher Kleinmut.
Die Bescheidenheit war ihm, dem ländlichen Menschen, schon in die Wiege gelegt und dann in der Schule kräftig gepflegt worden. Er erinnerte sich an Schönschreibübungen in Sütterlin-Schrift, wobei er mit Hingabe und Akribie über mehrere Seiten hinweg den Satz: Schuster, bleib bei deinen Leisten! mit der Stahlfeder in sein Heft gekratzt hatte. Sogar so etwas wie Freude hatte er dabei empfunden.