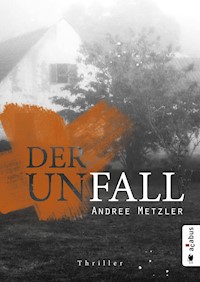
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- E-Book-Herausgeber: Acabus VerlagHörbuch-Herausgeber: liberaudio
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Ein Verkehrsunfall, eine neue Liebe, ein abgelegenes Haus. Meli van Bergen ist eine erfolgreiche Immobilienmaklerin. Sie führt ein Leben auf der Überholspur, bis ein Unfall sie jäh ausbremst: Querschnittslähmung. Rollstuhl. Depression. In der Reha lernt sie den fröhlichen Therapeuten Tom kennen, der ihr zeigt, dass das Leben noch immer lebenswert ist. Sie verlieben sich, heiraten und ziehen in ein einsames Haus am See. In der freien Natur, ohne Telefon und Internet, lebt Meli wieder auf. Doch unmerklich holt die Vergangenheit sie wieder ein. Die perfekte Idylle bekommt Risse und Meli muss plötzlich um ihr Leben kämpfen …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 281
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Andree Metzler
Der Unfall
Thriller
Metzler, Andree: Der Unfall. Hamburg, acabus Verlag 2019
Originaldaten
ePub-eBook: ISBN 978-3-86282-655-1
PDF-eBook: ISBN 978-3-86282-654-4
Print: ISBN 978-3-86282-653-7
Lektorat: Sophie Sander, acabus Verlag
Satz: Sophie Sander, acabus Verlag
Cover: © Annelie Lamers, acabus Verlag
Covermotiv: www.pixabay.com
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Der acabus Verlag ist ein Imprint der Bedey Media GmbH,
Hermannstal 119k, 22119 Hamburg.
_______________________________
© acabus Verlag, Hamburg 2019
Alle Rechte vorbehalten.
http://www.acabus-verlag.de
Prolog
Donnerstag, 12. Januar 2012
22:46 Uhr
Vorsichtig zog sie sich die Gummihandschuhe über ihre schmalen Hände. Dann ließ sie Wasser in die Spüle und reinigte sorgsam das Geschirr vom Abendessen. Das war an diesem Abend anders, denn für gewöhnlich widmete sie sich den Abendbrottellern erst am nächsten Morgen. Ihr Mann nahm derweil die Fernbedienung des Fernsehers und ließ ihn mit einem Knopfdruck verstummen. Wie stets nach den Spätnachrichten. Er verharrte noch einen Moment stehend vor dem Gerät. Sein Blick war leer, als er ihr in die Küche folgte. Wortlos trocknete er das wenige Geschirr ab, stellte es bedächtig in den Schrank. Dann begab er sich still ins Bad, putzte sich die Zähne, wusch sein Gesicht und cremte es, wie jeden Abend, mit ihrer Nachtcreme ein. Noch ein wenig Lippenbalsam, denn das spröde Gefühl nach dem Waschen mochte er gar nicht. Sein prüfender Blick in den Spiegel ließ ihn seine Traurigkeit erkennen. Er verließ das Bad und löschte das Licht.
Seine Frau hatte sich schon gleich nach dem Abendessen die Zähne geputzt – sie mochte saubere Zähne zu jeder Zeit – und bettfertig gemacht. Ab da trug sie ihren weichen Baumwollschlafanzug und ihren Kuschelbademantel und hatte so den Fernsehfilm mit ihrer Lieblingsdecke auf dem Sofa angesehen.
Als er das Schlafzimmer betrat, hatte sie schon die Etagenheizung auf Nachtabsenkung geschaltet und war gerade dabei, die Betten aufzuschütteln. Er zog sich aus, legte seine Sachen sorgsamer als sonst auf den Stuhl neben seinem Bett, richtete seine Hausschuhe aus, bevor er sein Nachthemd überstreifte. Bedächtig setzte er sich auf die Bettkante und schaute auf die Tür, die zum Wohnzimmer führte. Dort auf der Kommode sah er die alten Fotos, die Familienbilder aus glücklichen Tagen. Sein Blick wurde milchig. Er legte sich in seine Betthälfte, drehte sich zu ihr und beide sahen sich lange an. Sie hielten sich bei den Händen und lächelten.
Wie auf ein stilles Signal griff sie nach den beiden Schläuchen, die von der Wand über ihrem Bett hingen. Geschickt verband sie das eine Ende mit der Braunüle in seinem Handrücken, dann das Ende des anderen Schlauchs mit der Braunüle in ihrem Arm. Sie hatte sich den Zugang selbst legen müssen, was nicht einfach war, obwohl sie als Krankenschwester darin Übung hatte. Jedoch immer bei ihren Patienten, nie bei sich selbst. Bei ihrem Mann geschah es schnell und routiniert. Er hatte zwar gezuckt, denn er mochte keine Art von Spritzen oder Nadeln in seinem Körper, aber es war in diesem Fall unvermeidlich.
Als die Schläuche verbunden waren, öffnete sie auf sein Nicken die beiden Tropfkammern und sofort begannen die Infusionen zu laufen. Tippend dimmte er seine Nachttischlampe auf ein Minimum herunter. Dann schmiegten sich beide eng aneinander, sie umarmten und küssten sich, schauten sich dann in die Augen.
»Danke, dass du für mich da warst, immer …«, flüsterte er ihr stockend ins Ohr, »… ich liebe dich über alle Maßen, mein Schatz!«
Sie streichelte ihn sanft. »Ich dich auch, danke, dass du mich stets begleitet hast! Wir sehen uns … gleich …« Sie schluchzte. Ihre Tränen flossen, er wischte ihr mit seiner Hand die Feuchtigkeit aus dem Gesicht und war doch selbst den Tränen nah. Schon bald begann das Schlafmittel zu wirken.
Kapitel Eins
Samstag, 10. September 2016
Morgens
Die alten Steinplatten auf der großen Terrasse sind grau von der Zeit. Aus den Fugen wachsen kleine Grasbüschel. Am Rand sind ein paar Platten lose, der Mörtel darunter bröckelt. Direkt am Haus, von dem sich schon der gelbe Putz löst, steht eine verwitterte Holzbank. Alles zeugt von allzu langer Abwesenheit irgendwelcher Bewohner. Meli stört das nicht, sie hat nur Augen für den vor ihr liegenden, von Kiefernmischwald und Schilf eingefassten smaragdgrünen See, der wie ein übergroßer Diamant im morgendlichen Sonnenlicht glitzert. Die weite Naturlandschaft, die den See umgibt, ist ohne jegliche menschlichen Spuren. Keine Hochspannungsleitungen, keine Windräder, keine anderen Gebäude. Meli ist überwältigt bei dem Gedanken, hier völlig allein zu sein. Allein mit Tom, natürlich.
Über dem Wasser gleitet gerade elegant ein Graureiher, die Flügel weit, Stelzenbeine und Füße verlängern den Schnabel und schlanken Körper.
Eine leichte Brise lässt Melis lockere, von der Nacht verwuschelten Haarsträhnen tanzen, während Tom wie ein aufgeregter Junge die Wiese zum See hinunterläuft und den alten Steg betritt. Gerade als er ein paar Meter darauf zurückgelegt hat, bricht er mit einem Bein durch ein morsches Holzstück, sodass er stürzt und sein Fuß mitsamt Schuh im Wasser landet. Meli ist erschrocken, doch als sie merkt, er hat sich nicht verletzt, muss sie laut lachen. Tom befreit sich aus dem Loch, steht vorsichtig auf und gestikuliert gespielt verärgert.
»Was für ein Mist, alles vermodert hier!«
Meli winkt ihm grinsend zurück. »Ich liebe diesen Ort schon jetzt«, ruft sie mit ihrer zarten Stimme Richtung See.
»Ja toll, und ich habe hier die nächsten zehn Jahre zu tun«, erwidert Tom fröhlich.
Meli weiß, dass das übertrieben ist und dass sich trotzdem jeder Handschlag von ihm lohnen wird.
Vorsichtig macht Tom ein paar Schritte auf das Stegende zu, dann, ganz vorn, dreht er sich um, will Meli stolz zeigen, wie viel Mut in ihm steckt, da verliert er erneut den Halt und kippt der Länge nach ins Wasser. Das laute Platschen schreckt ein Entenpärchen hoch, das sich mit energischem Flügelschlag und Geschnatter schnell entfernt. Meli beobachtet die Stelle, an der er ins Wasser gefallen ist. Die Wellen, die sein Eintauchen verursacht hat, ziehen still ihre Kreise auf den See hinaus. Ansonsten rührt sich nichts. Meli starrt auf das Wasser und ruckt nervös in ihrem Rollstuhl hin und her. Warum taucht er nicht wieder auf? Wo ist er? Was soll ich denn machen, wenn er …
»Tom? TOM?«
In dem Moment schießt er wie ein Pfeil aus dem Wasser, macht sich lang und bleibt dann bis zur Hüfte im Wasser stehen. Seine Klamotten hängen nass an ihm herab. Er wischt sich die blonden Haare aus dem Gesicht und sieht sehr glücklich und entspannt aus.
»Herrlich hier«, ruft er, »wir werden bleiben!«
Meli nickt aufgeregt. Ja, auch sie will hier nicht mehr weg. Will dieses Paradies nicht wieder hergeben. Obwohl sie nicht weiß, wie sie in den ersten Stock der alten Gründerzeitvilla kommen soll. Und obwohl auch die untere Etage nicht wirklich behindertengerecht gebaut ist. Tom watet aus dem See, wischt sich grob etwas Wasser aus den Kleidern und schlappt dann die kleine Wiese zum Haus hoch.
»Schon toll, nur mit dem Preis müssen wir noch mal … bei all den Mängeln …!«
Mit einem entsetzten Blick zeigt Meli ihr Unverständnis für Toms Vorhaben. »Nein. Egal! Wir haben genug Geld und nehmen das Haus so, wie es ist.«
Auf der Terrasse schüttelt Tom als Antwort neben Meli seinen pitschnassen Kopf. Doch die paar Wasserspritzer, die er dabei produziert, ringen Meli nur ein spöttisches Lächeln ab. »Das können Hunde aber besser! Apropos … wann holen wir Balu? Er muss sein neues Heim doch auch bald kennenlernen.«
Balu, ihr junger Golden Retriever, wird überglücklich hier herumtollen, stellt sich Meli in diesem Augenblick vor. Er wird herumschnüffeln, die Enten jagen, überall seine Marke setzen und damit stolz anzeigen, dass das hier sein Revier ist. Hier pinkelt nur einer, wird das heißen. Sehnsüchtig erinnert sie sich an das kleine süße Knäuel, dass ihr die belastende Reha plötzlich so nebensächlich hat erscheinen lassen. Dieses junge und verspielte Hundeleben, das ihr, immer wenn sie es beobachtete, sofort ein Lächeln ins Gesicht zauberte, das ihr in der schwierigsten Lebenslage zeigte, hey, schau her, das Leben ist zu schön, um es nur trüb zu sehen. Balu war es egal, dass Meli im Rollstuhl saß. Dass es ihr schwerfiel, sich zu ihm runterzubeugen, um ihn zu streicheln. Oft genug gab Tom ihr den kleinen Racker auf den Schoß und Meli genoss sein kuschelweiches Fell, streichelte es unentwegt. Und Balu leckte mit seiner rauen Zunge über ihr Gesicht, wobei sie immer lachen musste. Tom hatte ihr diesen tierischen Begleiter eines Tages in die Arme gelegt und gesagt, nun bist du nicht nur für dich, sondern auch für dieses Leben verantwortlich. Meli hatte zunächst verärgert reagiert. Wie sollte sie denn noch für etwas anderes als für sich und ihren Schicksalsschlag Verantwortung übernehmen? Sie sei schon damit vollständig überlastet. Doch Tom ließ sie einfach mit dem jungen Hund allein und schon einige Minuten später hätte er Mühe gehabt, ihr den Hund wieder wegzunehmen. Klar musste er sich abends und nachts um Balu kümmern, denn in der Klinik konnte der kleine Racker nur tagsüber bleiben. Und so teilten sich Meli und Tom die Erziehung und Betreuung.
»Ja, ich sollte ihn bald holen«, erwidert Tom, der Meli nun sanft über eine provisorische, schnell von ihm gebaute Rampe in das große Wohnzimmer des Hauses schiebt. Das matte Parkett knarrt müde, während Tom Meli nun vor dem großen Fenster zum See in Stellung bringt.
»Diese riesige Fensterfront, einfach fantastisch.«
In seiner Stimme klingt große Begeisterung. Meli kann das verstehen. Es erinnert sie an ihr Penthouse, in dem sie ein ebenso riesiges, bodentiefes Fenster hinaus zur Frankfurter Skyline hatte. Sie liebt es, Weitblick zu haben, sich nicht eingeschlossen zu fühlen. Und es war ihr immer wichtig, Leben zu spüren, den Puls der Stadt. Sie fühlte sich dann dazugehörig, als Teil des Ganzen. Letztlich war es die Angst vor der Einsamkeit, vor der Leere, die sie oft an ihrem Fenster stehen und den regen Auto- oder Bahnverkehr verfolgen ließ. Die Stadt, die sich unter ihr bewegte, bewegte auch sie. Doch nun hatten sich die Dinge verändert. Sie wollte, ja sie brauchte Abstand zu dem lebendigen, bisweilen hektischen Treiben in der Bankenmetropole. Sie war nicht mehr Teil dieser Gesellschaft, sie fühlte sich dort nicht mehr zuhause. Die Stadt hatte ihr Vertrauen missbraucht, hatte sie rüde behandelt. Glücklicherweise, und das versöhnte sie, hatte die Stadt ihr Tom geschickt. Nun ist er ihre Bezugsperson, ihr Leben, ihr Motor, auf ihn kann sie sich hundertprozentig verlassen. Mit einem verliebten Blick schaut sie auf ihn, der gerade, neben ihr hockend, mit der Hand über das alte, wellige Parkett streicht. Sie fährt ihm sanft durch die feuchten, strubbeligen Haare.
»Muss abgezogen werden … Mannomann … Das wird ’ne Baustelle …« Tom stöhnt.
Meli legt ihm die Hand auf die Schulter, was so viel heißen soll wie: Das kriegen wir hin. Gemeinsam.
Kapitel Zwei
Samstag, 10. September 2016
Mittags
Die Sonne steht hoch am Horizont, ihre Strahlen spiegeln sich glitzernd auf der Oberfläche des Sees, als Tom sie den leichten Hang hinunterschiebt. Aufgeregt schaut Meli auf das näher kommende, sanft wogende und unermüdlich ans Ufer plätschernde Wasser. Wasser! Wie lange ist sie nicht mehr in ihm versunken, wie lange hat sie diese Freiheit nicht mehr genossen, dieses wohlig Umschlossene um ihren Körper, die Schwerelosigkeit gespürt. Sie hat in ihrem Leben schon einige der schönsten Meere und Buchten, Strände und Pools auf dieser Welt kennengelernt, ist am Great Barrier Reef den bunten Fischen hinterhergetaucht, auf Bali geschnorchelt, an Costa Ricas schönsten Stränden in azurblaues Meer gerannt. Sie schwamm mitten in der Wüste Namib in einer Oase im Hotelpool und ließ sich auf Sansibar und Mauritius treiben. Wasser ist immer ihr Element gewesen. Und wenn sie nicht auf Reisen war, entspannte sie sich in ihrer Badewanne mit ätherischen Ölen und dem Blick auf die Frankfurter City oder zog ihre Bahnen im Pool des besten Fitnessclubs der Stadt.
Mit einem leichten Ruck, der die Räder in den lockeren Sand bohrt, kommt Melis Sport-Rollstuhl zum Stehen. Der See ist nur noch wenige Schritte entfernt. Tom zieht die Bremse an und wirft sein Handtuch, das er bis dahin um den Hals getragen hat, über die Rollstuhlgriffe. Aufgedreht springt er hinter Meli hervor, so als wolle er sagen: Los jetzt, wer als Erster im Wasser ist.
»Sind Sie bereit, Frau van Bergen?«
Meli schluckt kurz, ihr Herz pocht wie damals, als sie ihre erste Barbie zum Geburtstag bekam. Ja, sie möchte, unbedingt, aber wie soll das gehen, es ist doch nun alles so anders. Sie kann nicht mehr schwimmen, sich allein über Wasser halten, bestimmt nicht, sie braucht Hilfe. Mit dieser verfluchten Behinderung ist sie total unselbstständig geworden. Meli schaut auf den See, schaut auf den langen, morschen Steg und auf das Schwanenpärchen, das weit draußen, einer inneren Choreographie folgend, seine Kreise zieht. Zwei wie eins.
»Na?!«
Tom lächelt. Er sieht in seinen bunten, weiten Badeshorts, mit seinem Oberkörper, der ein wenig mehr Training nötig hätte, und mit seinen blonden, wuscheligen Haaren richtig süß aus. Meli wirft ihrem Mann ein verliebtes Lächeln zu. Sie spürt, dass dieser Blick gerade jetzt mehr aus ihrem Herzen als aus ihrem Verstand kommt. Noch vor einem Jahr hätte sie so einen wie ihn nicht an sich herangelassen. So einen von der Sorte Loser. Sie wollte immer einen dieser coolen und erfolgreichen Waschbrettjungs, dunkelhaarig und blauäugig. Nun schauen sie zwei braune Augen erwartungsvoll und einladend an. Also gut.
»Bereit, wenn Sie es sind!«
Sie mag diesen Spruch von Hannibal Lecter, sie liebt den Grusel von »Schweigen der Lämmer«. Die menschlichen Abgründe.
Mit leichten Handbewegungen schiebt sie den seidenen Bademantel von ihrer rechten, dann von ihrer linken Schulter. Geschickt dreht sie im Sitzen ihre Arme aus den weiten Ärmeln, stützt sich mit den Händen auf den Lehnen des Rollstuhls etwas ab und ruckelt mit ihrem Oberkörper ihr Gesäß nach vorn. Ihr edler Bikini zeugt von besseren Strandtagen, doch steht er ihr wohl auch im Sitzen noch immer tadellos, wie sie an Toms Blick befriedigt feststellt. Es kann losgehen, sagt ihr Gesichtsausdruck, den Tom mit einem Augenzwinkern erwidert.
Er geht einen Schritt auf sie zu, schiebt seinen rechten Arm unter ihren linken und ergreift hinter ihrem Rücken ihre Achsel. Sein anderer Arm gleitet unter ihren Kniekehlen hindurch und mit einer tiefen Einatmung hebt er sie aus dem Rollstuhl. Ihre Arme haben längst seinen Hals umschlungen und sich in seinem Nacken getroffen. Sie schmiegt sich mit ihrem Oberkörper an ihn, ihre Beine dagegen hängen über seinem Arm wie eine Bleischürze. Ihre Füße sind einander zugewandt und ihre Zehen tänzeln bei jedem seiner Schritte über dem hellen Ufersand. Meli schaut kurz hinter sich auf das große Haus, das oben am Anfang des grünen, flachen Abhangs steht. Etwas in die Jahre gekommen, aber immer noch herrschaftlich. Ein sonniges Schlösschen für zwei, mit einer großen Terrasse, alles wird bald behindertengerecht umgebaut sein, und – und das ist unbezahlbar – weit und breit keine Nachbarn. Ja, nicht mal Wanderer oder Angler, die sich hierher verirren, so sagten es die Verkäufer. Ihre Insel mitten im Grünen.
Sie hört, wie Tom in den See stapft, wie das Wasser platscht, doch die Spritzer, die er dabei erzeugt und die sie abbekommt, spürt sie nicht. Ihre Beine bleiben das, was sie sind: taub. Ohne jegliches Gefühl. Auch als ihre Füße die Wasseroberfläche berühren, als sie einsinken in den an dieser Stelle bis zum Grund durchsichtigen See, hat sie keine Empfindungen. Erst ab dem Rücken spürt sie dieses wohlig nasse Gefühl, diese zarte Begegnung mit dem Wasser, die sie so liebt. Freudig und auch ein wenig über die frische Temperatur erschreckt, juchzt Meli auf. Tom lächelt, die Sonne strahlt, alles ist so phantastisch. Noch vor Monaten hätte sie das nicht für möglich gehalten. Meli spielt mit ihrer rechten Hand im samtigen Wasser, lässt es durch ihre Finger gleiten, dann spritzt sie Tom ein paar Tropfen ins Gesicht und lacht. Er deutet an, sie auf das Wasser legen zu wollen, und breitet sogleich seine Arme so aus, dass sie darauf zum Liegen kommt. Meli hält sich mit der linken Hand an seinem Nacken fest und versucht, sich lang zu machen. Ihre Unterschenkel und Füße hängen reglos im Wasser, ihr Oberkörper jedoch ist gerade. Und dann schwebt sie auf dem See, Toms Hände halten sie mit dem Kopf knapp über der Wasseroberfläche, die leichten Wogen bewegen sie, die Sonne wärmt seitlich ihr Gesicht. Sie riecht die Natur um sich herum, sie entspannt sich, schließt langsam die Augen, sodass der blaue Himmel über ihr verschwimmt. Das ist Frieden. Einfach wunderbar.
Völlig unerwartet überspült sie eine Welle, sie bekommt Wasser in die Nase, muss schlucken und husten. Panisch klammert sie sich an Toms Nacken fest und zieht sich hoch. Wo kommt diese Welle her, fragen ihre großen Augen. Tom zuckt mit den Schultern, während er sie weiter in der Schwebe hält. Meli beruhigt sich, macht sich erneut lang und schließt wieder die Augen. Sie spürt den Bewegungen des Wassers nach, den sanften Wellen, die Tom mit seinen Armen begleitet, und verliert sich erneut darin. Atmet mit offenem Mund tief diese Glückseligkeit ein, da überspült sie wieder eine Welle. Sie verschluckt sich, versucht krampfhaft, sich von Toms Händen aufzurichten, spuckt Wasser aus und hustet. Ihr Herz geht schnell. Mit angstvollem Blick sucht sie nach einer Erklärung.
»Was war das? Kannst du mir …?«
Kopfschüttelnd zieht Tom Meli an sich, sie umarmen sich und sie spürt die Geborgenheit, die diese Nähe auslöst. Nach einem langen Moment trägt er sie aus dem See hinaus und setzt sie sanft in den Rollstuhl.
Kapitel Drei
Dienstag, 13. September 2016
Vormittags
Mit etwas Schwung rollt Meli über die flache Rampe vom Wohnzimmer nach draußen und dirigiert den Rollstuhl mit leichten Armbewegungen auf das Ende der Terrasse zu. Unten auf dem Steg ist Tom schon dabei, das alte Ruderboot ins Wasser zu lassen.
Am Tag zuvor hat er den Bootsschuppen entrümpelt und allerlei verstaubtes Zeug rausgeholt: eine Angel, Netze, Gewichte, modrige Seile, die er zum Trocknen in die Spätsommersonne legte. Bevor er sich jedoch dem Schuppen gewidmet hatte, hatte er sie auf das vordere Ende des Stegs gefahren, denn nur dort gab es Mobilfunk-Empfang. Tom hatte ihren Rolli mit einem Spanngurt gesichert, damit sie in aller Ruhe mit ihren Eltern telefonieren konnte.
»Es ist ein Traum, ihr werdet es ja bald sehen, unser Paradies …«, hat Meli ihnen ihre Eindrücke der ersten wunderbaren Tage hier geschildert, ihnen das Haus sowie die Vogel- und Pflanzenwelt detailreich beschrieben. Bei all ihrer Euphorie spürt sie jedoch, wie sie sich dabei doch nach ihrer alten Heimat sehnt. Nach der Freude ihres Vaters, wenn er sie zur Tür reinkommen sah, nach dem leckeren Lieblingsessen, das ihre Mutter extra für sie zubereitete, ja, einfach nach der Geborgenheit in ihrem Elternhaus. Sie sollte vielleicht anfangs nicht so oft mit ihnen sprechen, denkt sie, als sie das Gespräch beendet hat. Es tut ihr und ihnen nicht gut. In diesen Gedanken versunken, löst sie den Spanngurt und fährt mit ihrem Rollstuhl zurück, als er sich plötzlich leicht dreht und in den See abzustürzen droht. Im letzten Moment, Meli ist starr vor Schreck, ruckt Tom den Rollstuhl wieder in die richtige Richtung und zieht ihn sanft auf die Wiese. Er lächelt beruhigend, küsst sie und deutet im nächsten Moment zum Bootsschuppen. Meli dreht sich um und sieht ein mit Staub und Spinnweben überzogenes Ruderboot.
»Im nächsten Jahr werde ich es gründlich generalüberholen«, verspricht er Meli. »Doch morgen bringe ich es so weit in Gang, dass wir eine Runde über den See fahren und uns mit der Umgebung bekanntmachen können, ja?«
Meli sieht ihn grinsen, fühlt sich aber bei dem Gedanken, behindert in einem ollen, wackligen Boot zu sitzen, überhaupt nicht wohl. »Wir werden sehen«, gibt sie betont entspannt zurück.
Wie geschickt er mit seinen Händen und seiner Kraft umgeht. Wie kontrolliert und vorsichtig er den entrümpelten und entstaubten Ruderkahn auf dem morschen Steg bewegt und ihn dann sanft ins Wasser gleiten lässt. Meli ist stolz auf ihren Mann. Sie beobachtet ihn, und als er sie bemerkt, winkt sie ihm freudig zu. In dem Moment, als er den Gruß erwidert, driftet das Boot weg. Tom erschrickt, schaut sich hektisch um, als ob er ein Hilfsmittel sucht, irgendwas, mit dem er den Kahn wieder einholen kann. Da entdeckt er einen langen, rostigen Bootshaken, der am Schuppen hängt. Schnell greift er ihn und erwischt den Kahn im letzten Augenblick. Als er ihn sicher am Steg befestigt hat, dreht er sich zu Meli und streckt beide Arme in die Höhe. Ich bin der Sieger. Ausgelassen johlt und applaudiert sie von oben, betrachtet dabei seine starken Oberarme, die aus den hochgekrempelten, karierten Hemdsärmeln emporragen.
Mit diesen Armen hatte er sie vor ein paar Tagen über die Schwelle dieses wunderschönen Hauses getragen. Er im schwarzen Anzug, sie im weißen schlichten Brautkleid. Nie hätte sie sich ihre Hochzeit so vorgestellt. Am wenigsten im weißen Brautkleid, dafür aber immer mit einer großen Gästeschar, mit einer kirchlichen Trauung, einer weißen Kutsche und einer großen Party in einem der exklusiven Schlosshotels rund um Frankfurt. Doch der Tag, es war Freitag, der 9. September 2016, begann mit der Entlassung aus der Reha. Der Chefarzt wünschte ihr alles Gute, die Schwesternschaft hielt sich zurück. Sie war wohl keine einfache Patientin gewesen. Mit Tom fuhr sie zum Standesamt, dort warteten schon ihre Eltern sowie Anne und Frau Germann. Die Trauung dauerte kaum länger als eine halbe Stunde. Unterschriften. Fotos vor dem Eingangsportal, dort wo noch die Rosenblätter der vorherigen Hochzeit lagen, dann der Abschied von den lieben Trauzeugen, denn Tom und sie wollten noch vor Sonnenuntergang in ihrem neuen Dornröschen-Domizil in Brandenburg sein. Meli tat es um ihre Eltern leid, die sicher gern diesen besonderen Tag mit ihrer Tochter verbracht hätten. Aber sie war so aufgeregt, so neugierig auf ihr neues Zuhause, auf ihr Haus am See. Sie kannte es nur von Bildern, Tom hatte es im Internet gefunden, sich angeschaut und alsbald den Kaufvertrag unterschrieben. Meli hatte das Geld bereitgestellt.
Die Autofahrt dauerte viele Stunden. Auf der A4 an Bad Hersfeld, Erfurt und Jena vorbei. Dann die vielbefahrene A9 Richtung Berlin mit den Abfahrten nach Leipzig und Potsdam. Städte, die sie von ihren Immobiliengeschäften kannte. Den westlichen Berliner Ring hatte sie allerdings in ihrem Leben noch nicht befahren. Sie schaute auf die Seen, die links und rechts vorbeizogen. Nahe Oranienburg ging es dann auf die B96, die Fernverkehrsstraße, die Berlin mit der Ostsee verband. Bei Fürstenberg bog Tom, der sich die ganze Zeit auf das Navigationssystem verlassen hatte, auf eine einsame Landstraße ab. Sie hatten die Norduckermärkische Seenlandschaft erreicht, die mit Lychen, der alten Flößerstadt, wie Meli auf einem Schild las, die letzte menschliche Siedlung auf ihrer Fahrt darstellte. Meli verspürte trotz des sehr komfortablen Pickups – auf der Ladefläche waren ihr Sport-Rollstuhl, eine Kingsize-Matratze und drei Leichtmetallkoffer verzurrt – mit jedem der letzten Kilometer immer mehr Schmerzen. Endlich bog Tom von der einsamen Landstraße auf einen unbefestigten Weg ab. Ihr Ziel kam immer näher, Frankfurt am Main, ihre Eltern und Anne lagen nun rund 650 Kilometer entfernt. Es ging durch dichten Laubwald, der von Nadelhölzern durchbrochen war. Plötzlich endete der grüne Tunnel, sie fuhren auf eine Lichtung und sahen in der nahen Ferne im späten Abendrot den See, an dem das Haus friedlich lag. Meli stockte der Atem. So viel Natur, so viel Himmel, so viel Ruhe. Tom lenkte den Wagen geschickt die Lichtung über einen Sandweg hinunter bis an ein Tor. Rasch sprang er aus dem Auto, schloss es auf, schob die beiden schweren Flügel zur Seite und fuhr Meli hinein.
»Willkommen auf unserem Schloss«, trötete er, als er sie aus der Beifahrerseite hob. Im Scheinwerferlicht des Wagens trug er sie auf Händen zum Haus. Ihre Arme um seinen Hals geschlungen, freute sie sich wie ein kleines Kind, das ein neues Spielzeug bekommt. Vor der Haustür hielt er inne und deutete ihr, sie möge in seine Sakkoinnentasche greifen. Umständlich kramte sie einen Schlüsselbund hervor, an dem ein roter Herzanhänger befestigt war.
»Dein neuer Schlüssel zum Glück«, hauchte er und küsste sie. Meli war im siebten Himmel. Leidenschaftlich erwiderte sie seinen Kuss, so lange, bis er unter ihrer Last zu stöhnen begann. Sie lachte, sperrte rasch die Tür auf und er machte einen großen Schritt hinein, ins neue Glück. Mitten im großen Wohnzimmer stand ein großer Strauß langstieliger roter Rosen. Frisch.
Meli staunte und Tom grinste überlegen: »Die ehemaligen Eigentümer waren so nett!« Dann setzte er sie sanft auf einen Stuhl. Meli betrachtete nun überwältigt die riesige Fensterfront, mit dem in abendliches Licht getauchten See dahinter. So eindrucksvoll hatten die Fotos nicht ausgesehen. Ihr Glück war in diesem Moment unendlich.
Nach einem ausführlichen Rundgang auf Toms Armen durch das Haus entfachte er ein kuscheliges Feuer im Kamin, breitete die große Matratze, mehrere Schaffelle und Kissen davor aus und legte Meli sanft darauf ab. Mit einem ordentlichen Knall entkorkte er eine Flasche Champagner. Eine wunderbare Hochzeitsnacht begann …
»Wir können!« Tom hockt neben Melis Rollstuhl und schaut sie an. »Träumst du?«
Mit einem Lächeln dreht sie sich nah zu ihm und nickt. »Ja! Von dir! Und von mir!«
»Bereit, in See zu stechen?«
Ihre Augen werden groß, sie ist hin- und hergerissen. »Aber ich kann nicht schwimmen, nicht mehr …!« Sie schaut auf das Boot, das keinen sicheren Eindruck macht.
Tom folgt ihrem Blick. »Die ganze Mühe umsonst?« Sein Ton klingt leicht beleidigt.
Sie nimmt seine Hand und streichelt sie. »Nein, nein. Ich weiß, dass du das für mich machst. Fahr du hinaus, hab Spaß und im nächsten Frühjahr kaufen wir ein richtig tolles Boot, mit dem wir zusammen rausfahren werden.«
»Allein hab ich auch keine Lust!«
»Ach, komm schon, du hast das Boot flottgemacht, also los. Ich werde hier sitzen und deinen Ausflug beobachten. Vielleicht nimmst du eine Angel mit und wir haben heute Abend einen Fisch in der Pfanne …«
Tom grinst. Diese Idee scheint ihm zu gefallen. Forsch steht er auf, dreht sich um und marschiert hinunter zu dem kleinen Bootsschuppen, in dem er die alte Angel gefunden hatte. Wenig später rudert er mit kräftigen Schlägen auf den See hinaus, zieht eine Runde und wirft dann die Angel aus. Meli winkt ihm aus der Ferne zu.
Kapitel Vier
Donnerstag, 15. September 2016
Nachts
Das Licht sticht ihr in die Augen. Sie blinzelt, dreht ihren Kopf weg. Angestrengt aufrecht steht sie in ihrem neuen Kleid an der Bar und nippt an einem Batida de Maracuja de Limao. Der Cocktail ist zu süß und das wahrscheinlich bloß, um den harten Cachaça zu überdecken.
Meli fühlt sich nicht wohl so allein. Doch es war ihr Wunsch. Solo in einen Club, nicht immer die zunehmend langweiliger werdenden Partys mit den immer gleichen Freunden in den immer gleichen Schicki-Micki-Bars. Sie entlastet eines ihrer schlanken Beine, deren Füße in Stilettos stecken. Es ist sehr wichtig, bei Ausgehschuhen nicht zu sparen. Sie verleihen einem Eleganz und Selbstsicherheit. So riet ihr Anne zum Kauf dieser sündhaft teuren und unendlich hohen Stiefeletten mit dem goldenen Nietendekor. Nie zuvor hatte sie solche Absätze getragen. Meli spürt kurz an sich hinunter. Anstatt Selbstsicherheit sind hier eher Fußschmerzen im Preis inklusive. Aber die Jungs sind ganz heiß auf sexy Heels, meinte Anne auch noch, als Meli die Dinger längst bezahlt hatte.
Meli schaut sich um, checkt dezent die männlichen Clubgäste. Gut gebaute Studenten verprassen feierhungrig Papas üppigen Unterhalt, und Jungunternehmer in Designeranzügen tanzen zu den südamerikanischen Rhythmen im Sinnesrausch ihres frischen Erfolges. Daneben zappeln braungebrannte Daddys, die mit Polo Ralph Lauren und Rolex die engsten Beziehungen ihres Lebens eingegangen sind. Melis Augen suchen weiter im bunten und angeschwitzten Menschengewühl. Warum ist es nur so schwer, den richtigen Mann zu finden? Meli ist müde. Müde vom Suchen und müde vom Stehen.
Plötzlich dringt ein sanftes »Hallo« an ihr Ohr. Sie dreht sich langsam und schaut in das Gesicht eines dunkelhaarigen Mannes. Der lächelt keck, seine Augen strahlen in einem funkelnden Blau und Meli ist sofort angetan.
»Hallo, Frau van Bergen!«
Der hübsche Kerl mit der sonoren Stimme berührt mit seiner Hand ihre Schulter. Es kribbelt. Wow, der ist ja mutig. Nur weiter so. Da erst fällt ihr auf, dass der furchtlose Fremde ihren Namen nannte. Woher kennt er mich? Ist das ein Geschäftspartner? Ein Kunde? Oder jemand aus dem edlen Fitnesstempel, in dem sich die Körperbewussten aus Frankfurt zwischen den neuesten Hochleistungsgeräten ein verschwitzt-durchtrainiertes »Hi« zuwerfen? Aber wer, außer den Angestellten dort, kennt meinen Namen?
»Hallo, hören Sie mich?«
Ja, na klar, ich kann dich hören, du mein Prinz. Wo warst du? Ich habe so lange nach dir gesucht.
Meli schaltet auf Flirtmodus, wendet sich ganz ihrem Gegenüber zu und lächelt charmant, doch sein Gesicht wird unscharf. Alles verschwimmt auf einmal so merkwürdig. Was ist los? Sie wendet ihren Blick in eine andere Richtung und muss nun die Augen zukneifen. Sie blinzelt in eine kalte und aufdringliche Neonleuchte, die nicht zu der exklusiven Lichtanlage zu passen scheint, die normalerweise im angesagtesten Club Frankfurts ihre verführerische Stimmung verströmt.
Meli öffnet ihre Augen einen winzigen Spalt mehr. In ihrem trüb-verwaschenen Sichtspektrum erkennt sie eine junge Frau, die nicht gerade nach rauschender Partynacht aussieht. Sie ist ungeschminkt, mit leichten Augenringen. Die strähnigen Haare sind zu einem Zopf gebunden und sie trägt einen schlichten Anzug aus purem Blau. Was für eine merkwürdige Person, denkt Meli und will sich abwenden. Doch die fremde Frau bleibt vor ihr, neigt sich sogar noch weiter in ihre Richtung. Was will sie von mir? Nun erst erkennt Meli, dass sie liegt. In einem Bett. Ein unbequemes Bett mit stählerner Einfassung an Kopf- und Fußende und harter Bettwäsche, die, ja, die nach Desinfektionsmittel riecht. Sie fühlt sich wie aufgebahrt. Und hinter ihr piept irgendetwas die ganze Zeit. Dann bemerkt sie die Kabel und Schläuche, an die sie angeschlossen ist, und die vielen technischen Gerätschaften an ihrem Bett.
»Wo bin ich?«, stößt sie, eingezwängt zwischen Traum und Realität, kraftlos hervor.
»Im Aufwachraum.«
»Wo?« Der Begriff »Aufwachraum« sagt Meli in diesem Moment überhaupt nichts.
»Im Aufwachraum der Unfallklinik«, gibt der blaue Kittel sanftmütig zurück. Und ergänzt: »Auf der Intensiv!«
Intensiv … Intensivstation? Das sagt Meli etwas. Sie hebt schwerfällig den Kopf um einige Zentimeter und starrt auf die blaue Gestalt.
»Was …?« Für mehr Fragen reicht ihre Kraft nicht.
»Frau van Bergen, können Sie Ihre Zehen spüren?«
Die Frau in Blau wartet auf eine Antwort, während gerade ein weiterer Patient in den Aufwachraum geschoben wird. Meli schaut ungläubig auf den einschwebenden Schlafenden und kann die Frage nach ihren Zehen nicht begreifen. Alles ist wie benebelt. Kraftlos lässt sie ihren Kopf in das klumpige Kissen sinken, schließt die Augen und lässt alles los.
»Hallo? Sind Sie bei mir?«
Die Schwester erhält keine Antwort.
»Okay, ich bringe Sie später in ein Zweibettzimmer, ja?«
Ja, ja, sehr gern, bringen Sie, bringen Sie … bringen Sie mir noch einen, aber bitte etwas ohne Alkohol. Nicht noch mal diesen Batida-de-Maracu-irgendwas, ja? Denn den süßen Poltergeist sollte ich lieber sein lassen. Macht nur blöde Albträume.
Meli spürt ihre Zehen sehr gut. Überhaupt spürt sie ihren ganzen Körper sehr gut. Die Bässe der Musik wummern in ihrem Magen und die Rhythmen prickeln in den Haarwurzeln. Sie steht auf der Tanzfläche und bewegt sich ausgelassen zwischen den extrovertierten Partygästen. Ein Gemisch aus edlem Parfüm und frischem Schweiß umgibt sie. Erneut lässt sie ihren Blick streifen, sie sucht, hat ihn nicht vergessen, diesen stahlblauen Blick des dunkelhaarigen Verführers. Wo ist er? Ein Rolex-Daddy mit errötetem Kopf tanzt sie offensiv an, doch Meli lächelt eine eindeutige Ablehnung. Nein, diese Nacht gehört mir. Und ihm, dem Prinzen, wenn er noch da ist. Vielleicht auch nur mir ganz allein. Ob ich den Mann wiedersehe? Egal, jetzt wird gefeiert.
Meli bewegt sich grazil, sie weiß ihren Körper einzusetzen, den Takt der Musik in wohlchoreografierte Schwingungen umzuwandeln. Auf ihren durchtrainierten Körper ist sie sehr stolz. In Grooves versunken hebt sie ihre Arme, schließt die Augen und greift nach den Sternen. Vergessen die schmerzenden Füße, vergessen die Suche, einfach nur das Dasein spüren.
Als sie die Augen wieder öffnet, steht er vor ihr, der Traumtyp von vorhin. Er hat mich gesucht. Er hat mich gefunden, wie süß. Gut sieht er aus. So durchtrainiert, mit so einem sanften Lächeln. Meli lächelt zurück, ein unerschöpfliches, nie enden wollendes Lächeln.
Doch plötzlich stehen ihr, hinter dem Traum von einem Mann, einige weitere Menschen gegenüber und schauen sie an. Menschen, die reglos sind. Menschen in Blau. Schon wieder diese komische Farbe. Auch ihr Traummann trägt nun ein blaues Gewand. Alle seine Prinzenattribute sind schlagartig verschwunden. Er lächelt nicht mehr, seine Haare sind lichter, seine Stirn höher und seine Gesichtsfalten tiefer. Er trägt eine Brille und wirkt mit seiner Clique richtig bedrohlich. Was will er, was will diese Sekte von mir? Wer lässt denn nur solche Spinner hier rein? Und warum sehen die mich alle so besorgt an?
Wie Bowlingkegel stehen die blau Gekleideten aufgereiht. Der Älteste, mein gerade vergangener Traummann, im Vordergrund, dahinter in zweiter und dritter Reihe jüngere und, so scheint es, unwichtigere Gestalten. Ganz hinten, hinter einer getönten Scheibe mit Jalousie, erkennt Meli ihre Eltern. Ein Gefühl der Wärme durchdringt sie. Doch nur kurz. Wie? Meine alten Herrschaften? In einem Nachtclub? Sie, die abends immer nur vor dem Fernseher – Volksmusik hier, Krimi da – sind hier? Das ist ja … toll!
Sie hebt ein wenig den Kopf, um sie besser zu sehen. Meli spürt einen wohligen Hauch Geborgenheit, lächelt jedoch irritiert, da ihre Eltern ein bekümmertes Gesicht machen. Was ist denn bloß los hier? Sie hebt leicht die Hand und versucht zu winken.
»Hallo! Frau van Bergen, mein Name ist Professor Doktor Schneider«, fängt der vorderste blaue Bowlingkegel überlaut an zu sprechen. Seine knarrende Stimme klingt reifer als die des Prinzen und dröhnt in Melis Kopf, als ob eine Planierraupe mitten durch fährt.
»Sie hatten einen schweren Unfall.«





























