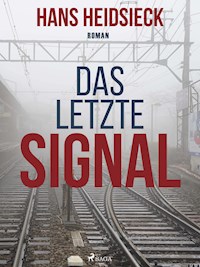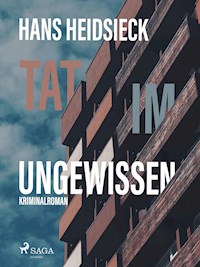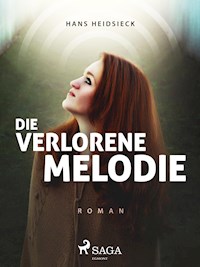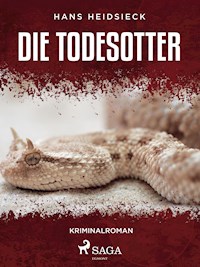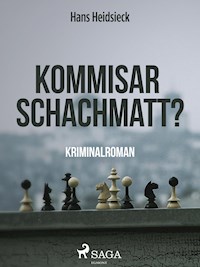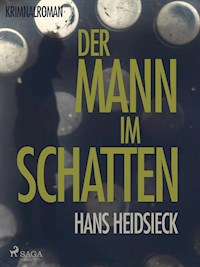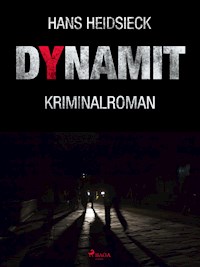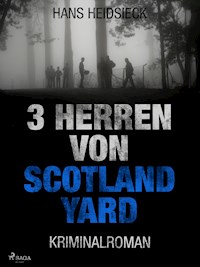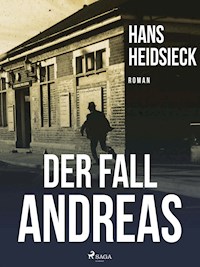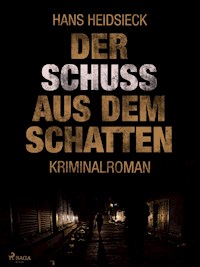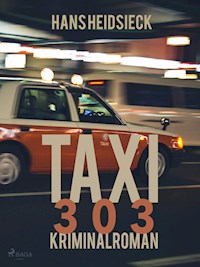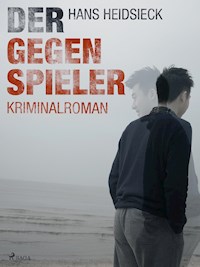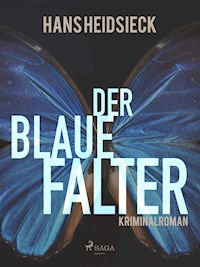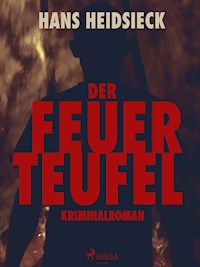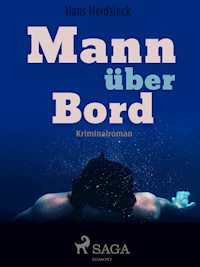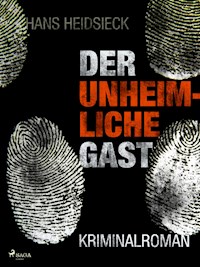
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Gutsherr Aldergast bekommt gegen 21 Uhr am Abend Besuch von einem Herrn, der vorgibt, in einer wichtigen Familienangelegenheit mit dem Hausherrn sprechen zu müssen, obwohl die Familie des Gutsherrn, einschließlich der Kinder Dr. Manfred und Beate Aldergast, vorhat, an diesem Abend zu einer Tanzveranstaltung ins nahe Grünberg zu fahren. Aldergast verspricht nachzukommen, doch von Stund an bleibt er verschwunden. Die Tochter Beate, die den Gast als Einzige gesehen hat, wird von der Kriminalpolizei befragt. Doch sie kann lediglich sagen: dunkelhaariger, hagerer Gast und man hat einen braunen Wagen gesehen. Nach einer weiteren Woche wird im Hotel in Destedt ein Hotelzimmer geöffnet, denn man hat den Gutsherrn Aldergast erkannt – doch sein Zimmer ist leer. Im zweiten Einzelzimmer, das eine junge Frau in seiner Begleitung gemietet hat, findet man zwei Personen am Tisch – beide mit Kopfschuss getötet. Der Mann ist Aldergast – doch wer ist die Frau? Es gibt bald zwei weitere Leichen, Die Polizei arbeitet fieberhaft, man sucht nach dem hageren Mörder. Vier Leichen, die nichts miteinander zu tun haben – so meint die Kriminalpolizei, doch ein Privatdetektiv liefert schließlich die brillante Lösung.-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 199
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hans Heidsieck
Der unheimliche Gast
Saga
Der unheimliche Gast
© 1933 Hans Heidsieck
Alle Rechte der Ebookausgabe: © 2016 SAGA Egmont, an imprint of Lindhardt og Ringhof A/S Copenhagen
All rights reserved
ISBN: 9788711508435
1. Ebook-Auflage, 2016
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für andere als persönliche Nutzung ist nur nach Absprache mit Lindhardt und Ringhof und Autors nicht gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com – a part of Egmont, www.egmont.com
Otto, der Diener, kommt, bringt auf silbernem Teller eine Besuchskarte, reicht sie dem gnädigen Herrn.
„In einer dringenden Angelegenheit!“ fügt er hinzu.
Frau Rita Aldergast blickt ihren Gatten befremdet an. Jetzt — gegen neun Uhr des Abends — ein Gast noch? Ein Gast, der sich durch eine Karte anmelden läßt?
Der Gutsherr erhebt sich, kommt auf sie zu und küßt ihr die Stirn. Die Gäste blicken verwundert auf.
„Entschuldige, meine Liebe!“ sagt Aldergast. „Entschuldigen Sie einen Augenblick, meine Herrschaften!“
Damit ist er verschwunden.
Man schaut sich betreten an. Es ist etwas geschehen, was ganz und gar urplötzlich aus dem Rahmen des Aldergastschen Lebens herausfällt. Seltsam — sehr seltsam! Es springen gleich Fragen auf, dringende, zwingende Fragen:
Wer hat sich da melden lassen? Warum ließ Aldergast diesen Besucher nicht bitten, auch auf die Terrasse zu kommen? Was hat er Geheimnisvolles? Warum wurde er plötzlich so aufgeregt, als er die Karte gelesen hatte?
Man sitzt ein wenig befangen um die Bowle herum: Frau Rita Aldergast, Beate, die Tochter, Manfred, der Sohn, und die Gäste, Familie Grevenbruch. Mann, Frau und Tochter, — gute, liebwerte Nachbarn, die ebenfalls große Besitztümer hatten und öfter des Abends herüber kamen.
Draußen ist Frühling: sprießender, blühender, lachender Frühling. Um das Bassin herum, gleich vorn im großen Park schaukeln flackernde Lampions. Blütenduft weht angenehm, anheimelnd, berauschend auf die Terrasse zu. Dort — die Mandelbäumchen tun schon ihr Bestes. Überall leuchtet es, rosa und weiß. Das letzte Abendrot zuckt am Himmel.
Aldergast, Manfred, Grevenbruch und Frau Kitty Grevenbruch hatten Skat gespielt, während die anderen sich unterhielten. Nun ist alles auseinandergerissen. Frau Rita springt für den Gatten ein; aber das Spiel geht gewissermaßen nur erzwungen weiter.
Beate Aldergast schreitet mit ihrer Freundin Brigitte Grevenbruch langsam die Stufen der Terrasse zum Park hinunter. Arm in Arm, nach Art junger Mädchen, die gern etwas zu schwärmen pflegen.
„Sag’ mal, Beatchen, — wer mag das nur sein — der Herr, der Deinen Pa noch besuchen kommt zu so — — sagen wir’s offen: inoffizieller, ungelegener Stunde?“
Beate schüttelte den welligen Blondkopf und zuckt die Achseln. „Ich weiß es wahrhaftig nicht! In der letzten Zeit ist er manchmal ganz sonderbar —“
„Wer?“
„Na — mein Vater! Irgendetwas scheint ihn zu quälen, ihm jedenfalls Gedanken zu machen. Manchmal schaut er mich lange an — weißt Du, so — — so sinnend, als wolle er mir etwas sagen, — mich etwas fragen — ich weiß es nicht!“
Brigitte schlurft mit dem Fuß auf dem Kiesweg. Ein Grübchen spielt bei ihr auf der linken Wange. Sie tippt an einen der Lampions. „Höre mal — was sollte Dein Vater denn haben? Er ist doch der ruhigste, liebste und glücklichste Mensch von der Welt, meine ich! So ein Familienleben, wie Ihr es führt — da könnten sich meine Eltern noch ein Beispiel daran nehmen!“
Beate zeigt lachend die schönen Zähne: „So — meinst Du? Sind Deine Eltern etwa nicht glücklich?“
„Nun — wie man’s nimmt. So mit Kitt und Kleister — verstehst Du —?“
„Nein, — das verstehe ich wirklich nicht!“
„Na — sagen wir: mit dem Kitt der Gewohnheit und dem Kleister einer gewissen Duldsamkeit und bequemen Lebensauffassung.“
„So — das — — allerdings — bei meinen Eltern gibt es so etwas nicht. Da herrscht Harmonie, auch von innen her!“
Brigitte hat einen kleinen Blütenzweig abgerissen, mit dem sie spielt.
„Siehst Du — darin sind Deine Eltern mir immer ein Vorbild gewesen. Bei Euch herrscht stets Frieden, das wahre Glück und das große, unbedingte Vertrauen. Dein Papa ist die Ruhe, die Güte selbst. Ich könnte mir niemals bei ihm etwas Schlechtes denken.“
„Da kann ich Dir allerdings nicht widersprechen. Ich liebe ihn abgöttisch. Vielleicht ist es unrecht, wenn ich es sage, Gittchen, aber an ihm — — an ihm hänge ich mehr als an der Mutter.“
„Das glaube ich Dir, Beate. Obwohl ich auch gegen Deine Mutter nichts sagen kann. Aber bei ihm — bei Deinem Pachen, meine ich, da kommt alles so richtig von innen heraus, so vom Herzen — ich habe ihn eigentlich noch niemals bei schlechter Laune gesehen. Immer hat er einen harmlosen Scherz, eine frische Bemerkung. Wie habe ich oft lachen müssen! Und Du — weißt Du — — gerade deshalb fiel es mir auf, wie er vorhin auf einmal so ernst und nachdenklich wurde, als Otto ihm die Karte brachte. So — gänzlich — — anders!“
„Das ist mir auch aufgefallen. Es beunruhigt mich. Überhaupt — dieser Fremde — — warum muß uns der bei dem friedlichen Zusammensein stören!“
„Wir wollten doch noch alle nach Grünberg zur Tanzunterhaltung des Sportklubs! Ob daraus nun noch etwas werden wird?“
„Wer weiß! — Horch, mein Muttchen ruft eben!“
Beide eilten zur Terrasse zurück.
„Höre mal, Beatchen!“ bemerkt Frau Rita und streicht ihrer Tochter dabei über das wellige Blondhaar, „Du könntest eigentlich einmal schauen, ob Vater noch lange mit dem Fremden zu tun hat. Sei aber leise und vorsichtig. Erinnere ihn daran, daß wir noch zu dem Sportfest wollten — — natürlich mußt Du Dich wegen der Störung entschuldigen.“
„Ja, Muttchen — ich gehe sofort!“
Sie eilt durch das große Vestibül ins Innere des Schlosses. Klopft vorsichtig beim Zimmer des Vaters an.
„Herrrrein!“ ertönt es etwas erregt von innen. „Ach — Du, mein Kind?“
„Ja, Pachen — wir wollten doch noch — —“
„Richtig, mein Kind — — aber — höre, sage der Mutter, sie möge mit Euch und- Grevenbruchs schon vorausfahren. Ich komme nach, sobald ich hier fertig bin. Schickt nur den Wagen gleich wieder hierher zurück!“
„Entschuldigen Sie bitte die Störung!“ bemerkt Beate, zu dem Fremden gewendet; dann wieder zum Vater: „Gut, Pachen — wir werden also vorausfahren. Auf Wiedersehen!“
„Auf Wiedersehen, mein Liebling!“
Die Fahrt bis Grünberg ist gar nicht weit. Nach zwanzig Minuten bereits ist man dort. Grevenbruchs fahren in ihrem Wagen voraus. Aldergasts hinterher; aber Manfred, am Steuer sitzend, läßt es sich nicht nehmen, einen kleinen Wettfahrtversuch heraufzubeschwören. Er weiß, daß bei dem anderen Wagen Brigitte die Führung hat. Der möchte er imponieren.
Minutenlang sausen die beiden ungefähr gleich starken Autos auf der Landstraße neben einander her. Endlich kommt Manfred vor. Aber Brigitte fährt auch sehr wacker.
Die anderen Insassen kreischen zum Teil vor Angst, zum Teil vor Vergnügen.
Vor dem Gesellschaftshaus in Grünberg wird halt gemacht. Fliederduft — Musik — Lampions — tanzende Paare. Gartenfest.
„Phänomenal!“ meint Manfred, der seiner Mutter behilflich ist, aus dem Wagen zu steigen.
Den Chauffeur, der neben ihm saß, schickt er zurück, um den Vater zu holen.
Nun mischt man sich unter die anderen Gäste des Festes. Begrüßungen allerseits, teils wirklich herzlich, teils förmlich-steif. Im allgemeinen hat man viele Bekannte hier, da auf dem Lande die Menschen sich enger zusammenschließen als in der Stadt.
Brigitte hat sich sehr bald von den anderen abgesondert. Sie ist nicht mehr zu halten, nachdem sie der junge, blonde Referendar Max Alsen zum Tanze gebeten hat. Lächelnd schaut ihr Beate nach. Der steckt auch schon der Frühling in allen Gliedern!
Ja — der Frühling!
Freude, Lebenslust leuchtet aus allen Augen. Der Mond blinzelt schelmisch über die Büsche — er ist halt neugierig, und böse kann ihm hier niemand sein. Selbst dem Blasorchester ist man nicht böse, obwohl sein Pusten mehr falsche als reine Töne zutage fördert.
Alles ist ziemlich ländlich und primitiv. Aber gerade deshalb vielleicht so traulich, so schön und gleichsam so familiär.
Nur Manfred steht etwas traurig abseits. Er sieht Brigitte mit dem Referendar tanzen. Das paßt ihm nicht.
Herr und Frau Grevenbruch mit Frau Rita zusammen suchen zunächst einen Tisch, an dem sie Platz nehmen können. Da findet sich eine Ecke in einer Laube. Von hier aus kann man das ganze Fest übersehen.
Der Vorsitzende des Sportklubs, ein Arzt in den Vierzigern, kommt, um die späten Gäste herzlich willkommen zu heißen.
Beate hat sich mit an den Tisch gesetzt, während ihr Bruder Manfred die Tombola erst besichtigen muß. Sie blickt verträumt in den flimmernden Glanz der im Bogenlicht tanzenden Paare; als suche sie etwas. Ihr Herz schlägt hoch in Erwartung und Freude. Aber sie darf es nicht merken lassen. Sie hat ihr Geheimnis; glaubt es zu haben. Eigentlich ist es eine ganz böse Sache, muß es wenigstens — müßte es wenigstens sein in den Augen der Eltern; denn der, den sie schon lange liebte, war nicht ihres Standes, obwohl er der Sohn jenes Arztes ist, der eben noch allen die Hand gedrückt hatte. Jedenfalls spekulierte die Mutter für sie auf einen hochgestellten Beamten oder gar auch einen Gutsherrn.
Mit Hellmut Unger war das so eine eigene Sache. Obwohl er es zehnmal konnte, so hatte er doch keine Lust zu studieren. Er liebte nur die Natur; es zog ihn von je zu den Blumen, zum Garten und in den Sonnenschein. Gärtner wollte er werden, ein ganz einfacher Gärtner. Nach einem Studium stand ihm der Kopf nicht. Er bat den Vater, es ihm zu erlauben, er flehte — lag vor ihm auf den Knien. Niemals wird Beate vergessen, wie er ihr das erzählte, und wie das Leuchten in seine Augen kam, als er berichtete, wie der Vater schließlich gesagt hatte: Gut — magst du nach deinen Anlagen glücklich werden!
Das war groß von dem Vater, der seine Wünsche hinter die des Sohnes zurückstellen konnte. Und sie — — sie fühlte sich nun einmal mit unwiderstehlicher Gewalt dem Banne ihres Gärtners verfallen.
Jetzt blitzt es in ihren Augen: da ist er — hat sie erspäht, — kommt an den Tisch, bittet um einen Tanz.
Frau Aldergast runzelt die Stirn. Schon lange ahnte sie etwas. Jetzt hat sie Gewißheit. Um ihre fein geschwungenen Lippen zuckt es bedeutungsvoll.
Sich zu Frau Grevenbruch wendend, bemerkt sie: „Kennen Sie diesen jungen Mann?“
„Aber gewiß doch — — Ungers Sohn — man nennt ihn hier nur den ‚Gärtner‘.“
„Haben Sie nicht bemerkt, wie Beate — — mein Gott — — wären wir doch nicht hierher gefahren!“
„Ich bitte Sie, beste Freundin — er stammt doch schließlich aus guter Familie!“
„Nein, nein — — so etwas würde ich niemals dulden! — Der junge Mann ist ein Sonderling. Hätte zehnmal studieren und etwas Besseres werden können. Hingegen — Gärtner! —“ Ein unangenehmer Zug umspielt die Lippen der sonst noch recht hübschen Frau. „Das muß ich ihr auszutreiben versuchen.“
„Versuchen — jawohl. Dabei wird es auch bleiben!“
Grevenbruch mischt sich ein: „Ja, das fürchte ich auch, beste Frau Aldergast! Jugend läßt sich in Dingen des Herzens nur schwer beraten. Wir sind ja auch einmal jung gewesen. Und wenn Sie bitte bedenken wollen — — soviel mir Marcel einmal erzählte — — — Sie stammen selbst aus einer einfachen Kaufmannsfamilie — — —“
Frau Aldergast zuckt unwillkürlich zusammen. Das war ein Hieb!
„Aber — aber —“ sie stottert ein wenig — „ich meine es doch wirklich nur gut mit dem Kinde! Bei dieser Erziehung, die sie genossen hat — Sie wissen: Beate besuchte ein erstklassiges Pensionat in der Schweiz. Und das alles, um später Kohl und Rüben bauen zu helfen — —?“
„Ich glaube, Verehrteste, Sie haben einen ganz falschen Begriff von dem Beruf eines Gärtners!“
„Sind Sie einmal einer gewesen —?“
„Haha — durchaus nicht!“
„Dann können Sie auch nicht mitreden, lieber Freund! — Aber lassen wir jetzt dieses unerquickliche Thema. — — Marcel könnte übrigens wirklich nun endlich kommen! — Wo bleibt er denn nur!?“
„Der fremde Gast wird ihn noch immer in Anspruch nehmen.“
„Ich verstehe das nicht — — dieser Gast — — mir — — mir kommt die ganze Geschichte so unheimlich vor!! Warum sagte er nicht, wer es war? Er sagt mir doch sonst immer alles!“
„Ja — das mögen die Götter wissen! — Na — — er wird schon noch kommen.“
Es ist zwei Uhr nachts. Aldergast war nicht mehr gekommen. Von Stunde zu Stunde hatte man noch gehofft, daß er plötzlich auftauchen werde. Es war eine Täuschung. Frau Rita wird ungeduldig. Sie drängt zur Heimkehr. Um zwei Uhr dreißig kommt man zuhause an. Otto, der Diener, steht in der Tür.
„Wo ist denn Papa?“ fragt Beate.
Der Diener hebt, offensichtlich beklommen, die Schultern hoch: „Der gnädige Herr ist mit dem Fremden davongefahren; in dessen Auto.“
Frau Rita ist außer sich: „Was? — Ist — davongefahren?“ Sie stürzt ins Schloß. In das Arbeitszimmer des Gatten. Da — auf dem Schreibtisch — da liegt ein Zettel:
Liebste — ich muß in einer dringenden Sache zur Hauptstadt, bin aber spätestens morgen abend zurück.
Dein Marcel.
Frau Rita muß sich auf den Tisch stützen. Beate und Manfred stehen dicht hinter ihr. Auch sie sind betroffen. Aber sie suchen die Mutter zu trösten, sie zu beruhigen.
„Es muß halt etwas ganz Dringendes sein!“ meint Manfred und kneift dabei, wie um sich selbst zu beruhigen, ein wenig die Augen zusammen.
Beate empfiehlt sich bald und geht auf ihr Zimmer.
In allen aber spukt es noch während der Nacht: Was mochte der Vater nur haben? Er lebte doch in den besten, geregelten Verhältnissen. Also! —?
Wer war nur dieser unheimliche Gast, der ihn veranlaßt hatte, alle Gewohnheit über den Haufen zu werfen?
Es quält, es martert, wenn man solcherlei zu bedenken hat. — —
Manfred findet am schwierigsten seinen Schlaf. Er muß auch noch an Brigitte denken. Seine Erinnerung ankert sich an das Fest an. Warum erwiderte sie seine Liebe nicht? Was hätte sie an diesem dreimal + + + Referendar für einen Narren gefressen?
In einigen Tagen mußte Manfred zur Stadt zurück. Und mußte dann dulden, daß sie am Ende ganz diesem — — diesem albernen Grasaffen ins Netz ging!
Das ganze Leben war eine Lumperei — — eine Gemeinheit!
Er nimmt drei Schlaftabletten, — hat daraufhin Herzklopfen — schläft aber endlich, als schon das helle Morgenlicht durch die Scheiben schimmert, mit schwerem Kopfe ein. — — —
Am Morgen ist Aldergast noch nicht da. Frau Rita läuft wie ein Gespenst im Schloß umher.
Dann läßt sie den Diener kommen.
„Wer war der Herr eigentlich, der sich bei meinem Mann gestern melden ließ?“
Otto bedauert. Er weiß es nicht; hat den Namen in seinem Gedächtnis nicht registriert.
„Na — und die Karte — wo ist die denn?“
„Die hat der gnädige Herr in der Hand zerknüllt und in den Kamin geworfen.“
„In den Kamin?“
„Jawohl, gnädige Frau, — wo sie verbrannt ist.“
„Glauben Sie — — glauben Sie, Otto, daß er dies mit — mit Absicht getan hat?“
„Es sah ganz so aus, gnädige Frau!“
Frau Rita ist es, als krampfe sich ihr das Herz zusammen.
Geheimnisse? Niemals hatte der Gatte ihr bis auf den heutigen Tag auch nur das Geringste verschwiegen!
„Gut!“ sagt sie zum Diener. „Danke — Sie können gehen!“
Der Klang ihrer Stimme ist hart, metallen. Otto hat aufgehorcht. Aber es ziemt ihm nicht, eigene Gedanken zu haben. So konzentriert er sich rasch auf den Hasen, der für das Mittagessen gespickt wird.
Frau Rita trifft Beate auf der Veranda. „Du hast doch den Fremden gesehen, mein Kind! — Wie sah er aus?“
„Muttchen, er — er drehte mir den Rücken zu, als ich eintrat. Schließlich sah ich doch wenigstens sein Profil. Er hat so etwas — etwas Dämonisches, meine ich!“
„War er groß — klein — blond — schwarz? — Kannst Du ihn gar nicht beschreiben?“
„Nein, Muttchen. — Das Zwielicht störte mich. Weißt Du — Vater hatte die kleine Tischlampe angezündet: aber, so viel ich sah, war er groß, hager, sehr dunkel — —“
„Groß und hager — und dunkel, hm. — Wenn man doch nur einen Anhalt hätte!“
„Mamachen — Papa hat doch aufgeschrieben, daß er spätestens heute abend wieder zurück sei!“
„Das schon — aber — — aber — — das kommt mir alles so — so — — sonderbar, so unheimlich vor! Du weißt doch, Kind, niemals hatte er ein Geheimnis. Und nun auf einmal! Warum schreibt er kein Wort davon, wer und was ihn hinweggeführt hat? Eine ‚dringende Sache‘! Was heißt das? Ich wüßte nicht, was er Dringendes zu erledigen hätte. Und wenn schon — warum sagt er es mir denn nicht?“
„Mamachen — Du sollst Dich nicht aufregen! Komm, frühstücken wir erst einmal!“
Der Tisch ist gedeckt. Otto hat bereits alles herbeigebracht.
„Ist der junge Herr noch nicht da?“ fragt Frau Aldergast.
„Er wird sofort kommen, gnädige Frau!“
„Er dürfte ruhig etwas pünktlicher sein! Aber — na — er macht Ferien. Ich will nichts sagen!“
Endlich kommt Manfred, noch reichlich verschlafen, unmutig gähnend, im weißen Tennisanzug auf die Terrasse.
„’n Morgen, Muttchen!“ (Ein Kuß auf die Stirn.) „’n Morgen, Schwesterchen!“ (Ebenso.) „Na — gut geschlafen?“
„Ich habe kein Auge zumachen können“ erwidert Frau Aldergast „wegen Vater. Er ist ja noch nicht zurückgekommen!“
„Ja, ja. Ich hörte schon. Aber um ihn brauchen wir uns wohl am wenigsten Sorge zu machen. Er, die Gewissenhaftigkeit, die Korrektheit selbst — —“
„Ja — gerade darum — —“
„Aber ich bitte Dich, Mamachen!“ fällt wieder Beate ein. „Er hat vielleicht ein großes Geschäft vor!“
„Papa braucht kein Geschäft mehr zu machen. Außerdem wüßte ich das schon längst.“
„Übrigens, Muttchen, Du wolltest uns doch schon lange einmal die Geschichte erzählen,“ meint Manfred, um abzulenken, „wie das seinerzeit mit der Erbschaft war — weißt Du — ich kenne das alles bis heute nur andeutungsweise.“
„Kinder — das greift ja bis vor den Krieg zurück. Wenn ich bedenke — die Zeiten — die Zeiten!“
„Aber erzähle uns doch einmal ausführlich!“ bemerkt Beate. „Wie wir so lange getrennt von einander zu leben gezwungen waren — ich weiß noch —“
Frau Aldergast hat sich erhoben. „Na — schön — dann kommt mal mit mir in den Park hinunter — zum Weiher da drüben! Im kleinen Marmortempel läßt es sich am schönsten plaudern; da habt Ihr mir öfter zugehört, als Ihr noch klein ward.“
Freudig nehmen die beiden den Vorschlag an. Manfred hakt links bei der Mutter ein, Beate auf der anderen Seite. So geht es dem Tempel zu.
Bilder aus der Vergangenheit steigen auf. —
Ein junger Mann kommt in den Kaufmannsladen von Vanselow. Herr Vanselow handelt mit allem, was irgendeinen Nutzen abzuwerfen geeignet ist. Sein ‚Kaufhaus‘ ist das Kaufhaus des Städtchens.
Der junge Mann verlangt eine Seidenkrawatte. Vanselows Tochter bedient ihn. Sie nimmt gleich ein ganzes Dutzend länglicher Kästen aus einem Wandschrank und legt sie dem Fremden vor.
Ja — es war zweifelsohne ein Fremder: denn hier im Städtchen kannte man jedermann. Übrigens sah dieser Jüngling recht nett aus! Es kann nicht vermieden werden, daß ihre Blicke einander begegnen, und daß sie bereits im ersten Augenblick an einander Gefallen finden.
Der junge Mann wurde gesprächig.
„Fräulein — sagen Sie mal — wie steht es in dieser Stadt denn eigentlich mit der Mode?“
Sie blickt ihn verlegen an. „Ach — die Mode? Hier trägt man alles. Es wird nicht gar so genau genommen!“
Es entsteht eine Pause, während der er sich etwas ansieht. „Was meinen Sie,“ fragt er nach langem Suchen, wobei er sie immer wieder fixiert hat, „ob mir das Grün hier steht?“
„Oh“ erwidert sie geistvoll „grün kleidet immer!“
Er lächelt ein wenig und entscheidet sich dann für die grüne Krawatte.
„Sagen Sie mal,“ wagt er endlich zu fragen „kann man sich nicht einmal wiedersehen?“
Dabei blickt er ihr wieder tief in die Augen. Mit zitternden Fingern macht sie die Kästen zu. „Nein — leider — heimlich, das geht nicht. Das kann ich nicht machen. Da muß schon der Zufall spielen.“
Er macht ein vergnügtes Gesicht: „Na — dem will ich schon nachzuhelfen versuchen. Leben Sie wohl für heute, mein schönes Fräulein! Nur Ihren Namen noch, wenn ich bitten darf!?“
„Müssen Sie den denn unbedingt wissen? Na — meinetwegen: ich heiße Rita.“
„Ah — ein aparter Name!“
„Na — und der Ihrige?“
„Marcel Aldergast. Wohlbestallter Stadtschreiber im hiesigen Nestchen.“
„Na — dann auf Wiedersehen, Herr Stadtschreiber!“
„Auf Wiedersehen, Fräulein Rita!“ — — —
Frau Aldergast hält in ihrer Erzählung inne, versunken und traumverloren, in der Erinnerung schwelgend.
„So hast Du also den Vater kennen gelernt!“ meint Beate, der Mutter freundlich die Hände drükkend. „O — Du — — das muß himmlisch gewesen sein!“
„Na — nun erzähle mal weiter!“ meint Manfred. „Wie hat sich das denn in der Folgezeit so gegeben?“
„Ihr dürft mich nicht unterbrechen, Kinder! Hört also weiter zu!“ —
„Einige Tage später, auf einem Wohltätigkeitsfest, hat man Gelegenheit, sich nun auch offiziell kennen zu lernen. Der alte Vanselow war ein angesehener Bürger des Städtchens. Auch ihm gefällt der neue Stadtsekretär — er hat ihn sofort für seine Tochter aufs Korn genommen.
Aldergast wird also in die Familie eingeführt. Er hat gute Manieren, findet auch Gnade vor den Augen Frau Vanselows, kurz: es bandelt sich etwas Ernstliches an zwischen Fräulein Rita und Aldergast. Aber in allen Ehren natürlich, mit offizieller Billigung sämtlicher städtischer Argusaugen.
Mit seinem frischen, sprudelnden Wesen wußte sich Aldergast überall rasch beliebt zu machen. Kaum irgendjemand mißgönnte ihm diese ‚Glückspartie‘.
Aber es sollte nicht alles so glatt gehen, wie es den Anschein hatte. Schnell schreitet das Unglück, und oft geht das Schicksal verschlungene Wege.
Just einen Tag später, als Vanselows Feuerversicherung ablief, die er im Wust der Geschäfte sofort zu erneuern vergessen hatte, brannte das Kaufhaus nieder; bis auf die Grundmauern. So ist er über Nacht arm geworden. Das Geld, das ihm blieb, verlor er noch obendrein im Prozeß gegen seine Versicherung.
In der Stadt war man allseits gespannt, ob nun nicht Herr Aldergast die inzwischen erfolgte Verlobung wieder rückgängig machte. Aber er tat es nicht. Vielmehr kam er zu Vanselow, drückte dem niedergeschmetterten Alten aufmunternd die Hand und sagte: „Jetzt will ich Dir eine weitere Sorge wenigstens abnehmen, lieber Papa — in Gestalt Deiner Tochter. — Wir heiraten morgen!“
Seinen Worten folgte die Tat. Aber die Not war groß. Das Gehalt des Herrn Stadtsekretärs war nicht eben fürstlich zu nennen. Man gab sich zufrieden, in einer Stube mit Küche ein erstes Ehequartier zu finden.
Aber man achtete Aldergasts allerseits, trug ihnen überall ehrliche Freundschaft entgegen. Auf diesem ersprießlichen Untergrund konnte sich ihre Liebe erst recht entfalten. Zu hungern brauchten sie gerade nicht, und sie hielten wacker zusammen.
Nach einem Jahr kam ein Sohn an, ein reizender, kleiner Bursche. Der brachte den wahren Sonnenschein in die Ehe. Es herrschte glücklichste Harmonie.
Bald aber brach wieder Unglück ein. Durch die Machenschaften eines neidischen und gemeinen Kollegen ging Aldergast seiner Stellung verlustig.
Man zog in die Fremde, wo er bei einem Rechtsanwalt Bürovorsteher wurde. Hier war der bisher etwas gesteigerte Verdienst auf einmal wieder geringer. Bittere Not war täglicher Gast im Hause. Krankheit des Kindes — Verzweiflung — alle Bitternisse des Lebens lernte man kennen.
Die beiden verzagten nicht. Ein Blick in die Augen des anderen, — und jeder Zweifel, jede Zagheit war niedergeschmettert.
Aldergast hatte noch nie von seinen Eltern gesprochen. Jetzt aber tat er es, einer Hoffnung, einer gewissen Erwartung wegen. Er war mit dem Vater in Unfrieden aus einander gegangen, weil er ein Mädchen heiraten sollte, das er nicht leiden mochte. Reich sollte sie sein, — aber er pfiff auf den Reichtum.
Sein Vater war übrigens ein richtiger Abenteurer, ging noch im Alter von 42 Jahren nach Südamerika, baute dort eine Eisenbahn, wurde von einer glücklichen Konstellation der Umstände hochgewirbelt und war dabei, sich ein Riesenvermögen zu erspekulieren.
Zufällig hatte der Sohn davon in der Zeitung gelesen. Dann war auch einmal ein Brief des Vaters gekommen, sehr eigen, lakonisch, aber doch noch von Liebe zeugend:
Marcel, ich bitte Dich, komm herüber! Ich habe genug errafft, um auch Dir ein schönes Leben bieten zu können. Vergangenes soll vergessen sein. Bist Du inzwischen verheiratet, so bringe Deine Frau mit. Dann sollt Ihr mir beide willkommen sein!
Marcel erwiderte:
Lieber Vater!
Dein Brief hat mich sehr erfreut. Aber ich kann Deinen Rat nicht befolgen. Ich möchte auf eigenen Füßen stehen und mich nicht schon in jungen Jahren zu einem Nichtstuer-Leben verurteilen lassen.
Ein Vierteljahr später trat Beate ins Leben. Sie war, wie Manfred, ein reizend liebliches Kindchen; aber die Not wurde größer — —
Zwei Jahre später kam dann die große Wendung des Lebens. Marcels Vater starb plötzlich und hinterließ sein Millionenvermögen dem einzigen Sohn, den er niemals wieder gesehen hatte.
„Nun haben wir’s wohl verdient!“ meinte Marcel „im Hinblick auf unsere Kinder nehme ich alles dankbar als Fügung des Schicksals an.“
Da kommt nun der Sprung — mitten hinein in die Gesellschaft der Reichen. In Amerika aber gibt es noch einige Schwierigkeiten. Die wollen beseitigt werden. Um die Liquidation zu beschleunigen, reist das Ehepaar hinüber. Die Kinder aber, denen man diese Reise nicht zumuten mochte, läßt man daheim zurück, in der Obhut einer erprobten, ehemaligen Dienerin des alten, verstorbenen Aldergast.
Trotz allen Reichtums türmen sich neue, bittere Sorgen auf. Schon lange hat es gewetterleuchtet am politischen Horizont. Die Fackel ist angezündet — der Weltbrand bricht aus. Wie eine Furie jagt der Krieg über die Länder, Herr und Frau Aldergast werden zurückgehalten. Man verweigert ihnen die Ausreiseerlaubnis.