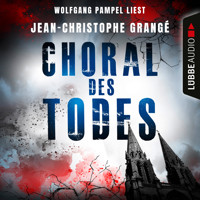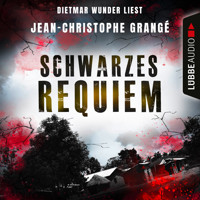Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Lübbe Audio
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Atemberaubende Spannung von Frankreichs Thriller-Autor Nr. 1
- Sprache: Deutsch
Ein Thriller wie ein Höllenritt - diabolisch und bis zur Schmerzgrenze fesselnd.
Mathias Freire leidet unter einer rätselhaften Krankheit: In Stresssituationen fällt er in Ohnmacht. Wenn er danach das Bewusstsein wiedererlangt, ist er ein anderer - ohne Erinnerung an seine Vergangenheit.
Eines Tages steht eine Polizeikommissarin vor seiner Tür: Eine Serie von bestialischen Ritualmorden wurde in unmittelbarer Nähe seiner Wohnung verübt. Ist Freire der Mörder?
Da auf sein Gedächtnis kein Verlass ist, muss Freire einen Weg finden, um seine Vergangenheit zu rekonstruieren. Doch die Suche nach seiner wahren Identität wird schon bald zu einem entsetzlichen Albtraum, aus dem es kein Entrinnen zu geben scheint. Ein Albtraum, der in einem dunklen Geheimnis um Freires Herkunft begründet liegt ...
»Grangé ist der König des Thrillers!« LE TEMPS
Jean-Christophe Grangé führt uns in eine Welt, in der Grausamkeit und dunkle Gesetze herrschen. Sein Markenzeichen ist Gänsehaut pur.
Weitere spannende Meisterwerke des Thriller-Genies Jean-Christophe Grangé bei beTHRILLED:
Der Flug der Störche
Der steinerne Kreis
Das Imperium der Wölfe
Das schwarze Blut
Das Herz der Hölle
Choral des Todes
Die Wahrheit des Blutes
Purpurne Rache
Schwarzes Requiem
eBooks von beTHRILLED - mörderisch gute Unterhaltung.
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Zeit:21 Std. 18 min
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Inhalt
Liebe Leserin, lieber Leser,
vielen Dank, dass du dich für ein Buch von beTHRILLED entschieden hast. Damit du mit jedem unserer Krimis und Thriller spannende Lesestunden genießen kannst, haben wir die Bücher in unserem Programm sorgfältig ausgewählt und lektoriert.
Wir freuen uns, wenn du Teil der beTHRILLED-Community werden und dich mit uns und anderen Krimi-Fans austauschen möchtest. Du findest uns unter be-thrilled.de oder auf Instagram und Facebook.
Du möchtest nie wieder neue Bücher aus unserem Programm, Gewinnspiele und Preis-Aktionen verpassen? Dann melde dich auf be-thrilled.de/newsletter für unseren kostenlosen Newsletter an.
Spannende Lesestunden und viel Spaß beim Miträtseln!
Dein beTHRILLED-Team
Melde dich hier für unseren Newsletter an:
Über dieses Buch
Mathias Freire leidet unter einer rätselhaften Krankheit: In Stresssituationen fällt er in Ohnmacht. Wenn er danach das Bewusstsein wiedererlangt, ist er ein anderer – ohne Erinnerung an seine Vergangenheit.
Eines Tages steht eine Polizeikommissarin vor seiner Tür: Eine Serie von bestialischen Ritualmorden wurde in unmittelbarer Nähe seiner Wohnung verübt. Ist Freire der Mörder?
Da auf sein Gedächtnis kein Verlass ist, muss Freire einen Weg finden, um seine Vergangenheit zu rekonstruieren. Doch die Suche nach seiner wahren Identität wird schon bald zu einem entsetzlichen Albtraum, aus dem es kein Entrinnen zu geben scheint. Ein Albtraum, der in einem dunklen Geheimnis um Freires Herkunft begründet liegt …
JEAN-CHRISTOPHE GRANGÉ
DER URSPRUNGDES
B Ö S E N
Aus dem Französischen vonUlrike Werner-Richter
Für Michèle Roca-Phelippot
1. Mathias Freire
Das Klingeln bohrte sich wie eine glühende Nadel in sein Bewusstsein.
Im Traum war er an einer sonnenbeschienenen Mauer entlanggelaufen. Es war eine strahlend weiße Wand, die weder Anfang noch Ende hatte, und er folgte seinem Schatten. Die Mauer war wie ein eigenes Universum, glatt, blendend, teilnahmslos …
Wieder klingelte es.
Er öffnete die Augen und warf einen Blick auf die Leuchtziffern des Weckers neben sich. Zwei Minuten nach vier. Mühsam stützte er sich auf einen Ellbogen und tastete nach dem Telefonhörer, griff aber ins Leere. Erst in diesem Moment fiel ihm ein, dass er sich im Ruheraum befand. Er suchte die Taschen seines Kittels ab, bis er das Handy fand. Die Nummer auf dem Display war ihm nicht bekannt. Er nahm das Gespräch an, ohne sich zu melden.
»Doktor Freire?«
Er antwortete nicht.
»Sie sind doch Doktor Mathias Freire, Psychiater im Bereitschaftsdienst, oder?«
Die Stimme schien von ganz weit her zu kommen. Immer noch war der Traum in seinem Kopf. Die Mauer, das weiße Licht, der Schatten …
»Das ist richtig«, antwortete er schließlich.
»Ich bin Doktor Fillon und habe heute Nacht Notdienst im Viertel Saint-Jean-Belcier.«
»Wieso rufen Sie mich unter dieser Nummer an?«
»Weil es die ist, die man mir gegeben hat. Störe ich gerade?«
Langsam gewöhnten sich Freires Augen an die Dunkelheit. Er erkannte die Leuchtplatte für Röntgenbilder, den Schreibtisch aus Metall und den doppelt verschlossenen Medikamentenschrank. Der Ruheraum war einfach nur sein Sprechzimmer. Er hatte das Licht gelöscht und auf dem Untersuchungstisch geschlafen.
»Was ist los?«, grunzte er und richtete sich auf.
»Ein merkwürdiger Vorfall am Bahnhof Saint-Jean. Gegen Mitternacht haben Wachleute einen Mann aufgefunden. Einen Penner, der sich in einem stillgelegten Bahnwärterhäuschen zwischen den Gleisen versteckt hatte.«
Die Stimme des Arztes klang angespannt. Freires Blick streifte den Wecker erneut. Fünf nach vier.
»Sie haben ihn zur Sanitätsstation gebracht und die nächstgelegene Polizeiwache kontaktiert. Die Bullen haben ihn mitgenommen und mich angerufen. Ich habe ihn auf der Wache untersucht.«
»Ist er verletzt?«
»Das nicht, aber er hat das Gedächtnis verloren. Und zwar vollständig. Ziemlich beeindruckend!«
Freire gähnte.
»Simuliert er vielleicht?«
»Sie sind der Spezialist. Aber ich glaube es eher nicht. Er scheint irgendwie ganz weit weg zu sein. Oder – wie soll ich sagen? – er schwimmt sozusagen im Nichts.«
»Ruft die Polizei auch noch bei mir an?«
»Nein, der Patient wird Ihnen gerade in einem Streifenwagen überstellt.«
»Na, herzlichen Dank«, grummelte Freire ironisch.
»Ich meine es ernst. Sie können ihm sicher helfen, da bin ich ganz sicher.«
»Haben Sie einen Untersuchungsbericht erstellt?«
»Der Patient bringt ihn mit. Viel Glück.«
Eilig legte der Arzt auf. Mathias Freire blieb reglos in der Dunkelheit stehen. Das Freizeichen bohrte sich in sein Trommelfell. Diese Nacht meinte es wirklich nicht gut mit ihm.
Schon gegen neun Uhr abends hatte der Zirkus angefangen. Auf der Station der zwangseingewiesenen Patienten hatte ein Neuzugang zunächst seinen Darm mitten ins Zimmer entleert, dann seine Exkremente verzehrt und dem herbeigeeilten Pfleger das Handgelenk gebrochen. Eine halbe Stunde später hatte sich eine Schizophrene auf einer anderen Station mit einem Stück Linoleum die Pulsadern durchgeschnitten. Freire kümmerte sich um die ersten Hilfsmaßnahmen und überstellte sie anschließend in die Universitätsklinik Pellegrin.
Gegen Mitternacht konnte er sich endlich hinlegen. Aber nur kurz. Eine Stunde später irrte ein Patient splitterfasernackt mit einer Plastiktrompete durch das Klinikgelände. Erst nach drei Spritzen gab er einigermaßen Ruhe. Anschließend mussten andere Patienten beschwichtigt werden, die er mit seinem Lärm geweckt hatte. Gleichzeitig bekam einer der Jungs auf der Station für Drogenabhängige einen epileptischen Anfall. Bis Freire bei ihm war, hatte der Kerl sich schon die Zunge durchgebissen, und das Blut sprudelte nur so aus seinem Mund. Man brauchte vier Männer, um seine Zuckungen unter Kontrolle zu bekommen. Im allgemeinen Durcheinander schaffte es der Mann trotz allem noch, sich Freires Handy zu schnappen. Der Psychiater musste warten, bis die Medikamente wirkten, ehe er die Finger des Kranken auseinanderbiegen und sein blutverschmiertes Telefon wieder an sich nehmen konnte.
Erst um halb vier fand er Zeit, sich wieder hinzulegen. Die Verschnaufpause hatte gerade einmal eine halbe Stunde gedauert, ehe dieser dämliche Anruf kam. Scheiße.
Reglos blieb er im Dunkeln sitzen. Immer noch tönte das Freizeichen durch den nächtlichen Raum.
Schließlich steckte er das Handy in die Tasche und stand auf. Wieder tauchte die weiße Mauer aus dem Traum vor seinen Augen auf. Eine Frauenstimme murmelte: »Feliz …« Es war das spanische Wort für »glücklich«. Wieso spanisch? Und wieso eine Frau? Hinter seinem linken Auge spürte er den vertrauten, stechenden Schmerz, der ihn bei jedem Aufwachen begleitete. Er rieb sich die Augen und trank einen Schluck Wasser direkt aus der Leitung.
Ohne Licht zu machen, tastete er sich zur Tür und öffnete sie mit seiner Chipkarte.
Er hatte sich in seinem Sprechzimmer eingeschlossen, weil der Medikamentenschrank behütet werden musste wie der Heilige Gral.
Fünf Minuten später betrat er die vor Nässe glänzende Auffahrt zu seiner Station. Seit dem Abend war Bordeaux in einen ungewöhnlich dichten, weißlichen Nebel gehüllt. Freire schlug den Kragen des Regenmantels hoch, den er über seinen Kittel gezogen hatte. Der Geruch des Meeres kribbelte in seiner Nase.
Freire schlenderte durch die Anlage. Man konnte kaum drei Meter weit sehen, doch er kannte das Gelände in- und auswendig. Niedrige, grau verputzte Pavillons mit gewölbten Dächern wechselten sich mit rechteckigen Rasenflächen ab. Natürlich hätte er auch einen Pfleger schicken können, doch er legte Wert darauf, seine »Kunden« selbst in Empfang zu nehmen.
Er überquerte den zentralen, von einigen Palmen gesäumten Innenhof. Normalerweise erfüllten ihn die von den Antillen importierten Bäume mit einem gewissen Optimismus, doch in dieser Nacht funktionierte es nicht. Die Dunstglocke aus Kälte und Feuchtigkeit war stärker. Freire erreichte das Eingangstor, grüßte den Wachmann mit einer Handbewegung und trat auf die Straße hinaus. Der Streifenwagen war bereits da. Stumm zeichnete das Blaulicht eine hektisch blinkende Spur in den Nebel.
Freire schloss die Augen. Der Schmerz pulsierte nach wie vor unter seinen Lidern, doch er maß ihm keine Bedeutung bei, weil er ihn für psychosomatisch hielt. Es war sein Beruf, psychische Erkrankungen zu versorgen, die den Körper in Mitleidenschaft zogen. Warum sollte sein eigener Organismus anders reagieren?
Als er die Augen wieder öffnete, stieg gerade ein Polizist aus dem Streifenwagen. Ein Mann in Zivil folgte ihm. Und jetzt verstand Freire auch, warum der Arzt am Telefon so irritiert gewirkt hatte. Der Patient, der sein Gedächtnis verloren hatte, erwies sich als wahrer Koloss. Er maß eins neunzig und würde gut und gern seine hundertdreißig Kilo auf die Waage bringen. Auf dem Kopf trug er einen echten texanischen Stetson, seine Füße steckten in Westernstiefeln aus Echsenleder. In seinem dunkelgrauen Mantel wirkte er unglaublich wuchtig. Er hatte eine Plastiktüte und einen prall mit Papieren gefüllten Umschlag bei sich.
Der Polizist wollte seinen Passagier begleiten, doch Freire machte ihm ein Zeichen, stehen zu bleiben. Langsam ging er auf den Cowboy zu. Der Schmerz hinter seinem Auge verstärkte sich mit jedem Schritt; ein Muskel im Augenwinkel begann zu zucken.
»Guten Abend«, grüßte er freundlich.
Der Mann antwortete nicht. Bewegungslos stand er im dunstigen Lichtkreis einer Laterne. Freire wandte sich an den Polizisten, der einsatzbereit mit der Hand in der Nähe des Pistolenhalfters wartete.
»Schon gut. Wir kommen klar.«
»Brauchen Sie keine Informationen über ihn?«
»Schicken Sie mir gleich morgen früh den amtlichen Bericht.«
Der Beamte nickte, drehte sich um und stieg in den Streifenwagen, der rasch vom Nebel verschluckt wurde.
Die beiden Männer standen einander nur durch ein paar Dunstfetzen getrennt gegenüber.
»Mein Name ist Mathias Freire«, stellte der Arzt sich schließlich vor. »Ich habe heute hier in der Klinik Nachtdienst.«
»Werden Sie sich um mich kümmern?«
Die tiefe Stimme klang wie erloschen. Freire konnte die unter dem Stetson verborgenen Züge des Mannes kaum erkennen. Der Patient schien einem der Riesen zu ähneln, wie man sie aus Zeichentrickfilmen kennt – Himmelfahrtsnase, breiter Mund, schweres Kinn.
»Wie fühlen Sie sich?«
»Ich brauche Hilfe.«
»Würden Sie mir bitte folgen?«
Der Mann bewegte sich nicht.
»Kommen Sie mit«, sagte Freire und streckte den Arm aus. »Wir werden Ihnen helfen.«
Der Mann wich reflexartig zurück und geriet dabei in den Lichtstrahl einer Laterne. Freire erkannte, dass er ihn richtig eingeschätzt hatte. Sein Gesicht wirkte gleichzeitig kindlich und unproportioniert. Er mochte etwa fünfzig Jahre alt sein; silberne Haarsträhnen quollen unter dem Hut hervor.
»Kommen Sie. Alles wird gut.«
Freire bemühte sich um seinen überzeugendsten Tonfall. Psychisch kranke Menschen besitzen oft eine besonders ausgeprägte Sensibilität und spüren sofort, wenn man sie zu manipulieren versucht. Es ist fast unmöglich, sie zu täuschen; man muss die Karten offen auf den Tisch legen.
Der Mann ohne Gedächtnis setzte sich langsam in Bewegung. Freire steckte die Hände in die Taschen, drehte sich um und schlenderte betont lässig auf die Klinik zu. Er musste sich zwingen, nicht über die Schulter zurückzublicken, doch er wollte seinem Patienten zeigen, dass er Vertrauen zu ihm hatte.
Sie erreichten das Hauptportal. Mathias atmete durch den Mund und sog die kalte, feuchte Luft ein. Er fühlte sich unendlich müde. Es lag wohl nicht nur am Schlafmangel – auch der trostlose Nebel war schuld. Und vor allem das Gefühl seiner Ohnmacht gegenüber den Geisteskrankheiten, die ihr Gesicht mit jedem Tag zu vervielfältigen schienen.
Wie würde dieser Neue sich verhalten? Was konnte er für ihn tun? Freire wusste nur zu genau, dass die Chance, mehr über die Vergangenheit dieses Patienten zu erfahren, ziemlich gering war. Und die Chance, ihn zu heilen, tendierte gegen null.
Aber so war nun einmal das Schicksal von Psychiatern: Man bemühte sich Tag für Tag aufs Neue, ein untergehendes Schiff mit einem Fingerhut leerzuschöpfen.
Es war neun Uhr morgens, als er in sein Auto stieg – einen zerbeulten Volvo Kombi, den er vor anderthalb Monaten bei seiner Ankunft in Bordeaux gebraucht gekauft hatte. Er hätte auch zu Fuß nach Hause gehen können, denn er wohnte nicht einmal einen Kilometer entfernt, doch er hatte sich angewöhnt, das alte Vehikel zu benutzen.
Die psychiatrische Klinik Pierre-Janet lag im Südwesten der Stadt, nicht weit von der Universitätsklinik Pellegrin entfernt. Freire wohnte im Viertel Fleming zwischen der Uniklinik und der Universität. Fleming war ein anonymes Neubauviertel mit endlosen Reihen identischer rosa Häuser, roten Ziegeldächern, gestutzten Hecken und kleinen Gärten.
Freire fuhr im Schritttempo durch den Nebel, der sich beharrlich hielt. Er konnte kaum etwas erkennen, doch die Stadt interessierte ihn ohnehin nicht. Man hatte ihm erklärt, Bordeaux sei eine Art kleines Paris, sehr ansehnlich und die Hauptstadt des Weins. Man hatte ihm überhaupt sehr viel erzählt, aber gesehen hatte er bisher nichts. Er fand Bordeaux spießig, hochnäsig und todlangweilig; ein unpersönliches Ballungsgebiet, wo man an jeder Straßenecke die miefige Atmosphäre einer herrschaftlichen Provinzvilla spürte.
Das andere Gesicht von Bordeaux, die legendäre gutbürgerliche Gesellschaft, hatte er bisher noch nicht kennengelernt. Viele seiner Kollegen in der Klinik fühlten sich zu den linken Parteien hingezogen, die seit jeher den bourgeoisen Traditionen den Kampf angesagt hatten. Aber genau diese Leute waren die ewigen Miesmacher, die gar nicht merkten, dass sie selbst einen wesentlichen Teil der von ihnen verabscheuten Klasse darstellten. Freire beschränkte den Kontakt zu ihnen auf die leichte Konversation beim Mittagessen – lustige Geschichten von Verrückten, die Gabeln verschluckten, Tiraden gegen das psychiatrische System in Frankreich, Pläne für den Urlaub und den Ruhestand.
Hätte Freire Anstalten gemacht, sich in die bessere Gesellschaft von Bordeaux einführen zu lassen, wäre er vermutlich kläglich gescheitert. Er litt nämlich unter einem maßgeblichen Handicap: Er trank keinen Wein. In der Gegend von Bordeaux findet man so etwas schlimmer, als blind, taub oder lahm zu sein. Natürlich machte ihm niemand Vorwürfe wegen dieses Mankos, doch seine Einsamkeit sprach für sich. Wer in Bordeaux keinen Wein trank, hatte keine Freunde. So einfach war das. Freire wurde nie privat angerufen und bekam weder Mails noch SMS. Seine Kommunikation beschränkte sich auf den beruflichen Austausch mit Kollegen und das Intranet der Klinik.
Trotz der langsamen Fahrweise war er schnell zu Hause.
Jedes Haus im Viertel trug den Namen eines Edelsteins. Topas. Diamant. Türkis. Die Namen waren die einzige Möglichkeit, die Häuser voneinander zu unterscheiden.
Freire wohnte im Haus Opal. Bei seiner Ankunft in Bordeaux hatte er geglaubt, er hätte sich für dieses Haus entschieden, weil es in der Nähe seines Arbeitsplatzes lag. Doch das stimmte nicht. Er hatte das Viertel ausgesucht, weil es neutral und unpersönlich war. Ein idealer Ort, um allem zu entfliehen, sich zu verbergen und in der Masse unterzutauchen.
Er war nach Bordeaux gekommen, um einen Schlussstrich unter seine Pariser Vergangenheit zu ziehen. Nie wieder würde und wollte er der Mann sein, der er früher gewesen war: ein renommierter, kultivierter, von Gleichgesinnten hofierter Arzt.
Er parkte wenige Meter von seinem Haus entfernt. Der Nebel war so dicht, dass die Stadtverwaltung sich entschlossen hatte, die Straßenlaternen auch am Tag nicht zu löschen.
Seine Garage benutzte Freire nie. Als er aus dem Auto stieg, hatte er den Eindruck, in einen Pool aus Milch einzutauchen. Milliarden winziger Tröpfchen schwebten in der Luft. Der Anblick erinnerte ihn an ein pointillistisches Gemälde.
Freire steckte die Hände in die Taschen seines Regenmantels und ging schneller. Trotz des hochgeklappten Kragens spürte er das eisige Prickeln des Nebels an seinem Hals. Er fühlte sich wie ein Privatdetektiv in einem alten Hollywoodstreifen: der einsame Held auf der Suche nach Licht.
Er öffnete das Gartentor, überquerte die wenigen Meter feucht glänzenden Rasens und steckte den Schlüssel ins Schloss.
Das Innere des Hauses war genauso austauschbar wie das Äußere. Die Aufteilung war immer gleich: Windfang, Wohnzimmer und Küche im Erdgeschoss, in der Etage darüber die Schlafzimmer. Alle Häuser waren mit den gleichen Materialien ausgestattet – Laminatböden, weiß verputzte Wände, furnierte Türen. Die Bewohner drückten ihre Individualität einzig durch das Mobiliar aus.
Freire zog seinen Mantel aus und ging in die Küche, ohne Licht zu machen. Die Originalität seiner Wohnung bestand darin, dass er keine oder fast keine Möbel besaß. Der einzige Schmuck hier waren ungeöffnete Umzugskartons, die an den Wänden aufgereiht standen. Freire wohnte in einer Musterwohnung.
Im Licht der Straßenlaternen brühte er sich einen Tee auf. An Schlaf war voraussichtlich nicht zu denken: Um 13.00 Uhr begann seine nächste Bereitschaft. Bis dahin würde er Krankenakten durcharbeiten. Wenn er schließlich gegen 22.00 Uhr Feierabend machen konnte, würde er sich vermutlich ohne Abendbrot hinter dem Fernseher verschanzen und dort auch den ganzen Sonntag verbringen. Nach einer hoffentlich gut durchgeschlafenen Nacht würde er am Montag seinen Dienst zu einer einigermaßen vernünftigen Uhrzeit wieder aufnehmen.
Er beobachtete die Teeblätter, die sich auf dem Boden der Glaskanne entfalteten, und sagte sich, dass er möglichst bald etwas ändern müsse. Nicht mehr ständig Bereitschaftsdienste übernehmen. Einen gewissen Rhythmus in sein Leben bringen. Sport treiben. Zu festen Zeiten essen. Aber auch diese Art von Überlegung gehörte zu seinem unübersichtlichen Tagesablauf, der sich ziellos immer wiederholte.
Er nahm das Sieb aus der Kanne und beobachtete, wie die braune Farbe sich verstärkte. Genauso sah es in seinem Kopf aus – seine Gedanken wurden immer düsterer. Es stimmt, dachte er, während er das Teesieb noch einmal eintauchte, ich habe mich in die psychischen Störungen anderer geflüchtet, um meine eigenen besser vergessen zu können.
Vor zwei Jahren – damals war er dreiundvierzig – hatte Mathias Freire den schwersten Verstoß gegen sein Berufsethos begangen, den man sich vorstellen konnte: Er hatte in der psychiatrischen Klinik von Villejuif mit einer Patientin geschlafen. Anne-Marie Straub war eine schizophrene und manisch-depressive junge Frau, deren Prognosen nicht darauf schließen ließen, dass sie die Klinik je wieder verlassen konnte. Wenn er über den Vorfall nachdachte, konnte Freire es noch immer nicht fassen. Er hatte das Tabu aller Tabus gebrochen.
Dabei war seine eigene Vorgeschichte alles andere als krank oder pervers. Auch wenn er Anne-Marie außerhalb der Klinik kennengelernt hätte, wäre er ihr Hals über Kopf verfallen. Er hätte das gleiche wilde, unüberlegte Verlangen gespürt, das ihn gleich beim ersten Anblick der jungen Frau in seinem Sprechzimmer überfiel. Weder Isolierzellen noch Medikamente oder die Schreie der anderen Patienten konnten seine Leidenschaft bremsen. Es war einfach Liebe auf den ersten Blick gewesen.
In Villejuif wohnte Freire am Rand des Klinikgeländes. Jede Nacht suchte er den Trakt auf, in dem Anne-Marie untergebracht war. Noch immer sah er jedes Detail vor sich: den Linoleumboden, die Türen mit den Gucklöchern, seine Chipkarte, die es ihm ermöglichte, jeden Bereich zu betreten. Als Schatten im Schatten wurde Mathias von seinem Verlangen geleitet. Oder eigentlich eher vorwärtskatapultiert. Jede Nacht durchquerte er den Saal, in dem Kunsttherapie angeboten wurde. Immer senkte er den Blick, um Anne-Maries Bilder nicht sehen zu müssen. Sie malte schwarze, verzerrte, obszöne Wunden auf rotem Untergrund. Manchmal zerschnitt sie auch die Leinwand mit dem Spachtel, wie Lucio Fontana. Wenn Mathias Anne-Maries Werke bei Tageslicht betrachtete, wusste er, dass die junge Frau eine der gefährlichsten Patientinnen der Klinik war. Bei Nacht aber wandte er den Blick ab und stahl sich in ihre Zelle.
Diese Nächte hatten ihn für immer gezeichnet. Leidenschaftliche Umarmungen hinter verschlossenen Türen. Geheimnisvolle, fesselnde, inspirierende Zärtlichkeiten. Verrückte, geflüsterte Worte. »Achte nicht auf sie, mein Liebling … Sie sind nicht böse …« Sie sprach von den Geistern, von denen sie sich in der Dunkelheit umgeben glaubte. Mathias antwortete nicht, sondern starrte in die Finsternis. Unglück, dachte er. Ich renne geradewegs in mein Unglück.
Eines Tages war er nach der Liebe eingeschlafen. Nur eine Stunde, vielleicht sogar weniger. Als er wach wurde – es musste gegen drei Uhr morgens gewesen sein –, baumelte Anne-Maries nackter Körper über dem Bett. Sie hatte sich erhängt. Mit seinem Gürtel.
In der ersten Sekunde hatte er nichts begriffen. Er glaubte, noch zu träumen, und bewunderte die Gestalt mit den schweren Brüsten, die ihn bereits wieder erregte. Doch dann explodierte die Panik in seinem Kopf. Ihm wurde entsetzlich klar, dass alles vorbei war. Für sie. Aber auch für ihn. Er kleidete sich an, ließ die Leiche am Fensterkreuz hängen, flüchtete durch die Flure, ging den Pflegern aus dem Weg und vergrub sich in seiner Wohnung wie eine Ratte in ihrem Loch.
Außer Atem und innerlich aufgewühlt spritzte er sich ein Beruhigungsmittel und verkroch sich mit über den Kopf gezogenem Laken in seinem Bett.
Als er zwölf Stunden später erwachte, hatte die Nachricht längst die Runde gemacht. Niemand wunderte sich, denn Anne-Marie hatte schon mehrfach versucht, ihrem Leben ein Ende zu setzen.
Allerdings stellte man Nachforschungen nach dem Männergürtel an. Seine Herkunft wurde nie geklärt. Mathias Freire wurde nie behelligt. Nicht einmal befragt. Anne-Marie Straub war schon länger als ein Jahr nicht mehr seine Patientin. Eine Familie besaß sie nicht. Niemand erhob Anklage; man legte den Fall zu den Akten.
Von diesem Tag an erledigte Freire seine Arbeit wie ein Automat und nahm abwechselnd Antidepressiva und Angstlöser, die ihn einigermaßen aufrecht hielten. Er hatte nicht die geringste Erinnerung an jene Zeit. Seine Sprechstunden hielt er wie ferngesteuert und stellte konfuse Diagnosen. Nachts träumte er nie. Eines Tages erhielt er das Angebot einer Klinik in Bordeaux. Er ergriff die Gelegenheit beim Schopf, setzte die Medikamente ab, packte seine Koffer und stieg in den Zug, ohne sich noch einmal umzuschauen.
Seit er in der Klinik in Bordeaux arbeitete, legte er eine neue Berufsauffassung an den Tag. Er vermied jedes persönliche Engagement. Seine Patienten waren für ihn keine Fälle mehr, sondern wie leere Felder eines Formulars, das er auszufüllen hatte: Schizophrenie, Depression, Hysterie, Zwangsstörungen, Paranoia, Autismus. Er untersuchte, verschrieb die entsprechende Behandlungsmethode und blieb auf Distanz. Man nahm ihn als kalt, abgehoben und roboterhaft wahr. Umso besser. Nie wieder würde er sich einem Patienten nähern. Und nie wieder würde er sein Ich in seine Arbeit einbringen.
Langsam kehrte er in die Gegenwart zurück. Er stand immer noch am Küchenfenster und blickte auf die leere, nebelverhangene Straße hinaus. Sein Tee war inzwischen so schwarz wie Kaffee. Draußen wurde es immer noch nicht richtig hell. Die Häuser hinter den Hecken sahen alle gleich aus. Hinter identischen Fenstern lagen immer gleich gepolte Menschen und schliefen. Es war Samstagmorgen, da blieb man lange im Bett.
Eine Kleinigkeit jedoch passte nicht.
Etwa fünfzig Meter entfernt stand ein schwarzes Geländefahrzeug mit eingeschalteten Scheinwerfern am Straßenrand.
Freire wischte die beschlagene Scheibe frei. In diesem Augenblick stiegen zwei Männer in schwarzen Mänteln aus dem Auto. Freire kniff die Augen zusammen. Die beiden waren im Nebel nur schwer zu erkennen, doch in Gestalt und Auftreten erinnerten sie ihn an FBI-Agenten in einem Film. Oder auch an die beiden witzigen Hauptfiguren aus Men in Black. Was mochten sie hier wollen?
Freire überlegte, ob es sich um Mitglieder einer von den Bewohnern des Viertels engagierten Privatmiliz handeln könnte, doch weder das Auto noch die Eleganz der Männer passten in dieses Bild. Inzwischen lehnten beide an der Motorhaube des Geländewagens. Der Nebel schien ihnen nichts auszumachen. Sie fixierten einen bestimmten Punkt. Erneut verspürte Mathias den Schmerz hinter seinem linken Auge.
Das, was die beiden Männer im Nebel beobachteten, war sein eigenes Haus. Und mit ziemlicher Sicherheit auch seine Gestalt, die sich am Fenster abzeichnete.
Gegen 13.00 Uhr kehrte Freire in die Klinik zurück. Er hatte eine Weile auf dem Sofa gedöst und sich dabei in Ermangelung einer Decke mit mehreren Patientenakten zugedeckt. Die Notaufnahme war menschenleer. Weder verzweifelte Patienten noch betrunkene Penner oder auch nur auf der Straße aufgegriffene Irre. Ein wahrer Glücksfall. Er begrüßte die Krankenschwestern. Man überreichte ihm seine Post und die Krankenblätter der Fälle vom Vortag, mit denen er sein Büro aufsuchte, das ihm auch als Sprechzimmer und Ruheraum diente.
Als Erstes nahm er sich den Bericht über den Mann vom Bahnhof Saint-Jean vor, der offenbar das Gedächtnis verloren hatte. Das Dokument war von einem gewissen Nicolas Pailhas erstellt worden, der auf der Polizeiwache an der Place des Capucins Dienst tat. Am Abend zuvor hatte Freire kein Aufnahmegespräch mehr mit dem Cowboy geführt. Er hatte ihn lediglich abgehorcht, ihm ein Schmerzmittel verabreicht und ihn zu Bett geschickt. Alles andere konnte man getrost verschieben.
Gleich die ersten Zeilen des Berichts weckten Freires Interesse.
Der Unbekannte war gegen Mitternacht von Bahnbeamten in einem ehemaligen Bahnwärterhäuschen neben dem Gleis 1 aufgefunden worden. Der Mann hatte das Schloss der Hütte aufgebrochen und sich drinnen versteckt. Als man ihn fragte, was er dort zu suchen habe, konnte er weder eine Antwort geben noch seinen Namen nennen. Außer seinem Stetson und seinen Stiefeln aus Echsenleder trug der Eindringling einen grauen Wollmantel, eine abgewetzte Samtjacke, ein Sweatshirt mit der Aufschrift »Champion« und durchlöcherte Jeans. Er hatte weder einen Ausweis noch irgendein anderes Dokument bei sich, mit dem man ihn hätte identifizieren können. Er schien unter Schock zu stehen, hatte Schwierigkeiten, sich auszudrücken, und verstand häufig die Fragen nicht, die man ihm stellte.
Viel beunruhigender aber waren die beiden Dinge, die aus der Hand zu geben er sich standhaft weigerte. Es handelte sich um einen fünfundvierzig Zentimeter langen verstellbaren Schraubenschlüssel – einen sogenannten Engländer – und ein Telefonbuch der Region Aquitaine aus dem Jahr 1996 mit einem Umfang von mehreren Tausend Dünndruckseiten. Sowohl der Engländer als auch das Telefonbuch waren blutbefleckt. Der Möchtegern-Texaner konnte nicht erklären, woher die beiden Dinge stammten, und wusste auch nichts über das Blut.
Die Eisenbahner hatten ihn zunächst zur Sanitätsstation des Bahnhofs gebracht, weil sie glaubten, er wäre verletzt. Trotz einer eingehenden Untersuchung konnte jedoch keinerlei Wunde festgestellt werden. Das Blut auf dem Engländer und dem Telefonbuch stammte nicht von ihm selbst. Man rief die Polizei. Pailhas und sein Team erschienen fünfzehn Minuten später. Sie nahmen den Unbekannten mit und brachten ihn zu dem Bereitschaftsarzt des Viertels – demjenigen, der Freire angerufen hatte.
Die Vernehmung auf der Wache ergab keine neuen Erkenntnisse. Man fotografierte den Mann, nahm seine Fingerabdrücke, und die Techniker von der Spurensicherung entnahmen ihm Speichel- und Haarproben, um seine DNA mit der nationalen Kartei zu vergleichen. Auf seinen Händen und unter den Nägeln fanden sich Staubspuren; auf das Resultat der Analyse wartete man noch. Natürlich waren der Engländer und das Telefonbuch als Beweismaterial konfisziert worden. Aber als Beweis wofür?
Freires Pager meldete sich. Er blickte auf die Uhr – es war drei. Der Trubel ging los. Die in die Ambulanz eingelieferten Kranken und die stationären Patienten ließen ihm nicht viel Zeit für andere Dinge. Hinweisen auf seinem Bildschirm entnahm er, dass es Probleme in der Isolierzelle West gab. Mit der Tasche in der Hand rannte er los. Der Weg durch den Park lag noch immer im dichten Nebel. Die Klinik bestand aus einem Dutzend Pavillons, die man entweder mit der Himmelsrichtung der Region Aquitaine bezeichnete, aus der die Patienten stammten, oder einem Krankheitsbild zugeordnet hatte: Drogenabhängigkeit, Sexualkriminalität, Autismus.
Der Pavillon West war der dritte auf der linken Seite. Freire stürzte in den Flur. Weiße Wände, beigefarbenes Linoleum, über Putz verlegte Rohre – jedes Gebäude sah gleich aus. Man wunderte sich nicht, dass manche Patienten sich verirrten, wenn sie in ihre Räume zurückkehren wollten.
»Was ist passiert?«
Der Pfleger grinste übellaunig.
»Scheiße, sehen Sie denn nicht, was hier los ist?«
Freire ging nicht auf seinen aggressiven Tonfall ein. Er warf einen Blick durch das Guckloch der Zelle. Eine nackte Frau, deren weißer Körper mit Kot und Urin beschmiert war, kauerte am Boden. Ihre Finger bluteten. Es war ihr gelungen, ganze Placken Farbe von den Wänden zu kratzen, die sie wütend zerkaute.
»Spritzen Sie ihr drei Einheiten Loxapac«, sagte Freire mit sachlicher Stimme.
Er kannte die Frau, konnte sich aber nicht an ihren Namen erinnern. Sie war Stammkundin in der Klinik und vermutlich am Morgen wieder einmal eingeliefert worden. Ihre Haut war so weiß wie Papier, ihre Züge spiegelten Angst wider. Ihr Körper bestand nur aus Haut und Knochen. Mit beiden Händen stopfte sie sich Farbbrocken in den Mund wie Cornflakes. Auf ihren Fingern war Blut, ebenso auf den Farbstücken und auf ihren Lippen.
»Vier Einheiten«, verbesserte sich Freire. »Nehmen Sie lieber gleich vier Einheiten.«
Er hatte schon lange aufgehört, sich Gedanken über die Ohnmacht der Psychiater zu machen. Für chronisch Kranke gab es nur eine Lösung – man pumpte sie mit Beruhigungsmitteln voll und wartete, bis der Anfall vorüber war. Das war zwar nicht viel, aber es half einigermaßen.
Auf dem Rückweg ging er bei dem ihm selbst unterstellten Pavillon Henri-Ey vorbei. Hier waren achtundzwanzig Patienten aus dem Osten der Region untergebracht. Schizophrene, Depressive, Paranoiker, aber auch ein paar weniger klare Fälle.
Am Empfang ließ er sich die Berichte über die Vorfälle des Vormittags aushändigen. Ein Weinkrampf. Rabatz in der Küche. Ein kleiner Junkie hatte irgendwo – niemand wusste, woher – ein Stück Schnur aufgetrieben und sich damit den Penis abgeschnürt. Alles Routinefälle.
Freire ging durch den Speisesaal, in dem es nach kaltem Tabak roch. Bei den Verrückten war das Rauchen noch gestattet. Er entriegelte eine weitere Tür. Der Geruch nach hochprozentigem Desinfektionsalkohol verriet die Krankenstation. Unterwegs begrüßte er ein paar Stammkunden. Da war zum Beispiel ein dicker Mann in weißem Anzug, der sich für den Klinikdirektor hielt. Ein anderer Mann mit afrikanischen Wurzeln ging immer auf haargenau dem gleichen Weg im Flur auf und ab. Wiederum ein anderer, ein Patient, dessen Augen tief in den Höhlen lagen, schaukelte ununterbrochen auf der Stelle wie ein Stehaufmännchen.
Auf der Krankenstation erkundigte sich Freire nach dem Mann ohne Gedächtnis. Der Pfleger blätterte im Register. Eine ruhige Nacht, ein ganz normaler Vormittag. Um zehn Uhr hatte man den Cowboy für ein neurobiologisches Gutachten in die Universitätsklinik gebracht, aber er hatte jede Art von Röntgenaufnahme strikt verweigert. An seinem Körper wurde keinerlei Verletzung gefunden; man ging daher von einer dissoziativen Amnesie aufgrund einer gefühlsmäßigen Traumatisierung aus. Das bedeutete, dass sich der Möchtegern-Texaner durch ein Erlebnis oder etwas, das er vielleicht nur mit angesehen hatte, plötzlich an nichts mehr erinnern konnte. Aber weshalb?
»Wo ist er jetzt? In seinem Zimmer?«
»Im Saal Camille Claudel.«
Es ist eine der Macken der modernen Psychiatrie, ihre Abteilungen, Wege und Dienste nach berühmten Geisteskranken zu benennen. Sogar der Wahnsinn hat seine Meister. Claudel war der Name des Kunsttherapiebereichs. Freire machte sich auf den Weg, passierte einige verschlossene Türen und erreichte schließlich die Räume, in denen die Patienten malen und bildhauern konnten oder mit Peddigrohr und Papier bastelten.
Er ging an Tischen vorbei, an denen getöpfert und gemalt wurde, und erreichte den Bereich der Flechtarbeiten. Mit konzentrierter Miene flochten Patienten hier Körbchen und Serviettenringe aus Peddigrohr. Biegsame Stängel vibrierten vor verbissenen, versteinerten Gesichtern. Fast wirkte es so, als ob die Pflanzenfasern ein bewegtes Eigenleben führten, während die Menschen Wurzeln geschlagen hatten.
Der Cowboy saß am Ende des Tisches. Selbst im Sitzen überragte er die anderen um gute zwanzig Zentimeter. Immer noch beschattete der Hut seine von tiefen Falten durchzogene Haut. Die großen blauen Augen leuchteten aus seinem ledrigen Gesicht.
Freire trat näher. Der Riese arbeitete an einem Korb in Form eines Schiffsrumpfs. Seine Hände waren schwielig. Die Hände eines Arbeiters oder eines Bauern, dachte der Psychiater.
»Guten Tag.«
Der Mann hob den Kopf. Er blinzelte sehr häufig, aber nicht hektisch. Sobald die Augen unter den Lidern hervorkamen, verblüfften sie durch ihre feuchte, perlmuttartige Klarheit.
»Hallo«, grüßte er zurück und hob den Hut mit der Zeigefingerspitze kurz an, wie es vielleicht ein Rodeoreiter getan hätte.
»Was soll das werden? Ein Schiff? Oder vielleicht ein baskischer Pelota-Handschuh?«
»Ich weiß noch nicht.«
»Kennen Sie das Baskenland?«
»Keine Ahnung.«
Freire zog sich einen Stuhl heran und setzte sich halb darauf.
Die klaren blauen Augen hefteten sich auf ihn.
»Bist du Spychiater?«
Freire fiel der Buchstabendreher sofort auf. Vielleicht ein Legastheniker. Auch das Duzen registrierte er, hielt es aber für ein eher positives Zeichen. Er entschloss sich, ebenfalls zum vertraulichen »Du« überzugehen.
»Mein Name ist Mathias Freire. Ich bin der Chef dieser Station. Gestern Abend habe ich dich hierherbringen lassen. Hast du gut geschlafen?«
»Ich habe immer den gleichen Traum.«
Der Mann flocht weiter. Der Dunst von Moor und feuchtem Schilf hing im Raum. Außer seinem großen Hut trug der Koloss ein T-Shirt und eine Hose aus den Beständen der Klinik. Seine riesigen, muskelbepackten Arme waren mit rötlich grauen Haaren bedeckt.
»Erzähl ihn mir.«
»Zuerst ist es immer sehr warm. Und dann wird alles weiß …«
»Wieso weiß?«
»Es ist die Sonne. Eine stechende Sonne, die alles zermalmt.«
»Weißt du, wo der Traum spielt?«
Der Cowboy zuckte die Schultern, ohne von seiner Arbeit aufzublicken. Sein Hantieren mit den langen Stängeln sah aus, als stricke er. Freire fand die Vorstellung komisch.
»Ich gehe durch ein Dorf mit weißen Mauern. Ein spanisches Dorf. Vielleicht auch griechisch – ich habe keine Ahnung. Ich sehe meinen Schatten, der vor mir herläuft. Über die Mauern, über den Boden. Er ist sehr kurz, es muss also Mittag sein.«
Unbehaglich rutschte Freire auf seinem Stuhl hin und her. Ehe der Riese in die Klinik kam, hatte er exakt den gleichen Traum gehabt. Ein Warnsignal?
Zwar glaubte er nicht wirklich an C. G. Jungs Theorie des synchronistischen Prinzips, aber zumindest gefiel sie ihm. Das berühmte Beispiel des Traums vom goldenen Skarabäus fiel ihm ein: Eine Patientin berichtete Jung, dass sie von einem solchen Tier geträumt hatte, während gleichzeitig ein goldfarbener Rosenkäfer gegen die Scheibe des Behandlungszimmers flog.
»Und was passiert dann?«, erkundigte er sich.
»Plötzlich gibt es einen noch viel grelleren Blitz und eine Explosion, die aber keinen Lärm verursacht. Ich kann nichts mehr sehen, weil ich so geblendet bin.«
Rechts von ihnen lachte jemand laut auf. Freire fuhr zusammen. Ein kleiner Mann mit dem grotesken Gesicht eines Wasserspeiers kauerte unter dem Tisch und beobachtete sie. Antoine, genannt Toto. Ein harmloser Irrer.
»Versuche, dich weiter zu erinnern.«
»Ich renne davon. Laufe ziellos durch die weißen Straßen.«
»Ist das alles?«
»Schon. Oder nein. Als ich weglaufe, bewegt sich mein Schatten nicht mehr. Er bleibt auf der Mauer. Wie in Hiroshima.«
»Hiroshima?«
»Nach der Bombe zeichneten sich die Umrisse verbrannter Menschen wie Schatten auf den Mauern ab. Wusstest du das nicht?«
»Doch«, entgegnete Freire. Er erinnerte sich dieses Phänomens nur dunkel.
Sie verstummten. Der Mann ohne Gedächtnis flocht weiter. Plötzlich hob er den Kopf. Seine Augen funkelten im Schatten des Stetsons.
»Was hältst du davon, Doc? Was hat der Traum zu bedeuten?«
»Ich denke, es handelt sich um eine symbolische Verarbeitung deines Unfalls«, improvisierte Freire. »Der weiße Blitz könnte eine Metapher für deinen Gedächtnisverlust sein. Im Grunde hat der Schock, den du erlitten hast, deine Erinnerung mit einem großen weißen Blatt überdeckt.«
Psychiater-Geschwafel. Es klang zwar gut, aber er hatte es sich aus den Fingern gesogen. Allerdings waren einem geschädigten Gehirn schöne Worte und logische Konstrukte ziemlich egal.
»Da gibt es allerdings ein Problem«, murmelte der Koloss. »Diesen Traum träume ich schon sehr lang.«
»Nein, du hast nur diesen Eindruck. Es ist unwahrscheinlich, dass du dich deiner Träume vor dem Unfall erinnerst. Solche Dinge gehören zu deinen intimen, den persönlichen Erinnerungen, und genau die sind ja betroffen – verstehst du?«
»Hat man denn mehrere Arten von Erinnerung?«
»Es gibt so etwas wie eine kulturelle Erinnerung, die allgemeiner ist – wie zum Beispiel deine Erinnerung an Hiroshima –, und eine autobiografische Erinnerung, die dein Leben betrifft. Deinen Namen. Deine Familie. Deinen Beruf. Und eben auch deine Träume.«
Der Riese schüttelte langsam den Kopf.
»Ich weiß nicht, was aus mir werden soll. Mein Kopf ist wie leer gefegt.«
»Mach dir nichts draus. Alles ist noch irgendwo erhalten. Manchmal sind solche Amnesien nur von kurzer Dauer. Sollten sie aber länger anhalten, kennen wir Möglichkeiten, mit denen wir deine Erinnerung stimulieren können – bestimmte Tests und Übungen. Wir werden dein Gedächtnis schon wieder aufwecken.«
Der Unbekannte fixierte Freire mit seinen großen Augen, die jetzt ins Graue spielten.
»Du hast heute Morgen im Krankenhaus abgelehnt, dich röntgen zu lassen. Warum?«
»Ich mag das nicht.«
»Hast du so etwas denn schon einmal gemacht?«
Der Mann antwortete nicht, und Freire ließ es dabei bewenden.
»Kannst du dich vielleicht heute an ein paar Dinge von gestern erinnern?«
»Meinst du, warum ich in dieser Hütte auf dem Bahngelände war?«
»Zum Beispiel.«
»Leider nein.«
»Und der Engländer? Das Telefonbuch?«
Der Mann runzelte die Stirn.
»Sie waren voller Blut, richtig?«
»Ja, voller Blut. Wo kam es her?«
Freire hatte seiner Stimme Autorität verliehen. Das Gesicht des Riesen schien zunächst zu versteinern, dann zeichnete sich Verzweiflung darauf ab.
»Ich … Ich weiß es nicht.«
»Und dein Name? Dein Vorname? Wo kommst du her?«
Sofort bereute Freire die Fragen. Sie waren zu barsch und zu rasch gekommen. Die Angst des Mannes schien sich zu verstärken. Seine Lippen zitterten.
»Wärst du einverstanden, es mit Hypnose zu probieren?«, fügte Freire mit sanfterer Stimme hinzu.
»Jetzt gleich?«
»Nein, morgen. Heute solltest du dich noch ausruhen.«
»Hilft Hypnose?«
»Ich kann dir nichts versprechen. Aber zumindest können wir es versuchen …«
Der Pager an Freires Gürtel piepste. Er warf einen kurzen Blick auf das Display und stand auf.
»Ich muss leider gehen. Ein Notfall. Ich möchte dich bitten, noch einmal über meinen Vorschlag nachzudenken.«
Langsam entfaltete der Cowboy seine ein Meter neunzig und streckte Freire die Hand entgegen. Die Geste war freundlich gemeint, wirkte aber fast beängstigend.
»Nicht nötig, Doc. Ich mache es. Ich vertraue dir. Bis morgen.«
Ein Mann hatte sich in die Toiletten neben der Notaufnahme eingeschlossen und weigerte sich seit einer halben Stunde, wieder herauszukommen. Freire und ein Techniker mit Werkzeugkasten standen vor der Kabine. Nach mehreren vergeblichen Aufforderungen ließ Freire die Tür aufbrechen. Ein bestialischer Gestank schlug ihnen entgegen. Im Halbdunkel der Kabine kauerte ein Mann auf dem Boden neben der Toilettenschüssel, hielt seine Knie umschlungen und hatte den Kopf auf die Arme gelegt.
»Ich bin Psychiater«, sagte Freire und schob die Tür mit der Schulter zu. »Brauchen Sie Hilfe?«
»Hauen Sie ab.«
Freire kniete sich auf den Boden, wobei er den Urinpfützen auswich.
»Wie heißen Sie?«
Keine Antwort. Der Mann hielt immer noch den Kopf in den Armen verborgen.
»Kommen Sie mit in mein Büro«, sagte Freire und legte ihm eine Hand auf die Schulter.
»Ich habe doch gesagt, Sie sollen verschwinden.«
Der Mann hatte einen Sprachfehler. Er verschluckte manche Silben und speichelte übermäßig. Von der Berührung überrascht hatte er den Kopf gehoben. Im Zwielicht konnte Freire sein missgebildetes Gesicht erkennen. Es wirkte gleichzeitig ausgehöhlt und aufgedunsen und so asymmetrisch, als wäre es aus mehreren Stücken zusammengesetzt.
»Stehen Sie auf!«, befahl Freire.
Der Kerl reckte den Hals. Freires erster Eindruck bestätigte sich. Das Gesicht bestand aus einer Ansammlung von geschrumpftem Fleisch, straff gespannter Haut und glänzenden Striemen. Es war entsetzlich anzusehen.
»Vertrauen Sie mir«, sagte Freire. Er kämpfte gegen den Ekel an.
Mehr noch als an Verbrennungen erinnerten die Verheerungen dieses Gesichts an eine Lepraerkrankung. An eine Krankheit, die das Aussehen nach und nach verstümmelte.
Bei genauerem Hinsehen allerdings erkannte Freire, dass der Fall ganz anders lag: Das Narbengewebe war nicht echt. Der Mann hatte sein Gesicht mit einem synthetischen Klebstoff verunstaltet. Er hatte sich selbst entstellt, um Mitleid zu erregen und vielleicht eingewiesen zu werden. Münchhausen-Syndrom, dachte der Psychiater.
»Kommen Sie«, wiederholte er.
Schließlich stand der Mann auf. Freire öffnete die Tür und trat dankbar in Helligkeit und eine einigermaßen frische Luft hinaus. Sie verließen die Toiletten und damit die Kloake, nicht aber den Albtraum. Eine ganze Stunde lang unterhielt sich Freire mit dem Klebstoff-Mann und sah seine erste Annahme bestätigt: Der Besucher war zu allem bereit, um eingewiesen und therapiert zu werden. Doch zunächst überwies Freire ihn in die Universitätsklinik. Das Gesicht des Mannes musste dringend behandelt werden, denn der Klebstoff begann das Gewebe zu verätzen.
17.30 Uhr.
Freire ließ sich in der Notaufnahme ablösen und kehrte zurück auf seine eigene Station. Niemand war mehr da. Er setzte sich an seinen Schreibtisch, aß ein Sandwich und versuchte, sich von dem letzten Zwischenfall zu erholen. Auf der Universität hatte man die jungen Mediziner damit beruhigt, dass man sich an alles gewöhnen könne. Doch bei ihm hatte es nicht funktioniert. Im Gegenteil – es wurde immer schlimmer. Dank der ständigen Konfrontation mit Geisteskrankheiten war seine Sensibilität zu einer dünnen, ständig gereizten Membran geworden, die sich vielleicht sogar schon teilweise infiziert hatte.
18.00 Uhr.
Freire kehrte in die Notaufnahme zurück.
Es war ruhiger geworden. Lediglich einige Patienten warteten noch vor der Ambulanz. Er kannte sie fast alle. Nach anderthalb Monaten an dieser Klinik war er mit den Patienten vertraut, die in regelmäßigen Abständen wiederkamen. Es waren die Kranken, die in der Klinik behandelt wurden, irgendwann in stabilem Zustand nach Hause entlassen werden konnten, ihre Neuroleptika nicht mehr einnahmen und prompt einen Rückfall erlitten. »Da bin ich wieder, Herr Doktor.«
19.00 Uhr.
Er musste nur noch ein paar Stunden durchhalten. Die Müdigkeit hämmerte in seinen Augenhöhlen, als wollte sie seine Lider mit Gewalt schließen. Er dachte an den Mann ohne Gedächtnis. Den ganzen Tag lang war ihm der Patient nicht aus dem Kopf gegangen. Der Fall machte ihn neugierig. Er verschanzte sich in seinem Büro, suchte die Nummer der Polizeiwache an der Place des Capucins und fragte nach Nicolas Pailhas – dem Beamten, der den Fall aufgenommen hatte. Der Polizist hatte an diesem Samstag frei. Nachdem Freire seine Position erläutert hatte, gab man ihm die Handynummer des Kommissars.
Schon beim zweiten Läuten nahm Pailhas ab. Mathias stellte sich vor.
»Ja bitte?« Sein Gesprächspartner wirkte nicht gerade begeistert über die Störung am Wochenende.
»Ich wollte wissen, ob Sie in Ihren Ermittlungen weitergekommen sind.«
»Ich bin zu Hause bei meinen Kindern.«
»Aber Sie haben doch ein paar Anfragen losgeschickt. Sicher liegt Ihnen inzwischen die eine oder andere Antwort vor.«
»Ich wüsste nicht, was Sie das angeht.«
Freire zwang sich, ruhig zu bleiben.
»Ich bin für diesen Patienten verantwortlich, und es ist meine Aufgabe, ihn zu therapieren. Das bedeutet unter anderem, dass ich wissen muss, wer er ist, damit ich ihm helfen kann, sein Gedächtnis wiederzufinden. In diesem Fall sind wir Partner, verstehen Sie?«
»Nein.«
Freire änderte die Taktik.
»Ist in der Region jemand vermisst gemeldet?«
»Nein.«
»Haben Sie die Organisationen benachrichtigt, die sich um Obdachlose kümmern?«
»Ist alles in die Wege geleitet.«
»Haben Sie auch an die Bahnhöfe gedacht, die sich in der Nähe von Bordeaux befinden? Gab es in den Zügen vielleicht irgendwelche Zeugen?«
»Wir kümmern uns darum.«
»Haben Sie eine Suchanzeige mit einer kostenlosen Rufnummer ins Internet gestellt? Sie …«
»Wenn uns die Ideen ausgehen, rufen wir Sie an.«
Freire ging nicht auf den sarkastischen Tonfall ein.
»Was hat die Analyse des Blutes auf dem Werkzeug und dem Telefonbuch ergeben?«
»Null positiv. Es könnte also von ungefähr fünfzig Prozent der französischen Bevölkerung stammen.«
»Wurde in dieser Nacht irgendeine Gewalttat angezeigt?«
»Nein.«
»Was ist mit dem Telefonbuch? Wurde eine Seite oder ein Name markiert?«
»Könnte es sein, dass Sie sich für einen Bullen halten?«
Mathias biss die Zähne zusammen.
»Ich versuche doch nur, den Mann zu identifizieren. Noch einmal: Wir beide ziehen am gleichen Strang. Morgen werde ich es mit Hypnose versuchen. Wenn Sie also auch nur den kleinsten Hinweis oder irgendeine Information besitzen, die meine Fragen in eine bestimmte Richtung lenken können, dann sollten Sie sie mir jetzt geben.«
»Da gibt es nichts«, knurrte der Polizist. »Wie oft soll ich es Ihnen noch sagen?«
»Ich habe auf der Wache angerufen. Anscheinend arbeitet heute niemand an dem Fall.«
»Morgen früh bin ich wieder im Dienst«, sagte der Polizist übellaunig. »Der Fall gehört zu meinen vorrangigen Aufgaben.«
»Was haben Sie mit dem Werkzeug und dem Telefonbuch gemacht?«
»Wir haben ein Eilverfahren eingeleitet, um die entsprechende Erfassung zu beschleunigen.«
»Bitte das Ganze noch mal so, dass es auch ein Normalsterblicher versteht.«
Der Polizist lachte. Seine Stimmung besserte sich zusehends.
»Die Sachen sind bei der Spurensicherung. Montag bekommen wir die Resultate. War das jetzt besser?«
»Darf ich auf Sie zählen? Auch der kleinste Hinweis wäre mir wichtig.«
»Gut«, sagte Pailhas deutlich verbindlicher. »Aber die Sache funktioniert nur auf Gegenseitigkeit. Sollten Sie mit Ihrer Hypnose etwas herausfinden, rufen Sie mich an.«
Er machte eine kurze Pause und fügte dann hinzu:
»Es liegt in Ihrem eigenen Interesse.«
Mathias musste lächeln. Reflexartige Drohung. Eigentlich müsste jeder Bulle eine Psychoanalyse über sich ergehen lassen, damit man wüsste, warum er ausgerechnet diesen Beruf gewählt hat. Freire versprach, sich zu melden, und gab Pailhas seine Telefonnummer. Keiner der beiden glaubte an ein Feedback. Das Motto lautete: Jeder für sich, und möge der Bessere gewinnen.
Freire kehrte in die Notaufnahme zurück. Er musste nur noch zwei Stunden durchhalten und durfte dann vor dem üblichen Samstagabend-Chaos nach Hause gehen. Er kümmerte sich nacheinander um mehrere Patienten, verschrieb Antidepressiva und Anxiolytika und schickte die Leute wieder nach Hause.
22.00 Uhr.
Mathias begrüßte den Arzt, der ihn ablöste und sein Büro aufsuchte. Der Nebel hatte sich noch immer nicht aufgelöst. Im Gegenteil, mit Einbruch der Dunkelheit schien er sich verdichtet zu haben. Freire fiel auf, dass der dichte Dunst seinen ganzen Tag verdüstert hatte. Als wäre in der dampfigen Luft nichts wirklich real.
Er legte den Kittel ab, suchte seine Sachen zusammen und schlüpfte in den Regenmantel. Ehe er ging, wollte er noch einmal kurz bei dem Mann mit dem Stetson vorbeischauen. Er betrat die erste Etage seiner Station. Im Flur roch es nach Essen, Urin, Äther und Medikamenten. Er hörte das Schlurfen von Pantoffeln auf dem Linoleum, laufende Fernseher und das klackende Geräusch eines Aschenbechers.
Plötzlich sprang eine Frau auf Freire zu. Unwillkürlich zuckte er zurück, doch dann erkannte er sie. Jeder nannte sie nur Mistinguett; auch er hatte ihren wirklichen Namen vergessen. Sie war sechzig Jahre alt, von denen sie vierzig in der Anstalt verbracht hatte. Bösartig war sie nicht, aber ihr Äußeres sprach nicht unbedingt für sie. Weißes, wirres Haar. Graue Haut, schlaffe Züge. Ihre fiebrigen Augen glitzerten grausam. Sie klammerte sich an den Kragen von Freires Trenchcoat.
»Immer mit der Ruhe, Mistinguett«, sagte er und löste ihre klauenartigen Hände von seinem Revers. »Gehen Sie schlafen.«
Die Frau lachte höhnisch auf, ehe ihr Lachen sich in ein hasserfülltes Pfeifen und schließlich in ein verzweifeltes Keuchen verwandelte.
Freire griff nach ihrem Arm. Sie roch unangenehm nach einem Einreibemittel und abgestandenem Urin.
»Haben Sie Ihre Tabletten genommen?«
Wie oft am Tag wiederholte er diese Worte? Schon längst war es keine Frage mehr. Eher ein Gebet, eine Litanei, eine Beschwörung. Es gelang ihm, Mistinguett in ihr Zimmer zurückzubringen. Ehe sie noch irgendetwas sagen konnte, verschloss er die Tür.
Ihm fiel auf, dass er aus einem Reflex heraus nach seiner magnetischen Chipkarte gegriffen hatte, mit der er Alarm auslösen konnte. Man brauchte bloß damit über einen Heizkörper oder ein Stahlrohr zu streichen, dann kamen Pfleger in hellen Scharen angerannt. Mit einem unbehaglichen Gefühl steckte er die Karte wieder in die Tasche seines Kittels. Gab es eigentlich einen Unterschied zwischen seinem Job und dem eines Gefängniswärters?
Freire erreichte das Zimmer des Cowboys und klopfte vorsichtig. Niemand antwortete. Er drückte die Klinke und betrat das abgedunkelte Zimmer. Der Koloss lag unbeweglich auf seiner Pritsche. Der Stetson und die Stiefel waren neben dem Bett aufgereiht wie brave Haustiere.
Leise trat Freire neben ihn, um ihn nicht zu erschrecken.
»Ich heiße Mischell«, murmelte der Riese.
Jetzt war es Freire, der erschrak.
»Ich heiße Mischell«, wiederholte der Mann. »Ich habe ein oder zwei Stunden geschlafen, und das ist dabei herausgekommen.« Er wandte dem Psychiater den Kopf zu. »Nicht schlecht, oder?«
Mathias öffnete seine Aktentasche und wühlte nach einem Stift und einem Heft. Langsam gewöhnten seine Augen sich an den Halbschatten.
»Ist das dein Vorname?«
»Nein, mein Nachname.«
»Wie wird es geschrieben?«
»M.I.S.C.H.E.L.L.«
Freire schrieb es auf, ohne daran zu glauben. Die Erinnerung kam zu schnell. Zweifellos verzerrt oder einfach nur ausgedacht.
»Ist dir im Schlaf vielleicht noch etwas eingefallen?«
»Nein.«
»Hast du geträumt?«
»Ich glaube schon.«
»Wovon?«
»Immer das Gleiche, Doc. Das weiße Dorf. Die Explosion. Mein Schatten, der an der Mauer klebte …«
Er sprach mit schläfriger, belegter Stimme. Mathias schrieb mit. Traumbücher konsultieren. Legenden über Schatten überprüfen. Er wusste längst, womit er sich an diesem Abend beschäftigen würde. Als er den Kopf von seinen Aufzeichnungen hob, atmete der Mann ganz regelmäßig. Er war wieder eingeschlafen. Freire zog sich leise zurück. Immerhin ein ermutigendes Anzeichen. Die Hypnose morgen würde vielleicht einen gewissen Erfolg bringen.
Er verließ den Pavillon. Die Deckenbeleuchtung war ausgeschaltet worden – Schlafenszeit für die Patienten.
Draußen verhüllte der Nebel Palmen und Laternen im Hof wie mit großen Segeln eines Geisterschiffs. Freire musste an Christo denken, der den Pont-Neuf und den Berliner Reichstag verpackt hatte. Ihm kam eine merkwürdige Idee. Wenn es nun der nebelhafte Geist des Mannes ohne Gedächtnis war, der die Klinik und die ganze Stadt einhüllte? Bordeaux befand sich vielleicht unter der Dunstglocke dieses Reisenden im Nebel …
Auf dem Weg zum Parkplatz änderte Freire seine Absichten.
Er hatte weder Hunger noch die geringste Lust, nach Hause zu fahren.
Eigentlich konnte er ebenso gut jetzt gleich die ersten Informationen überprüfen.
Er kehrte in sein Büro zurück, setzte sich noch im Mantel vor seinen PC und rief die landesweite Zentralmeldestelle für verschreibungspflichtige Medikamente auf.
Der Name Mischell war nicht zu finden.
Freire benutzte dieses Programm so gut wie nie, daher wusste er nicht, ob die Meldestelle möglicherweise einem strengen Datenschutz unterlag.
Angesichts dieses Fehlschlags bekam er erst recht Lust weiterzuforschen. Der Mann mit dem Engländer hatte keine Papiere bei sich gehabt, als er auf dem Bahngelände aufgegriffen worden war. Seine Kleidung war abgetragen. Außerdem wies er Merkmale eines Lebens im Freien auf: Seine Haut war gebräunt, die Hände von der Sonne verbrannt.
Mathias griff zum Telefon und rief die örtliche Obdachlosenhilfe an, die rund um die Uhr besetzt war. Kein Mischell bekannt. Auch bei dem Rehabilitationszentrum und dem Sozialdienst, die beide über eine nächtliche Rufbereitschaft verfügten, wurde er nicht fündig. In keinem der Archive gab es einen Mischell.
Eine Suche in den Online-Telefonbüchern ergab das gleiche Resultat. Weder in der Region Aquitaine noch im benachbarten Midi-Pyrénées fand er den Namen Mischell. Doch das verwunderte ihn nicht. Er hatte bereits vermutet, dass der Mann, ohne sich dessen bewusst zu sein, seinen Namen verballhornte. Das kurze Aufblitzen von Erinnerungen konnte in diesem frühen Stadium noch nicht anders als unvollkommen sein.
Da kam Mathias eine neue Idee. Laut Polizeibericht stammte das Telefonbuch, das der Mann bei sich gehabt hatte, aus dem Jahr 1996.
Nach langem Suchen im Internet fand er ein Programm, das die Einsicht in alte Telefonbücher ermöglichte. Er wählte das Jahr 1996 und fahndete nach dem Namen Mischell. Doch alle Mühe war vergebens. In keinem der fünf Departements der Region Aquitaine tauchte der Name auf. Kam der Cowboy etwa von weiter her?
Freire rief Google auf und tippte einfach den Namen »Mischell« ein. Doch auch hier erhielt er nur ein mageres Ergebnis: unter anderem ein Profil auf MySpace.com, in dem ein gewisser Mischell eine Videomontage mit den Helden aus Akte X, Mulder und Scully, eingestellt hatte, die musikalischen Ergüsse einer Sängerin namens Tommi Mischell und die Seite einer Hellseherin, die Patricia Mischell hieß und in den USA im Bundesstaat Missouri beheimatet war. Die Suchmaschine legte ihm außerdem nahe, es mit der Schreibweise »Mitchell« zu probieren.
Mitternacht. Nun war es aber wirklich Zeit, nach Hause zu fahren. Mathias schaltete den Computer aus und suchte seine Unterlagen zusammen. Auf dem Weg zum Tor überlegte er, dass er vielleicht der Obdachlosenhilfe in Bordeaux und im Umland ein Foto des Cowboys zukommen lassen sollte. Am besten auch den medizinisch-psychologischen Zentren und den Einrichtungen für psychiatrische Teilzeitbetreuung. Er kannte sie alle und würde sie selbst aufsuchen, denn er war ziemlich sicher, dass sein Patient nicht zum ersten Mal unter psychischen Problemen litt.
Der Nebel zwang ihn zu Schrittgeschwindigkeit, und er brauchte fast eine Viertelstunde bis zu seinem Haus. Entlang der Gärten parkte eine ungewöhnlich große Zahl Autos: die üblichen Samstagabend-Einladungen. Da er keinen Parkplatz fand, stellte er sein Auto hundert Meter entfernt ab und tastete sich zu Fuß durch den weißlichen Dunst. Die Straße schien keine Konturen mehr zu haben, die Laternen schwebten im Nebel. Alles wirkte leicht und körperlos. Als Freire sich dieses Eindrucks bewusst wurde, stellte er fest, dass er sich verlaufen hatte. Er ging an den feucht beperlten Hecken und geparkten Autos entlang. Ab und zu stellte er sich auf die Zehenspitzen, um die Namen der einzelnen Häuser entziffern zu können.
Endlich entdeckte er die vertrauten Buchstaben: Opal.
Behutsam öffnete er das Gartentor. Sechs Schritte. Einmal den Schlüssel drehen. Mit einer gewissen Erleichterung schloss er die Tür hinter sich, trat in den Windfang, stellte seine Aktentasche ab, legte den Regenmantel auf einen der Kartons und ging in die Küche, ohne Licht zu machen. Die standardisierten Abläufe seines einsamen Lebens entsprachen dem Standardgrundriss seines Hauses.
Nur Minuten später stand er am Küchenfenster und ließ seinen Tee ziehen. Im Haus war es ganz still; trotzdem hatte er den Eindruck, immer noch die Geräuschkulisse der Klinik zu hören. Alle Psychiater kennen dieses Phänomen und nennen es die »Musik der Verrückten«. Verballhornte Sprache. Schlurfende Schritte. Krisen. Freires Kopf summte von diesen Geräuschen wie eine Meermuschel. Seine Patienten verließen ihn niemals ganz. Oder anders ausgedrückt: Er war es, der die Station Henri-Ey nie ganz verließ.
Plötzlich stutzte er.
Der Geländewagen vom Vortag tauchte aus dem Nebel auf. Langsam, sehr langsam fuhr er die Straße entlang und blieb vor Freires Haus stehen. Mathias spürte, dass sein Herzschlag sich beschleunigte. Die beiden Männer in Schwarz stiegen gleichzeitig aus und postierten sich vor seinem Fenster.
Freire versuchte zu schlucken, doch es ging nicht. Er beobachtete die Männer, ohne sich um ein Versteck zu bemühen. Beide maßen mindestens einen Meter achtzig und trugen unter ihren Mänteln hochgeschlossene dunkle Anzüge, deren Stoff im Licht der Straßenlaternen schimmerte. Dazu weiße Hemden und schwarze Krawatten. Beide wirkten in ihrer rigiden, aufrechten Haltung wie Absolventen eines militärischen Elitekollegs, doch gleichzeitig haftete ihnen auch etwas Gewalttätiges, Geheimnisvolles an.
Mathias stand wie versteinert. Fast erwartete er, dass sie gleich das Gartentor öffnen und an seiner Haustür klingeln würden. Aber nein – die beiden Männer rührten sich nicht vom Fleck. Sie blieben unter der Laterne stehen, ohne auch nur zu versuchen, sich zu verstecken. Ihre Gesichter passten ausgezeichnet zu ihrem Erscheinungsbild. Der erste hatte eine hohe Stirn, trug eine Schildpattbrille, und sein silbernes Haar war aus dem Gesicht gekämmt. Der andere wirkte noch grimmiger. Sein langer brauner Schopf wurde bereits schütter. Sein Gesichtsausdruck unter den dichten Augenbrauen war unstet.
Beide Gesichter zeigten regelmäßige Züge – zwei Playboys in den Vierzigern, die sich in ihren italienischen Maßanzügen wohlfühlten.
Wer waren sie? Und was wollten sie?
Der Schmerz in der linken Augenhöhle kehrte zurück. Freire schloss die Augen und massierte sich vorsichtig die Lider. Als er die Augen wieder öffnete, waren die beiden Gestalten verschwunden.
Anaïs Chatelet konnte es kaum fassen. Was für ein verdammter Glücksfall!
Ein Bereitschaftsdienst am Samstagabend, und es gab tatsächlich eine Leiche. Ein waschechter Mord, einschließlich eines Rituals und diverser Verstümmelungen. Kaum hatte sie die Benachrichtigung erhalten, als sie sich auch schon in ihren Privatwagen setzte und an den Fundort der Leiche fuhr – den Bahnhof Saint-Jean. Unterwegs rief sie sich die Informationen ins Gedächtnis, die man ihr gegeben hatte. Ein junger Mann. Nackt. Keine sichtbaren Verletzungen, aber eine aberwitzige Inszenierung. Genaueres wusste sie noch nicht, doch das Ganze roch geradezu nach dem Werk eines Verrückten, nach Grausamkeit und Finsternis. Nicht einfach nur ein blöder Streit, der ausgeartet war, oder ein banaler Raubmord. Etwas richtig Ernsthaftes!
Als sie die Polizeiwagen sah, die mit eingeschaltetem Blaulicht im Nebel vor dem Bahnhof standen, und die Polizisten in ihren Regenmänteln, die wie glänzende Gespenster geschäftig umhereilten, begriff sie, dass es wirklich wahr war. Ihr erster Mord seit der Ernennung zur Hauptkommissarin. Sie würde ein Ermittlungsteam zusammenstellen, den Fall lösen, den Mörder einbuchten und auf den Titelseiten der Gazetten landen. Und das mit neunundzwanzig Jahren!
Sie stieg aus und atmete die feuchte Atmosphäre ein. Seit mittlerweile sechsunddreißig Stunden lag Bordeaux unter diesem weißlichen Nebel. Man hatte den Eindruck, sich in einem Sumpf samt seinen Ausdünstungen, seinem schuppigen Getier und seinen feuchten Gerüchen zu befinden. Dies fügte dem Ereignis eine zusätzliche Dimension hinzu: ein Mord im Nebel. Anaïs zitterte vor Erregung.
Ein Polizist von der Wache an der Place des Capucins kam auf sie zu.
Die Leiche war vom Führer einer Rangierlok entdeckt worden, der Zugteile zwischen dem Betriebshof und dem eigentlichen Bahnhof hin und her manövrierte. Der Mann hatte seinen Dienst gegen 23.00 Uhr angetreten und seinen Wagen auf dem Dienstparkplatz abgestellt. Seinen Arbeitsplatz erreichte er von dort aus durch einen seitlichen Verbindungsgang. Die Leiche lag in einer stillgelegten Reparaturgrube zwischen dem Gleis 1 und dem ehemaligen Bahnbetriebswerk. Natürlich hatte der Lokführer sofort die Bahnpolizei und den privaten Sicherheitsdienst benachrichtigt, der auf dem Bahngelände Dienst tat. Anschließend wurde die nächstgelegene Polizeiwache an der Place des Capucins verständigt.
Der weitere Verlauf war Anaïs bekannt. Um ein Uhr morgens hatte man den Oberstaatsanwalt aus dem Bett geholt, der seinerseits die Kriminalpolizei einschaltete. Und die Hauptkommissarin vom Dienst war sie. Die meisten anderen Polizisten waren mit Banalitäten beschäftigt, die der penetrante Nebel nach sich zog: Autounfälle, Plünderungen, Vermisstenanzeigen … Und so war es dazu gekommen, dass sie, Anaïs Chatelet, mit ihren zwei Jahren Berufserfahrung in Bordeaux das Sahnehäubchen dieser Nacht zugedacht bekam.
Gemeinsam mit dem Kollegen durchquerte sie die Bahnhofshalle. Ein Bahnbeamter reichte ihnen fluoreszierende Warnwesten. Während Anaïs mit den Klettverschlüssen herumhantierte, nahm sie sich eine Sekunde Zeit, die fast dreißig Meter hohe Stahlkonstruktion zu bewundern, die sich nach oben hin im Nebel verlor. Sie gingen den Bahnsteig entlang bis zu den äußeren Gleisen. Der Bahnbeamte redete ununterbrochen. So etwas habe man noch nie gesehen. Der gesamte Bahnverkehr sei auf Anordnung des Oberstaatsanwalts für zwei Stunden unterbrochen worden. Der Tote in der Grube sei eine Monstrosität. Alle seien völlig schockiert …
Anaïs hörte kaum zu. Sie spürte, wie die Feuchtigkeit ihren Nacken hinunterlief. Ihr wurde kalt. Im Dunst formten die sämtlich auf Rot stehenden Signale des Bahnhofs ein verschwommenes, blutiges Gebilde. Die elektrischen Oberleitungen trieften. Die nassen Gleise glitzerten, verloren sich aber bald in den wabernden Nebelschwaden.
Anaïs knickte auf den Schwellen und im Schotter um.
»Könnten Sie bitte auf den Boden leuchten?«
Der Bahnbeamte senkte den Lichtstrahl seiner Lampe und fuhr mit seinem Bericht fort. Anaïs schnappte ein paar technische Details auf. Die Gleise mit den geraden Nummern führten nach Paris, die mit den ungeraden Bezeichnungen hinunter in den Süden. Die Metallkonstruktionen auf den Dächern der Lokomotiven hießen »Stromabnehmer«. Zwar nützte ihr dieses Wissen im Augenblick gar nichts, trotzdem hatte sie den seltsamen Eindruck, sich auf diese Weise mit dem Verbrechen vertraut zu machen.
»Wir sind da.«
Die Projektoren der Spurensicherung sahen aus wie ferne, kalte Monde in der Nacht. Die Strahlen der Taschenlampen zeichneten weiße Lichtbänder in die Dunkelheit. In einiger Entfernung konnte man das Bahnbetriebswerk erahnen, in dem Lokomotiven und Draisinen unter einer silbrig feuchten Patina schimmerten. Auch Rangierloks, die Gegenstücke zu den Lotsenschiffen im Hafen, waren dort abgestellt. Die wuchtigen schwarzen Maschinen wirkten wie schweigsame Titanen.
Sie krochen unter den Absperrbändern hindurch und erreichten den Fundort der Leiche. Am Rand der Reparaturgrube standen die verchromten Stative der Projektoren. Techniker der Spurensicherung in weißen Overalls mit blauen Schriftzügen machten sich unten zu schaffen. Anaïs wunderte sich, dass sie bereits zur Stelle waren, denn das nächstgelegene Labor befand sich in Toulouse.
»Möchten Sie die Leiche sehen?«
Vor ihr stand ein Polizist in einer Regenjacke, über die er die Sicherheitsweste gezogen hatte. Mit entschlossener Miene nickte sie. Innerlich kämpfte sie gegen den Nebel, ihre Ungeduld und eine gewisse Erregung an. Auf der Universität hatte ein Juraprofessor sie eines Tages im Flur angehalten und ihr zugeflüstert: »Sie sind wie die Alice im Wunderland von Lewis Carroll. Ihre Aufgabe besteht darin, eine Welt zu finden, die Ihrer würdig ist.« Seither waren acht Jahre vergangen, und sie lief auf dem Weg zu einer Leiche zwischen Bahngleisen hindurch. Eine Welt, die Ihrer würdig ist …
Auf dem Grund der Grube, die etwa fünf Meter lang und zwei Meter breit war, herrschte das rege Treiben, das an Leichenfundorten üblich war, allerdings in einer gedrängten Version. Die Techniker benutzten ihre Ellbogen, um sich Platz zu schaffen, fotografierten, suchten jeden Millimeter des Bodens mit Speziallampen ab – Leuchten mit einem begrenzten Spektralbereich von Infrarot bis Ultraviolett – und versiegelten jedes noch so kleine Fundstück in besonderen Plastiktüten.
Schließlich entdeckte Anaïs im Gewimmel auch die Leiche. Es handelte sich um einen jungen Mann von etwa zwanzig Jahren. Er war nackt, sehr mager und fast am ganzen Körper tätowiert. Seine Knochen traten spitz hervor, und da, wo die Haut nicht mit Tattoos bedeckt war, schimmerte sie in einem fast phosphoreszierenden Weiß. Die Schienenstränge, die rechts und links an der Grube vorbeiführten, verliehen dem Ganzen eine Art Rahmen. Anaïs musste an ein Renaissancegemälde denken. Ein Märtyrer mit blassem Fleisch, der sich in schmerzlicher Haltung in der Tiefe einer Kirche krümmt.
Der wirkliche Schock jedoch war der Kopf.
Der Kopf war nicht menschlich, sondern gehörte zu einem Stier.
Mächtig, tiefschwarz und mindestens fünfzig Kilo schwer, war er am unteren Ende des Nackens abgetrennt worden.