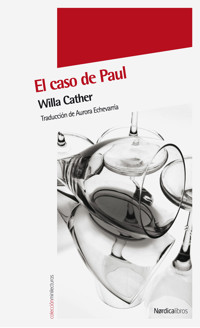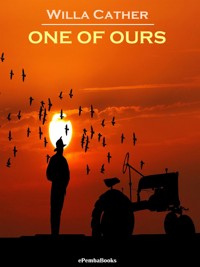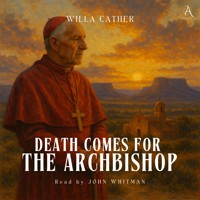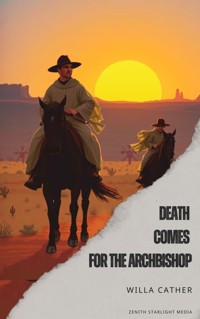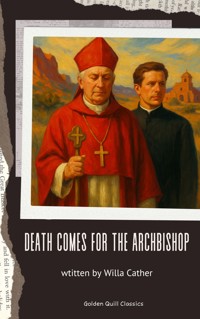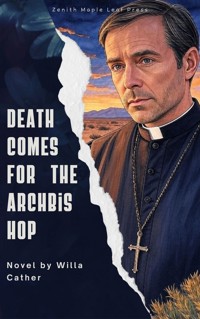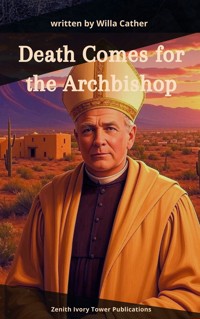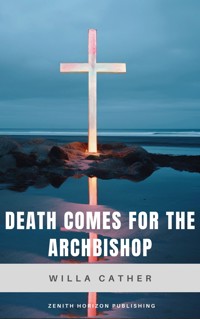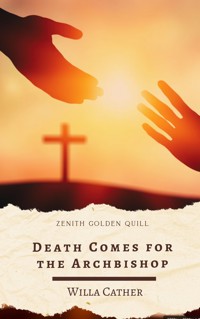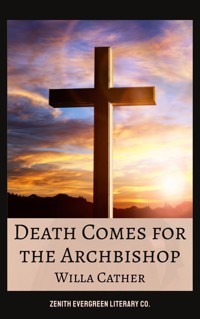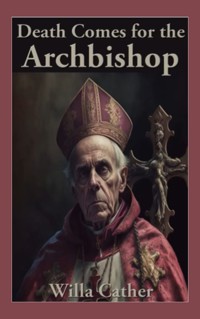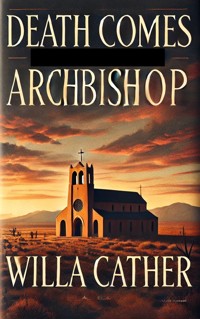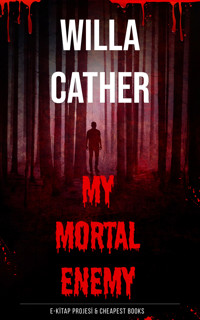16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Andere Bibliothek
- Sprache: Deutsch
Die unentdeckten Erzählungen einer der großen Stilistinnen der amerikanischen Literatur.
Mit trügerisch einfachen Worten und dem klaren Rhythmus ihrer Sätze leuchtet Willa Cather das Innenleben ihrer Figuren ebenso aus, wie sie deren Umfeld zum Leben erweckt: die leere Weite Nebraskas, die urbanen Räume New Yorks, die mythischen Felslandschaften des amerikanischen Südwestens oder einer schroffen Atlantikinsel. In »Der verwunschene Fels« blickt der Ich-Erzähler zurück auf eine Sommernacht mit seinen Schulfreunden auf einer Sandbank im Fluss: Sie erzählen einander von den Abenteuern, die sie bestehen wollen, und von ihren Träumen für die Zukunft, die doch von der Realität des Erwachsenseins eingeholt werden. Wie nebenbei scheinen bei Cather die großen Fragen unserer Existenz auf. Und sie führt uns bestechend klar vor Augen, wie Gesellschaft und Landschaft bestimmen, wer wir sind – bis wir uns von den Fesseln befreien.
»Cathers Erzählungen sind eine Liebeserklärung an die Orte, an denen sie lebte – und die Frauen, die sie liebte.« Agnes Krup.
»Literatur sollte aus dem erwachsen, was man um sich herum vorfindet.« Willa Cather.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 419
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Über das Buch
Die neu entdeckten Erzählungen einer der großen Stilistinnen der amerikanischen Literatur
Mit so einfach erscheinenden Worten und dem klaren Rhythmus ihrer Sätze leuchtet Willa Cather das Innenleben ihrer Figuren aus und erweckt deren Umfeld zum Leben:
Ob sechs Schulfreunde in einer Sommernacht auf einer Sandbank im Fluss von bevorstehenden Abenteuern träumen, Nelly Deane mit ungestümer Lebenslust nach den Sternen greift, der Lehrling Paul mit erschlichenem Geld in einem New Yorker Hotel die weite Welt schnuppert oder die alte Mrs. Harris versucht, ihrer Enkelin einen großen Zukunftswunsch zu erfüllen – wie nebenbei scheinen bei Cather die großen Fragen unserer Existenz auf. Und sie führt uns bestechend klar vor Augen, wie Gesellschaft und Landschaft bestimmen, wer wir sind. Bis wir uns von den Fesseln befreien.
Größtenteils zum ersten Mal übersetzt von Agnes Krup, die in ihrem Nachwort zeigt, wie Leben und Werk der Autorin zusammengehören.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlage.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Willa Cather
Der verwunschene Fels
und andere Erzählungen
Aus dem Amerikanischen von Agnes Krup
Herausgegeben von Agnes Krup
Übersicht
Cover
Titel
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Inhaltsverzeichnis
Titelinformationen
Informationen zum Buch
Newsletter
Der verwunschene Fels
Ein Wagner-Konzert
Pauls Fall
Auf der Straße der Möwen — Die Geschichte des Botschafters
Die Lebenslust der Nelly Deane
Schon bald: Aphrodite!
Die alte Mrs. Harris
Vor dem Frühstück
Willa Cather — * 1873 Winchester, Virginia † 1947 New York City
Ein Nachwort — Von Agnes Krup
Bildnachweis
Anmerkungen
Impressum
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
271
272
273
274
275
276
278
279
281
282
283
286
287
288
289
290
291
292
294
295
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
Willa Cather, 1927; Foto: Edward Steichen
Der verwunscheneFels
Wir waren vor Sonnenuntergang geschwommen, und während wir das Abendessen zubereiteten, glitzerten die schrägen Lichtstrahlen auf dem weißen Sand rings um uns her. Der durchsichtige rote Ball selbst versank hinter der braunen Weite der Maisfelder, als wir uns zum Essen setzten, und die warme Luftschicht, die über dem Wasser und unserer unberührten Sandbank gelegen hatte, kühlte ab und roch nach modrigen Scheinastern und Sonnenblumen, die an dem flacheren Ufer wuchsen. Der Fluss war braun und träge, wie jeder des halben Dutzends Flüsse, die Nebraskas Ackerland wässern. Ein Ufer wurde von einer unregelmäßigen Reihe kahler Lehmvorsprünge gebildet, auf denen ein paar Buscheichen mit dicken Stämmen und flachen, verkrümmten Kronen lichte Schatten über das lange Gras warfen. Das westliche Ufer war flach und eben, mit Maisfeldern, die sich bis zum Horizont erstreckten, und entlang der Uferkante gab es überall kleine sandige Buchten und Strände, in denen schlanke Schwarzpappeln und Weidentriebe schimmerten.
Im Frühjahr war das Wasser zu reißend, um eine Mühle zu betreiben, weshalb sich die viel beschäftigten Farmer nicht um den Fluss scherten, abgesehen davon, dass sie die alte rote Brücke instand hielten; und so waren die Jungen von Sandtown seine unstrittigen Herrscher. Im Herbst jagten wir Wachteln in den Stoppel- und Futterflächen, die sich meilenweit an dem flachen Ufer entlangzogen, und wenn die Schlittschuhsaison vorüber und das Eis des Winters geschmolzen war, sorgten die Hochwasser und Überschwemmungen des Frühjahrs regelmäßig für große Begeisterung. Das Flussbett verlief in jedem Jahr anders. Der angeschwollene Strom unterspülte manchmal einen Vorsprung am östlichen Ufer, oder er grub sich durch mehrere Morgen eines Maisfelds auf der westlichen Seite, wirbelte die Erde davon und spülte sie anderswo als schaumige Schlammbank wieder an. Wenn der Wasserstand dann in der Mitte des Sommers fiel, tauchten überall neue Sandbänke auf, die in der Augustsonne trockneten und bleichten. Manchmal erreichten sie eine solche Festigkeit, dass die Gewalt des nächsten Hochwassers sie nicht mehr fortzubringen vermochte; die kleinen Weidensprösslinge tauchten triumphierend aus dem gelben Schaum auf, schlugen im Frühjahr aus, schossen im Sommer empor, und mit ihrem Wurzelgeflecht hielten sie den feuchten Sand zusammen gegen die Anstürme des nächsten Aprils. Dazwischen zeigte sich hier und dort bald eine Schwarzpappel, in dem Luftzug zitternd, der sogar an jenen windstillen Tagen über der Wasseroberfläche erbebte, an denen der Staub wie Rauch über dem Karrenweg hing.
Auf einer solchen Insel, im dritten Sommer ihres gelbgrünen Bestehens, entzündeten wir unser Wachfeuer; nicht im Dickicht der tanzenden Weidenstämme, sondern auf der ebenen Fläche feinen Sandes, die in diesem Frühjahr hinzugekommen war; ein kleines neues Stück Welt, wunderhübsch gezeichnet vom Muster der Wellen und übersät von den winzigen Skeletten der Schildkröten und Fische, alle so ausgebleicht und getrocknet, als seien sie von Könnerhand präpariert. Wir hatten uns sehr bemüht, die Reinheit des Ortes nicht zu zerstören, obwohl wir an Sommerabenden häufig hinüberschwammen und uns zum Ausruhen auf den Sand legten.
Es war unser letztes Wachfeuer in diesem Jahr, und es gab Gründe, weshalb es mir besser im Gedächtnis blieb als die anderen. In der kommenden Woche würden die Jungs ihre angestammten Plätze in der höheren Schule von Sandtown wieder einnehmen, ich aber sollte auf die Hochebene hinauf, in meiner ersten Landschule unterrichten, bei den norwegischen Siedlern. Ich war schon jetzt krank vor Heimweh bei dem Gedanken, die Jungs zurückzulassen, mit denen ich seit meiner Kindheit gespielt hatte; bei dem Gedanken, den Fluss zu verlassen und auf die windige Ebene hinaufzuziehen, wo es nichts gab als Windmühlen und Maisfelder und endloses Weideland; wo die Landschaft nichts Mutwilliges und nichts Widerspenstiges hatte, keine neuen Inseln und nicht eine einzige mir fremde Vogelart – wie jene, die so oft den Wasserläufen folgten.
Andere Jungen kamen und gingen und nutzen den Fluss zum Fischen oder Schlittschuhlaufen, aber wir sechs hatten uns dem Geist des Stroms verschworen und waren vor allem des Flusses wegen Freunde. Da waren die beiden Hassler-Brüder, Fritz und Otto, die Söhne des kleinen deutschen Schneiders. Sie waren die Jüngsten unter uns; zerlumpte Jungs von zehn und zwölf Jahren, das Haar von der Sonne gebleicht, mit blassblauen Augen in den vom Wetter gezeichneten Gesichtern. Otto, der ältere, war in der Schule der beste in Mathematik und von rascher Auffassungsgabe, aber er schmiss die Schule in jedem Frühjahr, als ob der Fluss ohne ihn nicht vorankommen könne. Er und Fritz fingen die fetten gehörnten Katzenwelse und verkauften sie in der Stadt, und sie verbrachten so viel Zeit im Wasser, dass sie braun und sandig waren wie der Fluss selbst.
Da war Percy Pound, ein dicker, sommersprossiger Junge mit Pausbacken, der ein halbes Dutzend Heftchenromane abonniert hatte und dauernd nachsitzen musste, weil er unter seinem Pult Detektivgeschichten las. Da war Tip Smith, dem wegen seiner Sommersprossen und seiner roten Haare in allen unseren Spielen die Rolle des Kaspers zufiel, obwohl er den Gang eines schüchternen alten Männleins hatte und ein merkwürdig raues Lachen. Tip schuftete jeden Nachmittag im Geschäft seines Vaters, und morgens vor der Schule fegte er dort aus. Selbst in seiner Freizeit plagte er sich ab. Er sammelte unermüdlich Zigarettenkarten und Tabak-Blechmarken, und er verbrachte Stunden in seiner Bodenkammer, über eine quietschende kleine Laubsäge gebeugt. Sein kostbarster Besitz waren ein paar gläserne Tablettenröhrchen, die angeblich Weizenkörner aus dem Heiligen Land, Wasser aus dem Jordan und Erde vom Ölberg enthielten. Sein Vater hatte diese banalen Gegenstände einem missionierenden Baptisten abgekauft, der damit Handel trieb, und Tip schien aus ihrer entlegenen Herkunft tiefe Befriedigung zu gewinnen.
Der hoch aufgeschossene Junge war Arthur Adams. Er hatte hübsche nussbraune Augen, die für einen Jungen fast zu nachdenklich und teilnahmsvoll waren, und eine so wohlklingende Stimme, dass wir ihn alle liebend gern vorlesen hörten. Selbst wenn er in der Schule aufgefordert wurde, Gedichte vorzulesen, wäre niemand auf die Idee gekommen zu lachen. Allerdings war er nicht sehr oft in der Schule anzutreffen. Er war siebzehn und hätte den Abschluss im Vorjahr machen sollen, aber er war immer irgendwo mit seinem Gewehr unterwegs. Arthurs Mutter war tot, und sein Vater, stets mit fieberhaftem Eifer in irgendwelche Pyramidensysteme verwickelt, wollte ihn auf eine auswärtige Schule schicken, um ihn loszuwerden. Aber Arthur erbettelte sich immer ein weiteres Jahr Aufschub und versprach, sich auf den Hosenboden zu setzen. Ich erinnere ihn als einen großen, dunklen Jungen mit einem intelligenten Gesicht, der sich inmitten von uns Kleineren fläzte, öfter über uns lachte als mit uns, aber mit einem derart weichen, zufriedenen Lachen, dass wir uns fast geschmeichelt fühlten, es verursacht zu haben. Später sagten die Leute, Arthur sei schon als Junge auf Abwege geraten, und es stimmt, dass wir ihn oft mit den Söhnen des Glücksspielers sahen und mit dem Sohn der alten Spanischen Fanny, aber welch schlechten Einfluss diese Gesellschaft auch auf ihn hatte, er gab ihn nicht an uns weiter. Wir wären Arthur überallhin gefolgt, und ich muss sagen, dass er uns nie an üblere Orte geführt hat als in die von Rohrkolben bestandenen Sümpfe und die Stoppelfelder. Das also waren die Jungs, die in jener Sommernacht mit mir auf der Sandbank lagerten.
Nachdem wir gegessen hatten, durchkämmten wir das Weidendickicht nach Treibholz. Bis wir genug gesammelt hatten, war es vollends dunkel geworden, und der Geruch des Ufergrases wurde in der Abendkühle stechender. Wir warfen uns um das Feuer herum auf den Boden und unternahmen einen weiteren vergeblichen Versuch, Percy Pound den Kleinen Wagen zu zeigen. Wir hatte uns schon oft bemüht, aber er kam über den Großen nie hinaus.
»Siehst du die drei großen Sterne, gleich unter dem Griff, mit dem hellen in der Mitte?«, sagte Otto Hassler. »Das ist der Gürtel des Orions, und der helle ist die Schnalle.« Ich kroch hinter Ottos Schulter und folgte seinem ausgestreckten Arm bis zu dem Stern, der auf der Spitze seines Zeigefingers zu ruhen schien. Die Hassler-Brüder fischten nachts mit Wadennetzen und kannten sich mit den Sternen gut aus.
Percy gab die Suche nach dem Kleinen Wagen auf und legte sich im Sand zurück, die Hände hinterm Kopf verschränkt. »Ich seh den Polarstern«, sagte er zufrieden und zeigte mit dem großen Zeh darauf. »Falls man mal verloren geht, muss man das wissen.«
Wir sahen alle zum Polarstern hinauf.
»Wie, glaubt ihr, hat sich Kolumbus gefühlt, als sein Kompass nicht mehr Richtung Norden zeigte?«, fragte Tip.
Otto schüttelte den Kopf. »Mein Vater sagt, es gab mal einen anderen Polarstern. Und dass dieser hier vielleicht auch nicht ewig bestehen bleibt. Ich möchte mal wissen, was mit uns hier unten passiert, wenn mit dem was schiefgeht.«
Arthur lachte leise. »Mach dir mal keine Sorgen, Ott. Solange du am Leben bist, geht wahrscheinlich gar nichts schief. Seht mal, die Milchstraße! Ein ganzer Haufen guter toter Indianer muss da unterwegs sein.«
Wir lehnten uns zurück und sahen nachdenklich in die dunkle Hülle, die die Welt umgab. Das Wasser gurgelte inzwischen lauter. Wir hatten nachts oft seinen rebellischen, klagenden Ton vernommen, so ganz anders als das fröhliche Glucksen während des Tages, eher die Stimme eines viel tieferen und kraftvolleren Stroms. Unser Wasser verfügte stets über diese beiden Stimmungen: die eine von sonniger Gefälligkeit, die andere von untröstlichem, leidenschaftlichem Bedauern.
»Komisch, wie die Sterne alle in irgendwelche Diagramme fallen«, meinte Otto. »Man könnte fast alle geometrischen Sätze mit ihnen bilden. Sie sehen immer so aus, als würden sie etwas bedeuten. Es gibt ja Leute, die sagen, dass unser aller Schicksal in den Sternen geschrieben steht.«
»Das glauben sie jedenfalls in der Alten Welt«, bestätigte Fritz.
Aber Arthur lachte nur. »Du denkst an Napoleon, Fritzie. Sein Stern erlosch, als er anfing, Schlachten zu verlieren. Ich glaub kaum, dass die Sterne so genau Buch drüber führen, wie’s den Leuten in Sandtown gerade geht.«
Wir überlegten, wie oft wir bis hundert zählen könnten, bevor der Abendstern hinter den Maisfeldern verschwand, als einer von uns rief: »Da kommt er, groß wie ein Wagenrad!«
Wir sprangen auf, um den Mond zu begrüßen, der über das Steilufer hinter uns herangeschwommen kam wie eine Galeone unter vollen Segeln, riesengroß und ungeschlacht, zornesrot wie ein heidnischer Gott.
»Immer wenn der Mond so rot aufstieg, opferten die Azteken ihre Gefangenen auf der Spitze des Tempels«, sagte Percy.
»Lass stecken, Perce. Das hast du doch nur aus Goldene Tage. Glaubst du das etwa, Arthur?«, widersprach ich.
»Ob ihr’s glaubt oder nicht«, antwortete Arthur ernst. »Der Mond war einer ihrer Götter. Als mein Vater in Mexiko-Stadt war, hat er den Stein gesehen, auf dem sie ihre Gefangenen geopfert haben.«
Während wir es uns wieder am Feuer bequem machten, fragte jemand, ob die Ureinwohner, die die Hügelgräber erbaut hatten, wohl älter waren als die Azteken. Jedes Mal, wenn unser Gespräch auf die Erbauer der Hügelgräber kam, konnten wir von dem Thema nicht mehr loskommen, und wir spekulierten immer noch, als vom Wasser her ein lautes Platschen zu hören war.
»Das muss ’n großer Wels gewesen sein, der da gesprungen ist«, sagte Fritz. »Das machen die manchmal. Wahrscheinlich finden sie im Dunkeln irgendwelche Käfer. Seht mal die Spur, die der Mond zieht!«
Über das Wasser lief ein langer silberner Strich, und an einer Stelle, wo die Strömung um einen großen Baumstamm schäumte, zerbrodelte er zu Goldstücken.
»Was, wenn es tatsächlich irgendwann in diesem ollen Fluss mal Gold gegeben hat?«, fragte Fritz. Er lag da wie ein kleiner brauner Indianer, nah am Feuer, das Kinn in den Händen, seine nackten Füße in der Luft. Sein Bruder lachte, aber Arthur nahm die Frage ernst.
»’n paar von den Spaniern dachten, dass es hier irgendwo Gold gibt. Sieben Städte voller Gold, sagten sie, und Coronado und seine Leute kamen den ganzen Weg hier rauf, um es zu finden. Die Spanier waren damals überall.«
Percy horchte auf. »War das, bevor die Mormonen hier durchgezogen sind?«
Darüber lachten wir alle.
»Lange vorher. Vor den Pilgervätern, Perce. Vielleicht sind sie genau an diesem Fluss hier entlanggezogen. Sie sind immer dem Wasser gefolgt.«
»Ich möchte mal wissen, wo dieser Fluss eigentlich herkommt«, sagte Tip nachdenklich. Das war ein von uns lang gehegtes Lieblingsrätsel, das die Landkarte nicht eindeutig erklärte. Auf der Karte endete die kleine schwarze Linie irgendwo im westlichen Kansas, aber weil Flüsse doch meist in den Bergen entsprangen, konnten wir wohl annehmen, dass unser Fluss aus den Rockies kam. Seine Bestimmung, das wussten wir, war der Missouri, und die Hassler-Brüder behaupteten ständig, dass wir in der Zeit des Hochwassers in Sandtown nur ein Boot zu nehmen brauchten, um dann irgendwann, einfach der Nase nach, in New Orleans anzukommen. Jetzt fingen sie wieder davon an. »Wenn wir Jungs nur genug Mumm hätten, könnten wir im Nullkommanichts in Kansas City sein. Und in St. Joe.«
Wir fingen an, über die Orte zu reden, die wir gerne sehen wollten. Die Hassler-Brüder wollten zu den Schlachthöfen in Kansas City, und Percy wollte ein großes Warenhaus in Chicago besuchen. Arthur hielt das Gespräch am Laufen und gab selbst nichts preis.
»Jetzt bist du dran, Tip.«
Tip rollte sich auf seine Ellbogen und stocherte im Feuer. Seine Augen sahen schüchtern aus dem seltsam verkniffenen kleinen Gesicht. »Mein Ort ist wirklich weit weg. Mein Onkel Bill hat mir davon erzählt.«
Tips Onkel Bill war ein Landstreicher, fieberhaft getrieben vom Traum, sein Glück in den Minen zu machen. Mit einem gebrochenen Arm hatte es ihn nach Sandtown herein- und, sobald der Arm geheilt war, auch wieder aus der Stadt hinausgeweht.
»Wo liegt dein Ort?«
»Ach, ganz unten in New Mexico irgendwo. Da gibt’s keine Eisenbahn oder so was. Man muss Maultiere benutzen, und das Wasser geht einem aus, bevor man ankommt, und dann muss man Tomaten aus der Dose trinken.«
»Erzähl weiter, Kleiner. Wie ist es da, wenn man endlich ankommt?«
Tip setzte sich auf und begann aufgeregt zu erzählen.
»Da gibt’s einen riesigen roten Fels, direkt aus dem Sand, fast neunhundert Fuß hoch. Das Land drum herum ist ganz flach, und hier ist dieser Fels, ganz für sich, wie ein Denkmal. Da unten nennen sie ihn den verwunschenen Fels, weil noch kein weißer Mann je obendrauf gewesen ist. Die Seiten sind glatter Stein und ganz steil, wie eine Wand. Vor vielen hundert Jahren, sagen die Indianer, bevor die Spanier kamen, gab’s da oben hoch in der Luft ein Dorf. Der Stamm, der dort lebte, hatte so eine Art Stufen gebaut, aus Holz und Rinde, die über den Rand der Klippe hingen, und die Männer kletterten runter, um zu jagen, und auf ihrem Rücken trugen sie große Krüge mit Wasser nach oben. Sie hatten da oben einen großen Vorrat an Wasser und an getrocknetem Fleisch, und sie kamen niemals runter, außer zum Jagen. Sie waren ein friedlicher Stamm, sie webten und töpferten, und sie ließen sich da oben nieder, um den Kriegen zu entgehen. Dabei hätten sie, versteht ihr, jeden Angreifer abschießen können, der versucht hätte, die kleinen Stufen hochzukommen. Die Indianer sagen, sie waren ein stattliches Volk und hatten irgendeine komische Religion. Onkel Bill meint, sie gehörten ursprünglich zu den Klippensiedlern, hatten dann irgendwelche Schwierigkeiten bekommen und ihr Zuhause verlassen. Kämpfer waren sie jedenfalls nicht.
Einmal waren die Jäger gerade unten, als ein grässlicher Sturm aufkam, so eine Art Sturzflut, und als sie wieder bei ihrem Fels ankamen, war ihre kleine Treppe komplett zerstört, nur noch ein paar Stufen baumelten hoch oben in der Luft. Und während sie unten ein Lager aufschlugen und überlegten, was sie machen sollten, kam eine Bande von Kriegern aus Richtung Norden und brachte sie alle um bis auf den letzten Mann, und die Alten und die Frauen guckten vom Fels aus zu. Die Bande zog weiter nach Süden, und die Leute in dem Dorf mussten zusehen, wie sie auf dem besten Weg von dem Fels runterkommen. Natürlich kamen sie niemals runter. Sie verhungerten alle da oben, und als die Bande auf dem Rückweg nach Norden wieder vorbeikam, hörten sie die Kinder schreien, die an den Rand der Klippe gekrabbelt waren, aber es war weit und breit kein erwachsener Indianer mehr zu sehen. Seitdem ist niemand mehr da oben gewesen.«
Über diese traurige Geschichte stießen wir Wehklagen aus und setzten uns auf.
»So viele Leute können da oben doch gar nicht gewesen sein«, wandte Percy ein. »Wie groß ist denn der Gipfel, Tip?«
»Oh, ziemlich groß. So groß, dass man gar nicht sieht, wie hoch der Fels eigentlich ist. Er ist oben breiter als unten. Die Klippe ist irgendwie ausgewaschen auf den ersten paar hundert Fuß. Deshalb ist es ja so schwer hochzuklettern.«
Ich fragte, wie die Indianer überhaupt dort hochgekommen waren.
»Niemand weiß, wie und wann. Irgendwann kam eine Gruppe Jäger vorbei und sah, dass da oben eine Siedlung war, und das war’s.«
Otto rieb sich nachdenklich am Kinn. »Natürlich muss es irgendeinen Weg geben, da raufzukommen. Könnte man nicht irgendwie ein Seil rüberwerfen und eine Leiter hochziehen?«
Tips kleine Augen funkelten vor Aufregung. »Ich weiß wie. Onkel Bill und ich haben alles genau besprochen. Es gibt so eine Art Rakete, die ein Seil rüberschießen kann, Rettungsringe funktionieren auch so, und dann könnte man eine Strickleiter hochziehen und sie unten verankern, und auf der anderen Seite kann man sie mit Halteseilen straffziehen. Ich werd auf diesen Fels raufklettern, und ich hab es ganz genau geplant.«
Fritz fragte, was er dort oben zu finden hoffe.
»Knochen vielleicht, oder die Ruinen der Siedlung, oder Töpfereien, oder welche von ihren Götzen. Alles Mögliche kann da oben sein. Egal was, ich will es sehen.«
»Bist du sicher, dass noch niemand anders da oben gewesen ist, Tip?«, fragte Arthur.
»Ganz sicher. In der Gegend da unten ist fast niemand. Ein paar Jäger haben mal versucht, Stufen in den Fels zu schlagen, aber sie sind nur so weit gekommen, wie sie hochreichen konnten. Es ist sowieso eine komische Gegend. Der Fels ist ganz aus rotem Granit, Onkel Bill meint, es ist ein großer Findling, den die Gletscher zurückgelassen haben. Nichts als Kakteen und Wüste im Umkreis von Hunderten von Meilen, aber direkt unter dem Fels gibt es frisches Wasser und jede Menge Gras. Deshalb sind die Büffel früher immer dahin.«
Plötzlich hörten wir einen Schrei über unserem Feuer und sprangen auf. Wir sahen einen dunklen, schlanken Vogel, der hoch über uns gen Süden glitt – ein Schreikranichweibchen, wir erkannten sie an ihrem Ruf und ihrem langen Hals. Wir rannten bis zum Ende der Insel in der Hoffnung, sie landen zu sehen, doch sie schwebte in südlicher Richtung über den Flusslauf davon, bis wir sie aus den Augen verloren. Die Hassler-Brüder verkündeten, dass nach dem Stand der Sterne Mitternacht vorbei sein musste, und so warfen wir mehr Holz auf das Feuer, zogen unsere Jacken über und rollten uns im warmen Sand zusammen. Ein paar von uns taten so, als seien sie eingedöst, aber ich glaube, wir alle dachten in Wirklichkeit an Tips Fels und das gemordete Volk. Drüben im Gehölz riefen die Ringeltauben einander in klagendem Ton zu, und einmal hörten wir in der Ferne einen Hund bellen. »Irgendjemand treibt sich im Melonenbeet vom alten Tommy rum«, murmelte Fritz schläfrig, aber niemand antwortete. Schließlich hörten wir Percys Stimme aus den Schatten.
»Sag mal, Tip, wenn du da runterfährst, nimmst du mich mit?«
»Vielleicht.«
»Und was ist, wenn es einer von uns vor dir schafft, Tip?«
»Wer immer es zuerst zu dem Fels schafft, muss versprechen, uns anderen genau zu erzählen, was er dort gefunden hat«, bemerkte einer der Hassler-Brüder, und dem stimmten wir alle bereitwillig zu.
Einigermaßen beruhigt fiel ich in den Schlaf. Ich muss von dem Wettlauf um den Fels geträumt haben, denn ich erwachte voller Angst, dass andere mir zuvorkommen würden und ich meine Chance schon vertan hätte. Ich setzte mich auf in meinen klammen Kleidern und sah auf die anderen, die in einem Knäuel verrenkter Glieder um das erloschene Feuer lagen. Es war noch dunkel, doch der Himmel war blau vom letzten, wunderbar azurnen Licht der Nacht. Die Sterne schimmerten wie Kristallkugeln und zitterten, als schienen sie durch tiefes klares Wasser. Unter meinem Blick wurden sie blasser, während sich der Himmel erhellte. Der Tag brach plötzlich an, fast unmittelbar. Ich sah mich noch einmal nach der blauen Nacht um, aber sie war verschwunden. Überall begannen die Vögel zu rufen, und alle möglichen kleinen Insekten begannen zu zirpen und in den Weiden umherzuspringen. Von Westen erhob sich eine Brise und brachte den schweren Geruch von reifem Mais. Die Jungs rollten sich auf die andere Seite und schüttelten sich. Wir warfen unsere Sachen ab und stürzten uns in den Fluss, gerade als die Sonne über dem windigen Lehmbruch aufging.
Als ich zur Weihnachtszeit nach Sandtown zurückkehrte, liefen wir auf Schlittschuhen zu unserer Insel und sprachen über unsere Pläne hinsichtlich des verwunschenen Fels. Wir bekräftigten unseren Entschluss, ihn zu finden.
Obwohl das zwanzig Jahre her ist, hat keiner von uns den verwunschenen Fels je bestiegen. Percy Pound ist ein Börsenmakler in Kansas City, und er würde sich nirgendwo hinbegeben, wo er nicht in seinem roten Kabriolett hinfahren kann. Otto Hassler ist zur Eisenbahn gegangen und hat als Bremser einen Fuß verloren; danach haben er und Fritz die Schneiderei ihres Vaters übernommen.
Arthur ist zeit seines Lebens nicht aus der verschlafenen kleinen Stadt herausgekommen – er starb vor seinem fünfundzwanzigsten Geburtstag. Ich sah ihn zum letzten Mal, als ich während irgendwelcher Semesterferien zu Hause war. Er saß in einem Liegestuhl unter einer Schwarzpappel in dem kleinen Hintergarten eines der beiden Saloons, die es in Sandtown gab. Er sah sehr ungepflegt aus, und seine Hand zitterte, doch als er aufstand und mich ganz unbefangen begrüßte, waren seine Augen noch genauso klar und voller Wärme wie immer. Ich unterhielt mich etwa eine Stunde lang mit ihm und hörte noch einmal sein Lachen, und danach fragte ich mich, weshalb die Natur, nachdem sie sich so viel Mühe mit einem Mann gegeben hatte, von seinen Händen bis zu dem schön gewölbten langen Fuß, ihn dann einfach in Sandtown hatte verloren gehen lassen. Er machte Witze über Tip Smiths Fels und erklärte, er würde runterfahren, sobald das Wetter abkühlte. Er meinte, auch der Grand Cañon sei wohl sehenswert.
Als ich mich verabschiedete, war ich mir vollkommen sicher, dass er nie über den hohen Bretterzaun und den tröstenden Schatten der Schwarzpappel hinauskommen würde. Und tatsächlich ist er eines Sommermorgens unter genau diesem Baum gestorben.
Tip Smith redet noch immer von der Reise nach New Mexico. Er hat ein schlampiges Bauernmädchen geheiratet, das nicht mit Geld umgehen konnte, und einen Großteil seiner Tage damit verbracht, einen Kinderwagen vor sich her zu schieben. Er geht gebeugt und ergraut, einer, der nie regelmäßige Mahlzeiten oder genug Schlaf bekommen hat. Doch das Schlimmste liegt hinter ihm, sagt er, und sein Leben verläuft jetzt in ruhigeren Bahnen. Als ich das letzte Mal in Sandtown war, begleitete ich ihn im Mondlicht nach Hause, nachdem er Kasse gemacht und seinen Laden abgeschlossen hatte. Wir nahmen einen Umweg und setzten uns auf die Stufen des Schulhauses, wo wir beide uns noch einmal lebhaft in die alte Geschichte des einsamen roten Felses und seiner vergessenen Bewohner vertieften. Tip besteht noch immer darauf, dass er runterfahren wird, aber er meint, er will jetzt abwarten, bis sein Sohn Bert alt genug ist, ihn zu begleiten. Bert ist in das Geheimnis eingeweiht und kann an nichts anderes denken als an den verwunschenen Fels. ~
Ein Wagner-Konzert
Eines Morgens erhielt ich einen Brief, geschrieben mit blasser Tinte auf faserigem, blau liniertem Notizpapier und abgestempelt in einer kleinen Ortschaft in Nebraska. Diese Botschaft, speckig und abgeschabt, sah aus, als habe sie mehrere Tage in einer nicht allzu sauberen Jackentasche verbracht, und kam von meinem Onkel Howard. In ihr stand, dass seine Frau eine kleine Erbschaft von einem unverheirateten Verwandten gemacht habe, der kürzlich verstorben war, und dass sie nach Boston kommen müsse, um die Angelegenheit zu regeln. Er ersuchte mich, sie am Bahnhof zu treffen und ihr jedwede Unterstützung zukommen zu lassen, deren sie bedürfe. Als ich mir das Datum ihrer Ankunft näher besah, stellte ich fest, dass es schon morgen war. Er hatte es, wie es seine Art war, aufgeschoben zu schreiben, bis ich, wäre ich nur einen Tag verreist gewesen, die gute Frau ganz und gar verpasst hätte.
Der Name meiner Tante Georgiana rief in mir nicht nur das Bild einer armseligen, fratzenhaften Person wach, sondern eröffnete vor mir eine derart weite und tiefe Flut von Erinnerungen, dass mir der Brief aus den Händen fiel und ich mich plötzlich meiner gegenwärtigen Existenz vollkommen entfremdet fühlte, unbehaglich und fehl am Platz in meinem eigenen Arbeitszimmer. Ich wurde, kurzum, wieder zu dem hoch aufgeschossenen Bauernjungen, den meine Tante gekannt hatte, geplagt von Frostbeulen und Schüchternheit, die Hände rissig und wund vom Schälen der Maiskolben. Vorsichtig befühlte ich die Knöchel meines Daumens, ob sie womöglich wieder aufgeraut waren. Wieder saß ich vor dem Harmonium meiner Tante und fingerte mich mit steifen, roten Händen durch Tonleitern, während sie neben mir Leinenhandschuhe für die Schäler nähte.
Nachdem ich meiner Wirtin am nächsten Morgen die Situation in groben Zügen dargelegt hatte, fuhr ich zum Bahnhof. Als der Zug ankam, hatte ich zunächst Schwierigkeiten, meine Tante zu finden. Sie war von allen Passagieren die Letzte, die ausstieg, und als ich sie in die Droschke bugsierte, sah sie nicht viel anders aus als einer jener verkohlten, rauchenden Körper, die Feuerwehrleute aus den Trümmern eines verbrannten Gebäudes ziehen. Sie hatte die ganze Strecke in einem Sitzwagen zurückgelegt; ihr leinener Staubmantel war schwarz von Ruß und ihre schwarze Haube grau von Staub. Als wir in meiner Pension anlangten, steckte meine Wirtin sie sofort ins Bett, und ich sah sie bis zum nächsten Morgen nicht wieder.
Welches Grauen Mrs. Springer auch erfasst haben mochte, als sie meiner Tante ansichtig wurde, sie verbarg es taktvoll. Was mich anging, so löste der Anblick der verhärmten Gestalt in mir jene Art Ehrfurcht und Respekt aus, die man für gewöhnlich Forschern entgegenbringt, die ihre Ohren und Finger nördlich des Franz-Josef-Landes oder ihre Gesundheit irgendwo am Oberlauf des Kongo eingebüßt haben. Meine Tante Georgiana hatte am Konservatorium in Boston unterrichtet, irgendwann in den späten sechziger Jahren. Eines Sommers, den sie in jenem kleinen Ort in den Grünen Bergen verbrachte, in dem ihre Vorfahren seit Generationen gelebt hatten, weckte sie das Interesse des faulsten und trägsten Dorfjungen und entwickelte für diesen Howard Carpenter jene Art absurde und überspannte Leidenschaft, wie sie ein hübscher Landjunge von einundzwanzig zuweilen in einer unscheinbaren, ungelenken, bebrillten Frau von dreißig hervorruft. Als sie zu ihren Verpflichtungen nach Boston zurückkehrte, folgte ihr Howard, und das Ende dieser unerklärlichen Vernarrtheit war, dass sie mit ihm durchbrannte und sich, um sich den Vorwürfen und der Kritik ihrer Familie und Freunde zu entziehen, im Grenzland Nebraskas niederließ. Carpenter, der natürlich kein Geld hatte, ließ sich Siedlungsland in Red Willow County zuteilen, fünfzig Meilen von der Eisenbahnstrecke entfernt. Sie maßen ihre hundertsechzig Morgen ab, indem sie mit einem Wagen über die Prärie fuhren, an dessen Rad sie ein rotes Tuch gebunden hatten, mit dem sie die Umdrehungen abzählten. Dann gruben sie einen Unterstand in die rote Erde des Abhangs, eine jener Höhlenbehausungen, in denen die Bewohner für gewöhnlich in die primitivsten Lebensformen zurückfallen. Ihr Wasser holten sie von den Tümpeln, aus denen die Büffel tranken, und ihr schmaler Vorrat an Lebensmitteln war stets den umherstreifenden Indianerbanden ausgesetzt. Dreißig Jahre lang war meine Tante nicht mehr als fünfzig Meilen über diese Farm hinausgekommen.
Von alldem aber wusste Mrs. Springer nichts, weshalb sie über das, was von meiner Verwandten übrig geblieben war, einigermaßen entsetzt gewesen sein dürfte. Unter dem verdreckten leinenen Staubmantel, der zum Zeitpunkt ihrer Ankunft das auffälligste Detail ihrer Garderobe darstellte, trug sie ein schwarzes langes Kleid aus billigem Wollstoff, dessen Verarbeitung keinen Zweifel daran ließ, dass sie längst in die Hände einer Provinzschneiderin gefallen war. Die Figur meiner armen Tante hätte indes jede Schneiderin vor außergewöhnliche Herausforderungen gestellt. Ihre Haut war gelblich wie die einer Mongolin, war sie doch ständig einem mitleidlosen Wind ausgesetzt und basischem Wasser, das noch das zarteste Gewebe in eine Art dehnbares Leder verwandelt. Sie trug ein schlecht sitzendes Gebiss. Das herausragende Merkmal ihres Gesichtsausdrucks jedoch war das ununterbrochene Zucken ihres Mundes und der Augenbrauen, eine nervöse Störung, die die Folge von Einsamkeit und Eintönigkeit war sowie von häufigen körperlichen Leiden.
In meiner Kindheit hatte mich dieses Gebrechen auf grauenvolle Art fasziniert, ein Gefühl, für das ich mich heimlich schämte, denn was auch immer Gutes mir in jenen Tagen zuteil wurde, war dieser Frau geschuldet, und ich verspürte für sie eine geradezu verehrende Zuneigung. Während der drei Winter, in denen ich als Viehtreiber für meinen Onkel arbeitete, stand meine Tante, nachdem sie drei Mahlzeiten für das halbe Dutzend Farmarbeiter gekocht und sechs Kinder zu Bett gebracht hatte, oft bis Mitternacht an ihrem Bügelbrett, während ich am Küchentisch neben ihr lateinische Deklinationen und Konjugationen herunterbetete, und rüttelte mich sanft, wenn mein Kopf schlaftrunken auf eine Seite unregelmäßiger Verben niedergesunken war. Sie war es, der ich beim Bügeln oder Handarbeiten meine ersten Shakespeare-Stücke vorlas, und die Sammlung klassischer Mythen, die noch aus ihrer Schulzeit stammte, war die erste, die mir je in die leeren Hände fiel. Sie war es auch, die mir Tonleitern und Etüden auf dem kleinen Harmonium beibrachte, das ihr Mann ihr nach fünfzehn Jahren gekauft hatte. In all der Zeit zuvor hatte sie kein einziges Instrument zu Gesicht bekommen außer dem Akkordeon, das einem der norwegischen Farmarbeiter gehörte. Sie saß stundenlang neben mir, stopfte Socken und zählte den Takt, während ich mich durch die Grobschmied-Variationen kämpfte; doch sie sprach selten mit mir über Musik, und ich verstand, weshalb. Sie war eine fromme Frau; sie fand Trost in der Religion, und zumindest sie selbst empfand es nicht als erbarmungswürdig, wie sie sich aufopferte. Einmal, als ich verbissen eine einfache Passage aus einem alten Klavierauszug von Euryanthe herunterhämmerte, den ich in ihren Noten gefunden hatte, trat sie zu mir, legte mir ihre Hände über die Augen und zog meinen Kopf an ihre Schulter. »Gib dich nicht zu sehr hin, Clark, oder es wird dir genommen«, sagte sie mit zitternder Stimme. »Oh, lieber Junge, was auch immer das Opfer sein wird, das du zu bringen hast, bete darum, dass es nicht dies ist.«
Als meine Tante am Morgen nach ihrer Ankunft erschien, war sie noch immer in einem halb schlafwandlerischen Zustand. Sie schien nicht zu begreifen, dass sie sich in der Stadt befand, in der sie ihre Jugend verbracht und nach der sie sich ein halbes Leben lang verzehrt hatte. Während der ganzen Zugfahrt hatte ihr die Reisekrankheit derart zugesetzt, dass sie sich nur an dieses Unwohlsein erinnerte, und so lag für sie zwischen der Farm in Red Willow County und meinem Arbeitszimmer in der Newbury Street im Grunde nur ein Albtraum von wenigen Stunden. Ich hatte für den Nachmittag eine kleine Überraschung für sie geplant, um mich bei ihr für ein paar der wunderbaren Momente zu bedanken, die sie mir bereitet hatte, wenn wir gemeinsam in dem strohgedeckten Kuhstall melkten und sie mir, weil ich besonders müde war oder ihr Mann mich gerüffelt hatte, von der großartigen Aufführung von Meyerbeers Hugenotten erzählte, die sie in ihrer Jugend in Paris gesehen hatte. Um zwei Uhr würde das Bostoner Sinfonieorchester ein Wagner-Programm geben, und ich hatte vor, meine Tante dorthin einzuladen, obwohl mir nach und nach Zweifel kamen, ob es ihr Freude machen würde. Um ihrer selbst willen konnte ich nur hoffen, dass ihre Leidenschaft für derartige Dinge erstorben war und ihr langer Kampf mithin ein gnädiges Ende gefunden hatte. Ich machte den Vorschlag, vor dem Mittagessen das Konservatorium und den Stadtpark zu besuchen, aber sie schien viel zu verängstigt für einen Ausflug. Sie stellte mir ein paar zerstreute Fragen über Neuerungen in der Stadt, doch sie schien vor allem besorgt, dass sie keine Anweisungen hinterlassen hatte, wie ein bestimmtes schwächelndes Kälbchen mit fettarmer Milch zu füttern sei. »Ein Kälbchen von der alten Maggie, du weißt doch, Clark«, erklärte sie, wobei sie offenbar vergaß, wie lange ich schon fort war. Sie war auch beunruhigt, weil sie vergessen hatte, ihrer Tochter von der frisch geöffneten Dose mit Makrelen im Vorratskeller zu erzählen, die verderben würden, wenn man sie nicht gleich verbrauchte.
Ich fragte sie, ob sie je eine von Wagners Opern gehört hatte, was sie verneinte, obwohl sie mit den jeweiligen Inhalten vertraut war und früher einmal einen Klavierauszug vom Fliegenden Holländer besessen hatte. Immer mehr schien es mir, ich hätte sie besser nicht erwecken sollen, bevor ich sie nach Red Willow County zurückverfrachtete, und ich bereute, den Konzertbesuch vorgeschlagen zu haben.
Von dem Moment an, in dem wir die Konzerthalle betraten, war sie jedoch ein kleines bisschen weniger teilnahmslos und schien ihre Umwelt etwas mehr wahrzunehmen. Ich hatte befürchtet, dass sie sich ihres unmöglichen Aufzugs bewusst werden oder es ihr peinliches Unbehagen verursachen könnte, so plötzlich in eine Welt zu treten, für die sie ein Vierteljahrhundert lang nicht mehr existiert hatte. Doch wieder musste ich einsehen, wie oberflächlich ich über sie geurteilt hatte. Sie nahm Platz und blickte sich mit sachlichen, ja steinernen Augen um, wie ein granitener Ramses in einem Museum das Wogen der Menge um sein Podest betrachtet, durch die Einsamkeit langer Jahrhunderte davon entfernt. Ich habe die gleiche Unnahbarkeit an alten Goldgräbern wahrgenommen, die, die Taschen voll Gold und Silber, unrasiert und in schmutzigen Hemden, ins Brown Hotel in Denver gespült werden. Sie stehen allein in den überfüllten Fluren, als wären sie noch in einem frostigen Lager am Yukon oder in der gelben Glut der Wüste Arizonas, sich ganz der Tatsache bewusst, dass ihre Erfahrungen sie von ihren Mitmenschen in einer Weise entfremdet haben, die kein Herrenausstatter kaschieren kann.
Das Publikum bestand vor allem aus Frauen. Die Gesichter und Körper verschwammen, es waren keinerlei Linien mehr zu erkennen, nur die unterschiedlichen Farben zahlloser Oberteile, das Schimmern der Stoffe, weich und steif, seidig und zart, gestärkt und fließend: Rot, Violett, Rosa, Blau, Fliederfarben, Lila, Beige, Rosarot, Gelb, Cremefarben und Weiß – all die Farben, die ein impressionistischer Maler in einer sonnenerfüllten Landschaft entdeckt, und dazwischen hier und da der tiefschwarze Schatten eines Gehrocks. Meine Tante Georgiana sah darauf herunter, als seien es Farbkleckse auf einer Palette.
Als die Musiker nacheinander erschienen und sich setzten, verriet sie einen Hauch von erwartungsvoller Aufregung und sah mit gesteigertem Interesse über die Brüstung auf diesen immergleichen Auftritt; vielleicht war es das erste altbekannte Bild, das sie begrüßte, seit sie die Kuh Maggie und ihr schwächelndes Kälbchen hinter sich gelassen hatte. Ich fühlte, wie sich alle Einzelheiten in ihre Seele senkten, denn auch ich hatte nie vergessen, wie sie sich in mich gesenkt hatten, nachdem ich hier angekommen war, frisch vom eintönigen Pflügen in den grünen Schneisen zwischen den Maisstauden, wo man, wie in einem Laufrad, von Tagesanbruch bis zur Dämmerung gehen und gehen konnte, ohne auch nur die geringste Veränderung wahrzunehmen. Ich erinnerte mich, welchen Eindruck die klar gezeichneten Umrisse der Musiker auf mich gemacht hatten, der Glanz ihrer Hemden, das stumpfe Schwarz ihrer Fräcke, die herrlich geformten Instrumente, die Flecken gelben Lichts, die die grün beschirmten Stehlampen auf die glatt lackierten Körper der Celli und Kontrabässe im Hintergrund warfen, der rastlose, windgeschüttelte Wald von Violinhälsen und -bögen; ich erinnerte mich, wie in dem ersten Orchesterkonzert, das ich je gehört hatte, jene langen Bogenstriche mir die Seele aus dem Leib zu ziehen schienen, wie der Stab eines Zauberkünstlers ein Papierband aus einem Hut hervorspult.
Zuerst stand die Tannhäuser-Ouvertüre auf dem Programm. Als die Geigen die ersten Klänge des Pilgerchors intonierten, packte mich meine Tante Georgiana am Ärmel. In diesem Moment wurde mir klar, dass das tiefe Singen der Bässe und das durchdringende Taumeln der höheren Streichinstrumente für sie ein dreißig Jahre langes Schweigen brachen, die unvorstellbare Stille der Prärie. Während des Kampfes zwischen den beiden Motiven, der bitteren Ekstase des Venusberg-Themas mit dem reißenden Strudel der Streichinstrumente, wurde ich überwältigt von einer Erkenntnis über Verschleiß und Verlust, gegen die wir so machtlos sind. Ich sah wieder das hohe, kahle Haus auf der Prärie, schwarz und düster wie eine hölzerne Burg; den dunklen Tümpel, in dem ich schwimmen gelernt hatte, den lehmigen, von Regen durchfurchten Boden um das kahle Haus und die vier verkrüppelten kleinen Eschensetzlinge vor der Küchentür, an denen stets die Geschirrtücher zum Trocknen hingen. Die Welt dort ist die flache Welt längst vergangener Zeiten; nach Osten erstreckt sich ein Maisfeld bis Tagesanbruch, nach Westen eine Weide bis Sonnenuntergang, und dazwischen liegen die schäbigen Errungenschaften der Friedenszeit, härter umkämpft als die eines Krieges.
Die Ouvertüre endete. Meine Tante ließ meinen Ärmel los, doch sie sagte nichts. Sie starrte auf das Orchester durch den Stumpfsinn von dreißig Jahren, durch all die feinen Schichten, die sich nach und nach, an jedem der dreihundertfünfundsechzig Tage jeden Jahres, abgelagert hatten. Was, dachte ich, bedeutete ihr die Musik? Sie war, wie ich wusste, zu ihrer Zeit eine gute Pianistin gewesen und ihre Ausbildung umfassender als die der meisten Musiklehrer vor einem Vierteljahrhundert. Sie hatte oft von Mozarts und Meyerbeers Opern gesprochen, und ich konnte mich erinnern, dass sie vor vielen Jahren die eine oder andere Melodie von Verdi geträllert hatte. Als ich einmal an einem Fieber erkrankt war, hatte sie Abend für Abend neben meinem Lager gesessen, während der kühle Nachtwind durch das verblichene Insektennetz hereinwehte, das vor das Fenster genagelt war. Ich hatte den hellen Stern betrachtet, der über dem Maisfeld rötlich flackerte, während sie auf eine so anrührende Weise »In unsre Heimat kehren wir wieder!« sang, dass es einem Jungen aus Vermont das Herz hätte brechen können, der vor lauter Heimweh ohnehin dem Tod schon nahe war.
Während des Vorspiels zu Tristan und Isolde beobachtete ich sie genau. Vergeblich versuchte ich zu erraten, was dieses Ringen von Motiven, dieser brodelnde Aufruhr von Streichern und Bläsern ihr bedeuten könnte. Lag in dieser Musik für sie eine Botschaft? Schwamm ihr ein neuer Stern ins Fernglas oder nicht? Bis in die sechziger Jahre war Wagner den Amerikanern ein Buch mit sieben Siegeln gewesen. War in ihr noch etwas geblieben, womit sie diese Pracht erfassen konnte, die die Welt wie ein Blitz umzuckt hatte, nachdem sie sie verlassen hatte? Ich fieberte vor Neugier, aber Tante Georgiana verharrte schweigend auf ihrem Gipfel in Darien, völlig reglos während der folgenden Darbietung aus dem Fliegenden Holländer, obwohl sich ihre Hände mechanisch über ihr schwarzes Kleid bewegten, als erinnerten sie ganz von selbst die Fingersätze, die sie einst gespielt hatten. Die armen alten Hände! Sie waren überdehnt, gestreckt, verbogen wie Insektenbeinchen, die nur mehr zum Halten, Heben und Kneten dienten. Die Handflächen waren geschwollen, die Finger gekrümmt und knotig, und an einem saß ein abgenutztes Goldband, das einmal ein Ehering gewesen war. Während ich eine dieser tastenden Hände drückte und sanft zur Ruhe brachte, dachte ich mit zitternden Lidern an all die Dienste, die mir diese Hände in früheren Tagen geleistet hatten.
Kurz nachdem der Tenor das Preislied angestimmt hatte, vernahm ich ein tiefes Aufatmen und wandte mich meiner Tante zu. Ihre Augen waren geschlossen, aber auf ihren Wangen glänzten Tränen, und ich glaube, dass sie auch mir einen Moment später kamen. Stirbt sie also nie ganz, die Seele? Nach außen hin verkümmert sie zwar wie jenes seltsame Moos, das ein halbes Jahrhundert lang auf einem staubigen Regalbrett liegt und das doch, wenn man es wässert, wieder grünt. Meine Tante weinte still, während die Melodie sich entfaltete und steigerte.
In der Pause vor der zweiten Hälfte des Konzerts befragte ich meine Tante und fand heraus, dass ihr das Preislied nicht neu war. Einige Jahre zuvor hatte es einen jungen Deutschen auf die Farm in Red Willow County verschlagen, einen umherziehenden Viehtreiber, der als Junge zusammen mit anderen Bauernkindern im Chor von Bayreuth gesungen hatte. Sonntagmorgens pflegte er auf dem mit groben Laken bezogenen Bett im Schlafraum der Farmarbeiter zu sitzen, der von der Küche abging und wo er seine Lederstiefel und den Sattel polierte. Dabei sang er das Preislied, während meine Tante ihre Küchenarbeit verrichtete. Sie hatte nicht nachgegeben, bis er schließlich dem Kirchenchor beigetreten war, für den er sich, soweit ich das beurteilen konnte, einzig durch sein frisches Jungengesicht qualifizierte sowie die Tatsache, dass er diese göttliche Melodie beherrschte. Kurze Zeit später hatte er sich zum Unabhängigkeitstag in die Stadt aufgemacht, hatte sich mehrere Tage lang betrunken und sein ganzes Geld beim Pharo-Spielen verloren, war wegen einer Wette auf einem gesattelten texanischen Stier geritten und schließlich mit einem gebrochenen Schlüsselbein verschwunden.
»Na, jetzt haben wir es jedenfalls über den alten Trovatore hinausgebracht, was, Tante Georgiana?«, sagte ich mit wohlmeinender Scherzhaftigkeit.
Ihre Lippe zitterte, und sie führte rasch ihr Taschentuch zum Mund. »Hast du die ganze Zeit diese Musik gehört, Clark?«, murmelte sie hinter dem Tuch hervor. »Die ganze Zeit, seit du mich verlassen hast?« In ihrer Frage lag der sanfteste, traurigste Vorwurf.
»Aber verstehst du es denn, Tante Georgiana?«, beharrte ich. »Die großartige Struktur des Ganzen?«
»Wer könnte das verstehen?«, sagte sie zerstreut. »Und wozu?«
Die zweite Hälfte des Programms bestand aus vier Arien aus dem Ring, gefolgt vom Waldweben aus dem Siegfried und schließlich dem Trauermarsch. Meine Tante weinte leise, doch fast ununterbrochen. Ich war erstaunt, welches Musikverständnis sich ihr erhalten hatte, ihr, die doch nichts gehört hatte als Kirchenchoräle in den Gottesdiensten, die die Methodisten in dem würfelförmigen hölzernen Schulhaus der dreizehnten Sektion abhielten. Ich vermochte nicht abzuschätzen, wie viel davon sich in Seifenlauge aufgelöst hatte, in Brot eingeknetet oder in den Milcheimer hineingemolken worden war.
Die Klanglawine rauschte weiter; ich würde nie erfahren, was ihr der strahlende Strom bedeutete, wie weit er sie mit sich nahm, an welchen glücklichen Inseln vorbei und unter welche Himmel. Dem Zittern ihres Gesichts glaubte ich zu entnehmen, dass zumindest der Siegfried-Marsch sie dorthin trug, wo die unzählbaren Gräber sind, hinaus in die grauen Grabfelder der See oder in eine noch weitere Welt des Todes, wo seit Anbeginn der Zeit Hoffnung zu Hoffnung sich legt, Traum zu Traum, entsagt, und entschläft.
Das Konzert war vorüber; die Menge schob sich unter Plaudern und Lachen aus der Halle, froh, die Spannung zu lösen und zum Alltag zurückzufinden, aber meine Verwandte machte keinerlei Anstalten sich zu erheben. Ich sprach sie sanft an; sie brach in Tränen aus. »Ich will nicht gehen, Clark, ich will nicht!«, schluchzte sie heftig.
Ich verstand. Direkt vor dem Eingang der Konzerthalle lagen für sie der dunkle Tümpel mit dem von Viehspuren überzogenen Lehmufer, das hohe, ungestrichene Haus, nackt wie ein Turm mit seinen verwitterten Brettern, und die buckligen Eschensetzlinge, in denen die Geschirrtücher zum Trocknen hingen und unter denen die mageren, zerrupften Puter vor der Küchentür in den Abfällen pickten. ~
Pauls Fall
An diesem Nachmittag sollte Paul vor dem Kollegium der Pittsburgh High School erscheinen, um über seine mehrfachen Vergehen Rechenschaft abzulegen. Er war eine Woche zuvor suspendiert worden, und sein Vater hatte beim Direktor vorgesprochen, um seiner Ratlosigkeit in Bezug auf den Sohn Ausdruck zu verleihen. Paul betrat das Lehrerzimmer, höflich und lächelnd. Aus seinen Kleidern war er um ein Winziges herausgewachsen, und der hellbraune Samtkragen seines offenen Mantels war zerfranst und abgetragen. Trotzdem ging von ihm etwas Stutzerhaftes aus; er trug eine mit einem Opal geschmückte Nadel in seiner akkurat gebundenen Krawatte und eine rote Nelke im Knopfloch. Dieses letztere Zierstück vermochte das Kollegium nicht recht in Einklang zu bringen mit der reuevollen Gemütslage, die einem mit Suspension belegten Jungen anstand.
Paul war groß für sein Alter und sehr dünn, schmalbrüstig, mit hochgezogenen verkrampften Schultern. Seine Augen fielen durch eine Art hysterisches Funkeln auf, was er beständig und mit einer bewussten Theatralik einsetzte, die bei einem Jungen eigenartig anstößig wirkte. Die Pupillen waren unnatürlich weit, als sei er von Belladonna abhängig, doch lag ein gläsernes Glitzern darin, das diese Droge nicht hervorruft.
Als der Direktor ihn fragte, weshalb er hier sei, gab Paul einigermaßen höflich an, in die Schule zurückkehren zu wollen. Das war eine Lüge, aber Paul war es gewohnt zu lügen – ja, er fand es geradezu unverzichtbar, um Spannungen zu überwinden. Seine Lehrer wurden gebeten, ihre jeweiligen Klagen gegen ihn vorzubringen, und aus dem ausgesprochen bitteren und gekränkten Ton, in dem sie das taten, wurde sofort deutlich, dass es sich hier nicht um einen gewöhnlichen Fall handelte. Störung und Aufsässigkeit waren unter den vorgetragenen Verstößen, doch jeder seiner Lehrkräfte gab an, dass sich der wirkliche Grund des Problems kaum in Worte fassen ließe, weil es in dem Jungen einen geradezu hysterischen Trotz gab; eine Verachtung, die er, wie sie wussten, für sie alle empfand und die zu verheimlichen er nicht die geringste Anstrengung zu machen schien. Einmal, als er die Zusammenfassung eines Absatzes an die Tafel schreiben sollte, war seine Englischlehrerin neben ihn getreten und hatte versucht, seine Hand zu führen. Paul war erschauernd zurückgefahren und hatte die Hände hinter dem Rücken zusammengepresst. Die erstaunte Frau hätte kaum mehr gekränkt und beschämt sein können, wenn er nach ihr geschlagen hätte. Die Beleidigung war so spontan und eindeutig