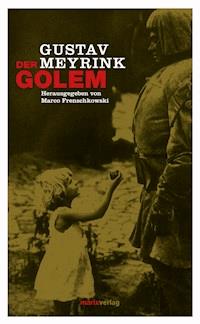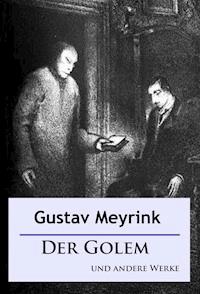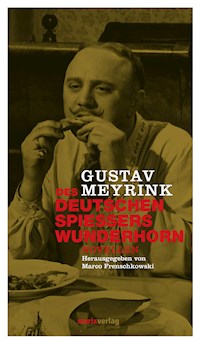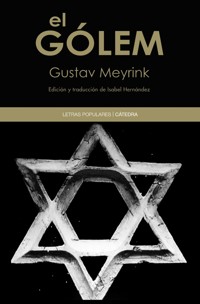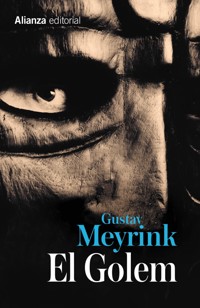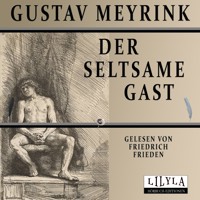6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Brot & Spiele Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Kurze Klassiker
- Sprache: Deutsch
Gustav Meyrink, geboren 1868 in Wien, ist nach E.T.A. Hoffmann eine vergessene Größe der deutschsprachigen Phantastik. Seine Erzählungen führen den Leser über Prag bis in die Berge von Tibet. Meyrink reizt auch die Grenzen menschlicher Glaubwürdigkeit aus, an der man seines klaren, ruhigen Stils wegen nicht zweifeln möchte. Obwohl man das tun sollte. Oder?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 83
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Der violette Tod
Gustav Meyrink
Erzählungen
Brot und Spiele Verlag
www.brotundspieleverlag.net
ISBN: 9783903406308
© 2023 Brot und Spiele Verlag e.U., Wien
Alle Rechte vorbehalten.
Lektorat: Max Haberich
Typografische Gestaltung und Satz:
Félix Müller
Inhaltsverzeichnis
J.H. Obereits Besuch bei den Zeitegeln
Der violette Tod
Das ganze Sein ist flammend Leid
Die Erzählung vom Raubmörder Babinski
Wie Dr. Hiob Paupersum seiner Tochter rote Rosen schenkte
Das Grillenspiel
J. H. Obereits Besuch bei den Zeitegeln
Mein Großvater liegt auf dem Friedhof des weltvergessenen Städtchens Runkel zur ewigen Ruhe bestattet. Auf einem dicht mit grünem Moos bewachsenen Grabstein stehen unter der verwitterten Jahreszahl, in ein Kreuz gefaßt und so frisch im Golde glänzend, als seien sie erst gestern gemeißelt worden, die Buchstaben:
„Vivo“ das heißt: „ich lebe“, bedeute das Wort, sagte man mir, als ich noch ein Knabe war und das erstemal die Inschrift las, und es hat sich mir so tief in die Seele geprägt, als hätte es der Tote selbst aus der Erde zu mir empor gerufen.
Vivo – ich lebe – ein seltsamer Wahlspruch für ein Grabmal!
Er klingt heute noch in mir wider, und wenn ich daran denke, wird mir wie einst, als ich davor stand: ich sehe im Geist meinen Großvater, den ich doch niemals im Leben gekannt, da unten liegen, unversehrt, die Hände gefaltet und die Augen, klar und durchsichtig wie Glas, weit offen und unbeweglich. Wie einer, der mitten im Reiche des Moders unverweslich zurückgeblieben ist und still und geduldig wartet auf die Auferstehung.
Ich habe die Friedhöfe so mancher Stadt besucht: immer war es ein leiser, mir unerklärlicher Wunsch, auf einem Grabstein wieder dasselbe Wort zu lesen, der meine Schritte lenkte, aber nur zweimal fand ich dieses „vivo“ wieder – einmal in Danzig, und einmal in Nürnberg. In beiden Fällen waren die Namen ausgetilgt vom Finger der Zeit; in beiden Fällen leuchtete das „vivo“ hell und frisch, als sei es selber voll des Lebens.
Von jeher nahm ich als erwiesen an, daß, wie man mir schon als Kind gesagt, mein Großvater keine Zeile von seiner Hand hinterlassen habe; um so mehr erregte es mich, als ich vor nicht langer Zeit in einem versteckten Fache meines Schreibtisches, unseres alten Erbstückes, auf ein ganzes Bündel Aufzeichnungen stieß, die offenkundig von ihm geschrieben waren.
Sie lagen in einer Mappe, auf der der sonderbare Satz zu lesen stand: „Wie will der Mensch dem Tod entrinnen, es sei denn, daß er nicht warte noch hoffe.“ Sofort flammte das Wort „Vivo“ in mir auf, das mich mein ganzes Leben hindurch wie ein lichter Schein begleitet hatte und nur weilenweis schlafen gegangen war, um, bald in Träumen, bald in Wachen, ohne äußeren Anlaß, wieder und wieder neu in mir zu werden. Wenn ich zuzeiten geglaubt, es könne Zufall gewesen sein, daß jenes vivo auf den Grabstein kam – eine Inschrift, der Wahl des Pfarrers überlassen – so wurde mir, als ich den Sinnspruch auf dem Buchdeckel gelesen, zu voller Gewißheit, es müsse sich dabei um eine tiefere Bedeutung handeln, um etwas, was vielleicht das ganze Dasein meines Großvaters erfüllt hatte.
Und was ich weiter las – in seinem Nachlaß – bestärkte mich in meiner Ansicht von Seite zu Seite.
Es stand zu viel von privaten Beziehungen darin, als daß ich es fremden Ohren enthüllen dürfte, und so mag es genügen, daß ich flüchtig nur das berühre, was zu meiner Bekanntschaft mit Johann Hermann Obereit führte und mit dessen Besuch bei den Zeit-egeln im Zusammenhang steht.
Wie aus den Aufzeichnungen hervorging, gehörte mein Großvater der Gesellschaft der „Philadelphischen Brüder“ an, einem Orden, er mit seinen Wurzeln zurückreicht bis ins alte Ägypten und den sagenhaften Hermes Trismegistos seinen Begründer nennt. Auch die „Griffe“ und Gesten, an denen die Mitglieder einander erkannten, waren ausführlich erklärt. – Sehr oft kam der Name Johann Hermann Obereit, eines Chemikers, der mit meinem Großvater eng befreundet gewesen schien und in Runkel gelebt haben mußte, vor, und da es mich interessierte, Näheres über das Leben meines Vorfahren und die dunkle weltabgewandte Philosophie, die aus jeder Zeile seiner Briefe sprach, zu erfahren, beschloß ich nach Runkel zu reisen, um dort zu erkunden, ob nicht vielleicht Nachkommen des erwähnten Obereit existierten und eine Familienchronik vorhanden sei.
Man kann sich nichts Traumhafteres denken als jenes winzige Städtchen, das wie ein vergessenes Stück Mittelalter mit seinen krummen, totenstillen Gassen und dem grasdurchwachsenen buckligen Pflaster zu Füßen des Bergschlosses Runkelstein, dem Stammsitz der Fürsten von Wied, unbekümmert den gellenden Schrei der Zeit verschläft.
Schon am frühen Morgen zog es mich hinaus zu dem kleinen Friedhof, und meine ganze Jugend wachte wieder auf, wie ich zum andern schritt und mechanisch die Namen derer von den Kreuzen ablas, die dort unten schlummerten in ihren Särgen. Von weitem erkannte ich an der funkelnden Inschrift den Grabstein meines Großvaters.
Ein alter Mann mit weißem Haar, bartlos, die Züge scharf geschnitten, saß davor, den Elfenbeingriff seines Spazierstocks ans Kinn gedrückt, und blickte mich mit merkwürdig lebhaften Augen an, wie jemand, bei dem die Ähnlichkeit eines Gesichtes allerlei Erinnerungen weckt.
Altmodisch gekleidet, fast in Biedermeiertracht, mit Vatermördern und schwarzseidner breiter Halsbinde, sah er aus wie ein Ahnenbild aus längst vergangener Zeit. Ich war über seinen Anblick, der ganz und gar nicht in die Gegenwart paßte, dermaßen erstaunt und hatte mich überdies so vergrübelt in all das, was ich dem Nachlaß meines Großvaters entnommen, daß ich, mir kaum bewußt, was ich tat, halblaut den Namen „Obereit“ aussprach.
„Ja, mein Name ist Johann Hermann Obereit“, sagte der alte Herr, ohne sich im geringsten zu wundern.
Mir verschlug es fast den Atem, und was ich im Verlauf des sich entwickelnden Gespräches noch weiter erfuhr, war ebenfalls nicht danach angetan, meine Überraschung zu vermindern.
Es ist an sich kein alltäglicher Eindruck, einen Menschen vor sich zu haben, der nicht viel älter schient, als man selbst ist, und doch anderthalb Jahrhunderte gesehen hat: – ich kam mir vor wie ein Jüngling trotz meiner schon weißen Haare, als wir nebeneinander hergingen und er mir von Napoleon und andern geschichtlichen Persönlichkeiten, die er gekannt, erzählte, wie man von Leuten spricht, die erst vor kurzem gestorben sind.
„In der Stadt gelte ich als mein eigener Enkel“, sagte er lächelnd und deutete auf einen Grabstein, an dem wir vorüberkamen und der die Jahreszahl 1798 trug, „von Rechts wegen sollte ich hier begraben liegen; ich habe das Todesdatum draufschreiben lassen, denn ich wünsche nicht, von der Menge als moderner Methusalem angestaunt zu werden. Das Wort ›Vivo‹“ fügte er bei, als habe er meine Gedanken erraten, „kommt erst hinzu, wenn ich wirklich tot bin.“
Wir schlossen bald enge Freundschaft, und er bestand darauf, daß ich bei ihm wohnte.
Wohl ein Monat war verflossen, und oft saßen wir bis tief in die Nacht in angeregter Unterhaltung beisammen, aber immer lenkte er ab, wenn ich die Frage stellte, was wohl der Satz auf der Mappe meines Großvaters: „Wie will einer dem Tod entrinnen, es sei denn, daß er nicht warte noch hoffe“, bedeuten möge: eines Abends jedoch – der letzte, den wir zusammen verbrachten (das Gespräch kam auf die alten Hexenprozesse, und ich vertrat die Absicht, es müsse sich in solchen Fällen wohl nur um hysterische Frauenzimmer gehandelt haben) – unterbrach er mich plötzlich: „Sie glauben also nicht, daß der Mensch seinen Körper verlassen kann und, sagen wir mal, nach dem Blocksberg reisen?“
Ich schüttelte den Kopf.
„Soll ich es Ihnen vormachen?“ fragte er kurz und sah mich scharf an.
„Ich gebe nur gerne zu“, erklärte ich, „daß die sogenannten Hexen durch den Gebrauch gewisser narkotischer Mittel in einen Zustand der Entrückung gerieten und felsenfest glaubten, auf einem Besen durch die Luft zu fliegen.“
Er dachte eine Weile nach. „Freilich, Sie werden immer sagen, auch ich bilde es mir nur ein“ – erwog er halblaut und versank wieder in Nachsinnen. Dann stand er auf und holte vom Bücherbord ein Heft. „Aber vielleicht interessiert es Sie, was ich hier niedergeschrieben habe, als ich vor Jahren das Experiment machte? Ich muß vorausschicken, ich war damals noch jung und voller Hoffnungen“ – ich sah an seinem versinkenden Blick, daß sein Geist zurückwanderte in ferne Zeiten – „und glaubte an das, was die Menschen das Leben nennen, bis es dann Schlag auf Schlag kam: ich verlor, was einem auf Erden lieb sein kann, mein Weib, meine Kinder – alles. Da führte mich das Schicksal mit Ihrem Großvater zusammen, und er lehrte mich verstehen, was Wünsche sind, was Warten ist, was Hoffen ist, wie sie miteinander verflochten sind, und wie man diesen Gespenstern die Maske vom Gesicht reißt. Wir haben sie die ›Zeit-egel‹ genannt, weil sie, wie die Blutegel das Blut, uns die Zeit, den wahren Saft des Lebens, aus dem Herzen saugen. Hier in diesem Zimmer war's, da lehrte er mich den ersten Schritt auf den Weg zu tun, auf dem man den Tod besiegt und die Vipern der Hoffnung zertritt. Und dann“ – er stockte einen Augenblick – „ja – und dann bin ich geworden wie Holz, das nicht fühlt, ob man es streichelt oder zersägt, ins Feuer oder ins Wasser wirft. Mein Inneres ist leer seitdem; ich habe keinen Trost mehr gesucht. Habe keinen mehr gebraucht. Wofür hätte ich ihn suchen sollen? Ich weiß: ich bin, und jetzt erst lebe ich. Es liegt ein feiner Unterschied zwischen: ›ich lebe‹ und ›ich lebe‹.“
„Sie sagen das alles so einfach, und es ist doch furchtbar!“ fiel ich erschüttert ein.
„Es scheint nur so“, beruhigte er mich lächelnd; „es strömt ein Glücksgefühl aus der Unbeweglichkeit des Herzens, das Sie sich nicht träumen lassen. Es ist wie eine ewige süße Melodie, dieses ›ich bin‹, die nie mehr erlöschen kann, wenn sie einmal geboren ist – weder im Schlaf, noch, wenn die Außenwelt wieder aufwacht in unsern Sinnen, noch auch im Tod.