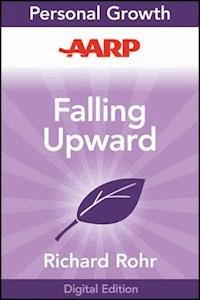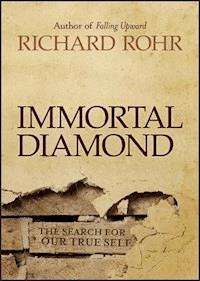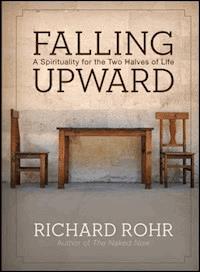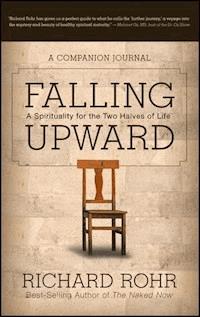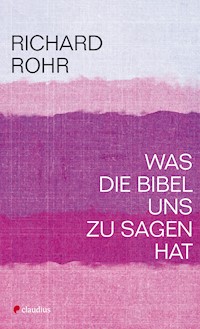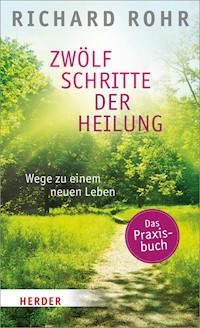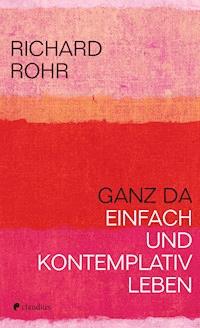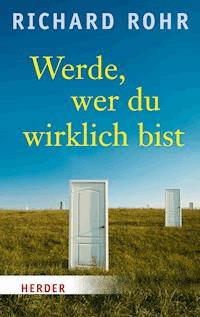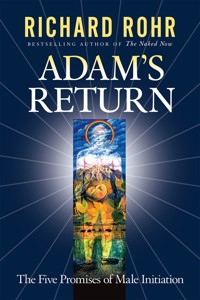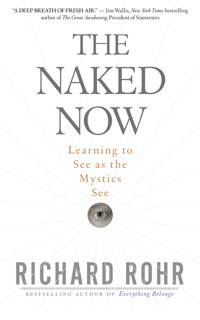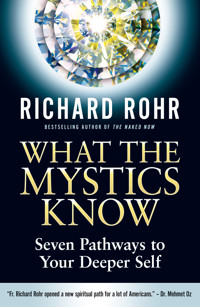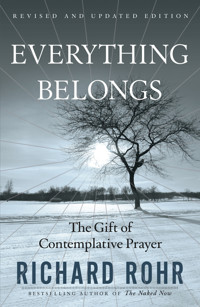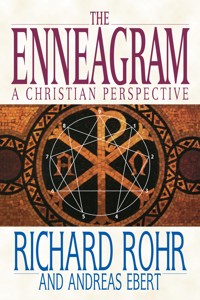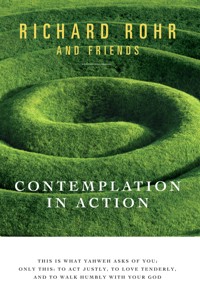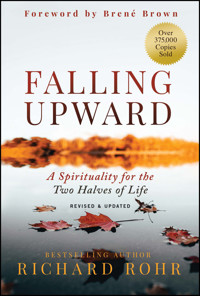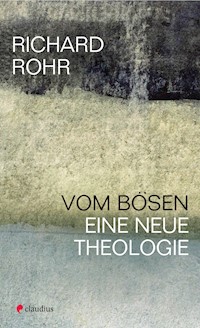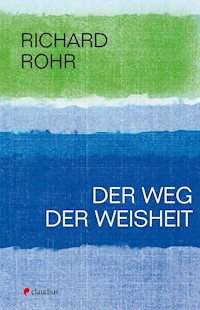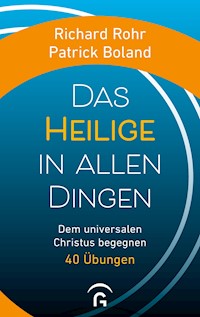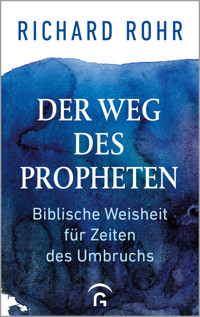
20,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Gütersloher Verlagshaus
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Das persönlichste Buch eines der bedeutendsten spirituellen Lehrer der Gegenwart
In seinem ersten großen Werk seit „Alles trägt den einen Namen“ führt Richard Rohr eine spirituelle Lebenshaltung der Hoffnung vor Augen, die auf der zeitlosen Weisheit der biblischen Propheten basiert.
Wie können wir in Zeiten des Umbruchs mit Zuversicht leben? Was hilft uns, in einer ungerechten und unsicheren Welt nicht nur Sorge und Wut zu empfinden? In seinem bisher persönlichsten Buch wendet sich Richard Rohr den Schriften der jüdischen Propheten zu. Er zeigt, wie einige der weniger gelesenen Bücher der Bibel uns heute einen überraschenden Weg zu Mitgefühl und Mut weisen.
Die Schriften der Propheten spiegeln einen besonderen Weg seelischer Reifung wider: Ob Amos oder Elija, Hosea oder Ezechiel - fast immer finden sie aus einer tiefen Wut und anklagenden Verzweiflung zu einer völlig neuen Haltung, in der sie das Leben trotz aller Schwierigkeiten zutiefst bejahen. Aus der scharfsinnigen Kritik an Kultur und Institutionen entsteht eine einzigartige Perspektive zur Bekämpfung des Bösen und der Ungerechtigkeit. Sie gründet im Wissen um die Verbundenheit aller Lebewesen und die behütende Realität einer göttlichen und universellen Liebe. Damit bereiten die Propheten den Weg für Jesus, der dieses Modell zur vollen Entfaltung brachte.
Auf die besondere Art, die Richard Rohr für Millionen von Menschen zu einem der wichtigsten spirituellen Lehrer der Gegenwart gemacht hat, haucht dieses Buch alter Weisheit neues Leben ein und öffnet einen Weg der Erkenntnis für alle, die nach einer mitfühlenden Lebensweise in einer leidenden Welt suchen.
- Ein Modell für eine Lebenshaltung der Zuversicht in einer unsicheren Welt
- Eine Ermutigung zur Wahrheit und zum Mitgefühl
- Für alle Leser*innen von Alles trägt den einen Namen
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 271
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Für eine Lebenshaltung der Zuversicht in einer unsicheren Welt
Wie können wir in Zeiten des Umbruchs mit Zuversicht leben? Was hilft uns, in einer ungerechten und unsicheren Welt nicht nur Sorge und Wut zu empfinden?
In seinem bisher persönlichsten Buch wendet sich Richard Rohr den Schriften der jüdischen Propheten zu. Er zeigt, wie einige der weniger gelesenen Bücher der Bibel uns heute einen überraschenden Weg zur Hoffnung, zu Mitgefühl und zum Mut weisen.
Richard Rohr ist ein weltweit bekannter Franziskaner und ökumenischer geistlicher Lehrer, dessen Werk von der tiefen Weisheit der christlichen Mystik zeugt. Er ist Gründer des Center for Action and Contemplation in Albuquerque, New Mexico, einer gemeinnützigen Bildungseinrichtung, die Suchenden den kontemplativen christlichen Weg der Transformation näherbringt.
Richard Rohr ist Autor zahlreicher erfolgreicher Bücher, darunter der New York Times Bestseller: Alles trägt den einen Namen. Die Wiederentdeckung des Universalen Christus.
RICHARD ROHR
DER WEG DES PROPHETEN
Biblische Weisheit für Zeiten des Umbruchs
Aus dem amerikanischen Englisch von Diedrich Steen
Der Verlag behält sich die Verwertung des urheberrechtlich geschützten Inhalts dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Wir haben uns bemüht, alle Rechteinhaber an den aufgeführten Zitaten ausfindig zu machen, verlagsüblich zu nennen und zu honorieren. Sollte uns dies im Einzelfall nicht gelungen sein, bitten wir um Nachricht durch den Rechteinhaber.
Die Zitate biblischer Texte in diesem Werk folgen der Übersetzung der Bibel in gerechter Sprache, herausgegeben von Ulrike Bail u.a., Gütersloher Verlagshaus, Erste Auflage Gütersloh 2006.
Titel der Originalausgabe:
The Tears of Things. Prophetic Wisdom for an Age of Outrage
© Richard Rohr 2025
This edition published by arrangement with Convergent Books, an imprint of Random House, a division of Penguin Random House LLC
1. Auflage
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2025
by Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
(Vorstehende Angaben sind zugleich
Pflichtinformationen nach GPSR.)
Umsetzung eBook: Greiner & Reichel, Köln
Umschlagmotiv: © Andreichenko – Adobe Stock.com
ISBN 978-3-641-33503-8V003
www.gtvh.de
Für Sheryl Fullerton, meiner vielfach leidgeprüften brillanten Lektorin, die sich über meine vielen unvollständigen und halbfertigen Ideen gebeugt hat, damit dieses Buch in Druck gehen konnte.
Für Lee Staman, unseren hochgeschätzten Bibliothekar am Center for Action and Contemplation, der mir versicherte, dass meine Hauptthese hier richtig ist.
Da, eine Hand streckte sich mir entgegen, und in ihr war
eine Schriftrolle. … Vorder- und Rückseite waren beschrieben.
Es stand dort: ›Klage‹ und ›Ach‹ und ›Wehe‹. …
Da öffnete ich meinen Mund und sie gab mir diese Rolle
zu essen. … Da aß ich sie und sie war in meinem Mund
so süß wie Honig. (Ezechiel 2,9f; 3,2f)
INHALT
EINFÜHRUNG
Nützlicher Unfrieden
KAPITEL 1
»Die Tränen der Dinge«
KAPITEL 2
Amos – Bote an die Gemeinschaft
KAPITEL 3
Eine kritische Masse – Das Geheimnis der kleinen Anzahl
KAPITEL 4
Wie die Propheten uns dabei helfen, heilige Unordnung zu befürworten
KAPITEL 5
Jeremia – Die Strukturen, die uns tragen
KAPITEL 6
Unvollendete Propheten – Elia, Jona und Johannes der Täufer
KAPITEL 7
Die Alchemie der Tränen – Wie wir universelles Mitgefühl und Güte lernen
KAPITEL 8
Die drei Jesajas – Das Herzstück der Prophetie
KAPITEL 9
Ezechiel – Erlösung und die Gnade Gottes
KAPITEL 10
Es kommt nur auf die Liebe an
EINEZUSAMMENFASSUNG
DIEPROPHETENISRAELS
SIEBENINHALTEDERALTERNATIVENORTHODOXIE
DANK
ANMERKUNGEN
DERAUTOR
EINFÜHRUNG
NÜTZLICHER UNFRIEDEN
Die Propheten der Hebräischen Bibel – und es gibt viele davon, darunter sieben Frauen1 – stellen wir uns gerne als wütende Prediger mit wilder Mähne vor, die das Volk Israel wegen seiner vielen Verfehlungen beschimpfen und sein zukünftiges Verderben voraussagen. Nun, einige Propheten taten genau das. Aber in meiner jahrlangen Beschäftigung mit ihnen habe ich gelernt, dass dieses vorherrschende Bild die Aufgabe, die Berufung und die Botschaft der Propheten nur sehr unzureichend beschreibt.
Es stimmt, dass die Propheten Israel viele Male dazu aufriefen, zum Bund, den Gott mit seinem Volk am Berg Sinai geschlossen hatte, zurückzukehren. Nachdem er es aus der Sklaverei in Ägypten herausgeführt hatte, gab er ihm das Gesetz und die Zehn Gebote, nach denen die Menschen ihr Zusammenleben im Gelobten Land gestalten sollten. Sie sollten nicht lügen, nicht stehlen, keinen Ehebruch begehen usw. Diese Regeln formulierten eine Grundordnung, ohne die eine Gesellschaft nicht bestehen kann. Aber die Menschen scheiterten daran, diese Grundordnung zu befolgen. Sie legten sich Reinheitsgebote auf und hingen einem religiösen Leistungsdenken an, sie folgten dem Buchstaben des Gesetzes, statt in seinem Geist zu handeln. Sie vergaßen ihre Versprechen Gott gegenüber und erinnerten sich nicht mehr daran, wie sehr Jahwe sich um sie kümmerte und für sie sorgte. Immer wieder brauchte es darum Menschen, die dazu aufriefen, zu Gott und zu seiner Gerechtigkeit zurückzukehren. Menschen, die warnten, kritisierten und ihren Mitmenschen Gottes Wesen und Wollen neu vor Augen führten. Diese Menschen nennen wir Propheten. Und jede Religion braucht sie.
In den für die Religionsgeschichte Israels entscheidenden Jahrhunderten von etwa 1.300 v. Chr. über die Zeit der Könige und des Exils hinweg bis in die Zeit der Besatzung durch fremde Mächte, waren Propheten wie Samuel, Jona, Amos, Jesaja, Jeremia und Ezechiel nicht nur »Wahrheits-Sager«, Menschen also, die die Fakten vor Augen führten. Sie waren als Botschafter göttlicher Offenbarungen auch die Verkünder ethischer Alternativen, die auf radikale Veränderung drängten und bestehende Ordnungen infrage stellten. Jesaja und Ezechiel bezeichnen die Propheten als »Wächter« oder »Wachleute«, deren Aufgabe es sei, Israel auf die Nerven zu gehen, indem sie die Menschen auffordern, sich an die Wahrheit zu halten und sich nicht mit Hilfe von Lügen, Geld, Waffen oder Macht eine trügerische Sicherheit zu verschaffen.
Damit führten sie ein völlig neues Rollenmodell in die Welt der antiken Religionen ein: einen »advocatus diaboli« mit der Lizenz zur öffentlichen Kritik, dessen Aufgabe es war, die Schattenseiten der eigenen Gruppe zu benennen und aufzudecken. Wenn überhaupt, dann haben nur wenige Kulturen ein solches kontraintuitives Rollenmodell entwickelt. Zivilisationen sind von Natur aus auf den eigenen Erfolg ausgerichtet und haben wenig Sinn für Selbstkritik. Wir verhöhnen das gegnerische Team und bemühen uns gleichzeitig um eine ungebrochene Loyalität gegenüber dem eigenen. In Israel war das in der Zeit nach Mose und bis ungefähr fünf Jahrhunderte vor dem Auftreten Jesu, als das Volk aus dem babylonischen Exil zurückkehrte, anders. Nach dem Exil allerdings scheint das Interesse an den Propheten abgenommen zu haben. Es gibt aus dieser Zeit nur die Moralpredigten Maleachis und verstreute Fragmente aus Sacharja II. Die Stimmen der Propheten sind in dieser Zeit nicht mehr zu hören und vielleicht ist das der Grund dafür, dass die Menschen zur Zeit Jesu für sein Auftreten nicht bereit waren. Die religiöse und spirituelle Wirklichkeit war zu uneinheitlich, und es gelang den einzelnen Menschen nicht mehr, eine starke innere spirituelle Empfindsamkeit zu entwickeln. Eine aufs Äußere gerichtete Observanz bestimmte die religiöse Praxis, was in der Bibel durch die häufige Erwähnung der »Schriftgelehrten und Pharisäer« als Gegner Jesu Ausdruck findet.
Im Matthäusevangelium kritisiert Jesus das in aller Deutlichkeit:
Wehe euch, ihr Scheinheiligen unter den Toragelehrten und pharisäischen Männern und Frauen! Ihr verzehntet Minze und Dill und Kümmel und habt das preisgegeben, was in der Tora mehr Gewicht hat: Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Vertrauen. Wir sollten das eine tun und das andere nicht preisgeben. Ihr Unverständigen, die den Weg zeigen wollen! Ihr siebt die Mücke heraus und verschluckt ein Kamel.
(Matthäus 23,23f)
Die gleiche Tendenz finden wir heute bei denen, die an der Macht sind oder nach ihr streben. Sie sind mehr darauf aus, die eigenen Interessen zu wahren, als sich um Gerechtigkeit zu bemühen.
Möglicherweise haben Sie schon einmal Gemälde oder Bilder auf Glasfenstern in einer Kirche gesehen, die einen Propheten darstellen, der auf Jesus zeigt. Vielleicht ist das heute deren Funktion! Ich bin überzeugt davon, dass wir Jesus nur dann verstehen können, wenn wir die Geschichte, das Wesen und den einzigartigen Ansatz der Propheten aus der Hebräischen Bibel verstanden haben.
In fast jedem Jahrhundert haben wir, wenn es keine Propheten gab, Zuflucht zu Revolutionen oder Reformen gesucht. Unsere Gesellschaften hatten keinen anderen inneren Mechanismus für Veränderung, und so ging es in unserer Geschichte vor allem darum, Ketzer aufzuspüren, vermeintliche Rebellen einzusperren und zu töten und so die Interessen unterschiedlicher tonangebender gesellschaftlicher Gruppen, die oft dualistischen und aggressiven Weltbildern anhingen, zu schützen. Dabei glaubte jede dieser Gruppen, mehr im Recht zu sein als die vorangegangene. Revolutionen traten an die Stelle einer Evolution, bei der sowohl Ordnung als auch Unordnung zusammenwirken dürfen.2 Das aber ist kein guter Weg, um voranzukommen.
Wenn wir uns ansehen, was Propheten tun und wie sie es tun, stellen wir fest, dass sie einem typischen Muster folgen. Wenn ein Prophet oder eine Prophetin wahrnimmt, dass der aktuelle Zustand einer Gesellschaft nicht zufriedenstellend ist, fördert er oder sie das, was ich als »heilige Unordnung« bezeichne. Gemeint ist ein Prozess, bei dem die geltenden Selbstverständlichkeiten und grundlegenden Beziehungen einer Gruppe aufgebrochen werden (wie das bei der Eroberung Israels durch die Babylonier z.B. der Fall war). Diese Disruption kann positive oder negative Auswirkungen haben. Entweder wächst unser Verständnis von Gott über unser gegenwärtiges, begrenztes Verständnis hinaus und wir wachsen mit (wie ich in meinem Buch Reifes Leben schrieb)3 oder wir entwickeln uns zurück, weil wir uns auf das, was geschieht, nicht einlassen können. Dann flüchtet sich die Gesellschaft in Legalismus und Formalismus, in der Erhaltung des Bestehenden, bis sie schließlich vollkommen in sich erstarrt. Aus solchen Störungen entsteht im besten Fall eine neue Ordnung. In ihr können die menschlichen Beziehungen auf einer höheren Ebene gedeihen. Sie sind hier kreativer, weniger dualistisch und in der Regel weniger gewalttätig als in der Ordnung auf der Ebene, die verlassen wurde.
»Heilige Unordnung« zu schaffen und sie zuzulassen ist das, was der amerikanische Bürgerrechtler und spätere Senator John Lewis als »nützlichen Unfrieden« bezeichnete. Er meinte damit die guten, weil notwendigen Akte des zivilen Ungehorsams im Streben nach mehr Rassengerechtigkeit. Diese Denkweise finden wir ebenso ausgeprägt auch bei den Propheten. Auch für sie konnten »nützlicher Unfrieden« und »heilige Unordnung« Besseres hervorbringen – ein völlig verändertes Bewusstsein, das sich durch ein größeres Gerechtigkeitsempfinden, dem Streben nach mehr Barmherzigkeit und eine intensivere Gottesnähe auszeichnet.
Natürlich verläuft dieser Prozess nie linear und er kommt auch nie an ein Ende. Die neue Ordnung wird wieder zu einer alten. Wir brauchen darum Propheten, die uns davor bewahren, den Status quo zu vergöttern. Wir brauchen Propheten, die den Prozess einer organischen Veränderung von innen in Gang halten.
Ich finde es auf diesem Hintergrund bemerkenswert, dass die Katholische Kirche das Weihesakrament kennt. Diejenigen, die Priester werden, werden mit der Weihe »ordiniert«, d.h. in eine Ordnung eingebunden. Obwohl die Prophetie dem biblischen Zeugnis zufolge als Gabe des Heiligen Geistes gleich nach dem Amt der Apostel kommt (1. Kor 12,28; Eph 4,11) und für wichtiger erachtet wird als das Lehramt oder die Bevollmächtigung, Wunder zu tun, gibt es aber kein Ritual, das sich auf die Bevollmächtigung zur »heiligen Unordnung« bezieht. Wir müssen uns fragen: Warum musste das kritische Denken immer von außen an unsere Glaubenssysteme herangetragen werden? Warum wurde es nicht von innen heraus ermöglicht?
Wir haben versucht, die Religion nach den gleichen von Zwang und Macht bestimmten Regeln zu reformieren, die auch in Wirtschaftssystemen oder Nationalstaaten zur Anwendung kommen. Dabei behalten die Eigeninteressen derjenigen, die die Macht haben, oft die Oberhand. Zugleich haben wir die Neigung, das Böse kleiner zu machen, als es ist, indem wir einzelne »Bösewichter« identifizieren, aber nicht die Dinge aufdecken und angreifen, die über Generationen hinweg die meisten Gesellschaften zerstören: Lügen, Stolz, Betrug, Macht, Krieg und Gier.
Das ist mehr als alles andere der Grund dafür, dass das Christentum wenig dazu beitrug, das Römische Reich, das Heilige Römische Reich Deutscher Nation oder die Imperien unter russischer, französischer, spanischer, britischer oder amerikanischer Herrschaft zu reformieren und weiterzuentwickeln, sondern lieber mit ihnen ins bequeme Bett stieg. Die bösen Mächte, die die Menschen bei lebendigem Leib verschlangen, wurden selten als solche kenntlich gemacht. Vielmehr ging es den »priesterlichen« Gruppen darum, Ritualvorschriften und Reinheitsgebote durchzusetzen – Äußerlichkeiten, an denen Jesus und die Propheten wenig oder überhaupt kein Interesse zeigten. Wenn man die Weise, wie Propheten die Dinge sehen, außer Acht lässt, dann wird vieles, das böse ist, geleugnet, verschleiert und hinter den Regeln der Religion und des Gesetzes versteckt. In einer solchermaßen dualistischen Welt wird die Wahrheit »erkannt«, in dem man religiöse Reinheits- und Identitätswettbewerbe gewinnt.
Der Philosoph Ken Wilber schreibt, dass unser Weg zur Reife in der Regel eine Abfolge von Schritten beinhaltet, die mit den Stichworten »Aufwachsen«, »Aufwachen«, »Aufblühen« und »Aufstehen« gekennzeichnet werden könne.4 Zu oft begnügen wir uns jedoch damit, nach einer Zeit des Aufwachsen nur »aufzuräumen« und das uns Wichtige vom uns weniger Wichtigen zu trennen. Wir bleiben dabei auf uns bezogen, fragen nicht nach den Talenten, die wir für andere nutzen können (aufwachen) und dann auch engagiert nutzen sollten (aufblühen und aufstehen). Dabei ist das Aufblühen gar nicht so schwer. Es kommt nur darauf an, unser Bedürfnis nach Abgrenzung zu erkennen und zu überwinden. Mir fällt in diesem Zusammenhang eine Klarstellung von Papst Franziskus über die grundlegende Bedeutung des Segens ein. Dieser wird nicht über Menschen gesprochen, die schon alle moralischen Hürden genommen haben, sondern über alle, die darum bitten!
Wir müssen uns einer Tatsache immer bewusst sein: Für das nicht transformierte Selbst ist Religion die gefährlichste Versuchung von allen. Unser durch Religion legitimiertes Ego erlaubt es uns, aufgrund seiner vorgeblichen Tugendhaftigkeit und seines angeblichen Hasses auf alles Böse zu unterjochen, auszugrenzen, zu erniedrigen, zu betrügen und uns selbst zu erhöhen. Genau das ist es, was die Propheten in umfassender Weise angreifen, wenn sie sich gegen den Kult im Tempel, gegen die priesterlichen Eliten, gegen Gebote, die nur dem Nutzen weniger dienen, und über Generationen hinweg weitergegebenen Reichtum wenden. »Seid hier sehr vorsichtig!«, mahnen sie immer wieder. Die Propheten wissen, dass Religion das Beste ist, aber auch das Schlimmste sein kann, weil wir es lieben, uns selbst für rein und ohne Schuld zu halten, weil wir es mögen, uns auf die Seite der Guten zu stellen, auch wenn es nur wenige Beweise dafür gibt, dass wir es wirklich sind. Für uns mag das überraschend sein, nicht so aber für die Propheten.
Was mir an den prophetischen Büchern der Bibel am besten gefällt, ist, dass sie zeigen, wie sich bei einer ganzen Reihe von Menschen das Gottesverständnis entwickelt. Wir kennen das von uns selbst: Am Anfang steht bei den Propheten oft ein Überlegenheitsgefühl, mit dem sie sich über andere erheben und diese wütend bewerten. Nach und nach zerbröselt diese Haltung dann. Die Prophetenbücher zeigen, wie der Prophet den Zorn überwindet und ein neues Bewusstsein entwickelt, das der Haltung Gottes näherkommt – seiner Geduld, seiner Vergebungsbereitschaft, seiner Liebe.
In der gesamten Bibel scheinen die Propheten eine Sünde mehr als alle anderen anzuprangern: den Götzendienst, unsere Neigung, Dinge, die nicht absolut, unendlich und objektiv gut sind, zu »vergöttlichen«. Und ebenso unbarmherzig nehmen sie unsere Selbstgerechtigkeit aufs Korn, die immer bemüht ist, uns im allerbesten Licht erscheinen zu lassen. So z.B. im Lukasevangelium: Nachdem Jesus die beiden Gebote »Liebe den Herrn, deinen Gott« und »Liebe deinen Nächsten wie dich selbst« als die wichtigsten des Gesetzes herausgestellt hat, fragt ein frömmlerischer »Gesetzeslehrer«, der symbolisch für uns alle steht: »Wer ist mein Nächster?« Das aber fragt er nicht, weil er eine ehrliche Antwort hören möchte, sondern weil er »weiter Recht bekommen will« (Lukas 10,27-29).
Die Bitte um Erbarmen zu Beginn christlicher Gottesdienste ist darum eine Mahnung und Warnung zugleich, die uns daran erinnern soll, dass wir uns auf heiligem Boden bewegen. Wir wissen nicht, wovon wir sprechen, wenn wir von Gott reden, und sollten daher demütig sein. Wenn ein Gottesdienst nicht mit einem aufrichtigen »Kyrie eleison« beginnt, ist Vorsicht geboten. Wir brauchen stets und immer die Gnade Gottes, weil wir die wahre Natur des Heiligen Mysteriums nicht kennen.
Propheten sind also »Wahrheits-Sager«, die uns vor Augen führen, was in Wahrheit ist. Sie sind keine Wahrsager, die die Zukunft voraussagen, sondern Männer und Frauen, die den Schleier von unserem Selbstbetrug reißen, von den immer gleichen Geschichten vom Gewinnen und Verlieren, Bestrafen und Belohnen. So geben sie uns die Möglichkeit, Neues zu gestalten. Propheten sind die Ausnahmegestalten, die die Wirklichkeit in der Fülle ihrer Möglichkeiten sehen, statt nur in Dualitäten von richtig oder falsch, gut oder böse.
In jeder Epoche muss es Menschen geben, die die Glaubensgemeinschaft und die Gesellschaft im Allgemeinen mahnen: Euer oberflächlicher Blick auf das Leben – und auf Gott – ist im Großen und Ganzen falsch und egoistisch! Und er wird in erster Linie von eurer Angst bestimmt. »Niemand anderer ist euer Problem«, sagt der Prophet. »Ihr selbst seid euer Problem. Was ihr für gut haltet, ist allzu oft eine Täuschung, und was ihr für schlecht haltet, könnte dagegen euer wertvollster spiritueller Schatz sein.« Dabei üben Propheten und Prophetinnen nicht nur Kritik, sondern bieten auch Visionen für eine gerechtere, barmherzigere und friedlichere Gesellschaft an. Sie rufen die Menschen dazu auf, diesen Visionen zu folgen. Religion oder philosophische Konzepte aber, die der Blindheit der Gruppe Vorschub leisten, statt diese zur Hellsichtigkeit zu führen, stehen einem Aufbruch entgegen.
Wie Jesaja es ausdrückte: »Weh denen, die das Böse gutheißen und das Gute böse. Sie machen Finsternis zu Licht und Licht zur Finsternis. Sie machen bitter zu süß und süß zu bitter.« (Jesaja 5,20) Er zeigt auf, wie wir alle Worte und Gefühle benutzen, um uns selbst und andere zu täuschen. Wie das konkret aussieht, kann man an einer politischen Partei in Amerika sehen, die auf jedem Parteitag lautstark »Recht und Ordnung« fordert und tatsächlich nichts so sehr hasst wie genau das: Recht und Ordnung. Nicht wenige der politischen Führer, die gegen Schamlosigkeit wettern, haben heimlich eine Affäre. Wenn es uns an Selbsterkenntnis fehlt, projizieren wir unbewusst unser ungeliebtes und unbekanntes Selbst auf andere und verurteilen diese für genau die Fehler, die wir selbst haben. Es ist darum kein Wunder, dass die meisten Propheten ermordet wurden, wie Jesus in Matthäus 23,31 anklagend feststellt.
Was für eine katastrophale Dynamik! Für den französischen Anthropologen und Literaturkritiker René Girard ist die Bibel in der gesamten Weltliteratur gerade darum einzigartig, weil sie die menschliche Neigung, die eigenen dunklen Seiten nicht sehen zu wollen, deutlich benennt. Girard nennt die Projektion unserer eigenen Fehler und Ängste auf andere »den Sündenbockmechanismus«.5Es gebe ihn in allen Kulturen, aber nur die Bibel beschreibe seine Funktionsweise. Girard betont, dass mit dem im Johannesevangelium angesprochenen »Unrecht der Welt« (Johannes 1,29) genau dieser Sündenbockmechanismus gemeint sei. Ihn zu überwinden, wäre die Aufgabe eines jeden, der davon spreche, die Menschheit und unsere stets fragile Geschichte »erlösen« zu wollen. Und doch bleibe der Mechanismus in den meisten Fällen unerkannt. Die jüdische und die christliche Religion entwickelten sich beide zu Glaubensgemeinschaften, denen es eher um individuelle Sündenfreiheit ging als darum, sich mit den Leidenden und den Sündern zu solidarisieren. Dies ist meiner Meinung nach ein entscheidender Punkt.
Die Religionen der Welt scheinen sich in jeder Epoche dafür hergegeben zu haben, etwas oder jemanden zu opfern, um so dazu beizutragen, dass der Status quo aufrechterhalten werden kann. Heute sind es die Migranten an den Grenzen; in anderen Zeiten waren es die Schwarzen im Süden oder die indigenen Völker Amerikas, die von ihrem Land vertrieben wurden. Indem Jesus, so betont René Girard, einen unendlich liebenden Gott offenbare, hebe er die Notwendigkeit des Opfers »ein für alle Mal« (Hebräer 7,28; 10,10) auf. Ein liebender Gott lässt sich nur schwer instrumentalisieren. Man kann mit ihm auch niemandem drohen. In dem vielleicht subtilsten und am besten begründeten theologischen Werk des Neuen Testaments, dem Brief an die Römer, betont Paulus darum, dass wir »dem Gesetz entbunden (sind), in dem wir gefangen waren.« (Römer 7,6) Nach Tod und Auferstehung Jesu sind wir »in der erneuerten Wirklichkeit der Geistkraft … nicht länger von der Ordnung des alten Buchstabens bestimmt«. (Römer 7,6) Die Propheten und Paulus lehren also, dass das Gesetz niemals Selbstzweck sein dürfe, sondern nur die Funktion habe, das aufgeblasene menschliche Ego vor sich selbst und das Wohl aller zu schützen. Diesem Thema widmet Paulus den größten Teil seines Briefes an die Römer sowie nochmals drei ganze Kapitel seines Galaterbriefes (3-5).
Die Aufgabe der Propheten war es immer, das eigentliche Problem offenzulegen: das Problem nämlich, das bei den Anklägern selbst und in den Trugbildern der Gesellschaft liegt. Sie benennen die so weitverbreitete Selbsttäuschung, wonach gilt: »Weil dein Steinewerfen schlecht ist, ist mein Steinewerfen gut.« Wenn das Problem wirklich in blind befolgten Konventionen jeder Gemeinschaft liegt, kann es nicht auf Sündenböcke abgewälzt werden, in der falschen Erwartung, dass »wir Rechtschaffenen« von Schuld oder Scham frei bleiben.
Die jüdischen Propheten sind einzigartig, wenn es darum geht, die verborgene, kollektive und maskierte Natur der Sünde und des Bösen zu erkennen. Sie sind gnadenlos, wenn es darum geht, die Wahrheit ans Licht zu bringen und die Masken herunterzureißen, die Einzelpersonen und Gruppen aufziehen, um ihr Selbstbild zu schützen. Die Propheten prangern nicht nur die Machthaber an, weil sie korrupt sind und ihre Aufgaben vernachlässigen, sondern kritisieren das gesamte System des Tempel- und Opferkultes. So schimpft Amos: »Die auf Elfenbeinbetten liegen, die sich auf ihren Diwanen fläzen, die junge Schafe und Ziegen verschlingen und Kälber aus dem Maststall; die wie David auf der Harfe herumklimpern, die für sich Musikinstrumente ausdenken; die Wein aus Opferschalen schlürfen: Sie versalben das beste Öl, und die schert der Untergang Josefs nicht.« (Amos 6,4-6)
Seit jeher errichten wir immer dieselben auf Eigennutz ausgerichteten Machtzentren, wie sie Jesus und die Propheten anprangerten. Die meisten von uns haben resigniert und sich mit diesem Zustand abgefunden. Als beispielsweise bekannt wurde, wie weit Pädophilie unter katholischen Priestern verbreitet ist, erwarteten nur sehr wenige, dass Kardinäle, Bischöfe und Priester ihre Komplizenschaft eingestehen oder sich ernsthaft darum bemühen würden, etwas dagegen zu unternehmen. Wir sind einfach nicht wirklich im Bilde darüber, welche Formen strukturelle Sünde annimmt; wir haben kein Bewusstsein für kollektive Schuld und generationenübergreifende Traumata, geschweige denn für kulturell geformte Ressentiments. Nicht alles davon ist böswillig. Aber wir neigen dazu, Einzelnen die Schuld zu geben und sie zur Umkehr aufzufordern. Die Analyse der Gesellschaft als ganzer wird dagegen von manchen als eine »Vermischung von Politik und Religion« verurteilt. Aber genau diese Analyse nehmen die Propheten vor. Sie wenden sich an die Gemeinschaft und nicht nur an den Einzelnen, um das Wohl der Allgemeinheit zu fördern und um überhaupt deutlich zu machen, dass das Wohl der Allgemeinheit möglich ist. Diese Einsicht ist für uns immer noch schwer zu begreifen.
Lernen, so zu lieben, wie Gott liebt
Als der Prophet Moses auf dem Berg Sinai war, fürchteten die rebellischen Israeliten, dass er nicht wiederkommen würde, und forderten ein Gottesbild, das die sehen konnten. Aaron, der Hohepriester und Bruder des Moses, beugte sich dieser Forderung. Er nahm allen Goldschmuck des Volkes und goss daraus ein goldenes Kalb, das dann zum Mittelpunkt der Anbetung wurde. Anders als Moses folgte Aaron damit lieber den Wünschen des Volkes als denen Gottes.
Als Moses zurückkehrte und sah, was geschehen war, zermahlte er das goldene Kalb zu Pulver, vermischte es mit Wasser und ließ die Israeliten trinken, was in seinen Augen eine notwendige Medizin für sie war (Exodus 32,20). Eine ebenso schockierende wie eindrückliche Zeichenhandlung: Ähnlich wie heute in mancher Suchttherapie gibt der Prophet den Menschen das eigene Gift zu »schmecken«, damit sie sich zukünftig davon fernhalten.
Die Priester der aaronitischen Tradition waren damit beschäftigt, Ritualen und Opfergottesdiensten vorzustehen, die nur sie leiten konnten. Sie bemühten sich, dem Volk zu geben, was dieses wollte, Hauptsache, sie selbst hatten einen Vorteil davon. In dieser Perspektive scheint jeder Priester einen prophetischen Bruder wie Moses oder eine prophetische Schwester wie Miriam zu nötig zu haben, die ihm beharrlich vor Augen führen, wo er goldene Kälber erschafft. Ein Aaron ohne einen Moses oder eine Miriam kann leicht zu einem Problem werden.
Als Propheten wirken Moses und Miriam als Korrektiv zu Aarons priesterlicher Dominanz. Aaron gestaltet und bewahrt den religiösen Raum, während die Propheten, wie Moses und Miriam, dafür sorgen, dass der Raum lebenswert und schön ist. In der biblischen Exoduserzählung leitet Miriam, nachdem die Flucht aus Ägypten geglückt ist, das Freudenfest mit Musik, Tanz und Lobliedern (Exodus 15,20-21).*
Ich sage gerne, dass sie die Befreiung zur Darstellung bringt. Moses ist derweil derjenige, der die vollständige Befreiung theologisch begleitet. Auf der Wanderung der Israeliten durch die Wüste sucht er stets nach einem Gleichgewicht zwischen Kult, Gesetz und Gemeinschaft. Er ist der erste, der diese damals neue Rolle des »Propheten« verkörpert und formt. Moses bringt das Gesetz vom Berg herab und zerschmettert es, als er sieht, dass das Volk ungehorsam war und das goldene Kalb erschaffen hat (Exodus 32,19). In diesen Handlungen verbindet er Ordnung mit Unordnung und verdient sich so seine Position als mutmaßlicher Begründer der monotheistischen Religion und einer klar definierten Prophetie. Moses zügelt und bändigt Aarons Neigung, der Menge mehr Beachtung zu schenken als Gott (wie er es mit dem goldenen Kalb tat), und macht Aaron so religiös handlungsfähig und nicht zu einem völligen Götzendiener.
Die den Egoismus untergrabende und den Sündenbockmechanismus entlarvende Vorgehensweise der Propheten ist meiner Meinung nach der Grund dafür, dass sie nie populär waren oder viel gelesen werden, obwohl prophetische Texte einen so großen Teil der Bibel ausmachen. Sie fordern uns ja auch auf, »zu sterben, bevor wir sterben« und dazu, die Dinge mit den Augen einer unendlichen Liebe zu sehen. Ohne ein solches Fundament der Liebe verkommen fast alle Religionen und Weltanschauungen zu Formen des Opferkults, in denen wir etwas (oder jemanden) entwerten, in der Hoffnung, selbst an Wert zu gewinnen. Deshalb spricht Jesus vom »Sterben des Selbst«. Und der Buddhismus weiß um die Notwendigkeit, alle Täuschungen und schlechten Gewohnheiten des Geistes, die Menschen davon abhalten, die Realität klar zu sehen, durch Übung zu überwinden. Alle Religionen, die eine Verwandlung und Umkehr des Menschen anstreben, versuchen auf ihre je eigene Weise, das übermächtige Ego zu bezwingen und das stets getarnte dunkle Selbst zu demaskieren. Doch wir müssen in der Gewissheit unendlicher Liebe verankert sein, bevor wir eine solche Aushöhlung des Egos riskieren können. Die Propheten führen uns auf ihre je eigene Weise allmählich zu dieser göttlichen Gewissheit und durch sie hindurch.
Wie die Propheten schon wussten, hängen wir an unseren Illusionen, wir brauchen unsere Feindbilder und wir sind an unsere Fehden und Vorurteile gewöhnt, so sehr wir auch das Gegenteil behaupten. Sie geben uns ein Gefühl moralischer Überlegenheit. Wie der Erzengel Michael, der den Drachen erschlug, alles Böse aus dem Himmel vertrieb (Offenbarung 12,7; 20,2) und so die gesamte Schöpfung in das absolut Gute und das absolut Böse teilte, können wir heldenhaft auf der Seite des absolut Guten stehen. Sichtbar wird das besonders in der umfassenden Anziehungskraft, die Krieg und Kampf ausüben, selbst dann, wenn objektiv nicht gut ist, was wir tun, weil wir eindeutig nur im Eigeninteresse handeln. Warum gilt im Krieg das Gebot »Du sollst nicht töten« plötzlich nicht mehr? Nur Quäker, Amische und Mennoniten sowie neuere Vertreter der Gewaltlosigkeit hatten den Mut, diese beunruhigende Frage überhaupt zu stellen.
Gott ist immer noch dabei, uns langsam von unserer Liebe zum Sieg und zum Erfolg zu befreien. Die allmähliche Wandlung unserer Gottesbilder – vom Löwen zum Lamm, vom zornigen Gott zu einem Gott der Tränen, von der verlassenen Einsamkeit zur dankbaren Gemeinschaft – vollzieht sich in aller Stille. Die Menschheit wird tatsächlich erwachsen. Das ist nur schwer nachzuvollziehen, solange wir nicht mindestens einmal mit dieser prophetischen Form einer gegenkulturellen Sichtweise in Berührung gekommen sind. Heute bin ich zum Beispiel voller Bewunderung für die große Anzahl von Menschen, die ernsthaft und leidenschaftlich an Werten orientiert sind, ohne einer bestimmten Gruppe anzugehören, die sie dazu zwingen würde, sich an deren Regeln zu halten. Das ist neu, denke ich, zumindest in einem so großen Umfang. Man kann Werte haben, ohne mit einer Bewegung verbunden zu sein, auch wenn man ohne ein Team strategisch wahrscheinlich weniger effektiv ist.
Dies ist die im Grunde wichtigste Lektion: Wir können eine solche Liebe entwickeln, indem wir genau darauf achten, wie Gott uns und die gesamte Schöpfung liebt. Oft muss man dazu nur das universelle Loblied der Natur hören und mitsingen, so wie es der heilige Franziskus, Hildegard von Bingen, William Wordsworth, John Muir und Mary Oliver taten. Schon der aufmerksame Blick auf eine Frühlingsblume, die aus dunkler Erde sprießt, oder auf ein Rotkehlchen, das über den Rasen hüpft – oder auf irgendetwas in der Natur – offenbart Gottes grenzenlose Großzügigkeit und die Heiligkeit jedes geschaffenen Wesens. So sieht Gott. Die meisten von uns haben nie gelernt, welche Erkenntnisse sich aus dieser Art der Betrachtung der geheimnisvollen Bewegung des Lebens und Sterbens ziehen lassen, weil wir von der Lektüre von von Menschen geschriebener religiöser Texte geprägt sind, in denen Gott als zornig, wütend, anklagend und strafend dargestellt wurde. Wir haben so ziemlich alle unsere Götter vermenschlicht und uns vorgestellt, sie wären so kleinlich und rechthaberisch wie wir!
Die Propheten haben genauso angefangen, aber sie haben sich verändert und sind erwachsen geworden. Das ist das Grundthema dieses Buches. Die Propheten erlaubten es Israel nicht, Gottes immerwährender Liebe untreu zu werden, weil sie auf das Bundesverhältnis (hesed) vertrauten, das Israel in die Gemeinschaft mit Gott »hineingeliebt« hatte. Es war Gottes beständiges Handeln an Israel, nicht die eigene Leistung oder der Status als »auserwähltes Volk«, das die Israeliten zu »Auserwählten« machte!
Mich erinnert das daran, dass ich als kleiner Junge davon überzeugt war, der »Auserwählte« zu sein, der Liebling meiner Mutter unter uns vier Kindern. Das war objektiv gesehen nicht wahr, aber der Glaube daran hatte eine magische Wirkung auf mich. Denn nun war es auch einfach zu glauben, dass ich Gottes Auserwählter war, so wie ich für Mama und Papa »Dickie Boy« war. Die Vorstellung, auserwählt zu sein, zieht uns sowohl in das Einssein als auch in die Güte, fast wie ein Magnet. In gleicher Weise betonen die Propheten auf eindrucksvolle Weise, dass die Israeliten sich auf Gott als Quelle ihrer Identität und des Zusammenhalts der Gruppe konzentrieren müssen. Gott machte sie zugleich eins und gut – durch Nachahmung und durch Reflexion.
In einer trinitarischen Perspektive ist alle Realität im Kern eine Beziehung.6 Der eine und einzige Spiegel des Wohlwollens zeigte sich Israel und machte es vollkommen sicher, frei und authentisch – und zugänglich für die tägliche Hinwendung und Begegnung, die wir zuallererst als Gebet bezeichnen würden. Jahwe stand ihnen als Gott Israels zur Verfügung, und die Propheten mussten sich diese Verfügbarkeit durch wechselseitige Verletzlichkeit, Risikobereitschaft und Selbsterkenntnis erschließen. Genauso, wie wir es heute tun.
Erstaunlicherweise beschrieben die Propheten diese Beziehung wiederholt als eine »Ehe« mit Gott. So sagt Hosea:
Ich will dich für mich auf ewig gewinnen.
Ich will dich für mich gewinnen
durch Gerechtigkeit und Recht,
durch Güte und Barmherzigkeit als Brautpreis.
Ich will dich für mich durch Treue gewinnen.
So sollst du die Ewige erkennen.
(Hosea 2,21f)
Diese Vertrautheit ist radikal und völlig anders als alles, was die Menschen sich jemals über Gott vorgestellt haben! Oder über sich selbst. Selbst das Wort »erkennen« ist im hebräischen Original bemerkenswert: Es ist das Wort, mit dem auch die sexuell-intime Begegnung von Mann und Frau beschrieben wird. Es scheint, als würden wir unsere Zeit verschwenden, wenn wir nach rationalem, dogmatischem Wissen über diesen Jahwe suchen, wo uns doch dieses innige, vertraute, geheime und allein überzeugende Wissen bereits zugänglich ist.
Doch die alten Israeliten fanden es, genau wie wir, unmöglich, nach dem »Heilsversprechen« dieser ehelichen Beziehung zu leben, und es erschien ihnen gefährlich, darauf zu vertrauen. »Ich werde sie durch den Herrn, ihren Gott, retten; nicht aber rette ich sie durch Bogen, Schwert und Krieg, nicht durch Pferde und Streitwagen«, verspricht Gott durch Hosea unerhörterweise (Hosea 1,7). Mit anderen Worten: Erlösung wird nicht in privater Reinheit oder Willenskraft zu finden sein, sondern in der vertrauensvollen Vereinigung zwischen Jahwe und dem Volk Israel. »Ich heile ihre Abkehr, ich liebe sie aus freien Stücken«, verspricht Jahwe (Hosea 14,4). Gottes Vergebung und zärtliche Liebe zu empfangen bedeutet in der Tat, Gottes Unendlichkeit in kleinen Dosen in sich aufzunehmen. Man kann nicht messen oder nachweisen, dass man sie erhalten hat. Sie summieren sich einfach, wenn man reifer wird und empfänglich ist. Aber selbst eine kleine Dosis Unendlichkeit, ja, noch ein Zehntel oder ein Hundertstel dieser kleinen Dosis ist immer noch Unendlichkeit! Jesus nimmt das Bild des Senfkorns – das ist alles, was nötig ist, scheint es (vgl. Markus 4,30ff).
Ist diese Vorstellung von der Beziehung zwischen Mensch und Gott so abwegig, wie es klingt? Ist es töricht, auf eine radikale, auf Dauer angelegte Bestimmung durch Jahwe zu vertrauen? Ich hoffe, in diesem Buch zu zeigen, dass die Antwort der Propheten auf diese Frage ein komplexes Nein