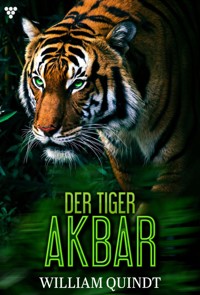25,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Martin Kelter Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Der weiße Wolf
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
William Quindt, der aus einer bäuerlichen Familie stammte, verlor früh seine Eltern und schlug sich ab dem 15. Lebensjahr mit verschiedenen Berufen durchs Leben. Schließlich wurde er Journalist. Doch auch diese Tätigkeit gab er wieder auf, um – seiner "Tiersehnsucht" folgend – Pressechef bei großen Zirkusunternehmen wie Sarrasani, Busch und anderen zu werden, mit denen er in der Folge ganz Europa bereiste. Weitere Reisen brachten ihn auch nach Afrika und Indien. William Quindt ist ein Autor, dessen besondere Begabung weit entfernt liegt von den Stoffgebieten und den Zielen üblicher Romanschreiber, ein Mann, der zu erzählen weiß von Tieren und Abenteuern, nicht nur, weil er das Leben der Tiere und die Gefahr der Abenteuer erlebt hat, sondern weil er sie liebt und mit seinem ganzen Herzen an ihnen hängt. Am Ende des Tales, vor dem niedrigen Geröllfeld, in dem die Murmeltiere pfeifen, bleibt der alte Mammutbulle zögernd stehen. Er dreht den Kopf nach links, nach rechts, er reibt die runden Fußsohlen im Moos, dann wiegt er sich auf seinen starken Beinsäulen hin und her, hin und her durch lange Zeit. Ein Goldfuchs, der am Rande der alten Moräne pirscht, lüstern nach fettem Murmeltierfleisch, setzt sich auf die Hinterkeulen und sieht den Giganten mit klugen und kalten Augen an. Schwer und gewaltig steht das Mammut auf dem leuchtend grünen Moos. Lang, zottelig, rostbraun umfließt ihn das dichte Fell. Ein mächtiger Fetthöcker wölbt sich hinter dem Hügel des Kopfes auf seinem Rücken, gibt dem Riesenleib eine nach hinten abfallende Schräge. Grellweiß in der Sonne des Mittags gleißt die geschwungene Wehr seiner Zähne. Klein und schlau blinzeln die braunen Augen aus der dicken Unterwolle, die den knochig wulstigen Schädel umhüllt. Hinter dem Alten verharrt das Rudel, die fuchsroten Weiber und die fahlblonden Jungen, wartet geduldig und still auf den Weitermarsch. Der alte Bulle wiegt sich hin und her. Einmal fährt sein Rüssel in die Höhe, das Lippenpaar des Rüsselmundes, die spitze Oberlippe, die breit hervorlappende Unterlippe, öffnet sich weit, das Mammut saugt so stark die Luft ein, dass der Fuchs sich erschrocken duckt und das Pfeifen der Murmeltiere für Minuten verstummt. Aber sogleich fällt der Rüssel wieder herab, das Mammut schlenkert den Kopf und steht still: Es ist kein Geruch, der seine Sicherheit gestört hat. Was ihn stört, was ihn unsicher macht, kommt nicht von außen, es sitzt in ihm, es spricht aus ihm, es ist die Erinnerung. E-Book 1: Eine Tiergeschichte aus der Vorzeit. E-Book 2: Der Kampf E-Book 3: Tanz in der Nacht E-Book 4: Der Stier E-Book 5: Der weiße Wolf E-Book 6: Wolfsmutter E-Book 7: Große Jagd E-Book 8: Abgeschlagen E-Book 9: Die Menschenfrau E-Book 10: Hungerwinter E-Book 11: Die Höhle E-Book 12: Das Feuer E-Book 13: Die große Not E-Book 14: Verwundet E-Book 15: Wärme E-Book 16: Güte E-Book 17: Liebe E-Book 18: Frühling E-Book 19: Tier des Menschen E-Book 20: Die fremden Jäger E-Book 21: Das Mammut E-Book 22: Nachwort
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 281
Ähnliche
Inhalt
Eine Tiergeschichte aus der Vorzeit.
Der Kampf
Tanz in der Nacht
Der Stier
Der weiße Wolf
Wolfsmutter
Große Jagd
Abgeschlagen
Die Menschenfrau
Hungerwinter
Die Höhle
Das Feuer
Die große Not
Verwundet
Wärme
Güte
Liebe
Frühling
Tier des Menschen
Die fremden Jäger
Das Mammut
Nachwort
Der weisse Wolf – 1–
Tiergeschichte aus der Vorzeit
William Quindt
Eine Tiergeschichte aus der Vorzeit.
Am Ende des Tales, vor dem niedrigen Geröllfeld, in dem die Murmeltiere pfeifen, bleibt der alte Mammutbulle zögernd stehen. Er dreht den Kopf nach links, nach rechts, er reibt die runden Fußsohlen im Moos, dann wiegt er sich auf seinen starken Beinsäulen hin und her, hin und her durch lange Zeit. Ein Goldfuchs, der am Rande der alten Moräne pirscht, lüstern nach fettem Murmeltierfleisch, setzt sich auf die Hinterkeulen und sieht den Giganten mit klugen und kalten Augen an.
Schwer und gewaltig steht das Mammut auf dem leuchtend grünen Moos. Lang, zottelig, rostbraun umfließt ihn das dichte Fell. Ein mächtiger Fetthöcker wölbt sich hinter dem Hügel des Kopfes auf seinem Rücken, gibt dem Riesenleib eine nach hinten abfallende Schräge. Grellweiß in der Sonne des Mittags gleißt die geschwungene Wehr seiner Zähne. Klein und schlau blinzeln die braunen Augen aus der dicken Unterwolle, die den knochig wulstigen Schädel umhüllt. Hinter dem Alten verharrt das Rudel, die fuchsroten Weiber und die fahlblonden Jungen, wartet geduldig und still auf den Weitermarsch.
Der alte Bulle wiegt sich hin und her. Einmal fährt sein Rüssel in die Höhe, das Lippenpaar des Rüsselmundes, die spitze Oberlippe, die breit hervorlappende Unterlippe, öffnet sich weit, das Mammut saugt so stark die Luft ein, dass der Fuchs sich erschrocken duckt und das Pfeifen der Murmeltiere für Minuten verstummt. Aber sogleich fällt der Rüssel wieder herab, das Mammut schlenkert den Kopf und steht still: Es ist kein Geruch, der seine Sicherheit gestört hat. Was ihn stört, was ihn unsicher macht, kommt nicht von außen, es sitzt in ihm, es spricht aus ihm, es ist die Erinnerung.
Hohes Gras und niedere Zwergstrauchheide fließt an den sanften Hügelwänden hinauf. Unter der Geröllhalde vertieft sich das Tal, Bäume drängen sich in ihm, Eichen, Linden, Ulmen, viele Haselsträucher und auch Eiben. Das alles ist es nicht – schwer wiegt sich das Mammut auf den vier Säulen seiner Beine. Hinter dem Tal erhebt sich nackt und steil eine hohe Wand, drohend dunkelt ihr Gestein in den hellen Tag. Das ist es! Es ist die Wand! Der alte Bulle schnauft, schneller schaukelt sein Leib hin und her.
Er vergisst mehr als hundert Jahre … Er ist noch klein, er hat noch keine Zähne, er zieht neben der großen und starken Mutter in der stillen Herde. Die Herde ist groß, viel größer als das Rudel, das er heute führt. Sie meidet die Steppe, sie meidet den Wald, sie lebt in Sicherheit, denn sie lebt draußen in der Tundra, in der das Mammut leben soll. Dort draußen kennen die großen Tiere nur einen einzigen Feind: das wilde, wütige, doppelgehörnte Nashorn. Es trägt den gleichen rostbraunen Filzpelz aus Unterwolle und langen Grannen, auch auf seinem Rücken wölbt sich ein schwerer Fetthöcker, von dem es zehrt in der härtesten Zeit, manchmal sucht es den Kampf und misst in schnell verpuffender Wut seine Kräfte mit denen der Mammute.
Aber mehr und mehr weicht die Tundra von den Hügeln zurück, folgt dem Eis zum Norden. Von den Hügeln fließt die Steppe, aus ihren Tälern schiebt sich der Wald, beide tilgten die alten Wechsel des Mammuts. – Einmal dann aber hat der alte Führer der Herde die Pfade seiner Jugend gesucht und ist seiner Erinnerung nachgezogen. Die Mammute ästen zwischen den Hügeln, wie saftig war die Flechte, wie weich das Mark der Baumzweige, wie süß schmeichelten die jungen Sprossen der Sträucher dem Gaumen. Dann aber, in diesen Tälern, zwischen diesen Hügeln, dann brach die schlimme Nacht über sie ein.
Der große Bulle quietscht leise und erbittert, sein Rüssel schlenkert böse hin und her, seine kleinen Augen glitzern: Da ist sie wieder, die ferne Nacht! Schlafend steht die Herde in der weichen Dunkelheit, in Frieden und Stille, die plötzlich zerrissen werden von Lärm und Geschrei und vom flackernden Feuer, das durch die Nacht gegen sie anspringt. Er sieht wieder dieses Feuer, er ahnt die schattenhaften Wesen, die es tragen, die mit ihm gegen die Herde der Mammute stürmen. Links und rechts von den Hügeln herunter, wie die flackernde Wand eines Steppenbrandes riegeln hinten die Feuer das Tal ab, schieben sich vor – ein einziger Weg nur bleibt zur Flucht.
Wieder hört er das entsetzte Brüllen der Herde, wieder läuft er mit ihr davon, dem dahinstürmenden Führer nach. Aber der Lärm folgt ihnen, das Feuer läuft mit ihnen, aus dem Dunkel fliegen Steine, viele Steine, geschleudert von den unsichtbaren schreienden Wesen, die mit dem Feuer durch die Nacht hetzen. Jeder Stein trifft in der enggedrängten Masse sein Ziel, jeder Stein steigert Furcht und Entsetzen – der Boden dröhnt, so stürmt die Herde dahin, bergauf, bergauf, getrieben von dem Feuer, von den Steinen, von dem grellen Lärm.
Wieder läuft er neben der großen und klugen Mutter, eilig und ängstlich, ein zitternder Zwerg unter erschrockenen Riesen. Sie laufen am Rande der Herde, ganz nahe ist ihnen das Geschrei, das furchtbare Feuer, viele Steine fliegen gegen sie. Einmal öffnet sich neben ihrem immer steiler aufwärts führenden Fluchtpfad ein Abhang, nur eine dünne Feuerkette sperrt ihn. Die Mutter schreit, spitz, hoch, wütend und entschlossen, sie drängt ihn zur Seite, aus der Flucht, aus der Herde heraus. Dicht vor ihnen springt ein Feuer auf, springt gegen sie an, erbittert kreischt der Schrei der großen Mammutmutter. Ihr Rüssel schnellt hoch, peitscht herab, das Feuer zerstiebt, und ein schmerzlicher Klageruf verweht purpurn vor ihnen in der Schwärze der Nacht. Etwas stürzt, schwer trampelt die Mutter auf der Stelle, wie seltsam das knirscht und gurgelt – dann schiebt sie ihr zitterndes Junges weiter, hinein in das Dunkel.
Sie ziehen mit schnellem Schritt durch die licht stehenden Bäume, hinter ihnen drängt erregt der Rest der Mammutherde, die den Führer verlassen hat und ihnen folgt, sie stürmen durch das Tal, sie erreichen die Ebene, die Erde zittert unter ihrem schweren und wilden Lauf – hinweg, hinweg aus Wald und Steppe, zurück und heim zur sicheren Tundra.
Sterne stehen am Himmel, fern schwimmt das schmale Horn des Mondes im rötlichen Dunst, neben ihnen, vor ihnen reckt sich in die dunkle Nacht die dunklere Steilwand. Über ihnen springen die Feuer, tobt der Lärm. Gewaltige Leiber fallen durch die Luft. Gleich huschenden nächtlichen Vögeln segeln sie an den Sternen vorüber mit grellem Schrei– es sind die Mammute, vom Lärm, vom Feuer und von den fliegenden Steinen über die Klippen gehetzt. Die auf dem Berg sich Drängenden brüllen dunkel und wild, die Stürzenden schreien hell, auf den Steinen am Fuß der Felsenwand klatscht dumpf und dröhnend Fall für Fall. Und mit jedem Sturz erstirbt ein Schrei, erstirbt eine Stimme für immer. Stechend süß, eine betäubende Wolke, steigen die Blutnebel auf und ziehen durch die Nacht.
Aus dem Wald und über den Hügeln schneiden die harten Schreie der Eulen, nahe winseln und bellen tausend Schakale, von fern aus der Tundra nähern sich rasch mit klagend gierigem Geheul die Rudel der Wölfe. Eine kurze Weile stehen die entronnenen Mammute steinern, starren in das Grauen der Nacht, ihre Augen glühen, ihre Rüssel winden furchtsam und bebend. Dann schreit die Mutter, schreit schrill und schmerzhaft, sie wirft den Rüssel geradeaus, ihr kurzer Schwanz fliegt steif nach hinten, schnell wie der Leithengst einer Pferdeherde stürmt sie in die Nacht hinein, der sicheren Tundra entgegen, gefolgt von ihrem Sohn, gefolgt von dem kleinen Rest der Herde, den sie vor Untergang und Verderben gerettet hat. Hinter ihnen schwimmen die kleinen flackernden Feuer durch das Tal ihrer Flucht in die Ebene herunter, noch aber tobt oben in der Höhe der Lärm, und die letzten Mammute stürzen sich über die Klippen in den Tod.
Das war die Nacht, die ferne, die schlimme Nacht, der alte Mammutbulle hat sie nicht vergessen. Über ihm, hoch im strahlenden Blau, hängt ein Adler, bewegungslos ruhend auf seinen ausgebreiteten Schwingen, zieht still Kreis um Kreis. Sieht das Adlerauge, was der Alte nicht sehen kann? Die geheimnisvoll grünende Welt der Hügel und Berge, die Steppe, die in die Ebene hinausfließt, die ferne Tundra, das geschwundene Eis?
Das alte Mammut sieht nur die steile Wand. Ist es die gleiche, über deren Klippen seine Brüder einst in den Tod getrieben worden sind? Er weiß es nicht – er sieht wieder die Feuer, hört wieder den Lärm und die dumpf krachenden Todesstürze, er spürt wieder die schmerzhaft süße Trunkenheit der ziehenden Blutnebel. Langsam wendet er auf der Stelle und dreht seine Stirn der Herde zu.
Die Kühe, die ihm zunächst stehen, weichen zurück, langsam schreitet er durch ihr Spalier. Ein Jungtier, das den Weg nicht rasch genug freigibt, pufft er mit dem massigen Leib so hart zur Seite, dass es schmerzlich aufquiekt. Als er am anderen Ende der Herde angelangt ist, schreit er einmal, stark und hell. Ohne sich umzublicken, zieht er dann aus dem Tal hinaus, durch die Steppe, der fernen dunkelnden Tundra entgegen. Die Tiere wenden still und folgen ohne Säumen ihrem Führer.
Nur das Kleinste der Herde schiebt sich noch schnell ein Stück den Hügelabhang hinauf. Dort oben brennt ein Magnolienbusch in trunkener Farbenseligkeit. Das kleine, von zottiger Wolle umflockte Mammut steht davor, seine Augen blinzeln lustig und versonnen. Dann hebt sich behutsam sein Rüssel und pflückt mitten aus dem Strauch die leuchtendsten Blätter heraus. Dann quietscht das kleine Mammut, denn es hört den hellen Schrei der Mutter, die aus der ziehenden Herde nach ihm ruft. Eilfertig wendet es und läuft dem Rudel nach, im zärtlich aufwärts gebogenen Rüsselmund trägt es andächtig die schöne Blüte mit sich davon.
Der Goldfuchs am Moränenrand reckt seinen Hals und schaut den davontrollenden Riesen nach. Sie ziehen dahin im gleichmäßig fördernden Trab, es sieht aus, als habe der Führer ein Ziel, das fern von diesem Tale liegt, und das er bald erreichen will.
Dann duckt sich der Fuchs im jähen Schreck, schnell wie ein Stein fällt ein Rauschen durch die Luft, es ist der Adler. Fast über seinem Rücken spannen sich die Schwingen, aber der Stoß des großen Räubers gilt nicht ihm, der Fuchs sieht aus furchtsam blinzelndem Augenspalt, wie der Adler in nächster Nähe von ihm im Schwung des Niederstoßens die hinteren Krallen seiner Griffe gleich Dolchen in den graubraunen Pelz eines Murmeltieres jagt.
Er hört den traurigen Schnaufer, mit dem das Geschlagene vergeht, nahe seinen Augen ist das Schwingen der großen Flügel. Sich reckend blickt er auf den Adler, der ihm den Rücken zuwendet, sieht auf Sprungweite nahe ein fettes braunes Murmelweibchen, das den rettenden Bau nicht mehr erreicht hat und sich zitternd in die Steine drückt, ist mit einem Satz bei ihm, stählern schnappen seine Kiefer – noch hebt sich der Adler kaum über das Geröll, da schnürt der Fuchs schon mit seiner Beute unter die Haselnusssträucher. Der Adler hat Junge im Horst, die Fähe des Fuchses hat Junge im Bau, Murmeltiere sind fett und zart, Murmeltiere sind die leckerste Speise für junge und auch für alte Räuber.
Minutenlang liegt das Geröllfeld still und wie ausgestorben, endlich dann hebt sich schüchtern der erste leise Pfiff. Hier und dort recken sich die kleinen Köpfe mit den glänzend großen schwarzen Augen zwischen den Steinen hervor. Ein Alter sitzt kerzengerade vor seinem Bau und späht ringsum. Er sieht nicht die ziehenden Mammute im silbernen Dunst der weiten Steppe. Er sieht nicht den Adler, der von fern sich aus dem Winde herantragen lässt, er sieht nicht den Fuchs, der sich lautlos aus dem Strauchwerk des Talgrundes heranschiebt – unbesorgt gibt sich sein Volk der Äsung hin.
Der Kampf
Aus dem Dunkel der Steilwand sehen zwei Augenpaare der dahinrollenden Mammutherde nach, die sich aufzulösen scheint im flirrenden Sonnenglast der endlosen Ebene. Der alte Mammutbulle hat nichts von diesen Augenpaaren gesehen, die Murmeltiere nicht, der Fuchs nicht, selbst nicht der Adler. Aber vielleicht hat der Adler sie doch gesehen und nur nicht beachtet, denn er, der starke und schnelle Jäger, kennt keinen Feind in der Luft und auf der Erde. Die Wesen dort unten sind für ihn weder Beute noch Gefahr, sein Blick ist gleichgültig über sie dahingegangen, ihre Anwesenheit bedeutet nichts für ihn – die zwei Wesen sind Menschen.
Ein Mann und eine Frau hängen auf einem schmalen Vorsprung in der Bergwand, in Baumhöhe über der Erde. Eng an den Stein geschmiegt, liegen sie halb, halb kauern sie, die Hände fest verkrampft um Büschel der Strauchheide, die karg und zäh durch das Gefels kriecht. Sie liegen bäuchlings, die Gesichter einander zugewandt, zwischen ihnen liegen einige große Steine und mancherlei Gerät. Sie sind fast nackt, der Mann trägt zwei Marderfelle an der Rentiersehne, die um seinen Leib läuft, die Frau hat den samtenen Pelz eines Fischotters um ihre Hüften geschlagen.
Der Mann ist groß, blond und schlank, seine starken Muskeln spielen unter der glatten Haut. Sein Gesicht ist edel geschnitten, voll Kühnheit und Adel, ein blonder Bart umfließt weich Mund und Kinn, das lange Haupthaar ist mit einem Knoten im Nacken gebändigt. Die hellen eisblauen Augen sehen mit weiter dunkelnder Pupille in die Ferne, den Mammuten nach.
Die Frau ist kleiner als der Mann, schmal, sehnig und geschmeidig, gleich einem lauernden Tier klebt sie am Fels, still und sicher. Ihr Gesicht ist um einige Linien gröber als das ihres Begleiters. Das Kinn ist schwer, der Mund voll, aber die weichen Lippen erscheinen hart unter der gebändigten Kraft, die sie verschließt. Sie trägt ihr dunkles Haar im Nacken geknotet wie der Mann, ihre Augen brennen schwarz und wild.
Auch sie sieht den entschwindenden Riesen nach, dann haucht sie leise durch die kaum sich öffnenden Lippen: »Das große Wintertier!« Der Mann nickt mit dem Kopf, aber er antwortet nicht, noch eine Weile sieht er in die Steppe hinaus, dann krallt sich seine Hand fester um das Kraut, er schiebt seinen Kopf vor und späht über den Rand der Platte hinab. Das Weib neben ihm schweigt und folgt seinem Blick, gleich ihm schaut sie angespannt und lauschend in die Tiefe.
Unter ihnen, in gleicher Höhe mit der Ebene, die vor dieser Steilwand endet, dunkelt eine Höhle im Gefels. Ein warmer tierischer Odem scheint aus ihrem offenen Maul zu steigen, ein dünnes Geräusch wie der regelmäßige Atem eines schlafenden Mannes. Die Höhle ist bewohnt, ein Bär haust in ihr, die beiden Menschen stellen ihm nach, denn sie müssen seine Höhle haben.
Ihre Heimat liegt im Süden und Osten, zwischen Morgen und Mittag, sie sind mit ihrem Stamm in die Ebene hinausgezogen, um zu jagen, Rentiere und wilde Pferde. Sie haben Unglück gehabt, zur Nachtzeit schlug der Blitz in die Bäume, unter denen ihre Zelte aus Rentierhaut standen. Das brennende Holz stürzte über sie, zertrümmerte ihre Habe und setzte sie in Brand. Und als sie noch standen, als sie lärmten und klagten in der Nacht, unter den springenden Blitzen und dem tosenden Donner, brach eine Schar Dämonen aus dem Wald, in dem andere Blitzschläge das Feuer entfesselt hatten – verzweifelt und wütig röhrende Büffel, sie traten alles unter sich, was ihnen im Weg war. Ein Mann nur außer ihnen entrann, und das war der Älteste der kleinen Jägerschar. Aber als sie dann im endlich herabbrechenden Regen, der die Flammen löschte, unter einem Baum kauerten, holte ein streichender Löwe den Alten von ihrer Seite hinweg und schleppte ihn in die Steppe hinaus. Nicht fern von ihnen begann der Löwe sein Mahl, und der alte Mann war noch nicht tot, sie hörten sein schmerzliches Rufen, sein gequältes Stöhnen, aber sie konnten ihm nicht helfen. Der Regen rann, die Welt war dunkel, der Löwe fraß an dem Schreienden, sie schmiegten sich eng und zitternd aneinander, die Furcht zu übertäuben, die in ihnen weilte. Als der Morgen kam und mit ihm die Sonne, war der Löwe verschwunden, und der alte Mann, dem ein Arm und ein Bein fehlte, war tot. Aber sie konnten ihn nicht begraben – sitzend in der Erde, das Gesicht gen Sonnenaufgang, seine Waffen ihm zur Seite und eine Wegmahlzeit in seinem Schoß –, denn die Wölfe waren gekommen, viele Wölfe. Sie rissen und schlangen an dem Toten, sie ließen sich ihre Beute nicht rauben, fletschend zeigten sie den beiden Menschen die Zähne. Einen von ihnen erschlug der Jäger mit dem Speer, die Hungernden fielen über den Toten her, aber die anderen drangen knurrend gegen den Jäger vor. Er ließ ihnen den Speer, und er musste ihnen die Leiche des alten Mannes lassen. Viele Tage lang zog er mit seinem Weib durch die Hügel am Rande der Ebene, nun haben sie diese Höhle entdeckt, sie müssen ein Heim haben, eine Stätte, in der sie sicher sind vor all den vielfältigen Gefahren und Bedrohungen der grausamen Wildnis, und darum müssen sie den Bären töten.
Schon seit dem Morgengrauen liegen sie auf dem Vorsprung im Gestein. Sie sind von oben an der nackten Wand herabgeklettert, zeitig mit dem Verblassen der letzten Sterne. Aber der Bär ist dennoch früher gewesen als sie, denn als sie endlich ihren Platz erreicht hatten, war er bereits von seinem nächtlichen Streifzug zurückgekehrt, sie hörten ihn in der Höhle, hörten ihn schmatzend und saugend seine Pfoten reinigen von den zwischen den Krallen verbliebenen Resten seiner Futtersuche. Sie blieben am Platz, schlangengleich klebten sie im Fels, alle Sinne gespannt, unablässig den Eingang der Höhle beobachtend. Der Morgen geht, der Mittag mit seiner Glut, die Sonne neigt sich in das Ende ihrer Bahn und versinkt im abendlichen Blutmeer, das purpurn den Himmel überschwemmt. Die beiden Menschen liegen still, ab und zu sehen sie sich an, das ist besser als alle Worte.
Endlich dann, als bereits die Dunkelheit aus der Ebene steigt und gegen die Hügel ankriecht, endlich dann regt es sich in der Höhle. Der Mann späht scharf hinab, lauscht mit angehaltenem Atem, dann zieht er vorsichtig und lautlos die Beine an und stellt sich auf die Füße, den Rücken zur Wand. Leise nimmt er einen der großen Steine auf, hält ihn mit beiden Händen ruhig vor sich hin, lauscht wieder und wartet. In der Höhle schnarcht es, schlurrt und schnauft und schmatzt. Dann ist es eine Weile wieder ganz still, und dann – dann berührt die Frau, die immer noch gleich einer schmalen Echse am Boden liegt, leicht und schnell den Fuß des Mannes, ihre schwarzen Augen brennen durch die Dämmerung auf zu seinem Gesicht. Er beugt sich um ein kleines Stück vor, dann sieht auch er den Bären.
Es ist ein großes starkes Tier, dessen aus dem Rücken springende Schulterblätter gut die Brusthöhe eines Mannes erreichen mögen, braun und zottelig. Es sitzt vor seiner Höhle, es schnüffelt mit windendem Fang in die Dämmerung, es grunzt unzufrieden und missmutig – hat es die Menschen gewittert, trotz all ihrer Vorsicht?
Der Mann schwingt lautlos den schweren Stein über seinen Kopf, zweimal hin und her wippend zielt er, dann schleudern seine Arme den kantigen Felsbrocken mit aller Kraft nach unten. Der knirschende Stein trifft den Bärenschädel gut zwischen den Ohren, aber der Bär fällt nicht, er brüllt nicht vor Wut und schreit nicht im Schmerz, er wiegt nur leise den Kopf und holt schnarchend Atem durch die Nase. Er steht betäubt, fast regungslos und ohne Laut.
Der Jäger reißt den Speer vom Boden auf, böse glitzern die scharfen Kanten der feingehämmerten Feuersteinklinge durch das Dämmern. Er fasst den Speer mit beiden Händen, er zielt nach der Stelle zwischen den Schulterblättern, aber dann wirft er die Waffe doch nicht, der Wurf ist ihm zu unsicher. Fester packt er den Speer, beugt sich in den Knien – und dann springt er. Den Speer steif vor sich haltend, mit der Spitze nach unten, springt er mit beiden Füßen vom Fels in die Tiefe.
Er stürzt im Reitsitz über das immer noch bewegungslos hockende Tier, seine Schenkel schließen sich sogleich wie eine Zange um den Bärenleib, im Schwung des Falles rennt der Speer tief durch das zottig dichte braune Fell. Aber der Mann spürt es im Stoß: Die Schneide fand nicht den richtigen Weg, sie vergleitet am Knochen. Noch den Speer haltend, wirft er den Kopf zurück: »Die alte Axt!«, ruft er dem Weib zu, das über ihm auf der Klippe kauert. Sie hat mit schnellem Griff die Waffe, wirft sie ihm zu, er fängt sie sicher aus der Luft. Es ist das älteste Steinbeil des Stammes, stumpf an der einen Seite, zugespitzt an der anderen, mit Rentiersehnen ist der Stiel, der durch den Stein geht, gesichert. Ein veraltetes Gerät, doch immer noch das beste, einen Bärenschädel zu zertrümmern.
Aber der Mann kommt nicht zum Schlag, denn der betäubte Bär kehrt in das Leben zurück. Der brennend durch seine Schultern flammende Schmerz hat ihn geweckt, er spürt den Reiter auf seinem Rücken, er schlägt nach ihm mit den langen Schaufelkrallen, aber er erreicht ihn nicht. Da wirft er sich herum, wälzt sich auf die Erde. Aber der Mann gleitet gedankenschnell von seinem Rücken, splitternd zerbricht der Speerschaft in der Wunde, und die Schneide, die zwischen seinen Schultern sitzt, drückt sich tief in das Fleisch des Bären. Brüllend vor Schmerz schnellt er sich auf seine Branten zurück – und spürt sogleich wieder den Druck der Männerschenkel. Dem Mann hat der Sturz das Beil aus der Hand gerissen, aber er lässt nicht von seinem Feind. Über ihm, auf ihm kauernd, den warmen bepelzten Leib fest zwischen seine Beine pressend, suchen seine Finger furchtlos nach der Kehle des wild röhrenden Tieres, zwischen dessen gelben Zähnen das rote Blut heraustropft.
Der Bär wirft sich zur Seite, gegen die Felswand, er will sich daran reiben, scheuern, den Reiter herunterholen von seinem Rücken. Aber er erreicht den Felsen nicht, das Weib hat sich von der Höhe heruntergeworfen im furchtlosen Schwung, einen kurzen Speer in der Hand. Sie schnellt sich katzengleich zwischen das Gestein und den Bären, kauert nieder, lang schiebt sich ein mageres, sehniges Bein nach hinten, stemmt sich ein, beide Hände halten den Speer. Der Bär brummt böse, schlägt nach der dunklen Spitze, die ihn bedroht. Dann aber wendet er sich halb ab, erst muss er den Mann von seinem Rücken loswerden, den Reiter, den Unsichtbaren, dann will er schon fertig werden mit diesem nackten Gezücht. Aber wie er sich wendet, strafft sich der schmale Frauenleib, an dem sich streckenden Bein springen Sehnen und Muskeln hervor. Das Weib schreit, hell und spitz, wie der Falke schreit, der die Taube schlägt – und hart unter dem Knie des den Bärenleib umklammernden Männerbeines dringt die Speerspitze durch das zottige Fell, findet sicher den Weg durch die Rippen und zerreißt das Herz.
Der Bär schnauft dunkel, bleibt stehen, dann gurgelt es in seiner Kehle, und ein dicker Blutstrom stürzt aus seinem sich öffnenden Rachen. Er schwankt, und dann kippt er weich nach der Seite über. Gewandt gleitet der Mann von seinem Rücken herab und steht neben dem Gefällten. Vor seinem Fuß liegt die alte Axt, noch zucken die Branten des Bären, noch wirft sich sein Leib. Schnell bückt der Jäger sich und reißt die Axt hoch. Unter ihrem schmetternden Hieb zerknirscht der Bärenschädel, die zuckenden Glieder strecken sich, das Tier liegt still.
Eine kurze Weile steht der Mann neben dem toten Bären und sieht auf ihn herab. Plötzlich lacht er, leise, wild und höhnisch, jählings aufbrüllend, dann reckt er die Axt seiner Väter gegen den dunklen Himmel und springt auf das tote Tier. Auf seinem Fell herumstampfend mit tanzenden Füßen, schreit er seinen lachenden Jubel triumphierend in die abendlich dämmernde Welt hinaus.
Hinter ihm, unbeachtet von ihm, kauert das Weib. Es hockt noch in der gleichen Stellung, aus der es dem Bären den tödlichen Stoß gegeben hat: Mit der Brust fast auf dem scharf angewinkelten linken Knie, weit nach hinten gereckt das rechte Bein, dessen Zehen sich geschmeidig um einen vorspringenden Stein legen. Ihre Hände halten den Speer, das rauchende Bärenblut tropft von dem Stein seiner Spitze. Aus ihrem Kauern heraus sieht sie zu dem Mann auf, der im Stolz des Siegers schwelgt, ihre Augen brennen hart, dunkel und tief.
Als der Jäger endlich verstummt, steht sie still auf, legt den Speer zur Seite und blickt sich suchend um. Hier und da liegen Steine und Steinplatten, sie nimmt eine nach der anderen und schichtet sie auf neben dem Eingang zur Höhle, formt sie zur Herdstelle. Indessen hat der Mann noch einmal den Sims erklommen, auf dem sie gehockt haben durch den Tag, kehrt zurück mit der Last ihrer Werkzeuge und Waffen. Sie entnimmt dem Bündel einen Dolch aus Rentierknochen, steckt ihn in die Schnur, die ihren Leib umschlingt, greift eine Axt mit dünner, zweiseitig geschärfter Schneide, geht dann wortlos in das immer mehr sich verdichtende Dunkel hinaus, dem nahen Waldtal zu.
Nach geraumer Zeit erst kehrt sie zurück, eine Fackel lodert in ihrer Hand, versprüht ihre tropfenden Funken in die Schwärze der Nacht. Rötlich überhaucht von dem Feuerschein federt ihre schlanke Gestalt leicht heran, gleichsam, als ob die schweren Holzbündel, die sie auf dem Rücken trägt, kein Gewicht haben für ihren schmalen und schönen Leib.
Der Mann, der neben dem Bären kniet, den er im Dunkel bereits halb aus seinem Fell geschlagen hat, blickt auf und sieht der Kommenden entgegen. Dunkel ist die Welt, aber durch das Dunkel naht die Gefährtin, ihre Hand hält das Feuer, der Herd ist bereit, bald wird von seiner sich erhitzenden Platte das Fett der Bärenkeule tropfen. Und zur Nacht werden sie in der Höhle geborgen ruhen, das Feuer wird sie schützen vor allen Gefahren, verschwunden ist die Furcht der vergangenen Tage.
Er richtet sich auf den Knien in die Höhe, er ruft der Herankommenden zu, einen Schrei ohne Worte, wild und zärtlich. Aber ihr Gesicht bewegt sich nicht, kurz und flüchtig nur streift ihn ihr dunkler Blick, dann wendet sie sich still dem Herd zu.
Tanz in der Nacht
Als das Feuer brennt, und die Steinplatte des Herdes bereits so heiß ist, dass sie zischt, wenn die Frau auf sie spuckt, hat der Mann den Bären abgebalgt, löst mit Dolch und Axt die Keulen vom Rumpf und schneidet die fleischige Zunge aus dem toten Rachen, der seine Zähne gegen das Feuer bleckt. Aber wie er aufstehen und die Fleischstücke zum Herd hinübertragen will, steht die Frau plötzlich neben ihm und nimmt ihm den Dolch aus den Händen. Der blutige nackte Kadaver des Bären liegt auf dem Rücken, sie beugt sich über ihn, rammt das Messer unter dem Brustkorb tief in das Fleisch, macht einen kurzen Schnitt, dann kniet sie nieder und fährt mit der Hand bis zum Ellbogen in die Bauchhöhle hinein. Unbewegten Gesichts sieht sie in die Nacht hinaus, ihre Finger tasten in dem toten Tier. Dann spannt sich ihr Arm, mit einem Ruck reißt sie ihn an sich, und ihre Hand hält das Herz des Bären, das sie ihm entrissen hat.
Der Mann hüpft auf seinen Füßen, sein Mund wirft einen jubelnden Schrei in die Nacht, sie beachtet ihn nicht und kehrt stumm zum Herd zurück, hockt daran nieder, spießt das tropfende Herz auf die Spitze des Dolches und hält es daran über das knisternde Feuer. Der Mann schlingt einige Rentiersehnen um den Kadaver, legt sie um seine Schultern wie ein Geschirr und zieht das tote Fleisch weit in die Steppe hinaus. Sie haben die Keulen, sie haben das Herz und die Zunge, neben dem Feuer würde das Fleisch schnell schlecht werden, sie haben für Tage Fleisch in Fülle – der Rest gehört den Tieren unter dem Sternenhimmel.
Er lässt den verstümmelten Leib liegen, löst die Sehnen und geht zurück. Hinter ihm steigt der volle Mond auf, ein blutig glühender Ball im roten Dunst. Still hockt die Frau am Feuer und wendet ihm den schmalen, geschmeidigen Rücken zu. Und schon sind die Schakale am Bärenluder, nah heult ein Wolf, von fern kommt ihm Antwort, die rasch sich nähert, morgen in der Frühe werden nur noch die Knochen des Bären in der Steppe liegen.
Der Mann hockt sich neben die Frau ans Feuer und zieht mit geblähten Nüstern den Duft des angebratenen Fleisches ein. Langsam zieht die Frau den Dolch zurück, legt das Bärenherz auf einen flachen Stein, dann schneidet sie es mit dem Messer in zwei gleiche Teile. Jeder Kämpfer eines großen Kampfes hat Anteil am Herzen des Gefällten. Schon will der Mann nach seiner Hälfte greifen, da schlägt die Frau schnell und böse mit dem Dolch nach seiner Hand – und dann teilt das Messer die Hälfte, die ihm zunächst liegt, wiederum in zwei gleiche Teile. Und sie nimmt ihre Hälfte an sich und dazu noch ein Viertel, das vierte Viertel allein lässt sie dem Mann.
Er versteht sofort: Sie behauptet ihr Recht, sie hat den tödlichen Stoß geführt, sein Anteil am Kampf soll nicht mehr bedeuten als dieses kleine Stück Herz – ärgerlich grunzend stößt er ihr den Ellenbogen in die Seite und greift nach dem Fleisch in ihren Händen. Aber sie fährt hoch und zurück, stopft sich mit schnellen Fingern das Vierte hinter die festen weißen Zähne, birgt die Hälfte des Herzens hinter ihrem Rücken, streckt ihren Dolch gegen den Mann und faucht, wie ein Luchs vom Baumast den schnürenden Wolf anfaucht. Schon aber ist der Ärger des Mannes wieder verloht, er lächelt sie an und bescheidet sich mit seinem Teil.
Dann legt sie ein großes Keulenstück auf die flach gemuldete Steinplatte des Herdes, und er macht sich von Neuem über das Bärenfell her, greift ein schmales langes Messer mit beiden Händen und schabt die Fleischreste von der Innenseite, die er schließlich stark mit Holzasche einreibt. Als er mit seiner Arbeit fertig ist, ist auch das Mahl bereit, sie setzen sich Seite an Seite, lehnen die Rücken gegen den Felsen, sie halten jeder in einer Hand ein großes Stück Fleisch, beißen hinein, dann fahren sie mit dem Messer dicht an ihren Lippen entlang und trennen so den Bissen vom Stück. Sie sitzen still, sie essen, sie sehen in die Weite hinaus und gegen den Mond, der sich nun silbern aus dem Blutdunst hebt, der sacht verbleicht und versickert. Unweit beim Bärenrest winseln die Schakale, Wölfe knurren heiß und wild, fern in der Steppe brüllt ein Löwe, und die scharfen Rufe der Eulen segeln über das Hügelland, über den Wald und in die Ebene hinaus.
Nach der Mahlzeit reinigt sich der Mann die Hände an den neben ihm wuchernden Grasbüscheln, steht auf und sucht eine Weile in dem Bündel seiner Geräte herum, nimmt ein Stück an sich und erklettert mit ihm den schmalen Felsenvorsprung, auf dem er durch den Tag dem Bären aufgelauert hat. Jetzt setzt er sich bequem, lehnt den Rücken gegen die Wand und lässt seine Beine vom Sims herabhängen. So sitzt er still und sieht in die weite Nacht hinaus.
Seine an das Dunkel der Bergtäler gewöhnten Augen finden die Nacht in der Ebene sehr hell. Er sieht die Schatten der sich balgenden Wölfe in der Nähe am Bärenluder, umwinselt von den aufgeregt und gierig sie umkreisenden Schakalen. Aus der Wand über ihm löst sich ein dunkel läutender Ruf, dann ist ein weiches Rauschen dicht neben ihm, zwei große goldene Augen sehen ihn kurz und fremd an im Mondlicht, und dann segelt der große Uhu stumm in die Steppe hinaus. Der Mann folgt seinem Schatten mit dem Blick. Der lautlose Eulenflug geht über eine Herde Steinböcke, die unbeweglich in der Steppe stehen und nach den schlingenden Wölfen hinübersichern. Dann verschwindet der Vogel in der silbernen Nacht, die Schakale winseln, aus der Steppe dröhnt der rasche Galopp einer Wildpferdherde, ein Wildochse röhrt ihr zornig nach, nahe im Walde kreischt ein Luchs.
Die Frau am Steinherd legt Holz über das niedere Feuer, dann setzt sie sich wieder mit dem Rücken gegen den Felsen, zieht die Beine heran und schlingt ihre Arme darum. Sie legt ihr Kinn auf die Knie, sie sitzt still und sieht mit weiten dunklen Augen in die Nacht. Das Feuer spielt über ihr Gesicht, es schimmert rötlich und hell, es ist unbeweglich wie eine Maske. Die Frau hat ihr Haar aus dem Knoten gelöst, weich und lang, schimmernd im spielenden Licht, fließt es ihr schwarz und zärtlich über die schmalen Schultern, über die kleine Brust und über die nervigen Arme.
Der Mann auf der Klippe nimmt das Gerät hoch, das seine Hände halten, führt es an den Mund. Es besteht aus dünnen Röhrenknochen des Rentieres. Die Knochen sind von gleicher Stärke, aber von verschiedener Länge, sie sind hohl und stecken in einem gespaltenen Knochen, der sie nebeneinander festhält. Der Mann bläst in eine der Röhren hinein – und aus der Flöte hebt sich der Ruf des großen Uhus, der seine Felsspalte verlässt und in die Steppe hinauszieht zur nächtlichen Jagd.
Dann aber gleiten die Lippen auf der Flöte hin und her, die Rufe der Nachtschwalben springen aus den Rentierknochen, das Krächzen der Raben, ein wilder Hengst wiehert hell – langsam löst sich eine Melodie heraus und schwingt sich in die Nacht hinein. Nun singt die Flöte, die dunkle Nacht ist in ihrem feinen Gesang, das Silberlicht des Mondes und die leisen Stimmen der ungezählten Tiere. Dann gebiert der Sang der Flöte aus sich selbst einen fremden Wind, der fasst die Melodie und trägt sie davon. Nun klingt und schwingt sie in sich selbst, nun weint sie und schluchzt und lacht, nun lockt sie, nun klagt sie, nun tanzt sie verspielt.
Langsam stellt sich die Frau neben der Höhle auf ihre Füße, sie schüttelt das Haar zurück, wie ein schwarzer Strom ergießt es sich über ihren Rücken. Ihr Gesicht ist starr, in dem glänzenden Schwarz der weiten Pupillen spiegelt sich das Feuer, spiegeln sich die Sterne und spiegelt sich der Mond. Mit rascher Hand nimmt die Frau das Otterfell von ihrer Hüfte und wirft es hinter sich. Nackt und schmal steht sie in der samtenen Nacht, ihre Arme hängen am Körper herab, aber die Fingerspitzen ihrer Hände klopfen und trommeln gegen die Haut ihrer gespannten Schenkel.