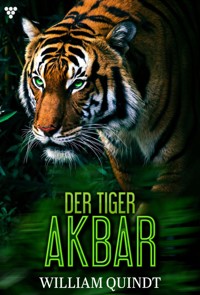30,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blattwerk Handel GmbH
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Der Wildpfad
- Sprache: Deutsch
Zwischen den Dschungeln Indiens, dem Wirbel der Weltstadt London und den weiten Steppen Afrikas spielt sich das faszinierende Leben Kathleen Wells ab. Ihre Geschichte, wie es dazu kam, dass diese schöne, stolze Frau ihren Mann erschoss, erzählt William Quindt auf seine eigene, unnachahmliche Art. Das Leben der wilden Tiere in Freiheit und Gefangenschaft, der Konflikt zwischen Natur und Zivilisation sind weitere Themen dieses großartigen Romans. Mitunter, vielleicht in der kurzen Dämmerung abendlicher Straßen, im Strom der Flanierenden, der Müßigen und der Geschäftigen, zwischen den Lichtfluten bunter Auslagen und dem leisen Gleiten hetzender Automeuten, vielleicht in der drängenden Unruhe menschenquirlender Bahnhofshallen, in der eleganten Langweiligkeit des Vestibüls eines ›Grand-Hotel‹, in der fiebernden Gespanntheit einer Rennplatz-Tribüne, in der knisternden Erwartung eines Theaterparketts, in der verhaltenen Sammlung eines Konzertsaales, vielleicht auch in einer festlichen Nacht, beim Tanz unter den bunten Lichtern und den singenden Geigen – mitunter taucht aus der Flut der Menschen ringsum ein fremdes Gesicht, rührt jählings und tief unser Herz, trifft unser Herz in seinen verschlossensten, gesichertsten Winkel, in jenen tausendfach geheimgehaltenen, tausendmal verleugneten Winkel, in dem wir das bittere Wissen eingeschlossen, eingesargt haben, dass wir alle im tiefsten Grunde einsam sind und einsam bleiben. Und die fremden Augen, die für eines Herzschlages Länge sich in den unseren verankern, mahnen uns in Stunden, in denen wir am wenigsten darum wissen wollen, in denen wir froh und unbeschwert plaudern und lachen im Kreise der Menschen, denen wir zugetan sind, mahnen uns daran, dass wir Einsame sind, und dass unsere fröhliche Geselligkeit nichts ist als ein wertloser Mantel, in den wir uns hüllen, weil wir nicht frieren mögen. Das fremde Gesicht, die fremden Augen gemahnen uns an ferne Träume. Wir alle haben einmal gewusst, dass es in dieser Welt Menschen geben muss, die eigens für uns und nur für uns geboren worden sind, die für uns leben, sinnen, trachten und denken. Wir haben sie gesucht, wir haben auf sie gewartet und auf ihr Licht, das unser ganzes Sein erleuchten sollte. Aber je dichter und enger die Menschen sich sammeln in Städten und Ländern, desto ferner und fremder sind sie einander geworden, nie fanden wir die Menschen aus unserem Traum, vergebens warteten wir auf das Licht vom verwandten Stern, wir blieben dunkel, wir wurden dumpf, wir nahmen die Menschen an, die Gelegenheit und Zufall über den Weg unseres Lebens führte, wir blieben bei ihnen, wir hielten sie fest – leuchteten sie nicht, so wärmten sie doch. Da wirft der fremde Blick, der unser Auge kreuzt, das einstmals ersehnte Licht in den Kerker unserer ältesten und stillsten Sehnsucht, da treibt das fremde Gesicht aus dem nächtigen Dunkel ringsum, treibt an uns vorbei und verweht wiederum in die Nacht. Tausend Mauern haben wir Menschen zwischen uns errichtet, unmöglich geworden ist der kurze Weg vom Herzen zum Herzen, wer kann ein Fremdes halten? Aufgewühlt, verlassen bleiben wir zurück, und das Wissen um unsere Einsamkeit ist nun ebenso bitter wie süß. Schmerzhaft tief ist uns diese Einsamkeit bewiesen worden, schmerzhaft tief aber auch die keuschesten, ältesten Träume unserer Sehnsucht, nun wissen wir, was wir dereinst nur ahnten: Wir brauchten nicht einsam zu sein! – Aber wir sind es, wir bleiben es, das fremde, leuchtende Gesicht, dem unser Herz entgegendrängte, versinkt, weil wir es nicht halten können. Und wir treiben weiter, einsam und in Nacht. Solcherart war meine erste Begegnung mit Kathleen Wells. Damals umbrandete mich das bunte Leben in seiner ruhelosesten, heftigsten Bewegung, in schillernd starken und lockend zarten Farben, in fanfarenhaft schmetternden und geigensanft verführerischen Tönen, damals reiste ich als Pressemann mit dem Zirkus.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 440
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Inhalt
Die fremde Frau
Gefesselte Wildnis
Mörderin
Melodie in Erz
Kinderherz im Hinterhaus
Die singende Erde
Am Rande der Welt
Das wilde Paradies
Unser täglich Brot
Verlorene Heimat
Geist und Abenteuer
Vergitterte Welt
Ruf der Tiefe
Der Kerker
Simba-Land
Der Gepfählte
Abermals
Angst
Die Befreiung
Das zwiefache Leben
Der Wildpfad – 2 –Zwischen den Dschungeln Indiens
William Quindt
Die fremde Frau
Kapitel -1-
Mitunter, vielleicht in der kurzen Dämmerung abendlicher Straßen, im Strom der Flanierenden, der Müßigen und der Geschäftigen, zwischen den Lichtfluten bunter Auslagen und dem leisen Gleiten hetzender Automeuten, vielleicht in der drängenden Unruhe menschenquirlender Bahnhofshallen, in der eleganten Langweiligkeit des Vestibüls eines ›Grand-Hotel‹, in der fiebernden Gespanntheit einer Rennplatz-Tribüne, in der knisternden Erwartung eines Theaterparketts, in der verhaltenen Sammlung eines Konzertsaales, vielleicht auch in einer festlichen Nacht, beim Tanz unter den bunten Lichtern und den singenden Geigen – mitunter taucht aus der Flut der Menschen ringsum ein fremdes Gesicht, rührt jählings und tief unser Herz, trifft unser Herz in seinen verschlossensten, gesichertsten Winkel, in jenen tausendfach geheimgehaltenen, tausendmal verleugneten Winkel, in dem wir das bittere Wissen eingeschlossen, eingesargt haben, dass wir alle im tiefsten Grunde einsam sind und einsam bleiben.
Und die fremden Augen, die für eines Herzschlages Länge sich in den unseren verankern, mahnen uns in Stunden, in denen wir am wenigsten darum wissen wollen, in denen wir froh und unbeschwert plaudern und lachen im Kreise der Menschen, denen wir zugetan sind, mahnen uns daran, dass wir Einsame sind, und dass unsere fröhliche Geselligkeit nichts ist als ein wertloser Mantel, in den wir uns hüllen, weil wir nicht frieren mögen.
Das fremde Gesicht, die fremden Augen gemahnen uns an ferne Träume. Wir alle haben einmal gewusst, dass es in dieser Welt Menschen geben muss, die eigens für uns und nur für uns geboren worden sind, die für uns leben, sinnen, trachten und denken. Wir haben sie gesucht, wir haben auf sie gewartet und auf ihr Licht, das unser ganzes Sein erleuchten sollte. Aber je dichter und enger die Menschen sich sammeln in Städten und Ländern, desto ferner und fremder sind sie einander geworden, nie fanden wir die Menschen aus unserem Traum, vergebens warteten wir auf das Licht vom verwandten Stern, wir blieben dunkel, wir wurden dumpf, wir nahmen die Menschen an, die Gelegenheit und Zufall über den Weg unseres Lebens führte, wir blieben bei ihnen, wir hielten sie fest – leuchteten sie nicht, so wärmten sie doch.
Da wirft der fremde Blick, der unser Auge kreuzt, das einstmals ersehnte Licht in den Kerker unserer ältesten und stillsten Sehnsucht, da treibt das fremde Gesicht aus dem nächtigen Dunkel ringsum, treibt an uns vorbei und verweht wiederum in die Nacht. Tausend Mauern haben wir Menschen zwischen uns errichtet, unmöglich geworden ist der kurze Weg vom Herzen zum Herzen, wer kann ein Fremdes halten?
Aufgewühlt, verlassen bleiben wir zurück, und das Wissen um unsere Einsamkeit ist nun ebenso bitter wie süß. Schmerzhaft tief ist uns diese Einsamkeit bewiesen worden, schmerzhaft tief aber auch die keuschesten, ältesten Träume unserer Sehnsucht, nun wissen wir, was wir dereinst nur ahnten: Wir brauchten nicht einsam zu sein! – Aber wir sind es, wir bleiben es, das fremde, leuchtende Gesicht, dem unser Herz entgegendrängte, versinkt, weil wir es nicht halten können. Und wir treiben weiter, einsam und in Nacht.
Solcherart war meine erste Begegnung mit Kathleen Wells.
Damals umbrandete mich das bunte Leben in seiner ruhelosesten, heftigsten Bewegung, in schillernd starken und lockend zarten Farben, in fanfarenhaft schmetternden und geigensanft verführerischen Tönen, damals reiste ich als Pressemann mit dem Zirkus.
Jene ewig unterirdisch pulsende, ewig leise knisternde Unruhe, die mich in keinem bürgerlichen Beruf hatte ausharren lassen, die mich über hundert lustig verschlungene Wege ziehen ließ, um mich von einem jeden wieder herunterzutreiben, sobald das Ziel erkannt war und Anstrengung und Mühsal sich zu lohnen drohten, jene Unruhe, merkwürdig gemischt aus dem männlichen Verlangen nach einem klaren, starken, nur auf sich selbst gestellten Sein und aus der kindhaften Sehnsucht nach Menschen von gleichem Blut, diese Unruhe trieb mich endlich mitten hinein in das farbentolle Kaleidoskop der wandernden Zeltstädte, in denen ich beseligt verblieb wie ein Gläubiger in seinem gelobten Land.
Die Wanderlust, die Sehnsucht zu schweifen, zu reisen – wer von uns hätte sie nicht? Diese Sehnsucht ist deutsch, die Sehnsucht ist alt, ist älter als wir, älter als alle Völker, älter selbst als die Rasse, aus der sich die Nationen gebildet haben. – Auf dem hochschnäbeligen Wikingerschiff, in dessen Segel der pralle Wind steht, waghalsig über die langen Wellen des Ozeans streichend gen Grönland, gen Engelland, gen Florida – zu Fuß, bewehrt mit Schild und Speer, sein Vieh hinter sich und auf den Wagen den Hausrat und die Frauen, entronnen den dunklen und endlosen Wäldern der Ebene, Bezwinger der Alpenpässe, waffenklirrend einherschreitend vor dem Wanderwagen, von Bergen herabsteigend in die sonnige Ebene des Po – so tritt der Germane aus dem Dunkel in das Licht der Geschichte. Eng, klar und sehr bürgerlich geordnet ist die Welt geworden in den Jahrhunderten, die zwischen uns und den ersten Wanderzügen unserer Rasse liegen, aber die jahrtausendealte Lust unserer Ahnen spukt uns allen noch heute als geheime Lockung in Blut und Herz, obwohl die Unruhigen längst den Sesshaften haben weichen müssen.
Streben und Trachten des bürgerlichen Menschen geht völlig dahin, sich an einem bestimmten Punkt seiner Heimat, seines Vaterlandes zu verankern. Er heiratet, er gründet eine Familie, er erwirbt Besitz, Geld und Geltung, Einfluss, Macht in den Gebieten seines Wirkens. Wenn er reist, reist er in Geschäften oder zu seinem Vergnügen. Sein Gegenpol ist der Vagabund, der lieber hungernd durch die Welt läuft, als sein Leben lang an einem Fleck satt zu sein, der jede Bindung scheut, allen Fesseln entweicht, der sich restlos, ohne Bedenken, mit Lust der Weite, dem Wandern, dem täglichen Wagnis verschreibt.
Die einmalige Welt des Zirkus’ steht unter besonderem Gesetz. Wir sind bürgerlich, denn wir sind beheimatet: Wir arbeiten fünfzehn und zwanzig Stunden am Tag, die Manege, das große Zelt ist unsere Heimat, der Wanderwagen unser Haus, die todverlachende Sensation ist unsere Arbeit und unser täglich Brot. Wir, Menschen und Tiere, sind zusammengeschweißt zu einer unlösbaren Schicksalsgemeinschaft, wer nicht zu uns gehört, ist uns fremd und bleibt uns fremd. Unsere Welt, bunt, weit, wild, tausend Menschen, tausend Tiere, in denen Glanz und Glut von fünf Erdteilen sitzt, bewegt sich durch die Länder wie ein Schiff durch das Meer. Wir begrüßen die Städte wie die Passagiere des Steamers die nahen Inseln, wir erwidern die lachenden und die wehmütigen Grüße, aber wir booten nicht aus, wir bleiben an Bord, bleiben beieinander, wir sind eine Welt für uns.
Zauberhafte Welt! Manege, Zirkus: höchste Primitivität auf der einen Seite, Triumph raffiniertester Technik auf der anderen. Telefon und Addiermaschinen, komplizierteste Lichtanlagen, modernste Traktoren und Raupenschlepper, Sonderzüge, Spezialautos, letzte Raummöglichkeiten geschickt ausnützende Bürowagen, tausend neueste Schöpfungen modernster Industriezweige – und diesen ganzen, unendlich komplizierten technischen Apparat um den primitiven Brennpunkt der Manege, um den magischen Ring aus Lehm und Sägespänen.
Zirkus: ein Direktor, der als Stallbursche begann, Rechtsanwälte, Ingenieure, Redakteure, Kaufleute in seinem Generalstab – und dann das ganze große vielgesichtige Zirkuspersonal: vom Regisseur, der einst selbst Direktor war, und dessen Name die glanzvollsten Zeiten des alten ›equestrischen Zirkus‹ heraufbeschwört, bis hinab zum versoffenen Plakatkleber, der einmal ebenfalls einen Zirkus besaß und heute bei uns gelandet ist, weil er doch unmöglich ohne die geliebte, ohne die lebensnotwendige Zirkusluft leben kann.
Kapitäne der englischen Kolonialarmee als Elefantendresseure, Mexikaner, die Experten in der Abrichtung von Nilpferden und Dromedarhengsten sind, ehemalige sächsische Bäcker, die Löwen und Tiger mit unerreichter Verve vorführen, ein bayerischer Schlachter, dessen Raubtierdressuren an Eleganz und Charme unerreicht sind in der weiten Welt, böhmische Musikanten, Zeltarbeiter aus der Pfalz, australische Holzhackerchampions, chinesische Akrobaten, japanische Keulenjongleure, Ballettmädchen aus allen Enden der Welt, deutsche Piloten als Reklameflieger, Trapeznummern aus Bukarest und Paris. Artisten aller Zungen und aller Grade, angefangen von der schlicht gekleideten Tochter des Chefs, der Akrobatennummer, bis zu der mondänen, seiderauschenden, pelzknisternden Schönheit der Solotänzerin, arabische Springer, echte Sioux-Indianer, Tempeltänzer aus Ceylon, schnatternde Zoe mit Lippenpflöcken, Somalikrieger, hammeltalgduftend, und rassige Tscherkessen, würdige Clowns und die lachenden Männer der Sensationen, die ein Spiel mit dem Leben sind – nicht auszuschöpfen ist die Fülle der Erscheinungen.
Zirkusleben, Artistenleben: Heute schlafe ich im Luxushotel, morgen in einem Dorfkretscham, übermorgen in einem möblierten Zimmer mit grauenhaftem Nippes, mit quietschender Matratze und der obligaten vase de nuit, die Parade steht unter dem Bettrand. Heute fahre ich in der fürstlichen Limousine meines Herrn Direktors, morgen flitze ich in einem lächerlichen Kleinauto die Landstraße auf und ab, die hundert Lastwagenzüge kontrollierend, die unser Material von einer Stadt zur anderen bringen, übermorgen liege ich im Heu einer Güterlore unseres Sonderzuges, der mich durch die steinern nackte Gigantenwelt der nächtlichen Alpen trägt, über der das schräge Horn des Mondes hängt. Heute stehe ich am Zirkuseingang, und von ihren Bergen herab strömen kropferte Vorälpler in unser Zelt. Drei Tage später spielt der Zirkus in Mailand, und die elegantesten Frauen Europas rauschen mit königinnenhaftem Lächeln an mir vorbei, der ich verwegen mit schnell gelernten italienischen Brocken das Publikum dirigiere. – Heute kann ich mir getrost ein Eisbein bestellen, morgen sitze ich mit gefurchter Stirn über einer undeutbaren ausländischen Speisenkarte.
Aber so bunt und verwirrend das Leben auch um mich kreisen mag, immer bin ich zu Haus, niemals bin ich heimatlos in der Fremde, unverändert bleibt die Manege im riesigen Zelt und der Standort meines Wagens, in dem ich wohne und arbeite. Alle drei, vier Tage aber wechselt die Landschaft vor meinen Fenstern: schneebedeckte Berge sind es heute, die Terrasse eines eleganten Cafés in der nächsten Stadt, Föhrenwälder in der dritten, der ruhig strömende Fluss in der vierten, blühende Wiesen folgen darauf und golden sich wiegende Kornfelder. Regen trommelt auf das Dach, nahe über unseren Köpfen, Sonne brennt, Winde gehen über uns dahin, zärtlich harfend oder gewaltsam tosend.
In das Diktat an den Chefredakteur Hochwohlgeboren raunzt die heiße Löwenhorde, in die Generalabrechnung der Inseratenkosten für Bromberg, Worms, Lyon oder Turin braust jubelnd der große Marsch unseres Fanfarenkorps. Abends liegt das Chapiteau, von tausend Birnen umschmeichelt, vor meinen Augen. Gleich mystisch funkelnden Sternstreifen glimmen die Lampen über dem luftigen Märchenberg, der von innerer Glut erleuchtet scheint und aus dem immerwährend der Jubel der Musik klingt, das Lachen, der frenetische Beifall von zehntausend hingerissenen Besuchern.
Steil brennt die Flamme unseres Lebens: Licht, Fanfare, rollende Räder, ewiger Sturm von Stadt zu Stadt. Denn jede Stadt muss im Sturm genommen werden, jede Stadt entzündet sich an der wilden Schönheit, die wir mit uns führen in Wagen und Zelten– uns selbst aber treibt immerfort der Stachel: weiter, weiter in die nächste Stadt! Sechzig, achtzig, hundert Städte in der Saison, zwei Millionen, drei Millionen Menschen wollen uns sehen, wollen sich begeistern, wollen sich entflammen an uns im Laufe eines Sommers – weiter, weiter in die nächste Stadt!
Bunt und lockend ist die Front, die der Bürger sieht. Verführerisch lockt unsere Welt den Fremden, wir sind die letzten Romantiker einer gnadenlos eisernen Zeit. Alle Romantik jedoch hat ihren Januskopf, ist ganz anders für den, der sie betrachtend genießt, als für den, der sie erlebt oder lebt. Zeigt unsere Welt den Bürgern ein verführerisch lockendes, zigeunerhaft üppiges Gesicht – wir Menschen vom Zirkus sind dem anderen Gesicht verfallen, dem strengen, asketischen Antlitz, dessen unerbittlich nüchterne Züge doch von zwei Dämonen gehämmert sind: vom Dämon der Arbeit, vom Dämon der Bewegung.
So reiste ich, so arbeitete ich, so lebte ich befriedet in diesen meinen Zirkusjahren, saß in meinem Bürowagen – acht Meter lang, drei Meter breit, ausgelegt mit edelsten Hölzern, mit eingebauten Schränken, Platz für drei Sekretärinnen und einem wunderschönen Ledersessel für Besucher neben meinem großen Schreibtisch – schickte jeden Tag einige Dutzend Inserate hinaus, verhandelte täglich mit hundert Menschen, führte Besucher von Rang durch Ställe und Zelte, Staatsmänner und Dichter, Politiker und Weltreisende, Professoren und Prinzessinnen, arrangierte Platzkonzerte, Reklame-Aktionen mit Stelzenläufern, Cowboy-Reitern und Fassadenkletterern, redigierte Programmhefte, Werbebroschüren und Zirkuszeitungen, entwarf Plakate, schrieb Notizen, Aufsätze und Feuilletons ohne Zahl, fegte im Auto über die Landstraßen zur nächsten Spielstadt und holte mir ihre Presseleute zur Vorbesichtigung, kam keine Nacht vor zwei, drei Uhr in mein Bett und saß stets am Morgen vor neun wieder vor dem Rasierspiegel – Tag für Tag, die Saison hindurch, ohne Sonntag, ohne Urlaub.
Ich war zufrieden, fühlte mich pudelwohl. Wenn die Arbeit sich häufte und der ruhelose Betrieb zum turbulenten Wirbel wurde, dann fluchte ich nicht mehr wie in meinen Anfängen, dann grinste ich nur und zwinkerte vergnügt dem Wandspruch zu, den ein weiser Vorgänger mir hinterlassen hatte. In schönen Lettern leuchtete er da über meinem Tisch:
›Ich wollt, ich wär ein Elefant,
dann würd ich jubeln laut.
Es wär mir nicht um’s Elfenbein,
nein – um die dicke Haut!‹
Ich grinste vergnügt, ich hatte längst das dicke Fell – wie sollte ich auch nicht?
Wenn die übliche Hochspannung, die an und für sich in jedem Zirkusbüro herrscht, noch um ein paar hundert Grad verstärkt wird, wenn sich jählings die Tournee verändert, ein Dutzend neuer, soeben erst vom Geschäftsführer entdeckter Städte mit Inseraten und Reklametexten zu bearbeiten ist, wenn die Schreibmaschinen rasselnd rauchen, wenn man am Telefon hängt, um mit dem Plakatlieferanten zu verhandeln, und es meldet sich nun schon zum vierten Male der Sargfabrikant, wenn die überarbeitete Sekretärin beim ersten leisen Anpfiff einen Weinkrampf kriegt und sich zur gleichen Zeit vor unseren Fenstern ein schwäbischer Chauffeur mit einem ostpreußischen Pferdepfleger nach dem hausbackenen System des Herrn von Berlichingen pöbelt, wenn der Ziegenbock Hans die Veranda erklettert, seinen Kopf mit dem penetrant duftenden langen Lockenbart durch das Fenster schiebt und in einem Augenblick, in dem man nicht aufpasst, ein halbes Dutzend Manuskripte und ein paar hoffnungsvolle Entwürfe, von denen man natürlich kein Duplikat hat, verschmutzt, wenn, kaum dass man den frechen Stänker in die Flucht gehauen hat, das ›Aas‹ Rosa, die Elefantenkuh, mit dem Schädel gegen den Wagen prallt, dass die schweren Schreibmaschinen aus den Tischen springen, wenn man im Eilzugtempo sechs dicke Mappen voll Inseratenaufträgen nach Spalten und Zeilen berechnet und auszeichnet, während man zwei Sekretärinnen Briefe in die Schreibmaschine diktiert – und wenn dann ein junger Dichter in den Wagen kommt, sich in den schönen Klubsessel setzt, mit romantikseligen Augen um sich sieht und von einem noch gern etwas Material für die Impressionen haben möchte, die über den Zirkus zu schreiben er unumstößlich gewillt ist, wenn der Herr Direktor dazwischenbrüllt, man wie ein Rennpferd über alle Hürden weg in seinen Wagen wetzt, woselbst man eine Reihe von Inseraten mit haarsträubenden Druckfehlern und eine Serie Texte mit peinlichen, höchst blamablen Böcken unter die Nase gerieben bekommt, wenn, da man gebrochen in seinen Wagen zurückwankt, der Entree-Clown das Pressebüro stürmt, sich bitter beschwert, dass er in der gestrigen Premiere-Besprechung nicht mit seinem vollen Firmennamen genannt worden ist, und mit lebensgefährlicher Ironie fragt, ob man vielleicht ein persönliches Interesse daran habe, ihn und seine weltbekannt erstklassige Arbeit zu unterdrücken, wenn eine mordgierige Schulreiterin den Meister des Humors ablöst, die einem an den Hals will, weil ein Redakteur aus einem verunglückten Maultier ein Schulpferd der Dame gemacht hat – und wenn man aus all diesem Tohuwabohu in die Wagenfenster des Zwergclowns sehen und den kleinen Kerl beobachten kann, wie er in der Seelenruhe, die ein gutes Gewissen gibt, gemächlich eine Kognakbuddel auspietscht – nun, wer solches hundertfach durchgestanden hat und dann immer noch über kein dickes Fell verfügt, dem bleibt eben nichts anderes übrig, als aus seiner unzureichenden Haut zu fahren.
Ich arbeitete, ich reiste, ich war vergnügt und ausgeglichen, der hart fordernde Rhythmus der wandernden Zeltstadt verlangte den ganzen Menschen, ich lieferte mich ihm aus, in ihm versank alles persönliche Wünschen, alle unbefriedigte Sehnsucht, alle Unruhe des eigenen Herzens. Mitunter jedoch ertappte ich mich in tiefer Versunkenheit vor den Auslagen der Buchhandlungen, bisweilen konnte ich den Mann, der einstmals der Welt des Druckpapiers entsprang, weil ihm zutiefst grauste vor dieser zerdachten, zerschriebenen, zerlesenen Welt, beobachten, wie er sich Bücher kaufte, sich für die karge Mittagszeit in die Stille seines Hotelzimmers verkroch und gierig den Geist der Dichtung in sich eintrank: Nietzsches Gedichte und Fontanes Balladen, James Joyces’ ›Ulysses‹, Porches Baudelaire-Biografie, dos Passos hämmernde Epen aus Manhattan, die Saga des Peter Freuchen vom Eskimo Mala und verschollene Novellen von Prosper Merimee, die wie vergilbte Seide waren …
Bisweilen jedoch wuchs sich die scharfe Anspannung zur körperlichen und geistigen Qual aus – so damals im Frankenland in jenen Tagen, bevor ich Kathleen Wells traf.
Wir brauchten ein neues Hausmagazin, ich fand bei Tage keine Zeit zur Arbeit daran, der Direktor drängte, der Drucker telefonierte jeden Tag um das Manuskript, schließlich blieb ich kurzerhand eine Nacht im Bürowagen und konnte am anderen Tag das fertige Heft zur Post geben.
Der Tag brachte Gäste: Eine Schriftstellervereinigung, die ich durch den Zirkus führte, die mich dann einlud und nach der Vorstellung entführte, mich die Nacht hindurch nicht aus den Fingern ließ, mich mit tausend Fragen auspresste, mein Leben hochinteressant fand, aber doch gleichzeitig recht stolz auf sich selbst war und auf ihre milde Herablassung, mit der sie mir dürftigem Zigeuner einen Hauch aus ihrer, der geistigen, der einzig wirklichen Welt zukommen ließen.
Am anderen Morgen in der Konferenz merkte der luchsäugige Herr Direktor natürlich bald meine Nervosität, fragte mich aus, schmunzelte recht vergnügt, als er erfuhr, dass ich mir nun zwei Nächte nacheinander im Interesse des Geschäftes um die Ohren geschlagen hatte – und angesichts seines Schmunzelns wusste ich sehr genau, dass er nun ganz gewiss irgendeine Teufelei aushecken würde, um meine Nerven der äußersten Belastungsprobe auszusetzen.
Am Abend war Abbau. Im Chapiteau jubelte der Schlussmarsch, das Publikum ergoss sich breit über den nächtigen Platz, die Arbeiter hatten die Telefone aus meinem Wagen entfernt, wir hatten alles verpackt, die Schreibtischplatten waren aufgeräumt, die Schubladen geschlossen, Spiegel und Bilder lagen weich zwischen dem Maschinenpapier, die Jalousien waren gesichert, die Koffer standen in der Schreibtischhöhle, ich lechzte nach Schlaf, ging zum Direktor hinüber und fragte, ob er noch etwas für mich hätte. Er lächelte honigsüß: »Ach, bitte, seien Sie doch so gut und fahren Sie heute mal wieder Kontrolle, ich habe sonst keinen Herrn mehr dafür frei!«
Also stapfte ich über den Platz, stolperte müde im Dunkeln über hängende Kabel, verschlungene Stricke, eiserne Pfähle, die überall herumlagen, fand meinen ›roten Adler‹, instruierte den Chauffeur – und die Hetzjagd begann: Die Chaussee entlang zur nächsten Spielstadt, zum Platz, auf dem sich bereits das zweite Zelt erhob. Und sofort wieder zurück, und dann abermals den Wagen herumgeworfen und wieder die Chaussee entlang – und wieder und wieder. Und immer die Augen auf den grünweißen Lastautozügen, die durch die Nacht rollten. Und bei jedem Anhänger der Ärger mit den Bremsern. Wir setzten auf jeden Wagen einen Mann, nahmen in jeder Stadt eigens für diese Nacht an die hundert Arbeitslose an, jeder von ihnen schlief ein, sobald er auf seinem Bremserstühlchen saß, jeder von ihnen schnarchte tief vor den Kurven, bei denen es allein auf die Bremser ankam. Und jeder von ihnen war höchlichst und ehrlichst entrüstet, dass der grobe Kerl, der da im roten Wagen aus der Nacht herangeprescht kam, so gar kein Verständnis dafür hatte, dass ein rechtschaffener Mensch nach zwölf Uhr nachts müde zu sein pflegt, sondern sie in massivsten Worten darauf aufmerksam machte, dass sie entweder wachzubleiben hätten oder aber von ihm höchst eigenhändig vom Bock heruntergeholt würden. Einige wenige Pannen, dann mussten die Wagen zur Seite bugsiert, musste die Ursache festgestellt werden, dann sauste ich, von giftigen Bremserblicken verfolgt – (so’n feiner Pinkel hat’s gut, der schläft bei Tage, und in der Nacht gibt er an wie ein Fürst!) – zurück und holte die Reparaturschlosser. Sonst ging alles leicht und gut, es gab schlimmere Kontrollfahrten.
Gegen Mittag rollte der letzte Wagen mit seinem Anhänger auf den Zirkusplatz und rangierte sich ein in die Wagenburg. Hinter ihm schloss sich der Zaun. Ich stieg mit steifen Knochen aus meinem Roadster, Mary Wittig, die Sekretärin des Syndikus, lief mir über den Weg, im Arm eine große Tüte exzellenter Tafelbirnen, über die ich mich sogleich hermachte, um sie gnadenlos zu zehnten. Kauend mit beiden Backen fragte ich: »Wo wohnt man in diesem Dorf, Mädchen?«
Das große schlanke Mädchen mit dem dunklen Pagenkopf und den großen schwarzen Augen, die ihr den netten Spitznamen eingebracht hatten, wusste natürlich längst, wo der Verwaltungsstab abgestiegen war und nannte mir das Hotel. »Stadtbekannt gute Küche. Ich esse heute auch dort!« – Also holte ich meinen kleinen Koffer aus dem Büro und trollte mich. Otto, mein Faktotum, kam mir mit dem Handschrankkoffer nach. Ein Zimmer, ein Bad, rasieren, frische Wäsche, anderen Anzug, einen sehnsüchtigen Blick nach dem breiten weißen Bett mit der goldenen Daunensteppdecke, dann ging ich hinunter in den Speisesaal.
Da saßen sie schon alle an einer großen Tafel, aus zusammengestellten Tischen improvisiert: Herr Guldner, der Verwaltungschef, der Syndikus, Fritzchen genannt, Mr Fuji mit seiner bildschönen flämischen Frau, die früher als spanische Tänzerin gearbeitet hatte, am anderen Ende der Tafel – Chinesen und Japaner können sich merkwürdigerweise nie riechen – Mr Hai Young mit seiner Nichte Nina Yutta Lou und seiner schönen Frau, dem Polderl, der lustigen Soubrette aus Wien. Ramon Prietos saß da, Spezialist für unbesteigbare Maultiere, Florio, der Kameldresseur, Mr Footit, unser Schulreiter, Elvira, die Königin der Luft, und Lydia, die Kaiserin auf dem Pferderücken. Das Fräulein Wittig war auch da und hatte mir einen Stuhl reserviert zwischen sich und dem üppigen Polderl, da war ich also denkbar bestens untergebracht, bekam sogleich von beiden Seiten eine Fülle guter Ratschläge, bestellte mir einen Bocksbeutel und begann getrosten Mutes mit einer hervorragend kräftigen Oxtailsuppe.
Ein Mensch, der mehrere Nächte hindurch den Schlaf entbehrt hat, befindet sich in einem merkwürdigen Zustand. Der Körper ist schlapp und zum Wegsinken müde, seltsam hellsichtig und hellhörig jedoch ist der Geist. So saß auch ich inmitten der lustigen Gesellschaft, deren Fröhlichkeit ich mich durchaus nicht verschloss, neckte Fritzchen, der natürlich wieder mit dem Schulreiter über James Fillis debattierte, wann er nun endlich sein Jus an den rostigen Nagel hängen wollte, an den es gehörte, um sein Debut in der Manege zu halten, brachte Polderl, die natürlich wieder vom schönen Kaiserwien schwärmte, in Rage durch die nüchterne Feststellung, dass ich damals, als wir im Prater gastierten, fünfmal das Hotel hatte wechseln müssen, ehe ich ein wanzenfreies Obdach fand, sprach mit Herrn Guldner ernsthaft über das letzthin erschienene Zirkusbuch eines großen deutschen Dichters und war durchaus mit ihm einig, dass es ganz unmöglich und obendrein blamabel schlecht geschrieben war, gab Nina Yutta, die eine große Artistin ist, sich aber nur für Film interessiert, Auskunft über die Organisation der Paramount und der United Artists und vertilgte meinen Rehrücken mit Champignons. Dabei entging mir kein Wort, das sonst am Tisch gesprochen wurde, kein Geräusch im weiten Saal, zum Zerreißen gespannt war jeder Nerv in mir, von krankhaft überreizter Wachheit mein Hirn.
Vielleicht wäre mir an einem anderen Tage, in einem anderen Zustand das, was mich nun erschüttern sollte, gar nicht aufgefallen. Vielleicht wäre ich, ausgeruht, ausgeschlafen, mit robuster Gleichgültigkeit an dem vorbeigegangen, das sich jetzt tief in meine Seele grub. – Als der Kellner die Erdbeeren des Nachtisches vor mich hinstellte, war ich just dabei, Elvira und Lydia, die mir gegenübersaßen, durch freches Augengeklapper zu reizen. Sie waren mir nämlich beide böse, ernsthaft böse, die Königin der Luft, weil ich die chinesischen Reckturner über den grünen Klee gelobt hatte, von denen sie behauptete, dass sie nur Allerweltsarbeit brächten, und dass jeder weiße Artist sich der Tricks schämen würde, die von ihnen gezeigt wurden. Und die Reiterin schmollte immer noch wegen des dummen Maultieres, das ein Redakteur zu ihrem Schulpferd hatte avancieren lassen, sie wollte mir keinesfalls glauben, dass ich diesmal wirklich nicht hinter dieser Infamie stand, die doch nur ersonnen war, sie zu kränken und zu beunruhigen. Da, inmitten dieses lustigen Krieges der Augen, irrte mein Blick plötzlich ab, verlor sich, ich sah …
Ich sah an dem Tisch hinter den beiden Artistinnen, eingerahmt von der blonden, kühlen, skandinavisch frischgewaschenen Schönheit Elviras und den weichen, südländisch üppigen, brünetten Reizen Lydias, ich sah zwischen ihnen, hinter ihnen die fremde Frau – sah ein faltenloses, bräunliches Gesicht, verschnittene Haare, lockig und schneeweiß, sah einen jungen Mund, in dem die Zigarette qualmte, die eine Hand hielt, schmal, braun, fest, mit reichlich viel Ringen an den Fingern und um das Gelenk – ich sah in zwei weiche braune Augen, die nachdenklich auf meinem Gesicht lagen.
Ich saß und starrte wie ein Tölpel. In bewegten und bizarren Wolken zog der Zigarettenrauch dort drüben über das seltsam junge Gesicht unter dem schneeweißen Haar. Weich, zärtlich, ohne Frage, ohne Lockung hielten die braunen Augen meinen Blick. Irgendetwas löste sich in mir, irgendetwas war, das riss mich heraus aus meinem augenblicklichen Sein, aus meiner jetzigen Gestalt und Form. Jählings war ich nicht mehr der sehr routinierte, schnoddrige, zynische, mit tausend Wassern gewaschene Pressemann des Riesen-Zirkusses, war ich nicht mehr der harte, kalte Mann, der an sich selbst glaubt und an nichts sonst in der Welt, der allein seinem inneren Gesetz folgt und jede äußere Lockung verächtlich abtut, plötzlich zerbrach die kühle Maske, die ich mir zugelegt hatte, weil man sich so leicht und bequem dahinter verbergen kann – jählings war ich das, was ich vor vielen Jahren einmal gewesen war: Ein sehr weiches Menschenkind, das an das Gute im Menschen glaubte, dem das Menschenherz Maß aller Dinge war, der in gefühlvollen und daher recht mäßigen Versen seine schöne Sehnsucht, seine große Liebe verströmte. Herausgerissen war ich plötzlich aus der vielfältig drängenden Fülle, mit der ich mich umgeben hatte, weil ich nie in meinem Leben das Einfache, das Schlichte, das Tiefe, das unverbogen ehrliche, aus reiner Seele quellende Menschliche gefunden hatte. Jählings war ich ein Knabe, der nichts von den Geschlechtern wusste, der die Frauen noch nicht kannte, dessen reines Herz süße Feenmärchen, gläubige Mutterträume knüpfte an das Bild einer fremden Frau.
Die beringte Hand nahm die Zigarette von den Lippen, drückte sie aus im Aschenbecher. Die Frau stand auf, nahm ihre Handtasche vom Tisch, ging an uns vorbei, durch den Saal. Ich sah ihr nach: Eine mittelgroße, schlanke, jugendlich geschmeidige Gestalt, ein einfaches dunkles Seidenkleid, das in schönen Falten um ihre rasch schreitenden hohen Beine fiel, eine dunkelrote englische Strickjacke um die schmalen Schultern gehängt.
Dann klappte die Tür, die Frau war verschwunden und ließ mich verlassen zurück. Florio, der Kameldresseur, sah mich mit großen Augen an und stöhnte tief aus kummerbeladenem Herzen: »Na, hörensema, jeehrtes Presseschaf, also wat die Moralität betrifft, jeht et nu aber reißend mit Sie berjab – nu sind Se wohl schon uff de Omamas scharf?« – Und das Polderl aus dem schönen Kaiserwien juchzte neben mir animiert auf und flüsterte dann eifrig, so laut, dass die ganze Tafelrunde es hören konnte: »Du, Quinterl, ich kenn a Witzerl für dich, a goldiges, a herziges Witzerl, weißt! Pass auf: Urahne, Großmutter, Mutter und Kind …« Und dann erzählte sie eine solch verbotene Sache, dass ich mit der Nase tief in meiner Erdbeerschüssel versank, dass Fräulein Wittig verstört die Märchenaugen rollte, Herr Guldner einen krebsroten Kopf bekam und Lydia und Elvira mal wieder sehr stolz waren, dass sie, Gott sei Dank, Artistinnen waren und nicht, Gott sei Dank, Operettensoubretten aus dem lockeren Wien.
Beim Mokka versöhnte ich mich mit der Königin der Luft und der Kaiserin der Hohen Schule, wir saßen noch ein halbes Stündchen zusammen, dann machten wir uns alle miteinander auf den Weg zum Zirkus und bummelten durch die Stadt. Heute weiß ich nicht mehr, ob wir in Heilbronn waren oder in Würzburg oder in Schweinfurt. Nur durch den Bocksbeutel entsinne ich mich, dass es im Frankenland gewesen sein muss.
Vor der Tür meines Bürowagens wartete ein Dutzend Inseratenwerber auf mich. Als ich endlich den letzten abgewimmelt hatte und mich zur Tür hineinschwang, streckte mir Regina Cariot auch schon den Telefonhörer entgegen. »Der Direktor hat schon zweimal angerufen!«, sagte sie dabei mit vorwurfsvollem Blick. Der Herr Direktor saß im Hotel in der Badewanne, ich hörte ihn vergnüglich plätschern, während unseres endlos langen Gespräches und hatte allerlei kannibalische Gelüste dabei. – Dann packte ich meinen Schreibtisch aus, ununterbrochen wurde angerufen, die ersten Freikartenschnorrer tauchten auf und wurden mit huldvollen Worten auf später vertröstet.
Dann kamen die üblichen »Idioten«, wie Regina sie herzlos nannte, wobei sie niemals verfehlte, mich mit meiner Vorliebe für diese still Verrückten gebührend zu frozzeln. Sie kommen in jeder Stadt und sind nie zu vertreiben. Wie ein Magnet die Eisenstäbchen, so saugt der Zirkus in jeder Spielstadt alles Unbürgerliche an sich, die Abenteuersehnsüchtigen, unheilbare Romantiker, ewig hungernden Herzens und mit lockerer Schraube im Kopf. Sie landeten alle in meinem Wagen, es war geheiligte Sitte, die Leutchen, die man nicht rubrizieren konnte, dem Pressemann auf den Hals zu schicken, ganz gleichgültig, ob es eine Schauspielerin war, die absolut Manegenaugust werden wollte, eine königliche Hoheit, die huldvollst geruhte, ein Privatissimum über unseren Marstall und über die Reiterinnen vom alten Papa Renz, die sich allesamt mit hohen Adeligen verheiratet haben, zu verlangen, junge Männer, die Löwen dressieren, Missionare merkwürdiger Sekten, die für das Seelenheil der Fahrenden sorgen, mehr als vollschlanke Frauen, die am Trapez arbeiten wollten. – Hundert andere noch, den Kopf voller Raupen, lustig verschrobene Käuze, von grotesker Unruhe geplagte Geister, die allesamt ernstlich glaubten, ich könnte ihnen alle ihre Sehnsüchte bei nur einem bisschen guten Willen leicht erfüllen: einer wollte nach Neuguinea, Paradiesvögel für uns holen, einer zum Amazonas-Urwald, woselbst, wie er genauestens wusste, ein noch nicht entdeckter Menschenaffe hauste, der uns doch, wie ich zugeben musste, dringlichst fehlte, einer zum Kongo, um dort eine Herde Okapis zu fangen, das wäre doch noch mal ’ne Sensation, nicht wahr – Hundert wollten nur zu Artisten oder zu Dompteuren ausgebildet werden, ganz gleich, welcher Art, sie würden alles können, tausend wollten weiter nichts als mitreisen – und alle waren sie mehr oder minder schwer beleidigt, dass ich nicht sofort die Schreibtischschublade aufzog und die paar lumpigen Tausendmarkscheine hervorholte, mit denen alle diese gloriosen Sachen gestartet werden konnten.
Dann hatte sich die Presse zur Premiere versammelt, aus der Spielstadt und aus der Umgebung, fünfzig Herren und ihre Damen, ich empfing sie, machte die Honneurs, hielt ihnen im Chapiteau meinen Vortrag, führte sie durch die Ställe, durch die Wagenburg, zeigte den Verheirateten die Wohnwagen der Artisten, führte die Unverheirateten durch die Puppenstübchen der Ballettdamen, saß dann mit allen im Restaurationszelt, erzählte ihnen meine alten Witze und Anekdoten, verstaute sie endlich fünf Minuten vor Beginn in ihren Logen, stand noch eine halbe Stunde im Eingang herum, in der Manege marschierten unsere Artisten zur Parade auf, der Direktor stieg in ihrer Mitte auf die samtbekleideten Böcke, machte dem Publikum seine Verbeugung und winkte mir von da oben höhnisch zu, na ja, er hatte mal wieder recht behalten, das Haus war bis auf den letzten Platz gestopft voll, und ich hatte für diese Stadt nur ein mittleres Geschäft prophezeit – dann ging ich zu meinem Wagen zurück, in dem die Arbeit auf mich wartete.
Als ich durch die Wagenreihen ging, sah ich plötzlich durch eine Lücke gegen nahe Häuser. Ich blieb stehen, ein paar Meter von mir entfernt lehnte im offenen Fenster eines erleuchteten Zimmers ein junges Paar. Ihre Hände hielten sich, der Kopf der blonden Frau lag an der Schulter des Mannes, beide sahen mit großen, verträumten, romantikseligen Augen in unser Zigeunerquartier hinein. Hinter ihnen glühten unter rotem Seidenschirm die Birnen, auf dem Tisch standen Rosen in schöner Vase, ein großer Schrank dunkelte, bunte Bücherrücken leuchteten heraus.
Ich stand im Finstern, unsichtbar ihren Augen, maßlos quoll auf einmal die Sehnsucht in mir auf, so müde war ich, so leer fühlte ich mich, ich starrte in diese Bürgerstube wie ein Verdammter in das Paradies, das ihm für ewig vergittert ist. Bücher an den Wänden, Rosen auf dem Tisch, den Arm um die Schultern der geliebten Frau – ach, wer so leben durfte, so glücklich spießig! Wer so leben konnte – warum konnte ich es nicht?
Aus dem Dunkel der Wagen löste sich, bleich und spukhaft groß, ein Gesicht, ein junges bräunliches Gesicht unter weißen Haaren. Braune Augen sahen mich still und weich an, eine schmale, reichberingte Hand hob sich mir wie grüßend entgegen.
Knurrend wandte ich mich ab. Ich hatte nicht mehr zurückgedacht an die fremde Frau, aber der merkwürdig weiche, sehnsüchtige, hilflos unlustige Zustand, in den sie mich versetzt hatte, war geblieben. Jetzt erfüllte mich meine eigene, unklare, vage Sehnsucht plötzlich mit Zorn und Ablehnung. Was sollte das? Wohin sollte es führen? Ich hatte zu arbeiten, ich konnte mir keine Primadonnen-Launen leisten! – Ach, ich musste nur endlich einmal wieder schlafen, dann würde schon alles gut werden, würde alles sich von selbst zurechtlaufen.
Ich setzte mich in meinen Schreibtischstuhl, schuftete ununterbrochen bis zum Schluss der Vorstellung, nahm Mantel und Hut, entwischte einigen Redakteuren, die mich in ihre Stammkneipe verschleppen wollten, indem ich an der dunkelsten Ecke über den Zaun turnte, fuhr ins Hotel, aß nichts mehr, trank nichts mehr, warf mich in das Bett, fiel augenblicklich in den tiefsten Abgrund besinnungslosen Schlafes, schlief bleiern und traumlos bis zum anderen Morgen.
Gefesselte Wildnis
Kapitel -2-
Der neue Tag hub schön und heiter an, alles schien geschaffen, mir Wohlbehagen und Freude zu machen. Ich hatte herrlich geschlafen, das Zimmermädchen, das mich weckte und ungeniert seinen Lockenkopf durch den Türspalt in das Zimmer schob, war nett und lustig und weder frech noch patzig. Aus der Leitung kam – jetzt im Hochsommer, ohne Verzögerung, welch ein Ereignis! – wirklich heißes Wasser, die Rasierklinge arbeitete so gut, wie man das sonst nur in den Inseratentexten liest, die Flanellhose, die ich aus dem Koffer fischte, hatte eine scharfe Bügelfalte und sonst nicht den kleinsten Kniff oder Knick. – Das Frühstück, das ich mit Herrn Guldner einnahm, war delikat, die Marmelade köstlich, der Kaffee stark, das Eis frisch, der Kirschschnaps, ohne den Herr Guldner keine Mahlzeit schließt, war ein Gedicht von Aroma und Wohlgeschmack.
Wir bummelten unter einem lachend blauen Sommerhimmel durch die fremde Stadt zum Zirkus hinaus, die Araber probten in der Manege und bauten uns zu Ehren eine grandiose Pyramide, wir schlenderten durch die Ställe, ein Zwergpony hatte gefohlt, die Mutter bekam den Zucker, den wir uns vom Kaffee abgespart hatten, ihr wohlgeratenes Kind unsere ganze Bewunderung. Wir neckten den Löwendompteur, dessen alter ›Ralf‹ bei der Premiere gestern mal wieder mit seinem unerschütterlichen Phlegma schwer aufgefallen war, dann standen wir lange vor den Tigern, die ich liebe und mit denen Herr Guldner seinen kleinen privaten Götzendienst treibt.
Und wieder, zum hundertsten Male, erzählte Herr Guldner mir vor den Tigerkäfigen die alte indische Legende: Eine Mutter beschreibt ihrem Kind die Tiere des Dschungels, vor denen es sich hüten müsse. Sie zählt alle die vielen Tiere auf und nennt ihre Merkmale. Dann will sie vom Tiger reden, aber da stockt sie und weiß nichts zu sagen. Wie soll sie ihn beschreiben, Sheerbagh, den Mächtigsten der Mächtigen? Schließlich birgt sie den Kopf des Kindes an ihre Brust und flüstert hilflos, mit versagender Stimme, in sein Ohr: »Und den Tiger, mein Kind, den Tiger erkennst du an seiner Schönheit!« – Wir guckten noch schnell einmal in den Elefantenstall, gaben Rosa, dem »Aas«, der Mörderin, unseren letzten Zucker, dann gingen wir, mit uns, der Welt und unserem Leben sehr zufrieden, zu unseren Wagen. Die Sonne lachte, das Geschäft ging gut in dieser Stadt, es würde weiter gut gehen auf unserer Tournee – es war eine Lust zu leben!
Ich war noch keine fünf Minuten im Wagen, und Regina Cariot hatte mir die skandalöse Geschichte, die sich in der letzten Nacht im Zirkus zugetragen – die Lotte war von ihrem Hans im hohen Bogen aus seinem Wagen gefeuert worden – noch längst nicht zu Ende erzählt, da schrillte das Telefon und rief mich zur Konferenz.
Kurze Zeit später waren wir alle im Direktionswagen versammelt: Der Sohn des Hauses, von uns ›der Junior‹ genannt, Fritzchen, der Syndikus, Carlito, unser Reklamechef, der mit seinen drei Klebekolonnen jede Spielstadt im weitesten Umkreise mit unseren Plakaten bekleisterte, Herr Guldner, Herr Bamdas, der Leiter des Autoparkes, Herr Delbosq, der Regisseur, zwei Geschäftsführer und ich. Wir saßen auf den langen Ledersofas, aufgereiht wie die Hühner auf ihrer Stange, und blickten verwundert gegen den leeren Schreibtisch, hinter dem nicht wie sonst – in Pyjamahosen und altem Frackhemd, mit dem grünen, verbeulten, verregneten, verschwitzten Hütchen auf dem Kopf – unser Direktor saß. Als er dann aber durch die Tür des Garderobenwagens eintrat, fertig angezogen, in dem besten der zwei Zivilanzüge, die er neben seiner reichen Direktorengarderobe besaß, wussten wir Bescheid, waren wir im Bilde. Alle Vierteljahre einmal leistete sich unser Herr Direktor einen freien Tag. Dann fuhr er morgens weg und kam erst zur »Parade« in der Abendvorstellung wieder. Die seltene Sonne eines solchen Tages ging also heute über unseren Häuptern auf.
»Meine Herren!«, sagte der Herr Direktor mit todernstem Gesicht, »Dringende Angelegenheiten zwingen mich, sofort eine zuständige Stelle persönlich aufzusuchen. Aller Voraussicht nach werde ich erst zur Abendvorstellung wieder zurück sein können!«
Wir legten unsere ernsten Ressortchefsgesichter in teilnehmend besorgte Falten, da hatte der Herr Direktor schon seinen neuen Hut aufgesetzt, hatte das Stöckchen mit der Silberkrücke in der Hand, sagte: »Guten Morgen, meine Herren! Ich werde im Laufe des Tages anrufen!« – Bums, da hatten wir’s: wehe dem, der jetzt so frech war, den Zirkus zu verlassen! – War vor uns zur Tür hinaus, sein schwerer Wagen war indessen vorgefahren, er hüpfte hinein, winkte noch einmal, jetzt offenkundig vergnügt wie ein Schuljunge, der mit fabelhafter Entschuldigung die Mathematikstunde schwänzen darf, der Wagen zog an, fort war er.
Wir standen, ein sehr vergnügtes Rudel, auf dem grünen Rasen und sahen gegen den blauen Himmel. Der Junior holte tief Luft, ahmte die grelle Hupe nach, dass wir alle sofort entsetzt zwei Schritte zur Seite wichen, pendelte mit den Armen wie ein Boxer, der sich zum Niederschlag des Gegners rüstet, und sagte dann in seinem tiefsten Bass: »Das Kommando ist in meiner Hand! Meine Herren, jetzt werde ich erst mal meine Kerls gründlich anschnauzen, dass die faulen Hunde auch arbeiten, und dann hau ich mich aufs Ohr und penn bis heute Abend!«
Carlito und die beiden Geschäftsführer– der Herr k.u.k. Oberstleutnant und der preußische Husarenrittmeister – verschwanden, ohne einen Augenblick unnütz zu säumen, in der Richtung der Ballettwagen. »Dö drei Schlawiner werden sich a Gaudi machen!«, seufzte Herr Bamdas ihnen nach. »Nun, ich habe eine gute Gelegenheit, mal alle Reifen nachsehen zu lassen. Morgen, die Herren!« Fritzchen, vielerfahrener Jurist, hütete sich wohl, Äußerungen fallenzulassen, die geeignet waren, seinem Ansehen Abbruch zu tun, aber er schmunzelte höchst vielsagend. Ich wusste, er würde sich jetzt umgehend die Reitstiefel anziehen, seinen Gaul aus der Box holen und sich, ebenso inbrünstig wie hoffnungslos, weiter in den Schritten und Gangarten der Hohen Schule versuchen.
Herr Guldner sah angestrengt denkend gegen das Chapiteau, dann hatte er’s mit einem Mal: »Mein Gott, das hätte ich doch beinahe vergessen! Ich muss ja noch mal mit dem Magistrat Rücksprache nehmen wegen der Platzgebühren. Am besten, wenn ich gleich selbst hingehe. Na – kann eine lange Sitzung werden, so hartleibig, wie die Herren hier sind!« Da ging er hin, fein hatte er das gemacht, mit dieser guten Ausrede brauchte auch er erst am Abend wieder im Zirkus zu sein.
Ich sah mich nach dem Regisseur um, aber der hatte sich bereits still verkrümelt, na ja, dem saß keiner auf der Pelle, der würde sich in seinen netten kleinen Wagen setzen und einen Tag im schönen Frankenland spazieren fahren. Hoffentlich fuhr er nicht, wie beim letzten Mal, dem Herrn Direktor über den Weg und kam, gegen Mittag schon, wieder zum Zirkus zurück: klein, hässlich und mächtig verknittert.
Nun, ich musste am Geschäft bleiben und konnte nicht bummeln gehen, aber immerhin: Ich konnte mir mal einen gemütlichen Tag machen. Heute also gehörte mir der schöne Ledersessel, in dem sich sonst die Besucher flegelten, ich las das Fachblatt, Regina erzählte mir nochmals und jetzt mit gebotener Ausführlichkeit das nächtliche Intermezzo mitsamt seiner höchst verwickelten Vorgeschichte, für die Mittagszeit heckte ich mir ausschweifende Pläne aus, ich hatte da im Vorbeigehen eine nette Bücherstube gesehen, aus der würde ich mir einen bestimmten schmalen Band Gedichte holen und diese im Hotelzimmer lesen, und würde mir außerdem einen dicken Band klassisch großer Epik zulegen, in die ich mich dann am Nachmittag tief versinken lassen würde. Fein war’s und schön sollte es werden, jetzt aber wollte ich zuerst einmal meine Privatpost erledigen – da reichte Regina mir den Telefonhörer.
Der weiche Alt einer Frauenstimme: »Man hat mich an Sie verwiesen, ich möchte gern Ihre Tierschau besuchen!« – »Morgen!«, sagte ich kurz. »Von zehn bis fünf Uhr. Heute haben wir geschlossen!« – Aber sie war nicht abzuschrecken: »Ich weiß, aber ich bin auf der Durchreise und muss morgen früh weiterfahren. Ich war gestern in Ihrer Vorstellung, ich möchte mir so gern heute einmal die Tiere aus der Nähe ansehen. Bitte, es ist zwar schon eine gute Zeit her, aber eigentlich bin ich doch vom Bau!« Und dann nannte sie vier, fünf Namen von europäischen Zirkussen und Varietés, und die waren schon das Beste, was zu nennen war.
»Wollen Sie es mir nun gestatten?«
Ich gestattete es sonst nie, über unsere Tiere wachten wir eifersüchtig, zudem ist es nie schöner im Zirkus, als wenn kein privater Mensch sich darin aufhalten darf und alles uns allein gehört, außerdem schätzten viele unserer Tiere den Trubel der Tierschau gar nicht, wurden erregt und nervös von dem Gedränge vor den Käfigen und dem ununterbrochenen Angestarre. Heute aber – war es nur, weil ich so gute Laune hatte, oder weil die Frauenstimme so ehrlich und fein in mein Ohr klang, oder weil diese Frau ja doch zu uns gehörte – heute sagte ich: »Gut, ausnahmsweise. Wann wollen Sie kommen?« – »Ich kann in fünf Minuten bei Ihnen sein!«, sagte die altgoldene Stimme, und ich hörte die Fröhlichkeit heraus. Und im gleichen Moment warf ich alle meine Pläne über den Haufen, ach was, Privatbriefe, Bücher, Gedichte, Epik – ich würde in die Ställe gehen, ich würde den Tag bei den Tieren verbringen, ich schnarrte in die schwarze Muschel: »Melden Sie sich also beim Pförtner, nennen Sie meinen Namen, ich stehe dann zu Ihrer Verfügung!« – »Oh, vielen Dank, ich komme gleich, ich danke Ihnen, auf Wiedersehen!«
Regina sah mich vorwurfsvoll an: »Ich denke, Sie wollten mit den Weibern aus dem Publikum nichts mehr zu tun haben?« – »Was heißt zu tun haben?«, begehrte ich auf. »Na, die kannte Sie doch schon wieder mal mit Namen, und Sie brauchen doch nicht Hinz und Kunz zur Verfügung zu stehen, wenn Sie ihr einen Zettel ausschreiben, kann sie doch allein durch die Tierschau gehen! Mich machen Sie doch nicht dumm – Sie haben hier also wieder mal was angefangen, sagen Sie es nur!« – »Ich denke nicht daran!«, empörte ich mich. »Ich kenne hier noch keinen Menschen!« – »Ach, Sie!«, kam nun Regina in Rage, betete mir zum x-ten Male mein Sündenregister herunter – es war wirklich erstaunlich reichhaltig! – Und dann kabbelten wir uns gründlich, denn sie fühlte sich wieder einmal verpflichtet, mich vor allen Fangstricken und Fallgruben zu schützen, und ich empfand das als eine unerhörte Anmaßung, die ich mir unmöglich gefallen lassen konnte.
Mitten in unserem heftigen und leidenschaftlich geführten Disput rollte die Tür zurück, ein uniformierter Tscheche steckte seinen Schädel herein, reckte mir eine Visitenkarte entgegen, ich nahm sie, las ›Kathleen Wells‹, lachte Regina in das zornrote Gesicht, der Pförtner schnarrte: »Damure meckte sprecken das Herr von die Presse!« Ich setzte mit schlankem Sprung über die Treppe weg zur Tür hinaus, richtete mich auf aus meiner Kniebeuge – und stand Auge in Auge mit der fremden Frau.
Sie trug das dunkle Seidenkleid vom vergangenen Tag, es hatte schmale, bunte Stickereien um den Ausschnitt und auf den langen Ärmeln, Opanken, seidene Strümpfe, sandfarben, eine weiche schwarze Handtasche unter dem Arm, sehr bürgerlich sah sie aus. Der reiche Schmuck an der schmalen Hand, die sie mir entgegenstreckte, störte zuerst, aber als ich mich darüberbeugte, sah ich, dass es sehr wertvolle, teils antike, teils exotische Ringe waren, sehr schön aufeinander abgestimmt, kein einziger Brillant unter ihnen.
Das schmale junge Gesicht unter den schneeweißen Haaren, von keinem Hut verdeckt, strahlte mich freudig an, die weichen braunen Augen liebkosten mich: »Ich bin Ihnen so dankbar!«, sagte die weiche Stimme. »Sie wissen nicht, welch große Freude Sie mir gemacht haben!«
Ich stotterte zusammenhanglos, ich benahm mich wie ein Tölpel, ich war vollends wieder dem vertrackten Zustand verfallen, in den mich gestern an der Mittagstafel ihr Blick gestoßen hatte. Wenn ich hätte tun dürfen, was mein Herz wünschte – ich hätte sie in den Wagen gehoben, hätte die Sekretärinnen hinausgejagt, hätte die Frau in den Sessel gesetzt, hätte mich vor ihr niedergekniet und meinen Kopf in ihren Schoß gelegt. Ich starrte sie an, aus der Nähe wirkte ihr Gesicht nicht mehr ganz so jugendlich, die bräunliche Haut schien zwar straff und fest, an den Augenwinkeln jedoch, an den beweglichen Flügeln der schlanken Nase, an den Enden des schmalen Lippenpaares hatten die Jahre in dünner, aber unverwischbarer Schrift ihre Zeichen und Runen hinterlassen. Aber das sah ich kaum, ich sah den Zauber, der über diesem Gesicht lag, vielleicht nur sichtbar für mich, in dessen Herzen er eine verschollene Saite zum Klingen brachte, ich ertrank in der zärtlich samtenen Weiche der braunen Augen.
Nahe daran, mich zu verlieren, fing ich mich auf und rettete mich in die Pose meines Berufes, löste mich aus dem Bann dieses Gesichtes, entwand mich dem haltenden Blick, der, ich fühlte es gut, nicht dem Zirkusmann, der dem Menschen in mir galt. Aber nur allzu gut hatte ich gelernt, mein Privates zu verleugnen, mein Menschliches zu verbergen – nun war ich wieder nichts als der Repräsentant des weltberühmten Riesen-Zirkusses, ich fühlte, sehr höflich, äußerst aufmerksam, unablässig Interessantes und Wissenswertes von mir gebend, einen sehr geschätzten Gast durch das Unternehmen meiner Direktion.
Wir begannen beim Chapiteau, ich erklärte ihr die Sitzeinrichtung, auf der zehntausend Menschen Platz fanden und die aus fünftausend Einzelteilen bestand, die fünfzig Arbeiter in drei Stunden ohne Schraube, ohne Nagel zusammensetzten. Ich erläuterte das System, nach dem man die vier überhaushohen Stahlrohrmasten, auf denen das Zelt ruht, aneinander in die Höhe hisst, beschrieb, wie die Artisten die Manege herrichten, erklärte die alten Zirkusausdrücke, die größtenteils der französischen Sprache entstammen, geleitete sie durch den Reitergang, bog rechts mit ihr ab in das große Stallzelt der Raubtiere. Ich ging mit ihr von Wagen zu Wagen, von Käfig zu Käfig, ich schnurrte wie ein Automat die Lebensgeschichte der Tiere ab, nach denen sie blickte, vor denen sie stehen blieb.
Wir waren allein in der langen Stallung, die Dompteure und ihre Helfer waren zu dieser Zeit alle im Nebenzelt, wo sie die Portionen für die Fütterung zerteilten.
Ich hatte Kathleen Wells erlaubt, mit mir hinter die Abzäunung zu treten, nun gingen wir dicht an den Käfigen entlang, ich sagte ihr, vor welchen Tieren sie sich hüten musste, welche sie anfassen, welche sie streicheln durfte. Sie war ganz Entzücken und Begeisterung, verlor sich auf eine mir tief an das Herz greifende Weise an die gefangenen Tiere.
»An die Eisbären dürfen Sie nicht so nahe herangehen. Die sind unberechenbar, man weiß nie, wann sie böse sind und wann gereizt. Gestern haben sie wieder mal einem Stallburschen, der zu dreist war, den ganzen Arm zerledert. Ich darf sie merkwürdigerweise anfassen, sehen Sie!« Ich griff durch das Gitter mit beiden Händen dem schönen Jimmy in den Pelz, er schnaufte vor Wohlbehagen, ließ sich auf den Rücken fallen und wälzte sich.
Sie sah mir mit glänzenden Augen zu. Ich dozierte: »Sie wissen, es gibt wenige Dompteure, die gern mit Bären arbeiten. Mit Tigern und Löwen arbeitet es sich leichter, als der Laie ahnt. Natürlich sind sie gefährlich, aber sie haben Gesichter, von denen man jede Gefühlsbewegung ablesen kann. Wenn sie wütend werden, geht gewöhnlich alles nach streng vorgeschriebenem Ritus: Sie brüllen, sie fauchen, sie ducken sich zum Sprung, und wenn der Dompteur nicht ganz unglücklich durch irgendwelche Umstände in seiner Verteidigung behindert ist, kann er ihnen immer noch rechtzeitig eins auf die Nase geben, dass sie das Anspringen unterlassen. Ein Bärengesicht dagegen ist undeutbar, sein Angriff nie vorauszusehen. Oft genug, dass der Bär auf den Hinterpranken läuft, was immer so komisch wirkt, dass das Publikum jubelt vor Lachen, dass er, plumpgraziös, wie ein Bär nun mal ist, so an seinem Dompteur vorbeiwatschelt – und aus diesem drolligen Watscheln heraus ganz plötzlich dem Mann seine Tatze über den Schädel haut, dass der zerkracht. – Bären und Elefanten, gerade die Tiere, die das Publikum harmlos findet, sind die gefährlichsten Dressurobjekte und fordern die meisten Opfer.«
»Dieser Wagen ist unsere Krankenstube. Hier haben Sie zuerst die Tigerin Kitty in ihrem Wochenbett. Ja, sie hat drei Junge. Sie können sie nicht sehen, Kitty liegt vor ihnen. Sie lässt ihre Kinder nicht an das Gitter heran. Übrigens sind die noch blind und kaum so groß wie kleine Kaninchen. – Hier haben Sie meinen speziellen Freund, Mucki, den Leoparden. Ja, er hat nur drei Läufe, den vierten, den rechten Vorderlauf, hat ihm vor Jahr und Tag der Max abgebissen, da, sein Zellennachbar, ein rüder Lümmel. Merkwürdig, der Lauf hing noch an einem Muskelstrang, wir ließen sofort einen berühmten Tierarzt kommen, per Flugzeug, einige tausend Mark hat uns die Geschichte gekostet und wäre gar nicht nötig gewesen. Mucki amputierte sich selbst den Lauf noch in der gleichen Nacht, fraß ihn auf, ließ keinen Menschen an sich heran, leckte und leckte die schreckliche Wunde. Wir mussten es darauf ankommen lassen, aber auffallend rasch hat sich neues Fell über dem Stumpf gebildet. – Sie sehen, heute hüpft Mucki vergnügt und lebenslustig in seiner Zelle herum. Er ist das sanfteste Raubtier, das ich kenne, eine zärtliche Schmeichelkatze!«
Ich trat an das Gitter, in den samtenen Leopardenaugen leuchtete es warm, Mucki drückte seinen dunklen, seidigen Leib gegen meine Hände und bot mir gurrend seine Kehle zum Kraulen dar. Und als die schmale Frauenhand durch das Gitter langte, leckte er mit schmeichelnder Zunge darüber hin. »Oh!«, klang neben mir leise Kathleen Wells’ verzückter Ruf.
Ich lockte sie weiter. »Vorsicht!«, rief ich dann. Ein Tiger warf sich mit dumpfem Brüllen gegen das Gitter, verkroch sich dann vor uns im dunkelsten Winkel, drückte sich gegen die Wand, fauchte, hell, ängstlich, trotzig. »Preziosa!«, erklärte ich. »Wir haben sie von einer kleinen Menagerie gekauft, vielleicht hat man sie dort gepeinigt oder verschreckt. Monatelang war sie zu jedem, der an ihren Käfig kam, so wie jetzt zu uns, ihr Brüllen und Fauchen ist Furcht, Sie verstehen mich? Sie hat ihre ersten Erfahrungen mit den Menschen nie vergessen, je klüger ein Tier ist, desto empfindlicher ist es, desto feinfühliger. Monatelang haben wir unsere Sorge mit ihr gehabt und sie umlauert, Tag für Tag und Stunde um Stunde. Aber vor vier Wochen hat sie sich zum ersten Mal von dem Dompteur anfassen lassen – und seither alle Tage. Auch wenn wir anderen Zirkusmänner an ihren Käfig kommen, verkriecht sie sich nicht mehr im Hintergrund. Nur wenn Fremde auftauchen – aber Sie sehen es ja!«
Es folgten die beiden Wagen der zwölf Tiger unserer Dressurgruppe. Der Tiger Dickkopp war sehr liebenswürdig, lag vorn am Gitter und ließ sich streicheln von der fremden Dame. Tristan, der Lümmel, schob seine Pranken unter dem Gitter vor und versuchte mit herausgereckten Krallen nach meiner Begleiterin zu häkeln, aber ich gab ihm einen Klaps auf die Pfoten, da zog er eine krause Nase, verdrückte sich in die Ecke und schämte sich. – Langsam glitt meine Reserve von mir ab. Ich war bei meinen Tieren, der Umgang mit ihnen erwärmte immer mein Herz, und ich konnte auch nicht kühl bleiben angesichts des Charmes dieser Frau, die an meinen Freunden erglühte, die auch, wie ich sah, mit den Tieren umzugehen verstand und harmlose Neugier und offene Sympathie bei ihnen erntete.
Die Tiger, dann kamen die Löwen, zwölf Wagen voll Löwen in allen Altersstufen, vom dick bemähnten Mummelgreis herab bis zum Dreiwochenbaby. Achtzig Löwen hatten wir, und wenn wir es uns auch zur Pflicht machten, in möglichst jeder Spielstadt einem Zoo oder irgendeiner Leuchte des öffentlichen Lebens ein Löwenkind zu verehren, sie wurden nicht weniger, es war schon eine Plage. Im ersten Käfig lag, gehüllt in seine kaiserliche, fast schwarze Mähne, das Riesenfaultier Ralf. Ich raufte in seinem Pelz, er gähnte genüsslich, ich steckte meine Hand in seinen Rachen, da guckte er verlegen wie ein junger Hund und hütete sich, das Maul auch nur um einen Millimeter zu schließen. »Er ist ein Gemütsathlet!«, lachte ich die erstaunte Frau an. »So was Pomadiges wie unseren Ralf gibt es nur einmal in der Welt. Haben Sie ihn gestern in der Vorstellung gesehen? Sein Gesicht ist unbezahlbar. Wenn er auf den Böcken in Positur steht, sieht er so traurig und empört drein, als wenn er sagen wollte: ›Schämt ihr euch denn gar nicht? Wie könnt ihr schlechten Menschen nur einen armen, alten, ehrlichen Kerl wie euern guten Ralf zu solchen Dummheiten zwingen?‹ – Übrigens: Sind Sie abergläubisch? Dann schenke ich Ihnen eine Handvoll Haare aus seiner Mähne. Löwenhaare sollen Glück bringen, in der Brieftasche getragen, sollen sie auch ihren Besitzer siegreich gegen jeden Dalles schützen. Ich glaube freilich nicht daran – vielleicht aber habe ich sie auch nur zu früh fortgeworfen!«