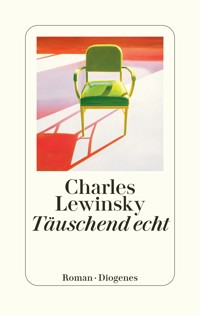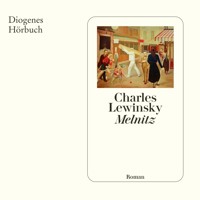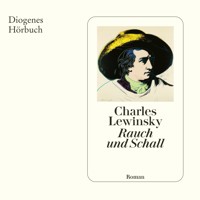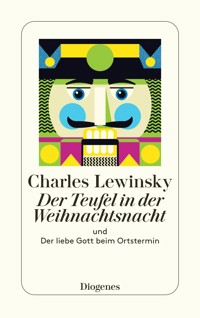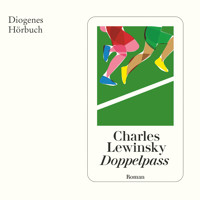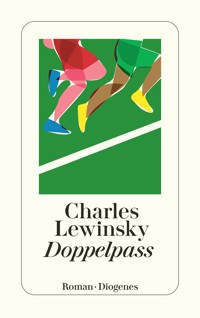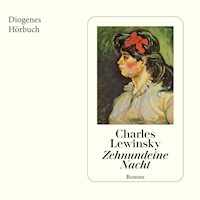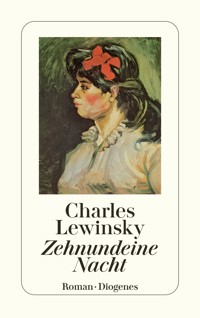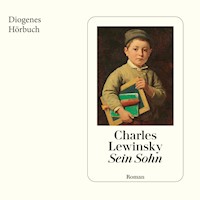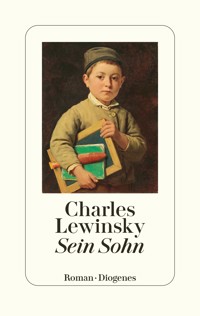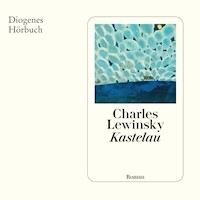17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Verlag Nagel & Kimche AG
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Charles Lewinskys souverän erzählter Krimi spielt in einer unheimlichen Szenerie: in einer Zukunft, in der die Schweiz allein von einer national-populistischen Partei regiert wird. Der pensionierte Journalist Kurt Weilemann erhält eine rätselhafte Botschaft von einem Kollegen, der kurz darauf stirbt. Weilemann will den Mord aufklären, bekommt es aber zuerst mit der Politik und dann bald mit der Angst zu tun, denn die Leute, die hier offensichtlich einen Mord durch einen weiteren vertuschen möchten, scheinen an entscheidenden Machtpositionen im neuen Staatsapparat zu sitzen. Mächtig genug, dass sie auch ihn verschwinden lassen könnten – und die Wahrheit gleich dazu.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 476
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Ein wenig schrullig ist er, der pensionierte Journalist Kurt Weilemann. Aber er spürt sofort, dass sein Kollege Felix Derendinger Angst hat. Bloß wovor? Fragen kann er ihn schon bald nicht mehr, denn binnen Stunden liegt Derendiger tot am Zürcher Limmatufer. Selbstmord durch Sprung von der Mauer, heißt es. Nur ist die Distanz zwischen Mauer und Uferweg mit einem Sprung überhaupt nicht zu überwinden. Das findet auch Derendingers schöne junge Bekannte – oder ist es seine Gespielin?, seine Therapeutin? –, mit der auch Weilemann gern intimer bekannt wäre. Sie möchte, dass er den Mord aufklärt. Er fühlt sich geschmeichelt und durch die Aufgabe deutlich verjüngt. Aber seine Unternehmungslust wird von Angst überdeckt, denn die Leute, die bald hinter ihm her sind, scheinen über machtvolle Mittel zu verfügen. Mächtig genug, dass sie auch ihn verschwinden lassen könnten – und die Wahrheit gleich dazu. Solche Macht besitzt eigentlich nur der neue Staatsapparat. Dieser ist, mit Zustimmung des Volkes, tatsächlich beinahe allmächtig. Eben wie es der Wille des Volkes verlangt.
Nagel & Kimche E-Book
Charles Lewinsky
Der Wille des Volkes
Kriminalroman
Nagel & Kimche
Für meinen Freund Siegi Ostermeier (1941–2017).
Bei allen andern Büchern warst Du mein erster Leser.
1
Manchmal nahm Weilemann den Hörer ab, obwohl es gar nicht geklingelt hatte, nur um zu überprüfen, ob da überhaupt noch ein Summton war. Es ging immer mal wieder das Gerücht, die Festanschlüsse sollten ganz abgeschafft werden, weil sie nicht mehr wirklich gebraucht wurden, wo doch jeder sein Handy hatte oder etwas noch Moderneres, er selber auch, es ging nicht ohne. Als damals die letzte Telefonzelle außer Betrieb genommen worden war, da hatte er noch einen Artikel darüber geschrieben, nichts Besonderes, «Ende einer Ära» und so, und der war dann nicht einmal erschienen, weil kurz vor Redaktionsschluss die Nachricht hereingekommen war, ein Fernsehmoderator, so ein Drei-Tage-Star mit Drei-Tage-Bart, sei gar nicht wegen einer Blinddarmentzündung in der Klinik gewesen, sondern habe sich heimlich Fett absaugen lassen; da war der Platz für sein Artikelchen natürlich weg gewesen. «kw» hatte sein Kürzel geheißen, für Kurt Weilemann, und alle, die ihn kannten, hatten ihn Kilowatt genannt. Damals, als es noch Leute gab, die ihn kannten.
Das war jetzt auch schon wieder lang her. Ein alter Sack war er geworden, ein altmodischer alter Sack, er sagte das von sich selber und zwar mit einem gewissen Stolz, er war retro, so wie das Wort «retro» auch schon selber retro geworden war, in einem Text hätten sie es ihm rausgestrichen, weil es niemand mehr verstand. Oder es wäre dringeblieben, weil sich ja heutzutage keiner mehr die Mühe machte, einen Artikel gegenzulesen, kaum in die Tastatur gehackt und schon im Internet. E-Paper – wenn er das Wort nur hörte, kam ihm die Galle hoch.
Dabei war es nicht so, dass ihn all die neuen Erfindungen überfordert hätten, überhaupt nicht, er war ja nicht verkalkt, er sah nur nicht ein, warum man sich ständig umstellen sollte, wenn die Dinge doch gut funktionierten, so wie sie waren. Da gab es diesen neuen Commis zum Beispiel, dieses supermoderne Gerät, das jetzt jeder haben musste, nur er hatte sich dieses Spielzeug noch nicht einmal angesehen. Solang man selber denken konnte, das war sein Standpunkt, brauchte man kein solches Hilfsgehirn, aber die Werbung redete den Leuten halt ein, man sei kein vollwertiger Mensch, wenn man keines habe. Immerhin: den Begriff «Communicator» hatten sie mit all ihren Werbespots nicht durchdrücken können, da war das Schweizerdeutsche stärker gewesen, man sagte «Commis», das alte Wort für einen Büroangestellten, und das war auch passend, so ein Bürogummi hatte ja auch all die tausend Dinge erledigen müssen, für die sein Chef keine Zeit hatte. Seinen Coiffeur, der ihm mit der Aufzählung all der tollen neuen Apps auf die Nerven gegangen war, hatte er mal gefragt: «Kann man sich mit dem Ding auch rasieren?», aber der Spruch war nicht angekommen, einerseits weil niemand mehr Ironie verstand, und andererseits weil sich ohnehin kaum mehr jemand rasierte. Man machte das jetzt mit einer Creme, die musste man nur einreiben, und eine Minute später konnte man sich die Stoppeln aus dem Gesicht waschen und hatte eine Woche Ruhe. Er selber benutzte immer noch seinen elektrischen Rasierapparat, und sein Telefon zuhause hatte ein richtiges Telefon zu sein, nicht so ein Spielzeug, das man immer erst suchen musste, wenn es läutete, weil es ohne Kabel ja keinen festen Platz mehr hatte. Sein altes Swisscom-Gerät funktionierte noch tipptopp, und selbst dieses Museumsstück konnte mehr, als er brauchte, zehn Tasten zum Einprogrammieren von Telefonnummern, wo doch Weilemann auch mit viel Nachdenken keine zehn Leute zusammengebracht hätte, die er hätte anrufen wollen, genauso, wie es keine zehn Leute mehr gab, die bei ihm angerufen hätten. Markus meldete sich seit dem letzten großen Krach überhaupt nicht mehr, es war definitiv ein Fehler gewesen, sich mit seinem Sohn auf politische Debatten einzulassen, Freunde hatte er nie viele gehabt, und die Kollegen waren einer nach dem andern auf den Friedhof umgezogen. Und dass jemand Arbeit für ihn hatte, kam auch nur alle Jubeljahre vor.
Er war in dem Alter, wo die Redaktionen nur noch anriefen, wenn wieder einer gestorben war, und sie einen Nachruf brauchten. «Sie haben ihn doch noch gekannt», sagten die jungen Schnösel dann am Telefon und hatten so wenig Sprachgefühl, dass sie nicht merkten, wie verletzend dieses «noch» klang. «Die andern aus deiner Generation», hieß das, «sind schon lang durch den Rost, nur dich hat man vergessen abzuholen.» Manchmal riefen sie nicht einmal an, sondern schickten bloß eine E-Mail, meistens ohne Anrede, hielten Höflichkeit wohl für eine ausgestorbene Tierart, machten sich nicht einmal die Mühe, ganze Sätze zu schreiben, oder hatten das verlernt, rotzten nur ein paar Stichworte in die Tastatur, den Namen des Toten und die Anzahl der Zeichen, die sie haben wollten, zwölfhundert für eine gewöhnliche Leiche, inklusive Leerzeichen, und manchmal noch weniger. Da hatte einer ein Leben gelebt, hatte sich abgerackert und etwas geschafft, und dann gönnten sie ihm noch nicht einmal eine ganze Spalte.
Zu seiner Zeit …
Weilemann ärgerte sich immer, wenn er «zu meiner Zeit» dachte, das war ein Zeichen von Vergreisung, und so weit war er noch lang nicht, auch wenn er sich, um seinen Fahrausweis zu behalten, schon zweimal einem Checkup hatte stellen müssen, eine völlig überflüssige Prozedur, einen Wagen konnte er sich schon lang nicht mehr leisten, und warum man für die modernen Autos einen Ausweis haben musste, hatte er sowieso nie verstanden, eigentlich brauchten die überhaupt keinen Fahrer mehr, zumindest nicht in der Stadt. «Verkehrsmedizinische Kontrolluntersuchung», auch so eine scheußliche Bürokratenformulierung, aber wenn einer anständiges Deutsch schreiben konnte, sortierten sie ihn wahrscheinlich schon bei der Bewerbung aus, diese beamteten Analphabeten. Er war nur aus Prinzip hingegangen, um sich selber zu beweisen, dass er noch voll im Schuss war, hatte sich vorher die Liste mit den Mindestanforderungen aus dem Internet gefischt, und es war eine Frechheit gewesen, was da alles bestätigt werden sollte, eine ausgesprochene Frechheit. «Keine Geisteskrankheiten. Keine Nervenkrankheiten mit dauernder Behinderung. Kein Schwachsinn.» Als ob man mit dem siebzigsten Geburtstag automatisch senil würde. Er hatte die Kontrolle beide Male mit fliegenden Fahnen bestanden, nein, nicht «mit fliegenden Fahnen», korrigierte er die Gedankenformulierung, das war ein dummes Militaristenklischee, mit Leichtigkeit hatte er sie bestanden. Bei ihm war ja auch alles in Ordnung. Das Hüftgelenk konnte man sich, wenn es schlimmer werden sollte, irgendwann ersetzen lassen.
Er war noch voll da, total arbeitsfähig, aber eben, wenn sie überhaupt einmal an ihn dachten, dann war bestimmt jemand gestorben. Und wahrscheinlich hatte der Volontär, der dann gnädig bei ihm anrief – sie beschäftigten nur noch Volontäre, schien ihm, die gestandenen Journalisten mussten froh sein, wenn sie für die Apothekerzeitung die Vorteile gesunder Ernährung bejubeln durften –, wahrscheinlich hatte der minderjährige Agenturmeldungsabschreiber, bevor er das Telefon in die Hand nahm, noch einen Kollegen gefragt: «Lebt der überhaupt noch, dieser Weilemann?»
Ja, er lebte noch, auch wenn man manchmal das Gefühl haben konnte, man müsse sich dafür entschuldigen, dass man noch nicht bei Exit angerufen und sich hatte entsorgen lassen. Man war kein nützliches Mitglied der Gesellschaft mehr, nur noch eine Belastung für die AHV.
Manchmal, wenn er schlechte Laune hatte, nicht die alltägliche dunkelgraue, sondern die rabenschwarze, überlegte er sich, wen sie wohl anfragen würden, wenn sein eigener Nachruf fällig würde. Falls sie den Platz nicht für etwas Wichtigeres brauchten, die Verlobung einer Schlagersängerin oder den Seitensprung eines Fußballspielers. Ihm fiel dann immer nur Derendinger ein, der war noch der Letzte von der alten Garde, Derendinger, mit dem er sich immer nur gefetzt hatte, am Anfang wegen ihrer politischen Meinungsverschiedenheiten und dann später aus Gewohnheit. Derendinger würde sich ein paar freundliche Floskeln aus den Fingern saugen, so wie er es auch selber für Derendinger machen würde, «ein Journalist der alten Schule» und so, zwölfhundert Zeichen und Deckel drauf. De mortuis nil nisi bonum. «Bonum» und nicht «bene». Aber Latein konnte auch keiner mehr.
Man sollte sich seinen Nachruf selber schreiben dürfen, dachte Weilemann, und hatte es auch schon versucht, nur aus Jux, man wollte ja nicht aus der Übung kommen, aber zwölfhundert Zeichen waren immer zu wenig gewesen; man hatte doch eine Menge gemacht im Lauf der Jahre. Nur schon der Fall Handschin damals, als er besser recherchiert hatte als die Polizei, die richtige Spur verfolgt und einen Unschuldigen aus dem Gefängnis geholt, dafür hätte man allein schon tausend Zeichen gebraucht, mindestens. Er hatte immer ein Buch über den Fall schreiben wollen, hatte sogar die Anfrage von einem Verlag gehabt, aber damals war er zu beschäftigt gewesen, und heute, wo er Zeit zum Versauen hatte, interessierte sich niemand mehr dafür.
Bücher wurden ja auch gar nicht mehr gelesen, nicht auf Papier auf jeden Fall, genauso wenig wie die Leute noch Zeitungen lasen, richtige Zeitungen, die am Morgen im Milchkasten lagen, und die man dann beim ersten Espresso des Tages in aller Ruhe studierte, zuerst Politik und Wirtschaft, dann das Lokale und ganz am Schluss, als Nachtisch, auch noch den Sport. Es gab die gedruckten Zeitungen noch, so viel Traditionsbewusstsein hatten sie, aber es legte sie niemand mehr in den Milchkasten. Zeitungsausträger waren ausgestorben, so wie Minnesänger ausgestorben waren oder Lampenputzer, dabei wären seit dem Krach mit Europa weiß Gott genügend Leute da gewesen, die keine Arbeit mehr fanden, weil sie eben nur Leute waren und keine Fachleute. Es rechnete sich nicht mehr, ein paar Abonnenten die Zeitungen ins Haus zu bringen. Wer immer noch darauf bestand, sie auf althergebrachte Weise zu lesen, musste mühselig zum Kiosk latschen, und wenn man einmal verschlafen hatte, waren sie oft schon ausverkauft. Dann musste man seine Zeitung am Bildschirm lesen, und das war ja nun wirklich, als ob man eine Frau durch so einen hygienischen Mundschutz hindurch küssen würde.
Papier, die beste Erfindung der Menschheit, verschwand immer mehr aus der Welt. Bei der ZB hatten sie doch tatsächlich ernsthaft darüber nachgedacht, neunzig Prozent ihres Bestandes einzustampfen, weil die Bücher ja alle digitalisiert zugänglich seien; der Vorschlag war zwar abgeschmettert worden, aber es würde noch so weit kommen, davon war Weilemann überzeugt, irgendwann würde es noch so weit kommen. Ganz gut, dass man nicht mehr der Jüngste war, wenigstens das würde man nicht mehr erleben müssen.
Er selber liebte den Geruch von altem Papier, schnitt immer noch Zeitungsartikel aus und bewahrte sie auf, obwohl es das alles auch im Internet gab. Für die Stapel auf seinem Schreibtisch brauchte er keine elektronische Suchfunktion, hätte auch gar keine haben wollen, damit fand man immer nur, was man gesucht hatte, den immer gleichen Googlehopf, und machte keine dieser zufälligen Entdeckungen, die doch das Interessanteste waren. Und wenn es ein bisschen länger dauerte – à la bonheur, Zeit hatte er, viel zu viel Zeit. Die Leute sagten zwar, die Tage gingen mit jedem Lebensjahr schneller vorbei, aber ihm kam es genau umgekehrt vor; jeden Morgen versuchte er, noch ein bisschen länger liegen zu bleiben, um schon mal ein bisschen von der Langeweile einzusparen, die ihn erwartete, aber das funktionierte nicht, immer schlechter funktionierte es, in seinem Alter hätte man mehr Schlaf gebraucht und bekam immer weniger davon; es war schon etwas dran an dem Gerede von der präsenilen Bettflucht.
Da müsste man mal etwas drüber schreiben, dachte er automatisch und ärgerte sich genauso automatisch darüber, dass dieser Reflex in seinem Kopf immer noch lebendig war. Er musste sich endlich daran gewöhnen, dass niemand mehr einen Text von ihm haben wollte, höchstens noch einen Nachruf, und auch den nur, wenn der Verstorbene zur Cervelat-Prominenz von vorgestern gehört hatte, ach was, nicht einmal Cervelat, Cippolata bestenfalls, lauter ganz kleine Würstchen. Bei den interessanten Toten kam er nicht in die Kränze, die waren für die Chefs reserviert, die sich für Edelfedern hielten, bloß weil sie die teureren Schreibtischsessel hatten. Er war sich ganz sicher, dass sie schon alle heimlich an einem Nachruf auf Stefan Wille herumbastelten, bei dem es ja, nach allem, was man aus den Bulletins der Krankenhausärzte herauslesen konnte, nicht mehr lang dauern würde. Ein Nachruf auf Wille, das wäre eine interessante Aufgabe, den würde man nicht in zwölfhundert Zeichen abfertigen müssen, und er, Weilemann, würde es auch ganz anders machen, nicht so, wie sie es wohl alle schon pfannenfertig in ihren Computern hatten, er würde auch Kritisches schreiben und nicht versuchen, wie es mit Sicherheit zu erwarten stand, dem Herrn Parteipräsidenten auch noch posthum in den Arsch zu kriechen. Aber es würde niemand einen Wille-Nachruf bei ihm bestellen, und wenn sie ihn bestellten, würden sie ihn nicht abdrucken.
«‹Abdrucken› ist ein altmodisches Wort. Bald drucken sie überhaupt nicht mehr.» Er merkte, dass er das laut ins leere Zimmer hinein gesagt hatte, und ärgerte sich über sich selber. Wenn einer anfing, Selbstgespräche zu führen, das war immer seine Überzeugung gewesen, dann war er reif fürs Altersheim.
Das Telefon läutete dann natürlich, als er auf dem WC saß. Typisch. Aber ein Auftrag war ein Auftrag, und seit die AHV-Ansätze zum zweiten Mal gekürzt worden waren, konnte man sich nicht leisten, einen zu verpassen. Weilemann humpelte also mit heruntergelassenen Hosen ins Wohnzimmer zurück. Allein zu leben hatte auch seine Vorteile.
2
«Weilemann.»
«Hier Derendinger.»
Weilemann zog schnell die Hosen hoch, auch wenn sein altmodisches Telefon keine Kamera hatte.
«Was willst du denn von mir?»
Viel zu abweisend. Auch wenn er sich mit dem alten Konkurrenten immer nur gekabbelt hatte, es war doch immerhin jemand, mit dem man sich unterhalten konnte, von Gleich zu Gleich, und solche Unterhaltungen ergaben sich nicht jeden Tag. Derendinger schien sich nicht verletzt zu fühlen.
«Dich treffen möchte ich.»
«Wozu?»
«Eine Runde Schach. Wie in alten Zeiten.»
Derendinger und er hatten ein einziges Mal versucht, miteinander Schach zu spielen, nach einer langweiligen Pressekonferenz, von der sie sich beide verdünnisiert hatten, und es war eine sehr kurze Partie geworden. Eine zweite hatten sie gar nicht mehr probiert, dafür war der Klassenunterschied zwischen ihnen einfach zu groß gewesen, er, Weilemann, damals am zweiten Brett im Verein, und Derendinger ein blutiger Anfänger, der sogar auf den Schäferzug reinfiel.
«Bist du noch dran?»
In der letzten Zeit kam es immer wieder vor, dass er sich mitten in einer Tätigkeit in seinen Gedanken verlor, und mit dem, was er angefangen hatte, einfach nicht mehr weitermachte. Das kam vom Alleinsein. Vor ein paar Tagen war es ihm im Migros passiert, er hatte angefangen, seine bescheidenen Einkäufe einzuscannen und dann …
«Hallo?»
«Ja, ja, ich bin dran. Ich staune nur. Seit einem Jahr habe ich nichts von dir gehört, und jetzt rufst du plötzlich an und willst …»
«Eine Partie. Dafür wirst du doch Zeit haben. Oder schreibst du gerade eine große Reportage für die New York Times?»
«Und wo?»
Früher hatte er immer im Schlachthof an der Herdernstraße gespielt, das war ihr inoffizielles Vereinslokal gewesen, ein Nebenzimmer, das meistens frei war, wenn nicht gerade im neuen Letzigrund ein Match stattgefunden hatte, und die Fans ihre heiser geschrienen Kehlen mit Bier kühlen mussten. Bis die Gegend dann hip und in und angesagt wurde, und sich der gemütliche Schlachthof in ein ungemütliches Trendlokal verwandelte. Er war nie wieder hingegangen. «Schweizerisch-asiatische Fusion-Küche», das war für ihn keine Verlockung, sondern eine Warnung, Sushi-Rösti stellte er sich darunter vor, Bratwurst mit Sojasprossen, das musste man sich wirklich nicht antun. Der Schachverein hatte sich dann irgendwann auch aufgelöst. Wer sich noch für das Spiel interessierte, benutzte den Computer als Gegner, wo man einstellen konnte, ob man gewinnen oder verlieren wollte.
«Hallo? Weilemann?»
Er musste sich diese Gedanken-Abschweiferei wirklich abgewöhnen. Gerade er, der den jungen Kollegen immer gepredigt hatte: «Das Allerwichtigste, was ein Reporter können muss, ist Zuhören.»
«Ich warte darauf, dass du einen Ort vorschlägst.»
«Auf dem Lindenhof.»
«Gibt es dort neuerdings eine Beiz?»
«Sie haben da diese großen Figuren.»
Wenn es etwas gab, das noch schlimmer war als Schach gegen den Computer, dann war es Freiluftschach, dieses 64-Felder-Minigolf, mit dem Pensionisten ihre leere Zeit totschlugen. Er war selber ja auch ein Zeit totschlagender Pensionist, aber er hatte trotzdem noch nie das Bedürfnis empfunden, in der Öffentlichkeit klobige Holzfiguren durch die Gegend zu schieben. Solche Leute waren für ihn keine richtigen Schachspieler, führten sich auf, als ob sie mindestens Elo 2000 hätten, wussten alles besser, und dabei würden sie eine englische Eröffnung noch nicht mal erkennen, wenn man sie ihnen auf dem Silbertablett servierte, mit Brunnenkresse garniert und einem Zitronenschnitz im Maul.
«Nein, wirklich, Derendinger, wenn du schon ums Verrecken eine Partie gegen mich verlieren willst, dann bitte an einem vernünftigen Ort.»
«Es ist wichtig», sagte Derendinger, in einem Ton, als ob es um Leben und Tod ginge, «wirklich, Kilowatt. In einer Stunde, ja? Um halb drei?»
«Wir könnten auch …»
Aber Derendinger hatte eingehängt. Kurlig war der geworden mit dem Alter, wirklich kurlig. Am besten würde man seinen Anruf einfach vergessen, so tun, als ob man ihn gar nicht bekommen hätte, sie hatten ja schließlich nichts abgemacht. Aber andererseits …
Vielleicht war es, weil Derendinger ihn «Kilowatt» genannt hatte. Den Übernamen hatte schon lang niemand mehr benutzt. Oder einfach die Neugier. Es musste etwas Ungewöhnliches dahinterstecken, wenn ein alter Kollege – oder Konkurrent, aber Konkurrenten waren ja gleichzeitig auch immer Kollegen –, wenn so ein alter Bekannter sich nach ewiger Zeit plötzlich wieder meldete und eine Partie Schach spielen wollte, ausgerechnet auf dem Lindenhof. Derendinger war immer ein Schachanalphabet gewesen, und wenn das einer mit vierzig ist, dann wird er mit siebzig nicht plötzlich zum Capablanca. Dazu dieser bettelnde Ton, und das von einem Mann, der die Nase immer hoch getragen hatte, «il pète plus haut que son cul», sagten dem die Franzosen. Hatte sich für etwas Besseres gehalten, weil er einmal bei der NZZ gewesen war, und das war damals, vor der Übernahme, ja auch wirklich noch so etwas wie journalistischer Hochadel gewesen. Nein, da gab es etwas herauszufinden, und selbst wenn es am Ende etwas völlig Unwichtiges war, Zeit hatte man ja.
In einer Stunde auf dem Lindenhof, das war zu schaffen.
«Der heißeste Juli seit Beginn der Wetteraufzeichnungen», hatten sie im Fernsehen gesagt, aber das sagten sie jedes Jahr, und er zog trotzdem seinen blauen Pullover an, ausgeleiert, aber bequem. Man wurde gfrörlig mit dem Alter. Dann zog er den Pullover wieder aus, Derendinger sollte nicht denken, dass er einer von diesen Scheißegal-Senioren war, die auf ihr Äußeres keinen Wert mehr legten. Das englische Jackett mit den Lederpatches an den Ellbogen war zwar auch nicht mehr neu, aber diese Sorte Kleidung wurde mit dem Alter nur besser.
Vor dem Haus – auch so ein vorsintflutlicher Reflex – öffnete er automatisch den Briefkasten, obwohl doch Mittwoch war, und die Post nur noch am Dienstag und am Freitag kam; wer verschickte denn noch Briefe? Nur ein Flugblatt hatte jemand durch den Schlitz gesteckt, «An alle echten Schweizer!», das konnte direkt in die Tonne, auch wenn es in Hochglanz daherkam. Dieses Verteilen von Werbezetteln war sowieso nur noch Folklore, eine Art Volksbrauch, nötig hatten sie es ja nicht mehr, so wie die Dinge lagen. Nicht bei der Mehrheit.
Er fuhr mit den Tram in die Stadt, die U-Bahn war nie gebaut worden, obwohl die Pläne fertig auf dem Tisch gelegen hatten, aber als es dann mit der Schweizer Wirtschaft bergab ging, war das Projekt nicht mehr zu finanzieren gewesen. Ihm war es egal, von der Heerenwiesen bis zum Central brauchte der Siebner auch nur eine Viertelstunde. Man hatte ihm das als großen Vorteil gepriesen, damals, als er seine schöne Wohnung im Seefeld hatte aufgeben müssen, weil sie die in eine Preisliga hinaufrenoviert hatten, in der ein pensionierter Journalist nicht mehr mitspielen konnte. Wobei «pensioniert» in seinem Fall ein sehr theoretischer Begriff war, er war zu lang freischaffend gewesen, und Beitragslücken waren keine Zahnlücken, wo man sich einfach eine Brücke einsetzen lassen konnte. Mit dem, was jeden Monat auf seinem Konto hereintröpfelte, musste er nicht in der Delicatessa einkaufen wollen.
Das Tram war voll, wie sonst immer erst vom Milchbuck an; eine lautstarke Schulklasse hatte alle Plätze besetzt, und natürlich dachte keiner von den Rotzlöffeln daran, seinetwegen aufzustehen. Andererseits – halbleeres Glas, halbvolles Glas – war das ja auch ein gutes Zeichen, er sah offenbar noch nicht alt und gebrechlich aus, aber es wäre ihm doch lieber gewesen, wenn ihm einer das Angebot gemacht hätte, nur damit er hätte sagen können: «Danke, nicht nötig, ich kann sehr gut stehen.» Bis jetzt hatte seine Hüfte ihren guten Tag.
Die Schüler stiegen dann zusammen mit ihm am Central aus, waren wahrscheinlich auf dem Weg zum Landesmuseum; die konnten sich dort kaum mehr vor dem Ansturm retten, hatte er gelesen, seit Schweizer Geschichte in den Schulen wieder so wichtig geworden war.
Die paar Schritte dem Limmatquai entlang machte er zu Fuß, umzusteigen hätte sich nicht gelohnt für die eine Station. Es waren eine Menge Touristen unterwegs, alles Asiaten. Er hatte mal gelernt, dass man die verschiedenen Nationen an der Augenstellung unterscheiden könne, zwanzig nach acht, Viertel nach neun, zehn nach zehn, aber – typisch! – er hatte vergessen, welches davon die Japaner waren, welches die Chinesen und welches die Koreaner. Es war lustig zu sehen, wie sich manchmal eine ganze Reisegruppe gleichzeitig im Kreis drehte, wie ein Volkstanz sah das aus, aber natürlich ging es nur um die Panorama-Aufnahmen, die sie mit ihren Brillenkameras machten. Kurz vor der Uraniabrücke wurde einer der japanischen Koreaner-Chinesen von einem Hipo aufgehalten, weil er ein Kaugummipapier auf den Boden geworfen hatte, und der Asiate reagierte nicht etwa irritiert, auch nicht schuldbewusst, sondern geradezu glücklich, hob das Papier auf, entschuldigte sich mit mehreren Verbeugungen und eilte dann seinen Kollegen hinterher, um ihnen ganz begeistert von seinem Erlebnis zu erzählen. In seinem Tagebuch, nein, auf seiner Facebook-Seite natürlich, würde er bestimmt schreiben: «Die Tourismus-Werbung übertreibt nicht: Zürich ist tatsächlich die sauberste Stadt der Welt, noch sauberer als Singapur.» Vielleicht würde er ein Foto von dem Hipo dazusetzen, fand den bestimmt ganz toll, so einen netten jungen Mann in hellblauer Uniform.
Weilemann mochte die freiwilligen Hilfspolizisten nicht, das waren alles Streber und Wichtigmacher, und wenn mal ein Papierfetzen oder ein Zigarettenstummel auf dem Boden landete, dann ging die Welt auch nicht unter. Es war sowieso alles viel zu sauber geworden, viel zu ordentlich. In seiner Jugend hatte es mal ein Lied gegeben, er wusste nicht mehr von wem, in dem war «meh Dräck» gefordert worden. Heute würde so ein Song wahrscheinlich verboten, nein, nicht verboten, einfach nicht gespielt. Man regelte solche Dinge diskreter als früher.
Die Treppe zum Lindenhof hinauf kam ihm steiler vor als auch schon. Man hätte eine kleines Glosse darüber schreiben können, eine neue Methode zur Bestimmung des Alters vorschlagen, nicht mehr nach der Anzahl der Lebensjahre, sondern danach, wie oft einer auf einer solchen Strecke stehen bleiben und einen Zwischenhalt einlegen musste. Aber kleine Glossen waren bei den Redaktionen etwa so gefragt wie Blutwürste an einem Vegetarierkongress. Egal, darüber nachdenken durfte man ja wohl noch, use it or lose it. Ob auch anderen Leuten dauernd Dinge einfielen, die niemand mehr haben wollte? Er musste Derendinger gleich mal fragen.
3
Aber da war weit und breit kein Derendinger, auch nicht unter den Gaffern, die um das Schachfeld herumstanden. Lauter Männer waren es, auch junge, alle mit so viel freier Zeit, dass sie mitten in der Woche einen ganzen Nachmittag auf dem Lindenhof verbringen konnten. Weilemann vermutete schon lang, dass die offiziellen Arbeitslosenzahlen nicht stimmten; wenn die Leute einmal ausgesteuert waren, wurden sie einfach nicht mehr mitgezählt.
Er war darin geübt, eine Schachpartie schnell zu erfassen, und das funktionierte auch mit diesen ungewohnten Riesenfiguren, gelernt ist gelernt. Das Spiel immer noch in der Eröffnungsphase, sizilianische Verteidigung in der Moskauer Variante, die Sorte Partie, die sich leicht in die Länge zog; bis auf diesem Spielfeld jemand anderes an die Reihe kam, konnte es dauern. Dass Derendinger allen Ernstes geglaubt hatte, man könne hier einfach so auftauchen, und es wären dann keine anderen Schachspieler da, man brauche nur die Figuren aufstellen und loslegen, das war ganz schön naiv von ihm gewesen. Unpünktlich war er auch. «In einer Stunde», hatte er gesagt, und wenn Weilemann es von Schwamendingen her geschafft hatte, dann konnte man das wohl auch von Derendinger erwarten. Fünf Minuten gab er ihm noch. Zehn allerhöchstens.
Er war voller Vorurteile gegen dieses Parkschach hergekommen und stellte jetzt mit Befriedigung fest, dass die Wirklichkeit noch viel lächerlicher war. Schon wie sich die Spieler mit den übergroßen Figuren abschleppten, sah sackdumm aus, und was die Kommentare der Zuschauer anbelangte – solche Kiebitze hatten sie früher im Verein «E-Em-Wes» genannt: Leute, die besser Eile mit Weile spielen sollten. Als Weiß rochierte, genau in der Position, in der man gemäß Lehrbuch bei dieser Eröffnung zu rochieren hatte, kommentierten sie den nun wirklich nicht überraschenden Zug so aufgeregt, als sei gerade das Schachspiel neu erfunden worden.
Und rücksichtslose Drängler waren sie auch. Da stieß ihn doch einer einfach mit dem Ellbogen an, meinte wohl, der Platz direkt am Spielfeld sei für ihn reserviert. Weilemann wollte den Kerl anblaffen – man musste seine schlechte Laune ab und zu an die frische Luft lassen, das tat ihr gut –, wollte gerade mit einer Tirade loslegen, aber als er sich zu dem Drängler hinwandte, war es Derendinger, der da neben ihm stand, ein alt gewordener Derendinger, auch das massive Brillengestell konnte die tiefen Tränensäcke nicht kaschieren.
«Bist du also doch noch aufgetaucht?»
Derendinger antwortete nicht, schien ihn gar nicht gehört zu haben, sondern starrte auf das Schachfeld, als ob die konventionelle Stellung das Spannendste sei, das er je gesehen hatte.
«Wie hast du dir eigentlich vorgestellt, dass wir hier …?»
Er sprach den Satz nicht zu Ende. Derendinger hatte unmerklich den Kopf geschüttelt, nur eine ganz kleine Bewegung, wie ein geflüstertes Nein, aber das war es nicht gewesen, was Weilemann hatte verstummen lassen. Da war etwas in Derendingers Gesicht, etwas Ängstliches, Gehetztes, das Weilemann unwillkürlich denken ließ: Der Mann hat Angst.
Aber wovor sollte Derendinger sich fürchten?
Er hatte sich sehr verändert, seit sie sich zum letzten Mal begegnet waren, bei einem Pensionistenstamm war das gewesen, ein Anlass, zu dem Weilemann, wie er gern sagte, dreimal hingegangen war, das erste Mal, das letzte Mal und einmal zu viel, lauter Leute, die nur noch in ihrer Vergangenheit lebten und sich mit der Aufzählung von Triumphen, die sie anno Tobak errungen haben wollten, gegenseitig langweilten. «Und dann bin ich in die Chefredaktion marschiert und habe auf den Tisch gehauen.» In Wirklichkeit hatten sie natürlich angeklopft, vor dem Schreibtisch des Chefs Männchen gemacht und brav geschwiegen, während sie ihren Anschiss kassierten. Ein paar Biere später erzählten sie dann reihum, mit welchen Hobbys sie sich die Zeit vertrieben, jetzt, wo sie zu viel davon hatten, Briefmarken sammeln oder Kakteen züchten. Als die Reihe an Derendinger gekommen war, hatte der ganz cool gesagt: «Ich arbeite immer noch. Bin an einer großen Geschichte dran.» Das hatte ihm zwar keiner so recht geglaubt, aber Derendinger war kein Mann, dem man ins Gesicht hinein widersprach. Eine Autoritätsfigur.
Und jetzt …
Viel zu dick angezogen für das Sommerwetter, unter dem Jackett auch noch ein Pullover. Trotzdem hatte Weilemann nicht den Eindruck, dass die Schweißtropfen auf Derendingers Stirn von der Hitze kamen. Das war kalter Schweiß, die Haut ganz fahl. Und seine Augen flackerten hin und her, als ob er sicher sein wollte, dass ihn niemand beobachtete. Als er dann endlich etwas sagte, den Blick immer noch auf die Schachfiguren gerichtet, da ergab das überhaupt keinen Sinn.
«Eine interessante Stellung, gell?»
Machte hier einen auf Fachmann, und dabei brauchte er wahrscheinlich immer noch einen Spickzettel, um zu wissen, wie sich die einzelnen Figuren bewegten. Nein, «kurlig» reichte als Bezeichnung nicht mehr aus. Mit Derendinger musste etwas passiert sein, und es war nicht schwer zu erraten, was das war. Im Internet – natürlich schaute man solche Dinge nach, auch wenn man sie gar nicht nachschauen wollte – gab es genügend Beschreibungen dieses Abbaus. «Der böse Alois», so hatten sie den Alzheimer genannt, damals, als die Diagnose noch etwas Neues war.
«Erinnert mich an diese Partie in Zollikon», sagte Derendinger, immer noch, ohne ihn anzusehen.
Weilemann konnte sich nicht daran erinnern, jemals in Zollikon angetreten zu sein. Ganz auszuschließen war es nicht, er hatte eine Menge lokaler Turniere gespielt, und hinterher kamen sie einem durcheinander. Aber wenn, dann war Derendinger bestimmt nicht dabei gewesen.
«Du weißt schon. Dieses Spiel, in dem Schwarz matt war, bevor Weiß den ersten Zug gemacht hatte.»
«Wie bitte?»
«In dem Schachklub an der Alten Landstraße.» Machte ihm da Zeichen, wie ein Verschwörer aus einem schlechten Film, mit den Augen und mit dem ganzen Gesicht, und wiederholte noch zweimal: «An der Alten Landstraße, an der schönen Alten Landstraße.»
In Weilemanns Kopf regte sich etwas, nicht direkt eine Erinnerung, nur etwas, das sich so ähnlich anfühlte. Einbildung natürlich. Vor Jahren hatte er einmal einen Artikel über diesen Mechanismus geschrieben, dass man einen Menschen nur lang genug nach etwas Bestimmtem fragen muss, und früher oder später fängt er an sich einzubilden, er habe das tatsächlich erlebt. Kann es manchmal sogar beschreiben, in allen Einzelheiten. Aber eine Schachpartie in Zollikon? Nein, wirklich nicht.
«Von was redest du eigentlich?»
Derendinger antwortete nicht, starrte immer noch auf das Spielfeld, wo schon seit Minuten nichts mehr passierte. Weiß am Zug konnte sich nicht entscheiden, ob er den schwarzen Läufer schlagen sollte oder nicht. Typisch Amateur, wozu spielte er die Variante, wenn er keinen Läufertausch wollte?
«Hallo! Jemand zuhause?»
Derendinger zuckte zusammen. Er winkte Weilemann näher zu sich heran und murmelte dann, so leise, dass man ihn kaum verstehen konnte: «Zollikon, Kilowatt. Schau’s halt nach, wenn du dich nicht erinnerst. War damals eine große Story. In allen Blättern.»
Durchgedreht, schade. Bei den meisten schlich sich der Alois ganz unauffällig ins Hirn, aber bei Derendinger schien er mit der Brechstange gekommen zu sein. Wenn einer sich an Sachen erinnerte, die nie stattgefunden hatten, dann musste man keinen FMH haben, um zu wissen, was es geschlagen hatte. Derendinger war ihm ja nie besonders sympathisch gewesen, aber seine Intelligenz hatte man dem Mann nicht absprechen können. Und jetzt phantasierte er da in der Weltgeschichte herum. Nicht widersprechen, das war in solchen Fällen das Beste. Nicken und lächeln. Und sich so schnell wie möglich vom Acker machen.
«Du musst das recherchieren», murmelte Derendinger. «Die ganze Partie noch einmal nachspielen.»
«Mach ich», sagte Weilemann. «Vom ersten Zug bis zum letzten.»
Nicht widersprechen.
«Wirklich. Glaub mir: Das gibt einen hochinteressanten Artikel.»
Klar. Ein Bericht über eine Schachpartie, die nie stattgefunden hatte – dafür machte einem jede Zeitung die Titelseite frei.
«Ich kümmere mich drum», sagte Weilemann und merkte selber, wie heuchlerisch seine Stimme klang. «Versprochen. Aber jetzt muss ich leider. Ich habe noch einen Termin.»
Er hatte nicht überzeugend genug gelogen, nicht den richtigen beruhigenden Ton getroffen, denn Derendinger hielt ihn am Ärmel fest und wurde immer aufgeregter. «Du musst es wirklich tun», sagte er und klang wieder so flehend wie vorhin am Telefon, «es ist wichtig. Es gibt überhaupt nichts Wichtigeres, glaub mir das. In der ganzen Schweiz nichts Wichtigeres. Und sprich auch mit Läuchli.»
«Läuchli?»
«Der hat damals das Turnier organisiert.»
«Natürlich», log Weilemann. «Läuchli. Jetzt fällt es mir wieder ein.»
«Gut», sagte Derendinger. «Das ist gut.»
Weiß hatte sich endlich doch entschieden, die Läufer abzutauschen. In der allgemeinen Unruhe, während die beiden Spieler ihre Figuren herumschleppten und die Kiebitze ihre Kommentare loswurden, fasste Derendinger in die Tasche seines Jacketts. «Hier», sagte er. «Damit du es nicht vergisst.» Er drückte Weilemann etwas in die Hand, etwas Kleines, Spitziges, das sich ihm schmerzhaft in die Haut bohrte.
«He! Was soll das?»
Aber Derendinger stand nicht mehr neben ihm. Wie vom Erdboden verschluckt, dachte Weilemann und ärgerte sich darüber, dass sein Kopf solche Klischee-Formulierungen produzierte. In einem Artikel würde er die Worte gelöscht und ein originelleres Sprachbild gesucht haben. Er musste sich eine ganze Weile umsehen, bis er, schon in einiger Distanz, Derendinger wieder entdeckte, wie der sich einen Weg durch einen Pulk von chinesischen – oder japanischen oder koreanischen – Touristen bahnte, bis er hinter dem Hedwigbrunnen aus dem Blickfeld verschwand. Das Denkmal war renoviert worden, das fiel Weilemann erst jetzt auf; die Figur der gepanzerten Frau glänzte frisch poliert in der Nachmittagssonne. Alles, was mit patriotischen Heldentaten zu tun hatte, wurde früher oder später renoviert.
Es hätte keinen Sinn gehabt, Derendinger einholen zu wollen, es war Weilemann auch ganz recht, dass er ihn los war. «Sturm im Grind» – eine so treffende Formulierung hatte das Hochdeutsche nicht zu bieten. Er machte ein paar Schritte von den Schachspielern weg und sah erfreut, dass ein junges Liebespärchen gerade einen Sitzplatz auf einer der Parkbänke freimachte. Langes Herumstehen tat seinem Hüftgelenk nicht gut.
Verwirrte Leute machten gern seltsame Geschenke. In einem Interview hatte mal ein Regierungsrat erzählt, dass ihm eine Frau, die er überhaupt nicht kannte, jede Woche eine Papierblume schickte, kunstvoll aus Zeitungspapier ausgeschnitten und zusammengeklebt. Was ihm Derendinger in die Hand gedrückt hatte, war eins dieser Abzeichen mit einem Kantonswappen, die vor ein paar Jahren aufgekommen waren, und die heute fast jeder am Revers trug, Weilemann selber ja nicht, er verweigerte sich schon aus Prinzip allen Modeerscheinungen. Auch darüber hatte er sich mit Markus gestritten. Ein Berner Wappen, was bedeutete, dass der Anstecker ursprünglich nicht Derendinger gehört haben konnte, man trug das Abzeichen seines Heimatkantons, und, wie der Name sagte, mussten die Derendingers ursprünglich aus dem Solothurnischen gekommen sein. Die Nadel war angerostet, also war das Ding nicht neu. Vom Email des Wappenbildes war ein kleines Stück abgebrochen, dem Berner Bären fehlte die rote Zunge. Wahrscheinlich hatte Derendinger den Anstecker irgendwo gefunden und in seiner Verwirrtheit für etwas Wertvolles gehalten.
Weilemann wollte das Geschenk schon wegwerfen, aber es spazierten gerade zwei von diesen hellblauen Hipos vorbei, und er hatte keine Lust, eine Buße wegen Littering zu bezahlen. Eigentlich komisch, dass sie immer noch diese englischen Ausdrücke gebrauchten, wo sie doch sonst alles Ausländische verteufelten. Aber egal, wie die Ordnungswidrigkeit hieß, ein Kantonswappen schmiss man nicht einfach auf den Boden, da konnte man Schwierigkeiten bekommen. Er steckte das Abzeichen also in die Tasche und schloss die Augen. Noch zehn Minuten die Sonne genießen, dachte er. Man hatte ja Zeit.
4
Das Bett war bequem, und Weilemann hasste es dafür. Es war ein schlechtes Zeichen, wenn man so ein bequemes Bett brauchte; als er noch jung gewesen war, hatte er beim Zelten auf dem Boden geschlafen, nicht einmal eine Thermomatte hatte er gebraucht. Und jetzt hatte er sich dieses Spitalbett anschaffen müssen, sie nannten es zwar nicht so, doch im Grund war es nichts anderes: ein Spitalbett, ein Altersheimbett, ein Nächste-Station-Friedhof-Bett. Aber bequem, das musste er widerwillig zugeben. Wenn er es auf die richtige Position eingestellt hatte, spürte er seine Hüfte kaum mehr, und wenn man das Oberteil aufrichtete, wurde es zum komfortablen Fernsehsessel.
Leider ließ sich das Fernsehprogramm nicht auch so auf Knopfdruck einrichten, maßgeschneidert nach den eigenen Wünschen; das hatten sie noch nicht erfunden. Man konnte sich durch die Kanäle hinauf- und hinunterklicken, es lief nirgends etwas, was einen interessierte, schon gar nicht im Schweizer Fernsehen oder wie der Sender jetzt gerade hieß, senden taten sie immer dasselbe, aber den Namen änderten sie so häufig wie andere Leute die Socken. Auf dem ersten Kanal wurde jodelnd gekocht oder kochend gejodelt, und im zweiten liefen irgendwelche Dokumentationen zur Schweizer Geschichte, bei Grandson das Gut, bei Murten den Mut, bei Nancy das Blut. Die Ausländer waren nicht besser, wenn sie überhaupt noch ganze Programme brachten und nicht nur Trailer für Sendungen, die man sich gefälligst selber aus dem Internet fischen sollte. Es wäre vernünftiger gewesen, ein gutes Buch zu lesen, aber am Abend machten seine Augen das nicht mehr mit. «Mit der Ermüdung werden Sie in Ihrem Alter leben müssen», hatten sie an der Uniklinik gesagt, was auf Deutsch hieß: «Bei Greisen wie Ihnen zahlt die Krankenkasse keine kostspielige Behandlung mehr.» Also doch Fernsehen. Auf einem Dorfplatz saßen Leute an langen Tischen im Regen, hatten durchsichtige Pelerinen über ihre Trachten gezogen und schunkelten im Takt einer Ländlerkapelle. Eine typische Sommerpausenwiederholung; Gewitter waren heute nirgends gemeldet. Im zweiten Programm …
Das Telefon musste natürlich genau dann läuten, wenn man es sich bequem gemacht hatte. Wenn das wieder so ein Massenanruf war, eine Computerstimme, die ihm etwas verkaufen wollte, eine Versicherung oder die Mitgliedschaft in einem Seniorenclub, dann würde er morgen früh gleich als Erstes einen gesalzenen Beschwerdebrief schreiben, gesalzen und gepfeffert. Schließlich nahmen sie ihm jeden Monat eine Gebühr dafür ab, dass sein Anschluss für Werbung gesperrt war. Das Bett hatte auch eine Ausstiegsfunktion, man wurde mit sanfter Gewalt auf die Füße gekippt, und weil sich der andere Pantoffel irgendwo verkrochen hatte, schlurfte er eben mit nur einem zum Schreibtisch.
«Weilemann.»
«Wir brauchen einen Nachruf», sagte jemand, der gerade erst den Stimmbruch hinter sich zu haben schien.
«Wer ist am Apparat?»
«Sehen Sie das nicht auf Ihrem Display?»
Natürlich hatte sein Telefon ein Display, ganz aus der Steinzeit war er auch nicht, aber das zeigte nur die Nummer des Anrufers an und nicht, wie die neueren Geräte, auch gleich den Namen und die Adresse.
«Hier ist die Weltwoche.» Ein Tonfall, als ob er gesagt hätte: «Hier ist das Weiße Haus» oder: «Hier ist der Vatikan.» Dabei waren die auch nur eine Zeitung, die größte, okay, aber Auflage allein war auch nicht alleinseligmachend, und was die Tradition anbelangte, auf die sie so stolz waren – bloß weil sie immer noch die «Woche» im Namen trugen, obwohl sie schon seit vielen Jahren täglich erschienen, deshalb waren sie doch nicht von Johannes Gutenberg persönlich gegründet worden. Aber egal, ein Auftrag war ein Auftrag.
«Ein Nachruf, okay.»
«Bis morgen zwölf Uhr. Und bitte exakte Länge.»
«Zwölfhundert Zeichen, ich weiß.»
«Maximal tausend. Scheint kein sehr wichtiger Mann gewesen zu sein. Alles klar?»
«Wenn Sie mir vielleicht freundlicherweise den Namen verraten würden?» Eigentlich war Sarkasmus bei solchen Leuten ja reine Verschwendung, denen pustete man schon auf der Journalistenschule jeden Sinn für Humor aus dem Hirn.
«Der Name. Natürlich.» Weilemann hörte das Klacken einer Tastatur. Der junge Herr Hilfsredaktor musste tatsächlich erst nachschauen.
«Derendinger, Felix», sagte die Stimmbruchstimme nach einer Pause. «Soll Journalist gewesen sein. Den haben Sie doch noch gekannt?»
Es war kein echter Calvados, den er da für Notfälle im Küchenschrank hatte, so einen richtig guten Importtropfen konnte er sich schon lang nicht mehr leisten. Im Thurgau gebrannt, aber auf die Herkunft kam es jetzt nicht an. Er brauchte einen Schluck gegen den Schock, mehr als einen.
Derendinger.
Vor ein paar Stunden hatte der noch gelebt, hatte nicht sehr gesund ausgesehen, weiß Gott nicht, aber auch nicht todkrank. Verwirrt war er gewesen, total verwirrt, aber am Alois starb man nicht, uralt konnte man damit werden, er wusste von Fällen, wo die nächste Generation auch schon im Altersheim gelandet war, und immer noch die Verantwortung hatte für einen Vater oder eine Mutter, die sich an nichts erinnerten und niemanden mehr erkannten. Nein, damit konnte es nichts zu tun gehabt haben. Sie hatten sich doch noch unterhalten, verdammt nochmal, keine richtige Unterhaltung, okay, Derendinger hatte auf ihn eingeredet, unsinniges Zeug, aber trotzdem, und war dann ohne Abschied weggegangen, quer über den Platz. Was war da passiert, hinterher? Warum hatte ihm dieser Teenager von der Weltwoche nicht gesagt, was mit Derendinger passiert war?
Sein alter Journalistenreflex war immer noch, sich ans Telefon zu hängen, Derendingers Familie ausfindig zu machen, wenn er noch eine hatte, verheiratet war er seines Wissens nie gewesen, oder die Spitäler anzurufen, eines nach dem andern, so viele gab es in Zürich gar nicht. Das Internet fiel ihm immer erst als Letztes ein, obwohl er durchaus damit umzugehen wusste, aber man hatte nun mal seine Gewohnheiten.
«Derendinger, Felix» eingeben und die Priorität auf «in den letzten 24 Stunden» stellen.
Sogar ein Foto gab es, an der Schipfe aufgenommen. Die Umrisse eines Körpers, abgedeckt mit einer Blache, unter der Blut heraussickerte. Ein Schriftzug auf dem Kunststoff, als er das Bild herangezoomt hatte, konnte er ihn sogar entziffern: «Limmatclub Zürich». Das war wohl der nächste Ort gewesen, wo sie etwas zum Zudecken holen konnten. Derendinger musste plötzlich dagelegen haben, gestolpert und dann unglücklich hingefallen, oder ein Herzinfarkt, nein, kein Herzinfarkt, davon blutete man nicht, da sackte man einfach zusammen.
Weder noch. Da war nicht nur eine Meldung, sondern mehrere, von Passanten, die zufällig vorbeigekommen waren und sich die Gelegenheit nicht hatten entgehen lassen, auch einmal Reporter zu spielen. «Vom Lindenhof heruntergestürzt», da waren sich alle einig. Einer wollte den Sturz sogar beobachtet haben, ein Wichtigmacher wahrscheinlich, wie es bei jedem Unfall welche gab, aber die Spuren schienen eindeutig. Auch eine Stellungnahme der Stadtpolizei war schon erschienen: «Vermutlich Selbstmord». Der Verunfallte, wurde angenommen, sei oben beim Lindenhof auf die Mauer gestiegen und von dort in die Tiefe gesprungen. Über ein Motiv war noch nichts bekannt.
Auf die Mauer gestiegen, ohne dass es jemand gesehen hatte? Das passte nicht zu der Erinnerung, die Weilemann an den Nachmittag hatte. Ja, Derendinger war in jene Richtung gegangen, am Hedwigbrunnen vorbei, aber dort waren jede Menge Leute gewesen, Touristen die meisten, und alle permanent am Fotografieren. Von seiner Parkbank aus hatte er selber nicht bis zur Mauer sehen können, aber er war sicher, dass sie sich dort erst recht gedrängelt hatten; die Aufnahme vom Lindenhof hinunter in Richtung Limmatquai gehörte zum Pflichtprogramm jeder Stadtführung. Und trotzdem hatte Derendinger es geschafft, völlig unbemerkt …? Und selbst wenn: Auf mindestens einer dieser Touristen-Aufnahmen musste er doch zu sehen sein, ach was, nicht auf einer, auf Dutzenden, diese Leute begannen ja schon beim Frühstück im Hotel zu filmen und schalteten das Gerät erst wieder aus, wenn sie ins Bett gingen. Von den Überwachungskameras ganz zu schweigen, die in der Stadt jeden Quadratmeter permanent beobachteten, am Anfang hatte es noch Proteste gegen das System gegeben, aber der Widerstand war dann eingeschlafen, vielleicht weil die Kameras kleiner und unauffälliger geworden waren, oder einfach, weil die Leute eingesehen hatten, dass Widerstand keinen Zweck hatte. Wenn man in der abgelegensten Quartierstraße einen Zigarettenstummel auf den Boden fallen ließ, hatte man am nächsten Tag den Bußenbescheid im Mail, und von einem spektakulären Selbstmord sollte es keine Aufnahmen geben? «Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen», das war natürlich nur heiße Luft, Weilemann hatte während seiner Berufsjahre genügend solcher Bulletins gelesen und fiel auf die Formulierung schon lang nicht mehr herein. «Ermittlungen aufgenommen», das hieß: «Warum sollen wir uns wild machen? Es gibt Wichtigeres auf der Welt als einen toten alten Mann.»
Der Thurgauer Calvados brannte im Hals, so ganz war die Imitation nicht gelungen, aber Weilemann schenkte sich trotzdem das nächste Glas ein. Es war eine Sauerei, dass die Polizei den Fall nicht ernst nahm, fürs Bußenverteilen hatten sie genügend Leute, jeder Betrunkene, der es nicht bis zum nächsten Toilettenhäuschen geschafft hatte, war ihnen wichtig, wichtiger als ein toter Derendinger. Wenn Weilemann noch bei der Zeitung gewesen wäre, hätte er sich auf der Stelle hingesetzt und einen flammenden Artikel gegen dieses Missverhältnis verfasst, aber denselben Text fürs Internet zu schreiben, wo er dann nur einer von den Hunderttausenden von Stänkerern und Miesmachern gewesen wäre, die dieses Medium bevölkerten, dazu hatte er keine Lust. Dort hatte man keine Leser, keine richtigen auf jeden Fall; seit es nur noch einen Tastendruck brauchte, um jeden Hirnfurz subito weltweit zu publizieren, waren sie alle viel zu sehr damit beschäftigt, selber zu schreiben.
Noch ein Glas. Morgen würde er mit einem Brummschädel aufwachen, aber das war ihm scheißegal, so einen Nachruf schrieb er zur Not auch noch im Koma. Es war sowieso eine Frechheit, was sie da bei ihm bestellt hatten, tausend Zeichen, das reichte für einen überfahrenen Hund, aber nicht für einen Derendinger, der doch so etwas wie der Doyen der Journalistenzunft gewesen war; den exakten Lebenslauf musste er sich auch noch aus dem Netz fischen. Derendinger hatte auch einmal ein paar Jahre in Deutschland gearbeitet, aber es fiel Weilemann ums Verrecken nicht mehr ein, ob das bei der Zeit oder bei der Welt gewesen war. Wahrscheinlich bei der Zeit, das passte besser zu ihm.
Egal. Morgen.
Der Küchenboden war kalt unter seinem linken Fuß, kein Wunder, wenn man nur einen Pantoffel anhatte. In seiner schönen alten Wohnung hatten sie bei der Renovation eine Fußbodenheizung eingebaut, die Küche mit Marmor und das neue WC wahrscheinlich mit Swarowski-Kristallen dekoriert. Sie hatten ihm die Pläne zugeschickt, mit einem stinkfreundlichen Brief, die Betonung auf «stink», wenn er die Wohnung nach dem Umbau wieder mieten wolle, würde er selbstverständlich den Vorrang haben. Dabei hatten sie ganz genau gewusst, dass er sich das nicht leisten konnte. Wo hatte Derendinger eigentlich gewohnt? Da kannte man sich schon seit Ewigkeiten, und wusste vom anderen über das Berufliche hinaus überhaupt nichts. Die Zeitungen aufzählen, bei denen Derendinger gearbeitet hatte, zu viel mehr würde der Platz nicht reichen. Den Journalistenpreis hatte er auch mal gewonnen – oder war es sogar zweimal gewesen? Das musste er auch noch nachschauen. Aber Persönliches? Fehlanzeige. «Sie haben ihn doch noch gekannt.» Nein, wirklich gekannt hatte er ihn nicht, er konnte ja nicht gut schreiben, dass Derendinger ein beschissener Schachspieler gewesen war und auf seine alten Tage plemplem. Aber doch noch einer von der alten Garde, als Nächster war man dann wohl selber an der Reihe, der letzte Mohikaner, und wenn sie dann jemanden suchten, der einen noch gekannt hatte, dann würden sie keinen finden. Ende der Fahnenstange.
So schlecht schmeckte der Calvados gar nicht, wenn man sich einmal an ihn gewöhnt hatte.
5
Er hatte den Traum schon als Kind geträumt, und seither immer wieder, manche Dinge änderten sich nicht. Er konnte dann fliegen, nein, «schweben» war das bessere Wort, ein paar Zentimeter über dem Boden, ein menschliches Hovercraft, durch Straßen, die er nicht kannte, und manchmal, ohne jede Anstrengung, eine Treppe hinauf, das war immer das Schönste. Man fühlte sich so leicht dabei. Und dann plötzlich …
Er wusste nicht mehr, was ihn so plötzlich herausgerissen hatte.
Ein Hindernis, ja, das war es gewesen, ein Straßenschild, und wenn er sich nur hätte erinnern können, was darauf stand …
Alte Landstraße.
Es war kein Wunder, dass einen die Ereignisse des Tages bis in die Träume hinein verfolgten. Erst Derendingers seltsames Verhalten und dann sein Tod, und den Nachruf musste er auch noch schreiben, tausend Zeichen. «Kein sehr wichtiger Mann», hatte der Schnösel gesagt. Dabei war Derendinger doch wirklich jemand gewesen. Aber so ein gewöhnlicher Todesfall, egal, wie er passiert war, gab eben keine Schlagzeile her, nicht wie ein Flugzeugabsturz oder ein saftiger Mord.
Mord.
Er hätte nicht erklären können, was für ein Mechanismus da in seinem Kopf ablief, aber plötzlich setzten sich die Teile wie von selber zusammen. Er hatte die ganze Zeit in die falsche Richtung gedacht, in der falschen Schublade gewühlt, wie wenn man auf der Straße einem Menschen begegnet, von dem man genau weiß, dass man ihn kennt, den man aber ums Verrecken nicht einordnen kann, man geht in Gedanken die ganze Kollegenkartei durch, und dann stellt sich heraus, dass es ein Schulkamerad ist, seit der Matur nicht mehr gesehen, oder der Apotheker, bei dem man sich immer seine Kopfschmerztabletten holt, egal, jemand aus einer ganz anderen Abteilung des eigenen Lebens. Aber das war ihm nur passiert, weil Derendinger von einer Schachpartie geredet hatte, und mit Schach hatte es nichts zu tun.
Zollikon, Alte Landstraße, das war die Adresse, wo damals der Morosani-Mord passiert war, vom ersten Tag an hatte man die Geschichte so genannt, da hatte sich gar kein Schlagzeilentexter wild machen müssen, die Bezeichnung hatte sich von selber angeboten, wegen der Alliteration. M&M’s. Wie lang war das jetzt schon wieder her? Zwanzig Jahre? Mehr als dreißig. Man wurde alt. Es hatte sich eine Menge verändert seit damals.
In der Redaktion hatten sie immer nur vom Mo-Mo gesprochen. Momo, wie bei Michael Ende.
Wenn es Derendinger darum gegangen war, warum hatte er dann nicht direkt …? Altersverwirrung? Oder hatte er einen Grund gehabt, um die Sache herumzureden? Tarnung? Hatte er von einer Schachpartie geredet, weil das in dieser Umgebung am wenigsten auffiel? Aber warum hätte Derendinger sich tarnen sollen? Wovor hätte er Angst haben sollen? Vor wem?
«Hundert Fragen bringen dich nicht weiter», alte Journalistenregel. «Eine einzige Antwort schon.»
Der Reihe nach also. Wenn Derendinger wirklich den Morosani-Mord gemeint haben sollte, wenn man das einfach mal als Hypothese annahm, an was von der Geschichte erinnerte er sich noch?
Werner Morosani selber, natürlich. Gründungspräsident der Eidgenössischen Demokraten, Nationalrat und erfolgreicher Geschäftsmann. Rohstoffhandel. Konnte es sich leisten, an einer der teuersten Adressen des Landes zu wohnen, eine dieser Goldküste-Straßen, die auf den ersten Blick ganz unauffällig aussahen, kleinbürgerlich geradezu, aber nur, weil die Residenzen, die sie säumten, ihr die bescheidenen Seitenflügel zuwendeten, das prächtige Hauptgebäude und der Park diskret hinter Hecken verborgen. Wer in der Schweiz zeigt, was er besitzt, der ist nicht wirklich reich. Morosani hatte noch spät in der Nacht seinen Hund ausgeführt, einen Dalmatiner, seltsam, dass man sich an so ein Detail noch erinnerte nach all den Jahren. Nicht weit weg von seinem Haus hatte ihn ein Schuss getroffen, nur einer, direkt in die Brust, und Morosani war sofort tot gewesen. Es hatte nicht gleich jemand reagiert, seine Nachbarn hielten den Knall wohl für eine Fehlzündung, und nur, weil da ein Hund bellte und mit Bellen nicht mehr aufhörte, war schließlich jemand aus seinem Haus gekommen, wollte sich über die Nachtruhestörung beschweren und hatte dann Morosanis Leiche auf dem Trottoir liegen sehen, die Leiche und den Hund, der über dem Toten stand – über, nicht neben, auch so ein Detail, das sich eingeprägt hatte. Die Geschichte war auch oft genug erzählt worden, in den Zeitungen, am Fernsehen und dann hinterher in der Wahlpropaganda. Weilemann erinnerte sich noch gut an das Plakat mit der Blutlache, kein originales Foto vom Tatort natürlich, ein nachgestelltes, aber seine Wirkung hatte es trotzdem getan. Und wie es seine Wirkung getan hatte.
Der Täter war ein Eritreer gewesen, ein Asylbewerber mit abgelehntem Antrag, zu Recht abgelehnt, wie sich später herausstellte, ein reiner Wirtschaftsflüchtling, in seiner Heimat überhaupt nicht persönlich bedroht. Die Ausschaffung war bereits angeordnet gewesen, und dort vermutete man auch das Motiv: Rache an den Eidgenössischen Demokraten, die sich immer für eine härtere Flüchtlingspolitik eingesetzt hatten. Dass es ausgerechnet Morosani getroffen hatte, war schon fast wieder ironisch, denn der war damals innerhalb seiner Partei wegen einer zu liberalen Haltung in der Ausländerfrage kritisiert worden, es hatte sogar Gerüchte über einen Aufstand gegen ihn am nächsten Parteitag gegeben. Wie hatte dieser Eritreer schon wieder geheißen? Weilemann brachte den Namen nicht zusammen, er wusste nur noch, dass der Vorname eine Bedeutung gehabt hatte, so wie Felix «der Glückliche» hieß und er selber, Kurt, «der Kühne».
Die Polizei war mit einem Großaufgebot zur Stelle gewesen, nicht so wie gestern bei Derendinger. Auch wenn die Eidgenössischen Demokraten damals noch nicht dieselbe Bedeutung hatten wie heute, Morosani war ein wichtiger Mann gewesen. Der Täter hatte zu Fuß zu fliehen versucht, und als man ihn stellte, hatte er das Feuer auf die Beamten eröffnet und war von ihnen erschossen worden. Deshalb hatte es auch nie einen Prozess gegeben, aber die Fakten waren klar, in der Tasche des Toten fand sich die Mordwaffe. Ein anderer Asylbewerber sagte zwar später aus, der Täter habe ihm erzählt, er sei von einem Unbekannten nach Zollikon bestellt worden, er wisse nicht, zu welchem Zweck. Vielleicht gehe es um Hilfe mit seinem Asylantrag, aber die Geschichte glaubte natürlich niemand, zu eindeutig war die definitive Ablehnung des Antrags und die Anordnung zur Ausschaffung. «Ein amtsbekannter Täter» hatten die ED das genannt, ein werbetechnisch gutgewähltes Wort, weil es einerseits nicht falsch war, und andererseits suggerierte, der Täter habe ein langes Strafregister und sei schon immer kriminell gewesen. Wie hatte er bloß geheißen, dieser Eritreer?
In irgendeiner alluvialen Schicht auf seinem Schreibtisch würde sich bestimmt ein alter Artikel zu dem Thema finden, aber wenn man eilig eine Antwort brauchte, war das Internet eben doch besser.
Bisrat Habesha hatte er geheißen.
Weilemann war unterdessen längst aufgestanden, hatte sich von dem Mechanismus aus dem Bett kippen lassen und saß jetzt im Pyjama am Schreibtisch.
Bisrat Habesha. In dem Moment, in dem er den Namen auf dem Bildschirm vor sich gesehen hatte, war die Erinnerung wieder voll da gewesen, die ED hatten ihn ja damals auch genügend in die Welt hinaustrompetet, auf jedem Plakat und in jedem Inserat. Bisrat hieß «Gute Nachricht», noch so eine Ironie, denn in der Wahlwerbung hatten sie ihn als Symbol für alles Böse verwendet, das der Schweiz von unerwünschten Einwanderern drohte, von Leuten, die nicht daran dachten, sich an unsere Gesetze zu halten und vor Mord und Totschlag nicht zurückschreckten. Morosanis Abdankung im überfüllten Großmünster war eine Demonstration zu diesem Thema geworden, mehr Parteiveranstaltung als Trauerfeier. Auch davon spuckte der Computer jede Menge Bilder aus, die Kränze aus roten und weißen Blumen, und der Sarg mit der Schweizerfahne bedeckt. Wille hatte damals die Hauptrede gehalten, eine sehr emotionale Rede, die er nur mühsam zu Ende brachte, weil ihm immer wieder die Tränen kamen. Damals war Wille noch ein aufstrebender Politiker gewesen, ein Zögling von Morosani, und jetzt lag er schwerkrank im Uni-Spital und wurde von Maschinen am Leben erhalten.
Ein unangenehmer Gedanke, dass Wille genau gleich alt war wie Weilemann selber.
Die Eidgenössischen Demokraten hatten dann die Wahlen gewonnen, nicht nur wegen dem Morosani-Mord, aber auch. Es war also nicht nur einfach ein Kriminalfall gewesen, sondern mehr, viel mehr, man konnte sagen: Es war der Moment gewesen, wo in der Schweiz die Stimmung endgültig gekippt war. Und Wille war dann sehr bald Parteipräsident geworden, später auch auf Lebenszeit. «Der Wille des Volkes». Den Spruch hatten sie nicht einmal verbreiten müssen, so selbstverständlich war er gewesen.
Wenn Derendinger diese alte Geschichte gemeint hatte – und er konnte nichts anderes gemeint haben, nicht mit «Zollikon» und «Alte Landstraße» und «Es stand in allen Zeitungen» –, wenn es ihm wirklich um den Morosani-Mord gegangen war, dann war das vielleicht die große Geschichte, von der er bei dem Seniorentreffen gesprochen hatte. Damals hatte ihm niemand so recht geglaubt, aber möglich war alles, vielleicht hatte Derendinger ja, trotz allem, was darüber schon publiziert worden war, doch noch ein neues Detail entdeckt, über das Vorleben von diesem Habesha vielleicht, oder …
Oder er war einfach senil. Weilemanns Suche im Internet hatte ergeben, dass Derendinger seinen ersten Journalistenpreis für die Berichterstattung über genau diesen Fall bekommen hatte, da war es gut möglich, dass er sich in seinem verwirrten Altherrenkopf in diese Zeit zurückversetzt hatte, dass er davon träumte, noch einmal als rasender Reporter den ganz großen Coup zu landen, sich eine Heldengeschichte einbildete, in denen er selber die Hauptrolle spielte. Das würde auch das Affentheater erklären, das er gestern aufgeführt hatte, mit Sich-auf-dem-Lindenhof-Treffen und so tun, als ob er plötzlich zum Schachpapst geworden wäre, die ganze Geheimnistuerei. In den Spionagethrillern, wo sich die Geheimagenten immer an irgendwelchen absurden Sätzen erkannten, gaben sie solche Orakelsprüche von sich, «Schwarz war matt, noch vor dem ersten Zug von Weiß», was ja nun wirklich keinen Sinn machte.
Was keinen Sinn ergab. Wenn man «machte»sagte,war der Satz nur eine schlampige Übernahme des englischen «making sense». Die automatische Korrektorenstimme in seinem Hirn würde sich wohl noch auf dem Sterbebett nicht abstellen lassen. «Der letzte Atemzug» ist nur ein Klischee, das würde er noch in dem Moment denken, wo er ihn schon machte.
Aber egal, wie man es formulierte: Es war logischer anzunehmen, dass es der böse Alois gewesen war, der aus Derendinger gesprochen hatte. Ockhams Rasiermesser: die einfache Hypothese nehmen und nicht die komplizierte. Derendinger musste sich an seinen alten Journalistentriumph erinnert und den Rest dazuspintisiert haben. Vor allem weil er von einem Läuchli geredet hatte, der irgendeine wichtige Rolle gespielt haben sollte, und dieser Name kam im Zusammenhang mit dem Morosani-Mord nirgends vor, absolut nirgends, und dabei hätte ihn Google ganz bestimmt gefunden, selbst wenn er nur der Tierarzt von Morosanis Dalmatiner gewesen wäre. Läuchli AND Morosani ergab nicht einen einzigen Treffer.
Nein, es hatte keinen Zweck, dass sich Weilemann wegen der Spinnereien eines dementen alten Mannes die Nacht um die Ohren schlug, auch nicht, wenn der einen Unfall gehabt hatte und jetzt tot war; außer einer Erkältung würde nichts dabei herauskommen. Er ging besser wieder ins Bett, obwohl er, das wusste er aus Erfahrung, noch stundenlang wach liegen würde; der Kopf ließ sich nicht so einfach auf Standby schalten wie ein Computer. Ob ihm wohl ein weiteres Gläschen von dem Thurgauer Calvados beim Einschlafen helfen würde? Besser nicht, er hatte schon jetzt einen ganz trockenen Mund.