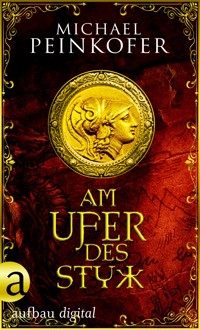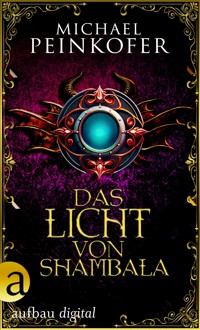6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Er ist El-Rih, der Wind. Als türkischer Janitschar kämpft er auf Seiten der Muslime.
Sie ist Alyssia, eine venezianische Christin, die einer Intrige zum Opfer fällt und in Kairo zur Sklavin wird. Ihr Name: Haqiqa, die Wahrheit.
Das Schicksal sorgt dafür, dass ihre Wege zueinander führen - doch welche Chance hat ihre Liebe in einer Zeit, in der dunkle Mächte einen neuen Krieg zwischen Christentum und Islam heraufbeschwören und die Reliquien eines Heiligen zum Zündstein eines mörderischen Konflikts werden? Die Entscheidung fällt in Alexandria ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 568
Ähnliche
Inhalt
ÜBER DAS BUCH
Er ist El-Rih, der Wind. Als türkischer Janitschar kämpft er auf Seiten der Muslime. Sie ist Alyssia, eine venezianische Christin, die einer Intrige zum Opfer fällt und in Kairo zur Sklavin wird. Ihr Name: Haqiqa, die Wahrheit. Das Schicksal sorgt dafür, dass ihre Wege zueinander führen – doch welche Chance hat ihre Liebe in einer Zeit, in der dunkle Mächte einen neuen Krieg zwischen Christentum und Islam heraufbeschwören und die Reliquien eines Heiligen zum Zündstein eines mörderischen Konflikts werden? Die Entscheidung fällt in Alexandria ...
ÜBER DEN AUTOR
Michael Peinkofer, Jahrgang 1969, studierte in München Germanistik, Geschichte und Kommunikationswissenschaft. Seit 1995 arbeitet er als freier Autor, Filmjournalist und Übersetzer. Unter diversen Pseudonymen hat er bereits zahlreiche Romane verschiedener Genres verfasst. Bekannt wurde er durch den Bestseller »Die Bruderschaft der Runen« und der Abenteuerreihe um Sarah Kincaid, deren abschließender vierter Band mit »Das Licht von Shambala« vorliegt. Michael Peinkofer lebt mit seiner Familie im Allgäu.
MICHAELPEINKOFER
Der Windunddie Wahrheit
HISTORISCHER ROMAN
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Originalausgabe
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Autoren-und Verlagsagentur Peter Molden, Köln
Copyright © 2016 by Michael Peinkofer
Originalausgabe 2016 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Stefan Bauer
Zeichnungen Innenteil: Daniel Ernle, dec3GmbH & Co. KG, Berkheim
Kartenzeichnungen: Helmut W. Pesch, Köln
Umschlaggestaltung: Johannes Wiebel,
Einband-/Umschlagmotiv: Johannes Wiebel | punchdesign, München
unter Verwendung von Motiven von© Shutterstock.com/Yuganov Konstantin; Shutterstock.com/Slava Gerj;
Shutterstock.com/Viorel Sima; Shutterstock.com/Rawpixel;Shutterstock.com/Alena Serdiukova
E-Book-Produktion: Dörlemann Satz, Lemförde
ISBN 978-3-732-52354-2
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
HANDELNDE PERSONEN(in alphabetischer Reihenfolge)
Alessandro Bertrano
Kaufmannssohn aus Venedig
Alyssia Bertrano
Kaufmannstochter aus Venedig
Battista Sabattini
Staatsinquisitor von Venedig
Bianca Sabattini
seine Tochter
Bruder Anselmo
Mönch des Dominikanerordens
Bruder Remigio
Mönch des Dominikanerordens
Burkas
ein stummer Grieche
Canzarro
ein Sklavenjäger
Carlo Varesi
venezianischer Patrizier
Cicero
ein Pirat
Dario Berlotti
Offizier der Stadtwache von Venedig
El-Rih
Krieger der Janitscharengarde
Enzo Gepardi
Kapitän eines Handelsseglers
Gangara
Statthalter von Alexandria
Giovanni
Hausdiener Bertranos
Giulia Marinara
Schneidersfrau aus Venedig
Jost van Geldern
deutscher Kaufmann
Kerim Bey
Sklavenhändler aus Cairo
Leonardo Bertrano
venezianischer Kaufmann
Lorenzo Celsi
Doge von Venedig
Luro del Rosso
Staatskämmerer von Venedig
Mancano
Piratenkapitän
Mario Capello
Buchhalter Bertranos
Markad al-Khassar
Berater Yalbughas
Omar ben Adil
Abgesandter des osmanischen Sultans
Pater Umberto
Mönch des Dominikanerordens
Peter I. von Lusignan
König von Zypern
Pietro Marcesi
venezianischer Patrizier
Raffaela Bertrano
Gemahlin Bertranos
Raymond de Berenger
Großmeister des Hospaliterordens
Sabina
eine Sklavin
Shaban al-Ashraf
junger Sultan der Mamluken
Stilicho
Diener Sabattinis, ein Byzantiner
Xavir
Hauptmann der Janitscharen
Yalbugha al-Khassaki
Emir von Cairo, Regent der Mamluken
Yussuf
Krieger der Janitscharengarde
PROLOG
AlexandriaIm Jahr des Herrn 829
Es war erst später Nachmittag, aber das Unwetter, das über der Stadt tobte, hatte den Himmel verfinstert.
Wind peitschte die See, sodass sich selbst die geschützten Häfen der Stadt in tosende Pfuhle verwandelten und die Kapitäne der Segler, die dort dicht an dicht vor Anker lagen, um ihre Schiffe fürchteten. Gleichzeitig stürzten Wassermassen herab, als hätte der Allmächtige beschlossen, eine zweite Sintflut über die Welt hereinbrechen zu lassen. Die Häuser der Stadt waren hinter Schleiern aus Regen und Dunkelheit verschwunden, ebenso wie die Kuppeln und Türme der Moscheen. Die Straßen, die am Tage vor Menschen überquollen, vor Pilgern, Händlern, Soldaten, Seeleuten, Dieben und noch vielen mehr, waren jetzt leer, und selbst die Bettler, die sonst die Gassen bevölkerten und eigentlich kein Obdach hatten, hatten sich in Nischen und Verschläge geflüchtet.
Nur ein einzelner Wagen quälte sich die Straße zum Osttor hinab, widersetzte sich tapfer dem Regen und dem Wind – und dafür gab es einen Grund.
Dieser Grund war eine unscheinbare hölzerne und mit Wachs versiegelte Kiste, die auf der Pritsche des Wagens lag und deren Inhalt von solcher Wichtigkeit war, dass die beiden Kaufleute, die den Wagen schoben, alles dafür riskierten.
Würden sie entdeckt, so würde die Strafe, die sie erwartete, schlimmer sein als der Tod. Beiden war dies klar gewesen, und dennoch hatten sie sich freiwillig für diese Mission gemeldet, die sie tief ins Land des Feindes führte, ins Reich der Gottlosen.
Lange hatte der Inhalt des Schreins in Alexandria geruht. Doch nun, da sein Erhalt bedroht war, da die Machthaber der Stadt damit begonnen hatten, christliche Kirchen einzureißen und daraus Moscheen für ihren heidnischen Gott und prunkvolle Paläste für sich selbst zu errichten, war die Zeit gekommen, das kostbare Artefakt an einen anderen Ort zu bringen, weit fort, auf die andere Seite des großen Meeres, das die eine Welt von der anderen trennte.
Bonus war der Name des einen Mannes, Rustico der des anderen. Weder waren es ihre richtigen Namen, noch gingen sie in Wahrheit dem Beruf des Kaufmanns nach. Es gehörte zur List, war Teil des Plans, den andere geschmiedet hatten. Bonus und Rustico waren lediglich die Arme, die die Tat vollführten, die Vollstrecker eines Urteils, das andernorts gefällt worden war. Der Gedanke, einen Diebstahl zu begehen, lag ihnen fern; vielmehr waren sie überzeugt, heimzuholen, was lange Zeit verloren gewesen war.
Als sich die Umrisse des Stadttores aus den Regenschleiern schälten, wechselten die beiden Männer unruhige Blicke. Die nächsten Momente würden entscheiden.
Über ihr Leben oder ihren Tod.
Und über das Wohl einer ganzen Stadt …
Der Regen ließ ein wenig nach, als der Karren das Tor erreichte. Der diensthabende Hauptmann, ein gepanzerter Krieger, der eine lederne, von einer Straußenfeder gekrönte Kappe über seinem Helm trug, schien wenig gewillt, der beiden Händler wegen in den Regen zu treten. Mit Gesten bedeutete er ihnen, unter den Torbogen zu kommen.
Bonus und Rustico wechselten noch einen Blick, dann leisteten sie der Aufforderung Folge. Indem der eine die Deichsel führte und der andere von hinten schob, bugsierten sie den Karren unter den Bogen, der sich in orientalischer Manier über ihnen wölbte. Der Hauptmann trat heran, in Begleitung zweier Posten, die nicht weniger schwer gepanzert waren als er selbst. Die Spitzen ihrer federgeschmückten Speere waren auf die Händler gerichtet, bereit, jeden Augenblick zuzustoßen.
»Wer seid ihr, und was wollt ihr?«, fragte der Hauptmann. Seine dunklen Augen musterten die Händler mit unverhohlenem Vorwurf. »Und was, beim Bart des Kalifen, habt ihr bei diesem Wetter draußen zu suchen?«
»Ihr könnt mir glauben, dass wir lieber zu Hause wären, Herr«, versicherte Bonus, der nicht zuletzt deshalb ausgewählt worden war, weil er die Zunge der Muselmanen fließend beherrschte, »doch unser Auftrag duldet keinen Aufschub.«
»Ach ja? Und was für ein Auftrag soll das sein?«
»Wir haben Weisung, die Ladung dieses Karrens aus der Stadt zu bringen«, erklärte Bonus frei heraus – und das war noch nicht einmal die Unwahrheit.
»Ungläubiger«, stieß der Offizier spöttisch hervor, »hältst du mich für so dumm? Was habt ihr gestohlen, dass ihr euch nun bei diesem Wetter aus der Stadt schleichen wollt?«
»Nichts, Herr«, versicherte Bonus, und sowohl er als auch sein bis auf die Knochen durchnässter Begleiter verneigten sich tief. »Wir bitten Euch nur, uns passieren zu lassen, damit wir entfernen können, was Eure Sinne und Euren Glauben beleidigt.«
»Was redest du da?« Mit einer unwirschen Bewegung bedeutete der Hauptmann seinen Leuten, den Karren zu durchsuchen. Während der eine die Händler in Schach hielt, nahm der andere den Speer, stach damit in die Plane aus durchnässtem Stoff, die über die Ladung gebreitet war, öffnete sie – und fuhr entsetzt zurück.
Der Hauptmann beugte sich vor, um ebenfalls einen Blick auf die Pritsche zu erheischen – und brach in eine wüste Verwünschung aus. »Sohn einer Hündin«, fuhr er Bonus an, »willst du uns beleidigen?«
»Nein, Herr«, versicherte Bonus. »Mein Begleiter und ich bitten Euch demütigst, uns passieren zu lassen, damit wir all das rasch aus Euren Augen schaffen können.«
»Und aus unseren Nasen«, fügte der Offizier hinzu, der die linke Hand vors Gesicht geschlagen hatte und nur noch stoßweise atmete. Mit der anderen Hand bedeutete er seinen Leuten, die Kaufleute durchzulassen. »Macht, dass ihr fortkommt, ihr schmutzigen Ungläubigen, ehe ich mich vergesse und eure fauligen Kadaver zu dem anderen Unrat werfe! Lasst euch hier ja nie wieder blicken, verstanden?«
»Verstanden, Herr«, versicherte Bonus und verbeugte sich tief, dann setzten sie den Wagen wieder in Bewegung. Quietschend wälzten sie die Räder unter dem Torbogen hindurch. Dass der strömende Regen sie schon im nächsten Moment wieder erfasste, war den falschen Kaufleuten gleichgültig.
Die Mission war geglückt.
Der Schrein hatte die Stadt der Muselmanen verlassen – unter einem Berg von altem Schweinefleisch.
Östliche Ägäis im Frühjahr 1344515 Jahre später
Unerwartet war es aufgetaucht.
Das Schiff mit dem charakteristischen Lateinsegel, das unter christlichen Seefahrern so gefürchtet war wie die dreieckige Flosse eines Haifischs bei Schiffbrüchigen. Und wie ein Hai hatte es zu seiner Beute aufgeschlossen und war nun kurz davor, sie zu verschlingen.
Der Besatzung der Handelsgaleere blieb keine Zeit, die Segel zu reffen. Die Brandpfeile, die vom Schiff der Piraten herüberflogen, setzten die Segel in Brand. Auf der Galeere brach Panik aus. Zwar versuchte Kapitän Gepardi, ein gebürtiger Genueser, der für byzantinische Kaufleute segelte, die Verteidigung seines Schiffes zu organisieren. Doch die Matrosen und Ruderer, die an Bord der Galeere ihren Dienst versahen, waren zu sehr damit beschäftigt, sich vor brennenden Stücken Stoff und Tau in Sicherheit zu bringen, die aus der Takelage herabfielen, als dass an Gegenwehr zu denken gewesen wäre.
Die Bogenschützen, die die Galeere begleiteten, gaben immerhin einige Pfeile ab, doch sie genügten nicht, um den Piratensegler auf Distanz zu halten, dessen hochgezogene Bordwände die Besatzung zuverlässig schützten. Unaufhaltsam kam das feindliche Schiff näher. Es gab keine Warnung oder Aufforderung, die Ladung herauszugeben oder ein Lösegeld zu begleichen. Diese Seeräuber waren ganz offenbar nicht nur auf Beute aus, sondern auch auf die Leben derer, die an Bord der Galeere fuhren …
»Haltet stand!«, schärfte Gepardi seinen Leuten ein, die inmitten von Rauch und kleinen Bränden an der Backbordseite Aufstellung genommen hatten, mit leichten Schilden und langen Messern bewehrt, wie sie auf See üblich waren. »Keiner dieser Halunken kommt an Bord dieses Schiffes, habt ihr verstanden?«
Die Seeleute nickten, doch die Furcht, die in ihren Gesichtern zu lesen stand, sagte etwas anderes. Dann ging das fremde Schiff längsseits. Taue wurden herübergeworfen, Enterhaken dazu benutzt, die Galeere heranzuziehen – und schon im nächsten Augenblick stürzten hinter der hohen Seitenwand des Schiffes bis an die Zähne bewaffnete Krieger hervor, die weite Kleider und Turbane trugen und deren Klingen nach arabischer Art gekrümmt waren.
»Haltet stand!«, schrie Gepardi noch einmal.
Es war das Letzte, was er sagte, denn ein Pfeil traf ihn in den Hals und erstickte seine Befehle in einem Blutschwall. Ein hünenhafter Araber, um dessen ungeheuren Leib eine rote Schärpe gebunden war, kam als Erster an Bord der Galeere. Sein erster Schwertstreich galt Gepardi, den er mit einem einzigen Hieb fällte, sodann fielen er und seine Spießgesellen über die Besatzung des Schiffes her, und ein wildes Handgemenge entbrannte.
Was genau weiter auf Deck geschah, konnte Leonardo Bertrano nicht mehr erkennen, denn ein zu Tode verwundeter Seemann sank genau vor dem Schlitz nieder, durch den Bertrano gespäht hatte – und so blieb den unter Deck Eingeschlossenen nur noch, den grässlichen Lauten zu lauschen, die von oben herabdrangen.
Dem Poltern der Schritte.
Dem Klirren der Waffen.
Den Schreien der Verwundeten.
Gehetzt blickte sich Bertrano im Halbdunkel der Kajüte um. Chiara, sein geliebtes Weib, drängte sich in eine Ecke des schmalen Raums, die kleine Alyssia im Arm; ihr gegenüber kauerten sein Freund und Partner Battista Sabattini und seine Gemahlin Allegra; auch sie hatten ihre Tochter bei sich, die auf den Namen Bianca hörte, und anders als die kleine Alyssia schien sie mit ihren fünf Jahren genau zu wissen, was vor sich ging. Die Furcht in ihren blassen, scharf geschnittenen Zügen spiegelte exakt das wider, was auch in den Gesichtern der Erwachsenen stand.
Nackte, panische Angst …
Zwar hielt Bertrano einen Dolch in den Händen, doch die Sicherheit, die ihm der Stahl gab, war sehr begrenzt. Sein Leben lang war er darauf stolz gewesen, kein Soldat zu sein, sondern Kaufmann, seinen Lebensunterhalt nicht damit zu verdingen, zu töten und zu zerstören, sondern zu verhandeln und friedliche Beziehungen zu knüpfen. In diesen bangen Augenblicken bereute er es zum ersten Mal.
Auch Sabattini hatte sein Schwert gezogen, und Bertrano fiel ein, dass er noch nicht einmal wusste, ob sein Kompagnon damit umzugehen verstand. Um die Geschäfte zu tätigen, denen sie gemeinsam in Konstantinopel nachgegangen waren und die sie beide wohlhabend gemacht hatten, war es nicht nötig gewesen. Doch nun, auf der Heimreise, schienen sie sich ihrer Haut erwehren zu müssen …
»Ich will nicht, dass sie mich lebend bekommen, Leonardo, hörst du?«, wandte Chiara sich ihrem Mann zu. Auch aus ihren Augen sprach Furcht, die jedoch von einer seltsamen Gelassenheit geprägt war. »Ich liebe dich.«
»Und ich liebe …«, wollte Bertrano erwidern – doch weiter kam er nicht. Etwas schlug von außen gegen die Tür der Kajüte, dass sie fast aus den Angeln fiel.
Die beiden Frauen schrien, die Kinder begannen zu weinen. Sabattini trat vor, stellte sich schützend vor seine Familie – und schon im nächsten Moment flog die Tür auf.
Gleich mehrere Muselmanen drängten herein, die sonnengebräunten Gesichter blutbesudelt, und Sabattini stieß zu. Seine Klinge fuhr in die Schulter eines der Männer und streckte ihn nieder, doch schon im nächsten Moment hatten sie ihn entwaffnet und zerrten ihn hinaus, ebenso wie seine Frau und Tochter. Bertrano zögerte noch, was er tun sollte, als seine Gemahlin nach dem Dolch fasste, den er in der Hand hielt, und ihm die Waffe entrang.
Für einen winzigen Augenblick begegneten sich ihre Blicke – dann stieß sie sich den Stahl in die Brust.
»Nein!«, schrie Bertrano und wollte zu ihr, aber die Piraten packten ihn und schleppten ihn ebenfalls nach draußen, zusammen mit Alyssia, seiner Tochter. Das Letzte, was das Kind von seiner Mutter erblickte, war eine auf dem Boden zusammengesunkene Gestalt, die ihr zum Abschied noch ein Lächeln schickte.
Dann ging es nach oben.
Über die Stufen des Niedergangs wurden sie hinaus ans Tageslicht gezerrt, zurück auf Deck, wo der Kampf zu Ende war und der Tod reiche Ernte gehalten hatte. Das Deck war von schwelenden Bränden übersät, die Planken hatten sich rot verfärbt. Die meisten der Piraten waren damit beschäftigt, den Laderaum des Handelsseglers zu leeren und das Beutegut auf das shalandiyat zu bringen. Andere waren dabei, tote und verwundete Seeleute kurzerhand über Bord zu werfen, auf dass sie den Haien als Nahrung dienten. Und inmitten des Schreckensbildes stand der hünenhafte Araber mit der roten Schärpe, der der Kapitän der Piraten zu sein schien. In barschen Worten wies er seine Leute an, die Gefangenen in einer Reihe aufzustellen, damit er sie inspizieren könne.
Bertrano war nur zu klar, welchem Zweck diese Inspektion diente; auf den Märkten von Beirut, Tyros und Alexandria waren christliche Sklaven eine begehrte Ware, besonders dann, wenn es sich um Frauen handelte. So verzweifelt Bertrano über Chiaras Tod war – dieser Weg würde ihr erspart bleiben.
Alyssia an sich pressend, die er auf den Armen trug, sah er zu, wie der Piratenkapitän die Spreu vom Weizen trennte. Gefangene, die ihm als zu schwächlich oder wenig gewinnversprechend erschienen, weil sie verwundet oder in seinen Augen zu schmächtig waren, ließ er kurzerhand über Bord werfen. Wen er für würdig befand, auf dem Sklavenmarkt feilgeboten zu werden, ließ er unter Peitschenhieben an Bord seines Schiffes bringen.
Als Nächstes war die Reihe an Sabattini und seiner Gemahlin. Allegra Sabattini hatte den Arm schützend um ihre Tochter Bianca gelegt. Mit ihrem glänzend schwarzen Haar und ihren ebenmäßigen Zügen war sie von berückender Schönheit, selbst jetzt in diesem Augenblick – und natürlich fand sie Gefallen in den Augen des Piraten. Mit einem Nicken bedeutete er seinen Leuten, sie mitzunehmen, doch Sabattini ging dazwischen. »Nein!«, brüllte er und sprang vor. »Du elender Heide wirst sie nicht …!«
Der Kapitän brachte ihn mit einem Schwerthieb zum Schweigen, der schräg über sein Gesicht verlief und seine Nase teilte. Blutüberströmt sank Sabattini nieder, zum Entsetzen seiner Frau, die ihr Kind losließ und sich neben ihn kauerte. Doch die Seeräuber ergriffen sie sofort und zerrten sie mitleidlos auf das andere Schiff.
»Allegra!«, schrie Sabattini verzweifelt und streckte seine blutige Rechte nach ihr aus, doch sein Flehen verhallte ungehört, seine Gemahlin kehrte nicht zurück.
Die Auslese ging weiter.
Der Hüne trat vor Bertrano und musterte zuerst ihn und dann seine Tochter. Als der Pirat jedoch in Alyssias Augen blickte, geschah etwas Seltsames: Er prallte zurück, und ein Anflug von Entsetzen zeigte sich auf seinen grausamen, blutbesudelten Zügen. Einen endlos scheinenden Moment lang starrte er das Mädchen an. Dann entfuhr ihm ein heiserer Befehl, und ohne Zögern machte er kehrt und befahl seinen Leuten, das Schiff augenblicklich zu verlassen. Furcht war plötzlich in den Gesichtern der Seeräuber zu lesen, und so bestiegen sie ihr shalandiyat, setzten Segel und fuhren davon, so rasch, wie sie aufgetaucht waren.
Von Entsetzen gezeichnet starrte Bertrano ihnen nach – und entdeckte ein Segel am Horizont.
Es gehörte zu einer venezianischen Galeere, die wenig später beidrehte und die Überlebenden des Überfalls an Bord nahm, für die es immer ein Rätsel blieb, was sie an jenem schicksalhaften Tag gerettet hatte.
Die Segel einer Kriegsgaleere am fernen Horizont? Oder die Augen eines kleinen Mädchens, die verschiedene Farben hatten.
Erstes Buch:
1
San Polo, Venedig31. März 1362
Geschäftiges Treiben herrschte auf dem Rialto, dem großen Markt von Venedig. Waren aus aller Welt wurden hier angeboten, warteten darauf, in großen Mengen eingekauft, umgelagert und dann weiter verschifft zu werden: französische Wolle, Tuche aus England, Felle und Leder aus dem Reich der Russen, Hornwaren und Filze aus deutschen Landen, Käse und getrockneter Fisch aus Griechenland und dem Süden Italiens; aber auch Gewürze aus dem fernen Indien, Mandeln und Rosinen aus dem Orient sowie Seide aus dem fernen China – all dies stapelte sich in den Kontoren und Magazinen, deren Säulenhallen sich auf dem Rialto reihten und bald zu engen Gassen drängten, bald weite Plätze umgaben. Hier drängten sich die Menschen: Händler und Unterhändler, Kaufleute und Agenten, Diener und Träger, aber auch Beamte der Stadt, die dafür Sorge trugen, dass die Republik Venedig an jedem Geschäft mitverdiente; selbst in dem schwirrenden, pulsierenden und in allen Sprachen parlierenden Durcheinander, das auf dem Rialto herrschte und das an das hektische Treiben in einem Bienenstock erinnerte, hatte alles seine Ordnung.
Es waren die Gesetze des Gewinns, die das Leben in Venedig regelten, der unabänderliche Wechsel von Kaufen und Verkaufen. Von ihm wurde alles bestimmt, in seinem Rhythmus atmete die Stadt. Wer vom Scheitel der hölzernen Brücke aus, die sich in einem weiten Bogen über den Canal Grande spannte, auf das rege Treiben des Rialto blickte, auf die unzähligen Koggen und Barken, die an den Kais entladen wurden, und auf die Häuser der Kaufleute, die sich stolz und erhaben entlang des Kanals reihten, der wäre wohl nicht auf den Gedanken gekommen, dass etwas die Blüte und den Wohlstand der Stadt bedrohen könnte – und doch war es so, wie Leonardo Bertrano aus leidvoller Erfahrung wusste.
Als Bertrano an diesem Vormittag seine Schritte über die Brücke lenkte, tat er es mit gemischten Gefühlen. Er war Händler, Kaufmann durch und durch, und es hatte Zeiten gegeben, da hatte er es nicht erwarten können, durch die Säulenhallen des Rialto zu wandeln und ein Geschäft nach dem anderen abzuschließen. Doch es war ein Unterschied, ob man im Bewusstsein dorthin ging, dass die Nachfrage hoch und die Lager reich gefüllt waren, oder ob man dort verkehrte, um Abbitte zu leisten.
»Vater?«
Bertrano war in Gedanken versunken gewesen; jetzt blieb er stehen und wandte sich der jungen Frau an seiner Seite zu. Sie wirkte zierlich, fast zerbrechlich, und ihr Haar war nicht pechschwarz wie das seine, sondern von kastanienbrauner, leicht rötlicher Farbe – ein Erbe ihrer verstorbenen Mutter. Hohe Wangenknochen und eine schmale Nase beherrschten ihre sanften, makellosen Gesichtszüge, ihr Mund war klein, die Lippen rosig. Am sonderbarsten jedoch waren ihre Augen anzusehen, denn so, als hätte sich der Schöpfer nicht für eine Augenfarbe entscheiden können, hatte er ihr gleich zwei mitgegeben: Während das rechte Auge dunkelbraun war, war das andere grün. Meist war es nicht zu sehen, wenn jedoch das Licht in einem bestimmten Winkel einfiel, so wie in diesem Moment, dann glitzerte Alyssias linkes Auge in geheimnisvollem Grün …
»Ja, meine Tochter?« Ihr Anblick erfreute ihn wie immer, sodass ein mildes Lächeln um seine Züge spielte.
»Dein Versprechen«, brachte sie in Erinnerung – und er schlug sich mit der flachen Hand vor den Kopf.
»Natürlich, bitte entschuldige, Liebes … Mario wird dir Geld geben. In dem neuen Kleid wirst du wie eine Prinzessin aussehen, davon bin ich überzeugt.«
»Danke, Vater.« Sie beugte sich vor und küsste ihn auf die Wange. Dann war Mario Capello, Bertranos geschäftiger Buchhalter und Stellvertreter, der ihn wie immer auf den Rialto begleitete, auch schon dabei, seine Börse zu öffnen. Alyssia nahm das Geld und bedankte sich dafür mit einem Lächeln. Dann wandten sich sie und ihr Diener, der sie außerhalb des Hauses stets begleitete, ab und verschwanden in der wogenden Menge.
»Sie ähnelt ihrer Mutter auf manche Weise«, meinte Bertrano, während er ihnen nachsah. »Auch sie liebte alles Schöne.«
»Aber Donna Chiara liebte auch die Wahrheit«, wandte Capello ein. »Ihr solltet ehrlich sein und es Eurer Tochter sagen, Herr. Ich bin sicher, sie würde es verstehen.«
»Das würde sie. Aber noch ist es nicht so weit, mein Freund. Schließlich sind wir nicht ohne Grund hierhergekommen.«
»Und Ihr seid sicher, dass Ihr das tun wollt?«
Capello war ein kleinwüchsiger Mann, der Bertrano nur bis zur Schulter reichte; seine scharf geschnittenen Gesichtszüge, das kantige Kinn und die wachsam blickenden Augen legten jedoch nahe, dass er mit Klugheit und Durchsetzungskraft aufwog, was ihm an Körpergröße fehlte. »Zu einer Notlüge zu greifen wäre in einem solchen Fall womöglich die geeignetere Strategie.«
»Und einem langjährigen Geschäftspartner dreist ins Gesicht lügen?« Bertrano verzog das schmale, von einem grauen Bart gesäumte Gesicht. Die dunklen Augen blickten traurig. »Nein, mein Freund. Ich bin in dieser Sache schon viel zu lange unehrlich gewesen, habe die Wahrheit vertuscht und meine Kunden hingehalten. Es war immer klar, dass ich mich früher oder später würde offenbaren müssen – und dieser Zeitpunkt ist jetzt gekommen.«
»Ich ersuche Euch noch einmal zu bedenken, was Ihr tut!« Capello wurde zunehmend unruhiger, je näher sie der anderen Seite der Brücke kamen. »Was ausgesprochen ist, kann nicht wieder zurückgenommen werden! Was, wenn morgen ein Schiff in den Canal Grande einfährt, das Eure Ware bringt? Die Gewürze, die Seide, die …«
»Dann werde ich nach San Marco gehen und dem Schutzheiligen eine fünf Pfund schwere Kerze aus feinstem Bienenwachs stiften«, erwiderte Bertrano ohne Zögern und mit einem freudlosen Lächeln. »Aber wir beide sind lange genug dabei, um zu wissen, dass das nicht geschehen wird.«
Capello widersprach nicht – wie sollte er auch?
Als Bertranos langjähriger Buchhalter kannte er das Auf und Ab der kaufmännischen Profession nur zu gut. Die großen Kontore der nobili konnten Rückschläge wie diese leicht verkraften und Verluste einfach durch Gewinne mit anderen Waren ausgleichen, und in den fraternite, den kaufmännischen Bruderschaften, konnten jederzeit die Familienmitglieder bei Engpässen aushelfen. Bertrano jedoch gehörte zu keiner der beiden Gruppen. Er betrieb nur ein kleines Kontor und war ganz allein. Er war ein cittadino – ein Bürger, der die Erlaubnis zum Handel erhalten hatte und dem es gelungen war, sich mit viel Fleiß und Geschick ein Vermögen zu erwerben. Doch in schlechten Zeiten konnte dieses Vermögen ebenso rasch wieder verloren gehen.
Sie erreichten die andere Seite der Brücke und tauchten in das Durcheinander aus Stimmen, Hautfarben und exotischen Gerüchen ein. Eine Barke mit russischen Sklaven wurde soeben am Pier entladen. Bertrano schüttelte sich innerlich bei dem Gedanken, mit Menschen zu handeln wie mit Salz oder Baumwolle. Obwohl viele Kaufleute – und nicht zuletzt die nobili, deren Paläste sich am Canal Grande reihten – durch Menschenhandel zu immensem Reichtum gelangt waren, hatte Bertrano stets seine Finger von dieser Art Geschäft gelassen. Er betrachtete es als widernatürlich und gegen Gottes Gebot verstoßend, wenn Menschen andere Menschen besaßen. Andere Kaufleute hatten weniger Skrupel, und es entbehrte nicht einer gewissen Ironie, dass sie sich dieser Tage keine Sorgen um ihre Existenz machen mussten.
Zielstrebig lenkte Bertrano seine Schritte in Richtung der großen Markthalle. Capello folgte ihm. Der Buchhalter hatte es aufgegeben, seinen Herrn zur Vernunft bringen zu wollen. Er wusste, dass es keinen Sinn hatte, Leonardo von etwas abzubringen, das dieser sich in den Kopf gesetzt hatte. Beharrlichkeit war Bertranos hervorstechendste Eigenschaft; ihr allein hatte er es zu verdanken, dass er in all den Jahren niemals aufgegeben und sich gegen alle Widrigkeiten behauptet hatte. Doch Beharrlichkeit allein würde ihm diesmal nicht weiterhelfen. Was Leonardo Bertrano brauchte, war ein Wunder. Und der Rialto war nachweislich nicht der Ort, an dem sich Wunder ereigneten.
Capello verspürte Übelkeit, als ihm Verwesungsgeruch in die Nase stieg. Instinktiv blickte er nach oben und sah die sterblichen Überreste, die dort von dem behelfsmäßig errichteten Galgen hingen. Immer wieder kam es vor, dass sich ein Dieb auf dem Rialto einschlich, um sich an den Münzen der Geldwechsler zu vergreifen. Wurde er ertappt, so hackte man ihm nicht nur die Hände ab, sondern pflegte ihn aufzuhängen und mehrere Tage lang öffentlich zur Schau zu stellen – was in diesen warmen Frühlingstagen nicht nur für einen schaurigen Anblick, sondern auch für abscheulichen Gestank sorgte.
Vom großen Marktplatz bogen sie in eine schmale Gasse ein, an deren Ende Bertrano das Kontor Jost van Gelderns wusste, eines norddeutschen Kaufmanns, der in Venedig eine Niederlassung unterhielt und mit dem Bertrano seit vielen Jahren in geschäftlicher Beziehung stand. Gewöhnlich wickelte Van Geldern seinen Handel über Gewährsleute ab, diesmal jedoch war er persönlich erschienen. Den Grund dafür kannte Bertrano nur zu gut.
Das Kontor maß keine fünf Schritte im Quadrat: ein kleiner Verkaufsraum, dessen einzige Ausstattung aus einem Tisch bestand sowie aus einer Truhe mit Warenmustern. Die tatsächlichen Bestände lagerten im fondaco dei tedeschi, dem großen Waren- und Wohnhaus auf der anderen Seite des Kanals, in dem alle deutschen Kaufleute unterkommen mussten, wenn sie in Venedig weilten. Die Regierung wollte es so, denn so ließen sich die Geschäfte der Ausländer kontrollieren – und mit ihnen auch die Zölle, die auf Ein- und Ausfuhr erhoben wurden.
»Jost, mein Freund!« Bertrano trat auf den Deutschen zu, dessen dunkelroter Rock sich über einem ziemlichen Wanst spannte. Van Gelderns blasses, von schulterlangem blonden Haar umrahmtes Gesicht war seit ihrer letzten Begegnung ebenfalls voller geworden – die Folge von Wohlstand, zweifellos. Offenbar war ihm das Glück in den letzten Jahren hold gewesen.
Mit ausgebreiteten Armen wollte Bertrano den Geschäftsfreund begrüßen, doch dieser machte keine Anstalten, die Freundlichkeit zu erwidern.
»Bertrano«, sagte er stattdessen nur und nickte. Die Anspannung in seinen Zügen war unübersehbar.
»Es freut mich, dass Euer Weg Euch nach Venedig geführt hat«, behauptete Bertrano. »Hattet Ihr eine gute Reise?«
»Nein«, entgegnete Van Geldern, der fließend Italienisch sprach. »Sie war lang und beschwerlich. Und sie wäre nicht nötig gewesen, wenn Ihr Euch an unsere Vereinbarungen halten würdet!«
»Aber das tue ich«, versicherte Bertrano. »Seid versichert, dass ich …«
Der Deutsche unterbrach ihn mit einem Wortschwall in seiner Muttersprache, die Bertrano zwar nicht verstand; Van Gelderns Gesichtsausdruck nach konnte es sich jedoch nur um eine Verwünschung handeln.
»Was Signore Van Geldern damit sagen will«, brachte sich ein anderer Mann, der bislang schweigend im Hintergrund gewartet hatte, in das Gespräch ein, »ist, dass er auf die Einhaltung der geschlossenen Verträge besteht.«
Es war der sensal, der Van Geldern zur Seite gestellt worden war, einer jener Beamten, die ausländische Kaufleute auf Schritt und Tritt begleiteten. Gewöhnlich bestand ihre Aufgabe darin, den Ausländern auf die Finger zu sehen. Dass einer von ihnen für Van Geldern Partei ergriff, war für Bertrano beschämend.
»Das versteht sich von selbst«, erklärte er und wandte sich wieder an Van Geldern. »Wie lange währt unsere Zusammenarbeit nun schon, mein guter Jost? Acht Jahre?«
»Neun«, gab der Deutsche zu.
»Neun. Und habe ich Euch in all dieser Zeit je betrogen? Habe ich je versucht, Euch zu übervorteilen oder Euch Ware vorzuenthalten?«
»Nein«, musste der Deutsche abermals zugestehen. »Und dennoch frage ich Euch: Wo ist mein Brokat? Wo der Pfeffer, der Ingwer, der Zimt, der Safran, der Muskat und all die anderen Gewürze, die Ihr liefern wolltet? Sie sollten längst bei mir eingetroffen sein!«
»Ich weiß, aber …«
»Und sagt nicht wieder, dass es zu unvorhergesehenen Verzögerungen gekommen sei! Damit mögt ihr meine Mittelsleute abspeisen können, aber nicht mich. Ich verlange eine Erklärung, hier und jetzt!«
»Das verstehe ich«, versicherte Bertrano, der sich in die Ecke gedrängt sah, »und ich versichere Euch, dass es weder meine Absicht war noch ist, Euch hinters Licht zu führen, das verbietet mir meine Ehre als Kaufmann.«
»Schön«, knurrte Van Geldern. »Und wo ist dann meine Ware? Teile der Lieferung hätten bereits im Herbst eintreffen sollen, wenn Ihr Euch erinnert. Die Stürme haben im vergangenen Jahr erst spät eingesetzt, meine Konkurrenten haben ihre Waren längst erhalten.«
»Das alles weiß ich«, versicherte Bertrano, »und es war auch nicht der Winter, der die Lieferung verzögert hat.«
»Was war es dann?«, verlangte der Deutsche zu wissen.
»Die Ägäis ist unsicher geworden«, erklärte Bertrano. »Piraten halten entlang der Küste Ausschau nach Beute, und es werden immer mehr. Allein im Herbst haben sie vier Koggen überfallen, die mit Waren meines Kontors beladen waren. Ich bin vom Pech verfolgt.«
»Waren Eure Waren nicht versichert?«, fragte Van Geldern ungerührt.
»Das waren sie, und natürlich habe ich die Summe sofort wieder investiert. Bedauerlicherweise waren die Preise inzwischen stark gestiegen …«
»Das ist Euer Problem, nicht meines.«
»… jedoch habe ich alle erforderlichen Käufe getätigt und erwarte nun jeden Tag das Eintreffen einer neuen Lieferung, die Konstantinopel bereits vor geraumer Zeit verlassen hat. Sobald sie hier ist, werdet Ihr alles bekommen, mein Freund: die Seide und den Brokat aus Damaskus ebenso wie die Gewürze aus der Levante.«
»Redet mit mir nicht wie ein Verkäufer!«, wehrte der Deutsche ab. »Ich habe bereits gekauft und auch dafür bezahlt. Ihr seid nicht der Einzige, der Verpflichtungen nachkommen muss, Bertrano. Wenn ich nicht liefere, werde ich meinerseits nicht beliefert.«
»Das weiß ich, ebenso wie ich weiß, dass ich bei Euch im Wort stehe. Und ich versichere Euch, dass ich alles tun werde, damit Ihr …«
»Würdet Ihr mich auch ausbezahlen?«
Bertrano spürte den warnenden Blick seines Buchhalters im Nacken. Capello wusste genau, dass Bertrano die Anzahlung, die Van Geldern geleistet hatte, nicht ohne Weiteres würde zurückerstatten können. Nicht ohne die letzten Reserven an Warenbestand zu verkaufen, die in seinem Haus lagerten. Zum großen Teil handelte es sich um Felle, die jetzt im beginnenden Sommer nur einen geringen Preis erzielen würden – ein Verlustgeschäft, das Bertrano womöglich in den Ruin führen würde. Und dennoch fühlte er sich an sein Wort gebunden.
»Wenn es das ist, was Ihr wollt, kann ich Euch auch ausbezahlen«, stimmte er zu.
»Zu den gegenwärtigen Konditionen?«
Bertrano merkte, wie Capello neben ihm zusammenzuckte. Die Preise für Gewürze waren in den letzten Monaten beständig gestiegen, was bedeutete, dass er dem Deutschen eine größere Summe würde ausbezahlen müssen, als dieser ihm gegeben hatte. Dennoch hatte er keine Wahl. Denn wenn sich herumsprach, dass er ein unzuverlässiger Handelspartner war und sein Wort nichts galt, konnte er sein Kontor ebenso gut gleich schließen.
»Auch das«, bestätigte er deshalb gepresst.
Van Geldern sah ihm prüfend ins Gesicht.
Dann streckte er ihm seine fleischige Rechte entgegen.
»Ich schlage Folgendes vor«, sagte der Deutsche. »Bis zum Ende des nächsten Monats werde ich in der Stadt bleiben, so lange gewähre ich Euch eine Schonfrist. Treffen Eure Schiffe bis dahin ein, werde ich meine Ladung in Empfang nehmen und die Sache als erledigt betrachten. Wenn nicht, werdet Ihr mich nach den dann geltenden Kursen ausbezahlen.«
»Einverstanden.« Bertrano ergriff die Hand und drückte sie, froh darüber, eine Einigung erzielt zu haben. Der sensal bestätigte die Abmachung und führte darüber Buch.
»Darf ich die Angelegenheit damit als aus der Welt geschafft betrachten und Euch heute Abend in mein Haus zum Mahl einladen?«, fragte Bertrano den Deutschen. »Wann seid Ihr das letzte Mal hier gewesen?«
»Vor fünf Jahren«, erwiderte Van Geldern, jetzt etwas freundlicher als zuvor.
»Dann müsst Ihr unbedingt kommen. Meine Gemahlin Raffaela wird sich freuen, Euch zu sehen, und die Kinder ebenso. Alessandro ist inzwischen ein Mann geworden, Ihr werdet ihn kaum noch wiedererkennen!«
»Und die kleine Alyssia?« Van Geldern hob eine blonde Braue. »Ist sie immer noch eine solche Schönheit?«
»Überzeugt Euch selbst.« Bertrano lächelte.
Van Geldern erwiderte, dass er das gerne tun wolle, und die beiden Männer umarmten sich zum Abschied. Dann verließen Bertrano und sein Buchhalter den Rialto.
»Ihr wisst, dass das Euren Ruin bedeuten kann?«, erkundigte sich Capello, als sie die Brücke überquerten. »Wenn die Lieferung nicht in den nächsten zwei Wochen eintrifft, bedeutet das Euer Ende.«
»Nun«, meinte Bertrano mit nachsichtigem Lächeln, »dann lass uns hoffen, dass es nicht zum Äußersten kommt, mein grüblerischer Freund. Schließlich schlägt ein Blitz niemals zweimal an derselben Stelle ein, nicht wahr?«
2
CairoAbend des 5. April 1362
Wie anders dieser Ort war!
Bursa, von wo sie aufgebrochen waren, war eine befestigte Stadt, bis zum Bersten gefüllt mit Menschen und strotzend von der Kraft einer aufstrebenden Macht; hier an diesem Ort jedoch waren nicht nur die machtvollen Monumente der Gegenwart präsent, sondern auch jene einer glorreichen Vergangenheit.
Schon vor Tausenden von Jahren hatten hier Könige gelebt und geherrscht, ihre Grabmäler waren draußen in der Wüste zu sehen, jenseits des großen Flusses; und auch jetzt residierte wieder ein mächtiger Herrscher hier – ihm galt der Besuch der Abordnung, die den weiten Weg von Bursa auf sich genommen hatte.
El-Rih verstand nicht viel von Politik, sie war ihm herzlich gleichgültig. Er war Soldat mit Leib und Seele, Kämpfer in einer Einheit, die erst vor wenigen Jahrzehnten gegründet worden war. Auf Befehl Sultan Orhan Gazis war eine Gruppe von Kriegern ins Leben gerufen worden, die ihre gesamte Existenz dem Schwert weihen und im Umgang mit Pfeil und Bogen Meisterschaft erlangen sollte. Nur wenigen war es vergönnt, zu dieser Gruppe von Auserwählten, Janitscharen genannt, zu gehören. Und selbst von denen, die dazu ausersehen waren, hielten viele den harten Anforderungen nicht stand. Ein Janitschar zu sein bedeutete, sich seiner Aufgabe ganz und gar zu verschreiben, keine Furcht zu kennen und keine Liebe, Befehle niemals in Frage zu stellen und selbst unter aussichtslosen Bedingungen immer noch weiterzukämpfen.
Seit Rih ein kleiner Junge gewesen war, war er für diese Aufgabe ausgebildet worden; etwas anderes als das Kriegerdasein hatte er nie kennengelernt. Seine Kameraden waren seine Familie, der Sultan war sein Vater; und er führte jeden Befehl, den dieser Vater ihm erteilte, ohne Zögern aus – auch wenn es bedeutete, die vertrauten Mauern Bursas zu verlassen und sich in ein fremdes Land zu begeben, in eine ferne Stadt.
Über Omar ben Adil, zu dessen Schutz seine Kameraden und er abgestellt waren, wusste Rih nicht allzu viel; nur, dass er ein hoher Beamter war und ein enger Vertrauter des Sultans; dass er als junger Mann bei der Eroberung Bursas dabei gewesen war und sich durch besondere Tapferkeit ausgezeichnet hatte; und dass er in der hohen Kunst der Diplomatie beschlagen war, was wohl auch der Grund dafür war, dass man ihn mit diesem Auftrag betraut hatte. Anders als das Reich der Osmanen, das erst wenige Jahrzehnte alt war, blickte das der Mamluken auf eine lange und große Tradition. Für den Sultan war es wichtig, Kontakt zu seinem mächtigen Nachbarn zu unterhalten, und diese Aufgabe fiel Omar zu. Warum man ihm ausgerechnet Krieger der noch jungen Janitscharengarde mitgegeben hatte, entzog sich Rihs Kenntnis. Nicht, dass es einen Unterschied gemacht hätte. Der Weg der Janitscharen führte dorthin, wo immer der Sultan es ihnen auftrug; wenn er es befahl, so kämpften sie, und wenn er es verlangte, so starben sie. Die Janitscharen, so hatte man es Rih und seine Kameraden gelehrt, waren der verlängerte Arm des Sultans, die Vollstrecker seines Willens – und diese Ehre war es wert, dafür auch sein Leben zu lassen.
Der Weg, den der Zug eingeschlagen hatte, ging durch belebte Viertel, mit Bauwerken aus Stein, wie weder Rih noch seine Kameraden sie je gesehen hatten. Durch das Bab al-Futuh, eines der nördlichen Stadttore, hatten sie Al-Qahira betreten, und nun führte ihr Weg an prächtigen Gebäuden vorbei gen Südwesten zum Palast des Regenten. Rih konnte sich kaum sattsehen an all den turmhohen Minaretten und prachtvollen Moscheen, den Palästen mit ihren Balkonen und Palmengärten; und die Bewohner von Al-Qahira, so schien es, konnten sich nicht sattsehen an den seltsam gewandeten Besuchern.
Soldaten der Stadtwache marschierten dem Trupp voraus, ihnen folgten zwei osmanische Offiziere zu Pferd, prächtig anzusehen in ihren orangeroten Waffenröcken und mit den Straußenfedern an den Helmen. Ihnen folgte Omar ben Adil, der Gesandte von Bursa, auch er eine prächtige Erscheinung in seinem von Silberfäden durchwirkten Mantel und mit dem weißen Turban auf dem Kopf. Seine Diener ritten bei ihm, ihnen folgten die rund vierzig Mann der Solak Ortas, der Ehrengarde, der auch Rih angehörte. In ihren blauen Pluderhosen und den schweren Kettenpanzern, über denen sie scharlachrote Waffenröcke und schneeweiße Schärpen trugen, wirkten die Janitscharen an sich schon furchterregend. Die spitz zulaufenden Helme jedoch, deren Kettengeflecht rings bis zu den Schultern reichte und nur zwei schmale Sehschlitze frei ließen, vervollständigten diesen Eindruck noch. Die Köcher mit den Pfeilen am Gürtel, die kurzen Bogen geschultert, so marschierten die Janitscharen ihrem Herrn hinterher, stolz und selbstbewusst, wie man es ihnen beigebracht hatte – auch an einem fremden Ort, an dem sie in verschwindender Unterzahl waren.
Rih war dankbar dafür, dass das Kettengeflecht sein Gesicht bedeckte. Zwar war es in den Straßen Al-Qahiras fast unerträglich heiß, und er hatte das Gefühl, unter dem Helm zu kochen; jedoch konnte auf diese Weise niemand das Erstaunen sehen, das immer wieder über sein bartloses Gesicht huschte. Den Janitscharen war es lediglich erlaubt, einen schmalen Oberlippenbart zu tragen. Doch selbst auf dieses Privileg hatte Rih verzichtet und schabte sich das Gesicht stattdessen glatt, zur Belustigung seiner Kameraden.
Seine Augen konnten sich nicht sattsehen an den fremden Eindrücken, die von allen Seiten auf ihn einstürzten, seine Nase konnte nicht genug bekommen von all den unterschiedlichen Gerüchen. Natürlich hatte er schon früher von Al-Qahira gehört, der sagenhaften Hauptstadt der Mamluken; sie jedoch mit eigenen Augen zu sehen, erfüllte ihn mit einer Begeisterung, die er noch selten an sich erlebt hatte und die ihm eigentlich auch nicht erlaubt war. Dennoch wusste er, dass es vielen seiner Kameraden ebenso erging – bis auf Xavir vermutlich, ihren gestrengen Hauptmann. Aber seinem Freund Yussuf, der neben ihm marschierte, ganz sicher. Vergessen waren die Strapazen des langen Marsches, vergessen der Sturm, in den sie auf See geraten waren. Das Ziel ihrer Reise war erreicht, und Rih hatte das Gefühl, dass in dieser Stadt aufregende Ereignisse bevorstanden.
Vorbei an einer großen Moschee, die den Namen Al-Akmar trug, führten die Stadtwachen sie zu einem von hohen Mauern umgebenen, prunkvollen Gebäude, das sich nordwestlich des Sultanspalastes befand und für die Dauer seines Aufenthalts Ben Adils Bleibe sein würde. Den Janitscharen und den Dienern wurden Quartiere im Innenhof zugeteilt: einfache Kammern nahe der Stallungen, die jedoch sehr viel komfortabler waren als alles, worin Rih und seine Kameraden in den letzten Wochen genächtigt hatten. Nun, da sie ihr Ziel erreicht hatten, spürten die Janitscharen erst die Müdigkeit, die ihnen in den Gliedern steckte, und sie sehnten sich danach, sich endlich auszuruhen. Doch Hauptmann Xavir war noch nicht gewillt, sie zu entlassen. In voller Rüstung versammelte er sie auf dem Innenhof und ließ sie eine endlos scheinende Weile warten, unbewegt wie Statuen. Dann erst gestattete er ihnen großmütig, die Helme abzunehmen.
Staubige, verschwitzte und von Strapazen gezeichnete Gesichter kamen darunter zum Vorschein; Augen, aus denen die Mühsal eines langen Marsches blickte. Rih sah zu Yussuf hinüber und erkundigte sich nach seinem Befinden. Das mit hartem Leder verstärkte Schuhwerk der Janitscharen war für den Einsatz auf dem Schlachtfeld gedacht, aber nicht unbedingt für lange Märsche. Entsprechend hatte sich Yussuf bereits in den ersten Tagen üble Blasen gelaufen, und seiner bekümmerten Miene nach war es nicht besser geworden. Rih konnte sehen, dass sich die Spitzen seiner Stiefel dunkel verfärbt hatten. Der arme Kerl schien in seinem eigenen Blut zu waten, dennoch kam kein Laut der Klage über seine Lippen. Ein Janitschar war dazu erzogen, Schmerz zu erdulden. Wer sich nicht daran hielt, wurde bestraft.
»Söhne des Sultans!«, wandte Xavir sich an seine Leute. Breitbeinig stand er in ihrer Mitte, ein kahlköpfiger Berg aus eisenharten Muskeln. Nicht von ungefähr hatte Xavir den Posten des Hauptmanns inne. Unter allen, die dafür in Frage gekommen waren, hatte er sich mit viel Abstand als der Stärkste erwiesen. »Nach langer Reise haben wir unser Ziel erreicht. Doch der Auftrag, mit dem wir von unserem geliebten Herrscher betraut wurden, nämlich das Leben seines ergebenen Dieners Omar ben Adil mit allen Mitteln zu schützen, hat damit erst begonnen.«
Auf den Fußballen wippend, blickte er wölfisch in die Runde, ehe er fortfuhr: »Ihr habt die Stadt der Mamluken gesehen, mit all ihrem Lärm und ihren Verlockungen. Viele von euch sind das erste Mal in einer Stadt wie dieser, und vermutlich hat euch gefallen, was ihr gesehen habt. Aber ich muss euch warnen. Al-Qahira mag euch wie das Paradies auf Erden erscheinen, aber das ist es nicht. Mancher Djinn treibt hier sein Unwesen und trachtet danach, euch zu verderben, ohne dass ihr es merkt. Lasst euch nicht täuschen. Wir befinden uns tief im Land des Feindes, auch wenn wir gegenwärtig Frieden halten. Deshalb vermag auch niemand zu sagen, was während unseres Aufenthalts hier geschehen wird. Emir Yalbugha, der die Geschicke Al-Qahiras lenkt, hat uns freies Geleit zugesichert, aber was bedeutet das schon? Morgen bereits kann sich alles ändern, deshalb müsst ihr auf der Hut sein und immer und überall mit einem Angriff rechnen, so wie man es euch gelehrt hat. Nur so könnt ihr den Auftrag erfüllen, den euer Vater der Sultan euch erteilt hat. Und wenn ich einen von euch erwischen sollte, der sich nicht an diese Regel hält oder glaubt, die Grundsätze der Garde ausgerechnet hier in Frage stellen zu müssen, den werde ich höchstpersönlich daran erinnern.«
Ein breites Grinsen dehnte Xavirs Züge. Jedem der Janitscharen war klar, was er meinte. Während ihrer Ausbildung hatte er schon aus weit geringeren Anlässen zu Stock und Peitsche gegriffen.
»Nachdem das geklärt ist«, fuhr er unbeirrt fort, »werde ich nun die Posten einteilen.«
Er begann, die Namen derer zu nennen, die die erste Wachschicht übernehmen würden. Rih war fast überrascht, sich nicht selbst darunter zu finden, denn Xavir und er waren nicht die besten Freunde, und für gewöhnlich war er immer dabei, wenn es unangenehme Pflichten zu erledigen galt. Yussuf hatte weniger Glück – sein Name wurde gleich als Erster genannt.
»Zu Befehl«, schnarrte er nur.
»Das ist Wahnsinn«, raunte Rih ihm zu. »Das hältst du nicht durch!«
»Ich bin ein Janitschar und werde tun, was mir befohlen wurde«, rezitierte Yussuf folgsam den Schwur, den sie alle geleistet hatten.
»Umfallen wirst du, das ist alles«, sagte Rih voraus. »Du kannst nicht …«
»He, ihr da!«, blaffte Xavir zu ihnen herüber. »Was habt ihr da zu bereden?« Schon kam er auf sie zu, ein breites Grinsen im Gesicht. »Natürlich, ich hätte mir denken können, woher der Wind weht«, meinte er und lachte über das Spiel mit Rihs Namen. »Was ist es diesmal?«
»Yussufs Füße bluten«, stellte Rih fest, auf die dunkel verfärbten Stiefel des Kameraden deutend.
»Und?«
»Er wird seine Wachschicht nicht durchhalten. Ich möchte deshalb für ihn übernehmen.«
Xavir hatte sich breitbeinig vor ihnen aufgebaut. »Wie selbstlos von dir«, stellte er fest, während er Rih aus zu Schlitzen verengten Augen musterte. »Das würdest du tun für deinen Kameraden? Obwohl du den ganzen Tag marschiert bist?«
»Ja«, bestätigte Rih ohne Zögern.
»Also schön, so viel Fleiß muss belohnt werden. Sieh zu, dass du den Wachturm besteigst, El-Rih – zusammen mit dir, Yussuf!«
»Was?«, fragte Rih.
»Hast du im Ernst gedacht, dass ich Yussuf aus der Verantwortung entlasse, nur weil du es so willst? Niemand schreibt mir vor, was ich zu tun habe! Und niemand stiehlt sich aus seiner Verantwortung, so lange ich hier das Sagen habe, das solltet ihr inzwischen wissen!«
»Aber das war nicht Yussufs Absicht«, wandte Rih ein. »Ich meinte nur …«
»Du meinst, ich soll ihn zuerst auspeitschen lassen, ehe ich ihn auf den Turm schicke?«
Rih biss sich auf die Lippen. Er sah ein, dass jedes weitere Wort zu viel gewesen wäre. Betreten schaute er zu Boden. »Nein«, knurrte er.
»Nein, was?«
»Nein, Hauptmann Xavir.«
»So ist es gut – und jetzt macht, dass ihr wegkommt, ehe ich mich vergesse und Meldung erstatte!«
Niemand war erpicht darauf, und Xavir wusste das. Rih nickte nur, und auch Yussuf nahm die Entscheidung widerspruchslos hin. Beide wandten sich ab und bestiegen den Wachturm auf der Westseite des Innenhofs, den Xavir ihnen zugewiesen hatte.
3
Arsenal von VenedigNacht des 5. April 1362
Der conseglio dei dieci, der Rat der Zehn, war erneut zusammengetreten – zum zweiten Mal in diesem Monat. Und wieder nicht im Dogenpalast, wo es einen Saal für die offiziellen Zusammenkünfte des mächtigsten aller venezianischen Gremien gab, sondern im Arsenal, das zugleich Schiffswerft und Waffenkammer war und einer Festung gleich bewacht wurde. Hier fanden die weniger offiziellen Sitzungen des Rates statt.
Nachts und im Geheimen …
Für Außenstehende, die noch dazu nicht den nobili der Stadt angehörten und somit von politischen Ämtern ausgeschlossen waren, mochte das venezianische Regierungssystem mit all seinen Räten, Kammern und Ämtern schwer zu durchblicken sein. Battista Sabattini jedoch hatte es von frühester Jugend an studiert und bis ins Mark durchschaut.
Schon als er noch ein Knabe gewesen war, hatte sein Vater ihn zu den Tagungen des Großen Rates mitgenommen, jenem Organ, dem nur die edelsten Bürger der Stadt angehörten. Doch der junge Battista hatte schon sehr bald begriffen, dass die wahre Macht in der Republik in den Händen anderer lag. In denen des Dogen etwa, der den Regierungsgeschäften vorstand und sich an der Piazza San Marco einen prunkvollen Palast errichten ließ, wie die Welt ihn noch nicht gesehen hatte, eine einmalige Zurschaustellung dessen, was venezianische Kunst und venezianisches Geld gemeinsam zu erbringen vermochten; doch auch seine Macht war nicht unbegrenzt, wurde durch den Senat und den Kleinen Rat beschnitten. Und natürlich durch jenes Gremium, dem Battista nun selbst angehörte: dem Rat der Zehn. Es hatte ihn viel Zeit, Mühe und auch einige Säcke Dukaten gekostet, um sich die dafür notwendigen Stimmen zu erkaufen – womöglich die beste Investition, die er je getätigt hatte.
Denn die Befugnisse dieses Rates waren breit gefächert. Zusammen mit dem Dogen und seinen Beratern vertrat der conseglio dei dieci das Recht in der Stadt, war oberster Ankläger und Richter und sorgte dafür, dass nichts die Geschäfte störte, die auf den Plätzen und in den Kontoren abgeschlossen wurden und dafür sorgten, dass eine kleine, auf Inseln und Pfählen errichtete Siedlung sich aufgemacht hatte, die Vorherrschaft im östlichen Mittelmeer zu erlangen. Wann immer etwas diese Entwicklung störte, war es Aufgabe der Zehn, sich damit zu befassen.
Die Ratsmitglieder, die im Gegensatz zu den roten Gewändern des Hohen Rates schwarze Roben trugen, hatten bereits im Saal Platz genommen, als der Doge und sein Gefolge eintraten, darunter auch Luro del Rosso. Als Staatskämmerer zeichnete er für die Finanzen der Republik verantwortlich und war damit beinahe so mächtig und einflussreich wie der Doge selbst. Die Ratsmitglieder erhoben sich, und die Begrüßungsformeln wurden gesprochen. Erst dann begann die eigentliche Sitzung, in der Carlo Varesi, Oberhaupt einer der ältesten und einflussreichsten venezianischen Familien, sofort das Wort ergriff.
»Ich nehme an, es gibt einen Grund für diese außerordentliche Zusammenkunft?«, fragte er unwirsch.
»Den gibt es durchaus«, versicherte Sabattini und erhob sich, wobei er sich zuerst vor dem Dogen, dann vor den übrigen Ratsmitgliedern verneigte.
»Wieso nur bin ich nicht überrascht?«, ätzte Varesi. Er hatte nie ein Hehl daraus gemacht, dass er Sabattini nicht leiden konnte und ihn für einen Emporkömmling hielt, für einen Neureichen, der im Rat der Zehn nichts verloren hatte, ungeachtet der Verdienste, die sich sein Vater im Einsatz für die Republik erworben hatte.
»Ist Euch zu Ohren gekommen, werter Varesi, dass es wieder Piratenüberfälle gegeben hat?«, erkundigte sich Sabattini lauernd.
»Ich habe davon gehört«, bestätigte der andere.
»Dann, hoher Herr, muss ich Euch fragen, warum Ihr es mir überlassen habt, um diese außerordentliche Sitzung zu ersuchen, und es nicht selbst getan habt? Denn diese Piraten wachsen sich mehr und mehr zu einer Bedrohung aus, die uns alle angeht. Einzelne venezianische Kaufleute sind durch die Überfälle bereits in finanzielle Not geraten. Nicht auszudenken, was geschieht, wenn …«
»Was für Kaufleute?«, fragte Luro del Rosso dazwischen. Der Staatskämmerer, mit dem runden, von schwarzen Locken umrahmten Gesicht ein Abbild der Selbstzufriedenheit, grinste matt. »Doch nur einige nuovi, die zu dumm oder zu unerfahren waren, ihre Investitionen breit zu streuen. Und um sie ist es sicher nicht schade.«
»Ganz meine Meinung«, pflichtete Varesi bei, und auch die übrigen Ratsmitglieder schienen dem zuzustimmen. Allenthalben wurde genickt und gemurmelt.
»Und ich denke, dass Ihr alle das Problem unterschätzt«, stellte Sabattini klar. »Das sind nicht nur ein paar Gesetzlose, die unseren Handelsschiffen auflauern, nicht nur barbarische Heiden, die zwischen den Inseln der Ägäis kreuzen und auf der Suche nach leichter Beute sind. Wir haben es mit gezielten Angriffen auf unsere Handelsrouten zu tun! Die Schiffe der Piraten sind schnell und gut ausgerüstet, und die Matrosen an Bord sind keine törichten Schläger, sondern gut ausgebildete Kämpfer. Mehrfach bereits haben sie Schiffe überfallen, die von Bewaffneten begleitet wurden – und dies, Exzellenz«, folgerte er an den Dogen gewandt weiter, »lässt eine gänzlich andere Handschrift erahnen.«
»Worauf wollt Ihr hinaus?«, brachte sich erstmals der Doge selbst in den Wortwechsel ein. Lorenzo Celsi war ein hagerer Mann mit einem seltsam stechenden Blick. Seine Vorliebe für Extravaganzen war ebenso ausgeprägt wie seine Liebe zum Prunk. Die Turniere, die er auf dem Markusplatz veranstalten ließ, hätten jedem König zur Ehre gereicht, und nicht selten nahm er selbst daran teil. An Mut mangelte es ihm also nicht, dafür aber an Realitätssinn, wie Sabattini fand.
»Ich denke, Exzellenz, dass die Bedrohung sehr viel größer und bedeutender ist, als wir uns eingestehen wollen. Noch mögen es nur einzelne Piratenschiffe sein, die uns attackieren – aber was, wenn diese Überfälle nur die Vorzeichen eines sehr viel größeren und bedeutenderen Angriffs sind? Wenn sie gezielt gelenkt werden und dazu dienen sollen, unseren Handel ins Stocken zu bringen und die Republik zu benachteiligen?«
»Wer?«, wollte Celsi wissen. »Wer sollte so etwas tun?«
»Alexandria«, gab Sabattini ohne Zögern zur Antwort – und erntete ein unwilliges Raunen dafür.
»Wir alle wissen um Eure Aversion gegen Alexandria, Sabattini, und auch warum Ihr sie hegt«, erwiderte Varesi. »Es ist wahr, Alexandria ist unser Hauptkonkurrent im Levante-Handel, doch wir unterhalten auch gute Geschäftsbeziehungen zu den Muselmanen, beziehen Gewürze, Seide, Rauchzeug und manches mehr aus Ägypten, Palästina und Kleinasien.«
»Und deshalb sollen wir dulden, dass die Muselmanen gegen uns intrigieren?«, fragte Sabattini. »Dass sie uns die Ägäis streitig machen, die unser ist, seit wir Byzanz den Heiden entrissen haben? Macht Euch nichts vor, ehrenwerte Mitglieder dieses Rates – Alexandria ist unser Feind. Es will die Vorherrschaft über das östliche Mittelmeer, und deshalb muss ihm Einhalt geboten werden.«
»Ihr solltet Euch reden hören«, spottete Varesi. »Ihr klingt wie der alte Cato, der dem römischen Senat den Krieg gegen Karthago schmackhaft zu machen versucht. Ist das Euer ceterum censeo?«
»Macht Euch nur darüber lustig«, forderte Sabattini ihn mit bitterer Miene auf. »Aber wenn die Raubzüge andauern, wenn der Gewürzhandel dadurch beeinträchtigt wird und die ersten Kaufleute Konkurs anmelden, wird Euch das Lachen vergehen. Es sind nicht nur die Muselmanen in Ägypten, die uns bedrohen, sondern auch die Osmanen, die immer mächtiger werden. Schon haben sie Anatolien unterworfen, und nun blicken sie gierig nach Konstantinopel und gen Westen – und es ist an uns, sie aufzuhalten, solange Zeit dazu ist!«
»Wie stellt Ihr Euch das vor?«, wollte der Doge wissen.
»Wir könnten Boten zum König von Zypern schicken«, schlug Sabattini vor.
»Um was zu tun?«, fuhr Varesi scharf dazwischen. »Ihn in seinem Wahnsinn zu bestärken? Wir alle wissen, was Peter von Lusignan plant.«
»Und warum auch nicht?«, fragte Sabattini dagegen. »Wenigstens will er nicht tatenlos zusehen, wie das Abendland von der Übermacht des muslimischen Feindes langsam erdrückt wird. Er bereitet einen Feldzug vor und hat Venedig dafür um Unterstützung ersucht.«
»Natürlich«, stimmte del Rosso zu, »weil niemand sonst genügend Schiffe für eine solche Unternehmung aufzubringen vermag. Habt Ihr eine Ahnung, Mann, was solch ein Abenteuer kostet?«
»Wie viel auch immer es ist«, konterte Sabattini, »es ist weniger, als wir alle bezahlen werden, wenn die Muselmanen erst die Levante kontrollieren.«
»So weit sind wir noch längst nicht«, hielt Varesi dagegen. »Überfälle durch Piraten hat es immer gegeben. Wenn Euch an Schutz gelegen ist, so lasst Eure Schiffe von Bewaffneten begleiten und bleibt auf den sicheren Routen. Deswegen einen Krieg vom Zaun zu brechen, halte ich für stark übertrieben.«
»Ist das auch Eure Meinung, Exzellenz?«, wandte Sabattini sich an den Dogen. »Ist es nicht die Aufgabe von diesem Gremium, die Republik Venedig zu schützen, die Ordnung zu wahren und alle inneren und äußeren Feinde zu bekämpfen?«
Celsi sah ihn nachdenklich an. »Das ist es«, räumte er nach einer Weile ein. »Dennoch muss ich meinem Kämmerer und den anderen Ratsmitgliedern zustimmen, Battista«, erwiderte er. »Zum gegenwärtigen Zeitpunkt kommt ein Krieg gegen die Heiden nicht in Frage. Zumal ich sehe, dass wir als König Peters Helfershelfer kaum etwas zu gewinnen, aber viel zu verlieren hätten.«
»Und wenn ich Euch den Beweis erbrächte?«
Der Doge sah ihn forschend an. »Den Beweis wofür?«
»Dafür, dass fremde Mächte unter uns wirken«, erwiderte Sabattini. »Eine heidnische Verschwörung, die danach trachtet, unsere Vormachtstellung zu untergraben, mit dem Ziel, uns zu vernichten. Die im Verborgenen wirkt, selbst jetzt, in diesem Augenblick!«
»Das könnt Ihr nicht, weil es eine solche Verschwörung nicht gibt«, warf Varesi ein.
»Und wenn doch?«, beharrte Sabattini. »Wenn ich Euch beweise, dass die Muselmanen bereits dabei sind, gegen unsere Republik zu intrigieren und einen Krieg vorzubereiten, werdet Ihr dann alles tun, was nötig ist, um Venedig vor Schaden zu bewahren?«
»Das würde ich«, versicherte der Doge mit dünnem Lächeln. »Aber dazu wird es nicht kommen.«
4
Palast von Al-Ablak, CairoZur selben Zeit
Es wurde eine lange Wachschicht.
Nicht nur, weil El-Rih und Yussuf müde und von den Strapazen des Tages und der letzten Wochen erschöpft waren, sondern auch, weil Hauptmann Xavir es versäumt hatte, sie um Mitternacht ablösen zu lassen. Natürlich war auch das nur eine Schikane. Doch ein Janitschar klagte nicht und fragte auch nicht, und so blieb den beiden nichts anderes übrig, als auch die zweite Hälfte auf dem Wachturm auszuharren und ihre Pflicht zu erfüllen, so gut sie es vermochten.
In ihrer Ausbildung waren sie von frühester Jugend an daran gewöhnt worden, zu gehorchen und Befehle auch dann auszuführen, wenn sie in ihren Augen keinen Sinn ergaben. Gewöhnlich hatte Rih kein Problem damit. In diesem Fall jedoch merkte er, wie tief in seinem Inneren Zorn brodelte, Wut auf den Hauptmann, der das Wohl und die Sicherheit aller gefährdete, nur um seine Macht zu demonstrieren. Dabei ging es Rih nicht um sich selbst, sondern um Yussuf, seinen Waffenbruder, für den er sich verantwortlich fühlte. Auch das hatte man ihn bei den Janitscharen gelehrt.
Gehorsam patrouillierten sie an der Mauerkrone mit ihren spitzen Zinnen, spähten hinab auf die nächtliche und ihnen noch so fremde Stadt. Ein glitzernder Sternenhimmel spannte sich über Al-Qahira, von den Hügeln, die die Stadt im Osten begrenzten, über das weite, endlos scheinende Häusermeer, aus dem sich die Zitadelle und der Palast des Sultans weithin sichtbar erhoben, umgeben von Türmen und Minaretten. Jenseits der Gärten von Qufur, die sich westlich von Al-Ablak erstreckten, verlief das weite Band des Nils; jenseits davon lag, endlos und majestätisch und von blauem Mondlicht beschienen, die Wüste. Nach Süden hin jedoch, unterhalb der Paläste des Sultans und seiner Emire und bis hinab zu der großen Mauer, die die Stadt umgab, erstreckten sich die Viertel der Einwohner: der Perser, der Araber, der Berber und Nubier, aber auch der Juden und Christen. In Rihs Augen sprach es für diesen Ort, dass hier in Frieden miteinander lebte, was sich andernorts bis aufs Blut bekämpfte. Als Soldat hatte er den Krieg kennengelernt, hatte am Feldzug gegen Edirne teilgenommen und zahlreiche Feinde getötet; er war dazu ausgebildet worden und konnte sich nicht vorstellen, etwas anderes zu sein als ein Kämpfer im Dienst des Sultans. Dennoch – oder vielleicht auch gerade deshalb – sehnte er sich nach Frieden.
Entsprechend war er voller Bewunderung für die Hauptstadt der Mamluken mit ihrer ganzen Pracht und ihren Palästen – anders als Yussuf, der dafür längst keine Augen mehr hatte und sich nur noch mühsam auf den Beinen hielt. Wann immer sie einander auf ihrem Rundgang begegneten, sah der Freund ein wenig elender aus, bis er im fahlen Mondlicht wie ein lebender Leichnam wirkte, mehr tot als lebendig. Ganz offenbar hatte sich sein wunder Fuß entzündet. Er hatte Fieber.
Mehrmals ermahnte Rih ihn, sich krankzumelden, aber Yussuf lehnte ab. Weder wollte er seinen Posten verlassen noch sich vor Xavir eine Blöße geben. Und so kam, was kommen musste – mit einem dumpfen Laut brach der Freund auf der Turmplattform zusammen.
»Yussuf!«
Sofort war Rih bei ihm. Der Kopf des Kameraden war heiß, Schweißperlen standen ihm auf der Stirn. Er atmete stoßweise und war kaum noch bei Bewusstsein.
»Yussuf? Kannst du mich hören?« Rih hatte den Freund am Kragen des Waffenrocks gepackt und schüttelte ihn. »Komm zu dir! Los doch!«
Er wollte zum Wasserbeutel greifen, um Yussuf zu trinken zu geben, als hinter ihm eine Stimme erklang.
»Du hast deinen Posten verlassen, Soldat?«
Wie von einer giftigen Schlange gebissen, schnellte Rih in die Höhe und fuhr herum. Vor ihm stand Hauptmann Xavir, der sich lautlos auf den Turm geschlichen hatte. Das zufriedene Grinsen in seinen kahlen Zügen ließ vermuten, dass er genau das vorgefunden hatte, was er sich insgeheim erhofft hatte …
»Yussuf ist verletzt, er braucht Hilfe«, stieß Rih hervor, den Vorwurf schlicht überhörend. Doch Xavir war nicht gewillt, davon abzulassen.
»Ist das die Entschuldigung, die du vorbringen willst, wenn der Feind kommt und die Zinnen erklimmt? Wenn die Kehlen jener, über die du wachen sollst und die dir vertrauen, im Schlaf durchschnitten werden?«
»Ich habe meinen Posten nicht verlassen«, versicherte Rih. »Ein Kamerad ist krank und brauchte meine Hilfe!«
»Und das Leben dieses einen ist wichtiger als die Leben jener, über die du wachen sollst?«
Rih holte tief Luft, doch statt zu widersprechen, würgte er nur ein »Nein« hervor. Jedes weitere Wort wäre ohnehin zu viel gewesen. Natürlich hatte Xavir recht: Ein Soldat, der zur Wache eingeteilt war, durfte seinen Posten nicht verlassen, ihm noch nicht einmal den Rücken zuwenden, wie Rih es getan hatte. Was Xavir dabei wohl vergessen hatte, war die Tatsache, dass der Hauptmann selbst für Yussufs bemitleidenswerten Zustand verantwortlich war …
»Und du?«, fuhr er jetzt den am Boden Liegenden an. »Was treibst du da? Bist du etwa eingeschlafen?«
»Nein«, versicherte Yussuf und raffte sich auf die Beine, obschon er sich kaum aufrecht halten konnte. Seine Miene war aschfahl, er sah hundeelend aus.
»Er ist krank und hat Fieber«, erklärte Rih an seiner Stelle. »Ich ersuche um seine Ablösung.«
»So, tust du das?« Hauptmann Xavir sah ihn an, musterte ihn von Kopf bis Fuß. »Nachdem ich dich dabei ertappt habe, wie du deine Pflicht sträflich vernachlässigst, willst du mir jetzt auch noch vorschreiben, was ich zu tun habe?«
»Nein, Hauptmann. Ich meinte nur …«







![Die Farm der fantastischen Tiere. Einfach unbegreiflich! [Band 2] - Michael Peinkofer - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/4d3987251531d3c0eb5b0ada994d2676/w200_u90.jpg)
![Die Farm der fantastischen Tiere. Voll angekokelt! [Band 1] - Michael Peinkofer - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/710616cb53ccb4acc4a9849ce5514b3c/w200_u90.jpg)