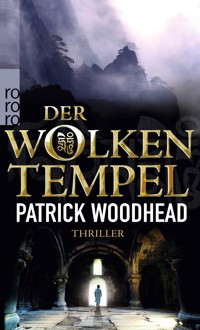
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Luca-Matthews-Reihe
- Sprache: Deutsch
Inmitten von Bergen, umhüllt von Wolken, hütet Tibet seinen größten Schatz. Ein Kloster, hoch oben im Himalaya. Keiner kennt den Weg dorthin. Zwei junge britische Bergsteiger, bereit für das Abenteuer ihres Lebens. Ein kleiner Junge auf der Flucht. Die Hoffnung eines ganzen Volkes ruht auf ihm. Ihnen auf den Fersen chinesische Soldaten. General Zhu weiß, wie man jemanden zum Reden bringt. Ein tödliches Katz-und-Maus-Spiel. Der Einsatz ist das Schicksal Tibets. «Voller Spannung, Intrigen und viel Waghalsigkeit. Erinnert stark an ‹Der Strand› von Alex Garland mit einem Schuss östlicher Mystik.» (BBC)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 451
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Patrick Woodhead
Der Wolkentempel
Thriller
Deutsch von Michael Windgassen
Für Mike,
Inspiration und Freundschaft
zu gleichen Teilen
«Fluten steigen. Rotes Wasser schwillt. Wie Inseln verschwinden wir, einer nach dem anderen, umhüllt von Dunkelheit. Wir brauchen Mut, uns zu entwickeln, stärker zu werden. Zu verstehen, dass die Verluste gerechtfertigt sein werden, dass alles ins Lot kommt. Nur wenn wir kämpfen für das, woran wir glauben, können wir wirklich frei sein.»
PROLOG
Tibet, März 1956
Kurz vor der Wegbiegung hielt er an.
Was den jungen Novizen in der Bewegung erstarren ließ, war ein Geräusch, das sich anhörte, als breche ein Tier durchs Bambusdickicht. Dann aber hörte er laute Stimmen, die Befehle auf Mandarin ausstießen. Er sprang vom Pfad und verbarg sich hinter einem dichten Strauch.
Wenige Sekunden später marschierten vier uniformierte Soldaten vorbei. Sie hatten Gewehre über die Schultern gehängt, sprachen aufgeregt miteinander und zeigten wild gestikulierend auf eine Stelle hoch oben am Hang.
Rega sah ein Paar ramponierter Stiefel nicht weit von sich entfernt. Auf den verschmutzten Schnürriemen klebten winzige Schneekristalle. Nur noch wenige Schritte, und sie würden ihn erreicht haben. Er hörte den Atem des Soldaten und schmatzende Laute. Anscheinend kaute er auf einem Priem.
«Zai Nar!», brüllte plötzlich eine andere Stimme aus größerer Entfernung. Die Stiefel hielten an und machten knirschend kehrt. Rega stieß einen Seufzer der Erleichterung aus, gleichzeitig war er entsetzt, weil ihm bewusst wurde, was nun geschehen würde.
Einer der Soldaten schien bemerkt zu haben, was eigentlich für weitere Jahrhunderte hätte verborgen bleiben sollen, nun aber durch eine Lücke zwischen Bäumen wie durch ein Schlüsselloch zu erkennen war.
Bald darauf wurden neue Rufe laut, und Dutzende von Stiefelpaaren trampelten an der Stelle vorbei, wo Rega versteckt lag.
Sie hatten sie gefunden.
Auf dem eisigen Grund der Tsangpo-Schlucht hatten die Mönche den ganzen Winter ausgeharrt. Als es dann wärmer geworden war und die Rhododendren zu sprossen begonnen hatten, wussten sie, dass ihre Zeit gekommen war. Mit den länger werdenden Tagen würde der Doshong-La bald wieder passierbar sein. Die Jahreszeiten wechselten, und mit ihnen änderte sich auch das Schicksal der Mönche.
Seit Monaten sickerten von außen Geschichten herein, geflüsterte, schreckliche Gerüchte. Dann, vor zwei Wochen, waren zwei Träger ins Kloster gekommen, erschöpft und durchfroren. Sie hatten ihr Leben riskiert und waren die ganze Nacht auf den Beinen gewesen, um Nachricht zu bringen: Jenseits der mächtigen Bergriesen waren Zelte einer chinesischen Patrouille entdeckt worden.
Weshalb sie dort auf einem der gefährlichsten Pässe Tibets campierten, konnte nur einen Grund haben. Jemand hatte den Soldaten einen Hinweis gegeben, und nun warteten sie das Ende der Winterstürme ab.
Viele Stunden lang verhielt sich der junge Novize Rega vollkommen still. Seine sonst glatte Stirn war gekraust, als er aus großen braunen Augen über die dunkler werdende Schlucht starrte. Er war gerade erst zwanzig geworden und von Natur aus dünn und drahtig, und trotz seines dicken Wintergewandes spürte er die Kälte, die vom Boden aufstieg. Er hielt die Arme vor der Brust verschränkt, um sich ein wenig zu wärmen, und fühlte, wie ihm die Beine taub wurden.
Zuerst war ihm nicht klar, was das flackernde Leuchten zu bedeuten hatte. Die vielen Stunden in Kälte und Angst hatten womöglich dazu geführt, dass er Täuschungen aufsaß. Aber das Leuchten dauerte an und nahm zu. Von Minute zu Minute schien das gelb-rote Licht stärker zu werden und höher hinauf in den Nachthimmel zu reichen.
Die Vorstellung war so unerträglich, dass es eine Weile dauerte, ehe Rega begriff, was er sah. Lange Feuerzungen, vom Wind geschürt, brachen aus dem Holzdach des Klosters. Obwohl es dunkel war, sah er Rauch aufsteigen und Asche aufwirbeln.
Rega raffte sich auf und taumelte, wie von den Flammen hypnotisiert, voran. Er musste sehen, was dort geschah. Er musste es mit eigenen Augen sehen.
Schnee rieselte von den Zweigen auf ihn herab, als er sich durchs Unterholz schleppte. Es ging steil bergan, und er geriet immer mehr in Atemnot, doch dann war endlich die Lichtung erreicht, und er sah die Fassade des Klosters vor sich. Den Arm vors Gesicht gehoben, um sich vor der sengenden Hitze zu schützen, blinzelte er in das verheerende Feuer. Die Türen der großen Bibliothek hingen schief und verkohlt in den schweren Angeln. Dahinter, am Rand der gewölbten Halle, stand ein Berg von Büchern in blauen Flammen.
Rega wich der Glut aus, lautlos auf seinen Filzstiefeln. Bislang hatte er niemanden gesehen, weder Soldaten noch Mönche.
Plötzlich hörte er es: dünne, klagende Laute, die das Prasseln des Feuers durchdrangen.
Versteckt hinter einer der großen Holzsäulen, die den Hof säumten, sah Rega Silhouetten. Die meisten Mönche standen am Rand des Hofes aufgereiht, während in der Mitte rund dreißig der älteren und gebrechlichen Brüder beieinanderkauerten, zusammengetrieben wie Vieh und von chinesischen Soldaten in Schach gehalten, die in ihren schwarzen Uniformen mit der Dunkelheit verschmolzen.
Ungefähr zehn Schritt vom Haupteingang entfernt stand, das Gesicht der Hauswand zugewandt, ein sehr junger Novize mit verbundenen Augen und hängenden Schultern. Er hielt, wie Rega bei näherem Hinsehen bemerkte, ein Gewehr in der Hand, dessen Mündung auf den Boden gerichtet war.
Soldaten, die um ihn herumstanden, fingen plötzlich an zu schreien und stemmten ihre Gewehre in die Luft.
«Schieß! Schieß!»
Der Novize trat einen Schritt zurück, hob das Gewehr mit zitternden Händen und richtete es auf die Wand vor sich. Zwei Soldaten zerrten einen der älteren Mönche aus dem Gedränge in der Mitte des Hofes und stießen ihn gegen die Wand, direkt vor den Lauf der Waffe. Der Novize konnte nicht sehen, wie der Alte vor ihm ins Straucheln geriet und in die Karabinermündung starrte.
Wehklagen hallte durch den Hof.
«Schieß! Schieß!», brüllten die Soldaten. Der Novize war sichtlich verstört.
Einer der Soldaten trat mit entschiedenem Schritt auf ihn zu. Er hatte seine Ärmel bis über die Ellbogen hochgekrempelt. Die Schulterklappen mit den goldenen Insignien schimmerten im Feuerschein, als er sich direkt hinter den jungen Mönch stellte. Rega sah, dass er ihm etwas zuflüsterte. Das Gewehr krachte, und im Zurücktaumeln prallte der Novize vor die Brust des Soldaten.
Es wurde plötzlich still. Das Klagen verstummte, als der alte Mönch zu Boden sackte und auf den Pflastersteinen aufschlug.
Weitere Schüsse fielen und durchbrachen das entsetzte Schweigen, aber es waren diesmal die Soldaten, die ihre Karabiner in die Luft abfeuerten und johlten.
Der Offizier ging auf den Novizen zu, nahm ihm das Gewehr ab und klopfte ihm ermutigend auf die Schulter. Als der Junge plötzlich in den Knien einzuknicken drohte, hielt er ihn fest, und für einen Moment standen die beiden dicht an dicht, zwei Gestalten, abgesondert von den anderen.
Dann machte der Offizier den Karabiner mit routinierten Handgriffen wieder schussbereit und brüllte, ohne auf die Gruppe der alten Mönche zurückzublicken: «Der Nächste!»
Rega sah alles mit an. Sein Mund war trocken. Entsetzt bemerkte er, dass ein weiterer Mann aus der Gruppe gezerrt und vor die Wand gestoßen wurde. Warum die Alten? Traute man ihnen nicht zu, dass sie den Marsch über den Bergpass schafften? Oder war das, wovon Rega nun Zeuge wurde, ein Beispiel jener sinnlosen Gewalt, die, wie sie alle gehört hatten, mit der sogenannten Kulturrevolution einherging?
Aus einem entfernten Winkel des Hofes gellten plötzlich Schreie – offenbar von den beiden Nonnen, Gesandten des Frauenklosters Namzong. Die Tempeltüren flogen auf und gaben einen Blick auf das frei, was dort im Halbdunkel geschah. Angewidert wandte sich Rega ab. Seine Starre hatte sich gelöst, ihm war klar, dass er fliehen und Mitteilung von dem machen musste, was er hier erlebt hatte.
Er wollte sich gerade zurückziehen, als er einen heftigen Stoß im Rücken spürte, der ihn auf die Pflastersteine niederwarf. Als er sich umdrehte, blickte er in das grinsende Gesicht eines Soldaten, der aus dem Schatten getreten war.
Es war ein großer Mann mit kantigem Kinn und dunklen, ihn nun höhnisch anblickenden Augen. Er packte Rega am Halsausschnitt seiner Kutte und zerrte ihn so nahe an sich heran, dass sich ihre Gesichter fast berührten. Er stank nach Nikotin und kaltem Rauch.
«Wen haben wir denn da?» Seine Zahnfüllungen glitzerten golden. «Einen kleinen Spion!»
Er riss Rega herum, stemmte ihm das Knie in den Rücken und drückte seine Wange auf die Pflastersteine. Der Junge sagte kein Wort. Benommen starrte er an den Säulen des Hofes vorbei auf die lodernden Flammen, die blau und gelb-rot aus dem Dach der Bibliothek in den Nachthimmel emporschlugen.
Der Soldat hatte den Gurt von seinem Karabiner gelöst und zwei Knoten im Abstand weniger Zentimeter in das Leder geschlungen. Nun packte er Rega bei den Haaren, zerrte seinen Kopf brutal in den Nacken und drückte ihm die beiden Knoten auf die Augen. Wie eine Aderpresse legte er den Gurt an, verzwirbelte ihn am Hinterkopf und erhöhte mit jeder Windung den Druck auf die Augen.
Rega wehrte sich heftig, doch vergebens. Seine Schreie verstummten mit der Zeit, als sich die Knoten tiefer und tiefer in den Schädel pressten, bis die Augäpfel schließlich platzten. Klebriges Wasser rann ihm übers Gesicht.
Der Junge erschlaffte und gab einen röchelnden Laut von sich.
Das wunderschöne, brennende Dach der Bibliothek war das Letzte, was seine Augen gesehen hatten.
1.KAPITEL
20. April 2005
Eswar sechs Uhr morgens. Hinter dem Dach der Welt zog die Dämmerung herauf. Leuchtendgelbe Wolken schienen wie Finger nach den zerklüfteten Gipfeln des Himalaja zu greifen und ließen die orangefarbenen Zelte auf der dunklen Geröllhalde erstrahlen.
Luca Matthews öffnete den Reißverschluss seines Zeltes und kroch hinaus in die eiskalte Bergluft. Er war groß und hatte breite Schultern, über die sich das Thermogewebe seines Schlafanzugs spannte, als er die Arme reckte. Dunkelblonde Haare, seit Tagen nicht gewaschen, fielen ihm ins Gesicht, das die intensive Sonne tief braun gefärbt hatte, abgesehen von den blassen Augenringen, über denen er sonst seine Gletscherbrille trug.
Er blieb eine Weile aufrecht stehen, trank aus einem Blechbecher Kaffee in kleinen Schlucken und genoss es, als Erster auf den Beinen zu sein. Für ihn, der nur wenige Stunden Schlaf brauchte, war der stille frühe Morgen die einzige Tageszeit, zu der er wirkliche Ruhe fand. Er atmete tief die prickelnde Luft ein und spürte, wie die Wärme des Bechers seine geschwollenen Knöchel belebte. Ganz in Gedanken kratzte er sich abgestorbene Hautschuppen vom linken Handballen, fuhr mit dem Finger über einen Schnitt, der sich bis zum Handgelenk hinzog, und schüttelte den Kopf. Wieder eine dieser lästigen Verletzungen, die an der trockenen Luft einfach nicht abheilen wollten.
Er schnappte sich einen Schaffellmantel, den er für ein paar hundert Rupien auf einem der Märkte in Katmandu erstanden hatte, stapfte an den rauchenden Überresten des Lagerfeuers vorbei und stellte seinen Becher vorsichtig auf einem Felsbrocken ab, um auszutreten. Als Junge hatte er von seinem Vater immer wieder zu hören bekommen, wie wichtig es sei, beim Pinkeln eine gute Aussicht zu haben. Damals hatte er natürlich noch nicht wissen können, was sich erst später herausstellte, nämlich, dass dies einer der wenigen Punkte sein würde, in denen er mit dem alten Mistkerl übereinstimmte.
Gähnend neigte Luca den Kopf zur Seite und massierte sich die Schulter. Fünf Tage lang hatte er Proviant hinauf ins Basislager geschleppt. Der Rücken schmerzte und war gezeichnet von den Rucksackgurten, die sich in die Haut eingegraben hatten. Keine Frage, dies war der undankbarste Teil des Aufstiegs: Mühe ohne jegliche Belohnung, die einzige Motivation war, dass sich hin und wieder die Wolken auftaten und die eine oder andere Bergspitze zum Vorschein kam.
Er nahm auf dem Felsen Platz, schlang die Arme um die Beine und zog die Knie bis unters Kinn. So saß er oft. Sein Blick folgte dem Grat der Bergflanke, die über drei oder vier Kilometer anstieg, ehe sie den ersten Gletscher erreichte, eine Haube aus Eis, glitzernd im frühen Morgenlicht. Dahinter reihte sich Bergrücken an Bergrücken, und die heftigen, vom Golfstrom aufgerührten Winde fegten darüber hinweg.
Zweieinhalb Kilometer über ihm trat nun auch der Gipfelgrat in Erscheinung, die letzte Etappe auf dem Weg zur Spitze des Makalu – der fünfhöchste Berg der Erde und Lucas zweiter Achttausender.
Normalerweise hätte ihn dieser Anblick begeistert, doch Luca empfand an diesem Morgen eine merkwürdige Unruhe. Er schüttete den Kaffeerest aus, sah eine Weile zu, wie er versickerte, und kehrte dann zu den Zelten zurück.
Der Aufstieg zum Grat war der gefährlichste Teil des ganzen Unternehmens.
«Willst du den ganzen Tag verpennen, Prinzessin?», rief Luca und rüttelte an einem der Zelte.
Das Schnarchen im Inneren hörte plötzlich auf. Jemand räusperte sich. «Mann, ich hab kaum ein Auge zugemacht. Die blöde Luftmatratze leckt.»
Luca grinste. «Wie wär’s mit ’nem Schluck Kaffee auf deine schlechte Laune?»
Geräuschvolles Wühlen war zu hören, dann wurde der Reißverschluss des Zeltes geöffnet, und Bill Taylors Gesicht wurde sichtbar, auf dem ein Schatten dunkler Bartstoppeln lag. Seine sonst meist munter wirkenden blauen Augen waren verquollen. Über der sonnenverbrannten Stirn standen die schütter werdenden Haare ab, als wären sie elektrisch aufgeladen.
«Danke, aber für mich lieber Tee», antwortete er und riss gähnend den Mund auf. «Ist mir unverständlich, wie man sich diese Drecksplörre antun kann.»
Luca beugte sich vor, setzte den Wassertopf auf den kleinen Kocher und drehte den Gashahn auf. Ein sanftes Fauchen wurde laut. Bill pellte sich langsam aus seinem Schlafsack.
«Du siehst beschissen aus», sagte Luca. «Traust du dir den Aufstieg heute wirklich zu?»
«Blöde Frage. Mir geht’s prächtig.»
Er reckte die Arme hoch über den Kopf und schlurfte hinüber zu dem Felsblock, neben dem sich auch Luca erleichtert hatte. «Ich verlasse mich allerdings darauf, dass du die perfekte Route ausgearbeitet hast.»
Luca blickte wieder auf die Felswand und biss die Zähne zusammen.
«Das erste Teilstück dürfte kein Problem sein, es geht einfach nur bergauf bis zu der Stelle, wo wir Lager zwei aufschlagen. Danach haben wir diese steile Eisflanke vor uns. Das wird ein bisschen haariger. Aber wenn der Gipfelgrat erreicht ist, sind’s nur noch zwei Stunden bis ganz oben.»
Bill war zurückgekehrt und kauerte nun neben ihm. Auch er schaute zum Berg auf. Luca reichte ihm einen Becher und füllte ihn mit kochendem Wasser. Die beiden sahen einander an, und noch ehe Bill den Mund aufmachte, wusste Luca, was sein Partner sagen würde.
«Pappenstiel.»
Luca grinste.
Eindreiviertel Stunden später machten sie sich an den Aufstieg.
2.KAPITEL
Sie waren schon neun Stunden unterwegs und hatten kaum ein Wort gewechselt. Der dumpfe Schmerz erschöpfter Muskeln ließ ihre Bewegungen schwerfällig und unkoordiniert werden.
Auf einem langgezogenen, geschwungenen Grat übernahm Luca die Führung. Er stapfte durch tiefen Schnee und hinterließ einen schmalen Pfad, auf dem sich auch Bill fortbewegte. Von Lucas Klettergurt gingen zwei Achtmillimeter-Seile, die sich über Schnee und Eis schlängelten, bis hinunter zu Bill, der im Abstand von gut zwanzig Metern folgte. Sie hatten sich an der Spitze abgewechselt und waren nach stundenlangem Anstieg beide gleichermaßen erschöpft, zogen aber, den Eispickel lose in der Hand, mit unvermindertem Tempo voran.
Luca versuchte, kontrolliert zu atmen, und zwang sich, langsamer zu treten. Zwei-, dreimal musste er für jeden Schritt den Fuß aufsetzen, um auf dem pulvrigen, an der Oberfläche eisig überkrusteten Schnee Halt zu finden, sank aber trotzdem immer wieder bis zu den Schenkeln ein. Sooft er absackte, brachte ihn der schwere Rucksack aus dem Gleichgewicht und zerrte schmerzhaft an seinen Schultern. Während er dann wieder mühsam Tritt zu fassen versuchte, blieb Bill nichts anderes übrig, als zu warten.
Am klaren Morgenhimmel zog ein dunkles Wolkenband auf und mit ihm ein scharfer Wind, dem sich die beiden, die Kapuzen ihrer Gore-Tex-Jacken tief in die Gesichter gezogen, entgegenstemmten.
Nicht weit über ihnen traf der Grat auf die Eiswand, die schon vom Basislager aus zu sehen gewesen war. Hier sollte das Zwischenlager errichtet werden, in sicherer Entfernung von herabstürzenden Felsen und Eisbrocken. Luca warf einen Blick auf seine Uhr, legte den Rucksack ab und schnallte die darauf festgebundene Schaufel ab. Während er zu schaufeln anfing, schloss Bill zu ihm auf. Er war außer Atem, stützte sich mit den Händen auf den Knien ab und rang nach Luft.
«Was hältst du von dieser Wolke?», keuchte er. «Laut Vorhersage schlägt das Wetter morgen um.»
Luca hielt kurz inne. Er nahm seine Brille ab und wischte sich den Schweiß von den Augen.
«Es wird schon wieder besser», antwortete er und schaufelte weiter.
Bill nickte. Er kletterte schon lange genug mit Luca, um zu wissen, dass Zweifel an dessen Wetterprognosen unangebracht waren. Was immer die Meteorologen vorhersagten, Luca schien am Ende stets recht zu behalten. Im Freundeskreis wurde gescherzt, Luca sei wetterfühlig wie eine Kuh: Wenn er sich hinlege, finge es in Kürze zu regnen an.
Bill nahm seine eigene Schaufel zur Hand und half. Eine halbe Stunde später hatten sie ihr Schneeloch gegraben, und bald streckten sie sich darin erschöpft in ihren Schlafsäcken aus. Das leise Fauchen des MSR-Öfchens übertönte die Geräusche der Außenwelt.
Bei Tagesanbruch durchstieß Luca mit den Füßen, die noch im Schlafsack steckten, die dünne Schneeschicht, die sich vor dem Einstieg gebildet hatte. Helles Morgenlicht fiel ein, und kalte frische Luft schlug ihm entgegen. Es war eine lange, unruhige Nacht gewesen, beide Männer hatten wegen der Höhe nur wenig schlafen können.
Bill öffnete den Reißverschluss seines Schlafsacks und stöhnte vor Schmerzen, als er sich aufrichtete. Eine Weile blieb er reglos sitzen und wartete darauf, dass die Schmerzen abklangen. Luca rutschte mit eingezogenem Kopf unter der niedrigen Schneedecke auf den Knien herum, kramte in seinem Rucksack und reichte dem Partner einen Müsliriegel und eine Tube Kondensmilch. Zucker war das Einzige, was einen Bergsteiger am Morgen wieder auf die Beine brachte.
«Gibst du mir mal das Wasser?», murmelte Bill und zeigte auf die Plastikflasche, die neben dem Kocher stand. «Bin total ausgetrocknet.»
«Kopfschmerzen?»
«Und was für welche!»
Bill nahm einen tiefen Schluck aus der Flasche und spähte nach draußen.
«Wenigstens in einer Hinsicht hast du recht behalten.»
«Das Wetter ist nicht unser Problem», bestätigte Luca und stopfte seine Sachen in den Rucksack. «Wohl aber die Eisflanke. Hast du in der Nacht das Geröll runterkommen hören?»
Bill nickte. Im Abstand von einer oder zwei Stunden waren schwere Brocken herabgestürzt und in der Tiefe auf dem Gletscher aufgeschlagen. Jedes Mal waren beide vor Schreck aufgewacht, aber keiner hatte etwas gesagt. Sie wussten um die Gefahren des Makalu-Westpfeilers.
Wortlos packten sie zusammen, lösten routiniert das Lager auf und waren in Gedanken schon beim Aufstieg. Sie hatten bereits eine Höhe von sechseinhalbtausend Metern erreicht, und die Eisflanke verlangte ein Höchstmaß an technischem Klettern.
«Du hast die Route geplant», sagte Bill. «Also könntest du auch heute die Führung übernehmen.»
Luca war mit den Schnallen seines Rucksacks beschäftigt. «Klar», entgegnete er, ohne aufzublicken und um einen ungezwungenen Tonfall bemüht. «Keine Sorge.»
Zwanzig Minuten später standen sie auf dem Grat und spürten die Wärme der Morgensonne. Luca hatte die Seile ausgerollt und reichte Bill zwei Enden. Der warf seinem Partner eine schwere Schlinge mit Klemmkeilen, Eisschrauben und Haken zu, die Luca in bestimmter Reihenfolge an seinem Klettergurt befestigte.
«Ich kenne keinen, der mit seinem Gerät so penibel umgeht», bemerkte Bill.
«Du weißt doch, je höher wir steigen, desto blöder werden wir. So weiß ich wenigstens, wo was ist.»
Bill lächelte trotz seiner Kopfschmerzen. Lucas Wohnung war das reinste Chaos, ein heilloses Durcheinander ungeöffneter Post und herumliegender Kleidungsstücke. Hier draußen in den Bergen hingegen zeigte er sich von einer ganz anderen Seite: präzise, aufmerksam und alles andere als nachlässig.
«Da oben werde ich dich sichern», sagte Luca und zeigte auf ein Felsstück, das gut zehn Meter über ihnen schwarz aus der steilen Eiswand ragte. Dann, als sie einander mit einem knappen Kopfnicken zu verstehen gegeben hatten, dass sie bereit waren, rückte er auf dem Grat vor und griff durch die Schlaufen seiner Eispickel.
So dicht an der Wand, dass er mit den Hüften fast auflag, schlug Luca seine Steigeisen ins Eis. Kleine Splitter rieselten herab. Mit fließenden, rhythmischen Bewegungen arbeitete er sich mit den Eispickeln Schritt für Schritt höher und verließ sich dabei ganz auf die Frontalzacken seiner Steigeisen, anstatt immer wieder neue Stufen zu treten. Ohne nach oben zu blicken, konzentrierte er sich allein auf das, was unmittelbar vor ihm lag.
Er verstand sich darauf, eine Kletterstrecke aufzuteilen, Seillänge für Seillänge. Nicht mehr. An den Gipfelgrat zu denken war viel zu früh, und die Eiswand über ihm stieg noch an die tausend Meter an.
Es vergingen Stunden. Immer wieder führte er dieselben Bewegungen aus, behielt seinen Rhythmus bei. Die Sonne wanderte am Himmel entlang und spiegelte sich im Eis, das wie poliert glänzte. Die Schatten, zuerst auf der rechten Seite, fielen schon nach links. Beide Männer schwiegen und wechselten nur ein paar Worte, wenn am Ende einer Seillänge die Klettergeräte ausgetauscht wurden.
Luca rammte seine Pickel ein, grätschte die Beine und nahm eine Eisschraube vom Gurt, die er auf Schulterhöhe in der Wand befestigte. Er klemmte das Seil in den Karabiner und lehnte sich, das Gewicht in den Sitz verlagernd, zurück, um die angespannten Unterschenkel zu entlasten. Dann trieb er eine zweite Schraube ins Eis, hakte das Seil ein und sah zwischen seinen Beinen hindurch nach unten.
Mit dem Blick den Seilen folgend, entdeckte er Bill und sah, wie er sich nach oben kämpfte. So kletterte sein Partner immer, wenn er müde war: kämpfend. Er hämmerte mit den Pickeln dermaßen wuchtig drauflos, dass die Eissplitter nur so stoben, und setzte Kraft statt Geschicklichkeit ein, um voranzukommen.
Plötzlich ging rechterhand eine kleine Stein- und Eislawine prasselnd nieder, mit Brocken, von denen manche kopfgroß waren, zum Glück weit genug entfernt, um ihnen nicht gefährlich werden zu können, doch allein der Anblick, wie sie Staub aufschlagend von der Wand abprallten, zerrte an den Nerven. Jedes dieser Geschosse hätte ihre Helme glatt zersplittern lassen.
Bill hatte den Kopf in den Nacken gelegt, und für einen kurzen Moment begegneten sich die Blicke der beiden. Keiner sagte ein Wort. Sie wussten um die Risiken, und es war nicht nötig, sie zur Sprache zu bringen.
Luca stieß einen Schwall frostig kondensierender Luft aus und gestattete sich einen Blick nach oben, um zu ermessen, wie weit sie gekommen waren. Sie hatten ein zügiges Tempo vorgelegt und fast zwei Drittel der Flanke bezwungen. Noch ein paar Stunden, und sie würden den Gipfelgrat erreicht haben.
Es war schon weit nach Mittag, und Luca spürte, wie seine Kräfte nachließen. Er wurde langsamer und hörte sich ächzen, sooft er seinen Körper ein Stück höher hievte. Die Unterarme waren hart und geschwollen. Im rechten Bein quälte ihn ein Krampf, von dem er wusste, dass er nicht auf die Kälte zurückzuführen war. Er fragte sich in fast klinischer Nüchternheit, wie lange er die Strapazen noch würde ertragen können.
Länger als Bill, dessen war er sich sicher. Während der letzten beiden Stunden hatte sein Partner immer wieder an den Seilen gezerrt, um ihn zu einer Verschnaufpause aufzufordern, und die wurden immer länger.
Fünfzehn Meter weiter unten spürte Bill, wie sich sein Schweiß mit der dünnen Eisschicht mischte, die sein Gesicht überzog. Er keuchte ächzend und wurde, sooft er innehielt und nach Luft zu schnappen versuchte, von einem Hustenreiz befallen, der ihm noch mehr zusetzte. Seine Beine fühlten sich wie lebloses Holz an, und immer wieder rutschte er mit den Füßen ab, weil er kaum mehr die Kraft hatte, die Steigeisen tief genug ins Eis zu schlagen. Die Pickel in seinen Händen kamen ihm unerträglich schwer vor, und ihm war bewusst, dass seine Bewegungen immer verzweifelter wurden.
Wieder hielt er an und machte sich auf einen weiteren Hustenanfall gefasst. Wenn er nach oben blickte, sah er durch die beschlagene Brille nur die Umrisse Lucas, der auf ihn wartete.
«Alles klar?»
Weil er wieder husten musste, konnte Bill nicht gleich antworten. Es dauerte eine Weile, bis der Anfall vorbei war. Schließlich hob er den Kopf und schrie unter Schmerzen ein einziges Wort:
«Pause.»
Selbst aus der Entfernung hörte Luca, wie gequält Bills Stimme klang. Nach sieben Jahren gemeinsamen Bergsteigens wusste er sehr wohl einzuschätzen, wie seinem Partner zumute war, und dessen Bewegungen nach zu urteilen, die seit gut einer Stunde ausgesprochen ungelenk wirkten, schien er sein Limit erreicht zu haben.
Luca blickte auf zu einem Felssims, der groß genug zu sein schien, dass beide darauf Platz finden mochten. Seit einer halben Stunde steuerte er darauf zu und war jetzt nur noch sechs oder sieben Meter davon entfernt. Er wartete, bis wieder genügend Spiel im Seil war, kletterte mit zitternden Armen weiter und hievte sich über den Rand. Den Rücken an die Eiswand gepresst und mit frei baumelnden Beinen zog er das Seil ein, um Bill zu helfen.
«Noch fünfundzwanzig Meter», brüllte er nach unten. «Wir haben hier unseren kleinen Privatbalkon.»
Seit Stunden hatte er nur spiegelndes Eis vor der Nase und nichts anderes als den Aufstieg im Sinn gehabt. Jetzt saß er im Sonnenschein und schaute blinzelnd auf die Welt, die sich unter ihm ausbreitete.
Jeder Blick war anders, und sooft er auch kletterte, war eine neue Perspektive für ihn immer atemberaubend. Als er die endlos scheinende Weite vor Augen sah, schienen alle Mühen am Berg zu verblassen, und er selbst schrumpfte zu dem zusammen, was er im Grunde war: ein winziger Mensch, umgeben von einem gigantischen Wust von Felsen.
Nein, diesmal kam ihm diese Wüste seltsam geordnet vor.
Luca blinzelte ins helle Licht und versuchte in sich aufzunehmen, was er sah. Auf der rechten Seite erhob sich ein Ring schneebedeckter Berge, vollkommen ebenmäßig angeordnet. Die Gipfel beschrieben einen Kreis von außergewöhnlicher Symmetrie, wie mit einem Zirkel gezogen. In der Mitte lag eine undurchdringlich dicke Wolkendecke.
Während er sie betrachtete, geriet diese Wolkendecke in Bewegung. Sie teilte sich langsam, veränderte ihre Form, setzte sich neu zusammen, und gleichzeitig nahm etwas in ihrer Mitte Gestalt an. Unwillkürlich lockerte sich sein Griff, mit dem er das Seil gepackt hielt. Er beugte sich vor.
Licht strömte durch die Wolkenlücke, ließ erst die eine Seite, dann die andere erstrahlen. Schließlich befreite sich das, was darunter Gestalt annahm, von dem Wolkenwirbel, und Luca starrte auf eine Pyramide, die so perfekt proportioniert war wie von Menschenhand geschaffen.
Was aber nicht sein konnte. Gewiss nicht. Hier, inmitten des Himalaja-Gebirges, konnte doch nichts anderes stehen als ein naturwüchsiger Berg. Mit Blick auf den Horizont stellte er fest, dass die anderen Gipfel die Pyramidenspitze überragten, wenn auch nur geringfügig. Sie musste also an die siebentausend Meter hoch sein. Absurd, auf den Gedanken zu kommen, sie könnte von Menschen errichtet worden sein.
Eine zitternde Hand langte neben ihm über den Felsrand.
Noch ganz in Gedanken an die Felspyramide, schreckte Luca auf. Doch er reagierte schnell und packte Bill beim Handgelenk, um ihm hochzuhelfen. Er konnte spüren, wie sehr sich Bill abmühte und mit seinen Steigeisen dabei immer wieder abrutschte. Kaum hatte Bill es schließlich geschafft, den Sims zu erklimmen, ließ er sich auf den Rücken fallen und rang nach Luft.
«Bist du okay, Kumpel?»
Selbst durch die Schneebrille hindurch sah Luca den Augen des Partners seine Erschöpfung an. Bill war bleich und wirkte völlig ausgelaugt. Alle Farbe war aus seinem Gesicht gewichen.
«Bist du okay?», wiederholte Luca seine Frage und holte die letzten Meter Seil ein. Unwillkürlich richtete er den Blick zurück auf die Pyramide. «Sieh dir mal den Berg da drüben an, Bill. So was ist mir noch nie zu Gesicht gekommen.»
Bill öffnete den Mund, um zu antworten, musste aber wieder keuchend husten. Luca schaute auf ihn hinab und sah, dass er den Kopf zur Seite gedreht hatte und blutiger Speichel aus seinem Mundwinkel tropfte. Durch den Sauerstoffmangel waren seine Lippen violett angelaufen.
«Scheiße», flüsterte Luca. Als sein Partner langsam die Augen schloss, hob er die Stimme. «Bill… du darfst jetzt nicht einschlafen.»
Doch der rührte sich nicht und hielt die Augen fest geschlossen.
Das Hämmern in seinem Kopf war unerträglich, und er fürchtete, die Schläfen könnten ihm platzen, falls er sich bewegte, was ihm aber vor lauter Schmerzen ohnehin kaum möglich war. Seit Stunden hatte er gegen sie anzukämpfen versucht, doch jetzt waren sie so schlimm, dass sich sogar sein Blick verschleierte.
«Die Kopfschmerzen bringen mich um», flüsterte er. «Die Höhe… wir klettern zu schnell.»
«Wie fühlst du dich?»
Es dauerte eine Weile, bis Bill wieder genügend Kraft aufbrachte, um zu antworten. Seine Stimme war kaum mehr als ein Murmeln.
«Mir verschwimmt alles vor den Augen.»
Luca fluchte leise und warf einen Blick über die steile Eiswand nach oben.
Der Gipfelgrat war nur noch eine halbe Stunde entfernt. Das Wetter hätte kaum besser sein können. Es gab nur wenig Wind, und die Luft war klar. Die Vorbereitungen der Expedition hatten Monate in Anspruch genommen, und nun herrschten beste Bedingungen – der Berg bot sich geradezu an. Schon seit geraumer Zeit war Luca bewusst, dass er eine Wahl zu treffen hatte. Er starrte auf den Gipfel und war sich absolut sicher, ihn im Alleingang bezwingen zu können.
«Bill, hör zu. Ich werde dich jetzt hier auf dem Sims absichern, nur für eine Stunde oder so, und allein bis zum Gipfel gehen. Du bist hier in Sicherheit, das kann ich dir versprechen.»
Bill ließ sich die Worte seines Partners durch den gemarterten Kopf gehen. Er richtete sich ein wenig auf, um eine Antwort zu geben, wurde aber wieder von einem Hustenanfall gepackt und fiel zurück wie ein Stein.
Einen Moment lag er völlig reglos da. Dann drehte er mühsam den Kopf zur Seite und spuckte Blut und Speichel aus.
«Du… darfst mich nicht allein lassen», röchelte er.
Er öffnete die Augen, blinzelte vor Schmerzen.
«Lass… mich verdammt nochmal… nicht allein», wiederholte er.
Bill wehrte sich gegen den Nebel, der seine Gedanken beschlich. Er musste wach bleiben und gegen die lähmende Trägheit ankämpfen. Sekunden vergingen. Er spürte, wie ihm die Sinne schwanden, wie es um ihn herum dunkel zu werden begann. In diesem Zustand verharrte er lange, wie es schien. Alles, was er hörte, waren die Geräusche in seiner Brust, das keuchende Auf und Ab. Die Dunkelheit an den Rändern seines Gesichtsfelds breitete sich aus, und er drohte, darin zu versinken.
«Luca… bitte.»
Bills Stimme, mit der er seine letzten Gedanken über die geschwollenen Lippen brachte, war kaum mehr zu hören. Durch Nebel, die seinen Blick verschleierten, glaubte er, Lucas Silhouette sehen zu können, die sich vor ihm aufrichtete. Er spürte eine Hand am Klettergurt und fühlte sich an den Rand des Felsvorsprungs gehievt.
Er streckte die Hand aus, um Lucas Arm zu ergreifen.
Als Luca endlich sprach, waren seiner Stimme die Wut und Frustration anzuhören.
«Dann reiß dich jetzt zusammen. Machen wir, dass wir runterkommen.»
3.KAPITEL
Es gab kein natürliches Licht, nur das von wenigen zerfließenden Kerzen, zwischen denen sich kleine Rinnsale sirupartigen Wachses ausbreiteten. Der gedämpfte Strahlenkranz ihrer Flammen beleuchtete die fünf Sitze, die in die Steinmauer gehöhlt waren.
Sie bildeten einen Halbkreis entlang der natürlich geschwungenen Kammerwand. Darauf hatten im Lotussitz Gestalten Platz genommen, in festlichen Gewändern aus gefärbtem Tuch und so angelegt, dass der rechte Arm einer jeden Gestalt nackt blieb.
Auf der anderen Seite der kreisförmigen Kammer, vom Licht der Kerzen kaum noch erreicht, lagen einige persönliche Gegenstände sorgfältig angeordnet auf dem steinernen Boden: Gebetsmühlen, Perlenketten und kleine goldene Schellen, jeweils fünf davon.
Eine der Gestalten lehnte sich zurück und streifte ihre gelbe Kapuze in den Nacken.
«Die Weissagung hat sich erfüllt», sagte der alte Mann mit brüchiger Stimme. «Der Junge wurde gefunden.»
Die anderen wandten sich ihm zu. Ihre greisen Gesichter verrieten Erstaunen.
«Bist du dir sicher?»
«Das bin ich.»
Ein anderer Mönch beugte sich auf seinem Sitz nach vorn und ordnete die Falten seines roten Gewandes.
«Wie konntest du ihn schon so bald nach dem Hinscheiden Seiner Heiligkeit ausfindig machen?»
Der Mönch im gelben Gewand lächelte. «Es war in der Tat wundersam. Bei seiner Feuerbestattung wehte der Rauch nach Südwesten und bestätigte das Orakel Tshangpas. Nach nur einem Monat Suche fanden wir den Jungen in einem kleinen Dorf namens Tingkye.»
«Nach nur einem Monat?», fragte ein anderer Mönch zweifelnd. «Wie ist das möglich in so kurzer Zeit?»
«Du solltest dich freuen, dass sich die Weissagung erfüllt hat und wir den Jungen so schnell gefunden haben.»
«Und wie ist er, der Junge?», fragte ein anderer, etwas jüngerer Mönch. Sein grünes Gewand schimmerte im Kerzenlicht, als er sich vorbeugte und eifrig in die Runde blickte.
«Er ist neun Jahre alt, das Kind von Bauern, ohne Schulbildung. Doch als ich ihn zu Gesicht bekam, sah ich sofort, dass er von einem Geist erfüllt ist, der dem seines Vorgängers entspricht. Als ich ihm die persönlichen Dinge zeigte, zögerte er keinen Augenblick. Er wählte die Gebetsmühle Seiner Heiligkeit, dann die goldene Schelle, die dieser nur in seiner Privatkammer zum Klingen gebracht hat. Als ihm die fünf verschiedenen Perlenketten vorgelegt wurden, führte er seine Hand über jede einzelne von ihnen und legte sie dann auf diejenige Seiner Heiligkeit, deren Perlen aus Jade und Silber bestehen, den Zeichen von Xigaze. Der Junge steckte sie in seine Tasche, schaute mich mit einem sonderbaren Ausdruck in den Augen an und sagte: ‹Das sind meine. Wo hast du sie gefunden?›»
Als sie das hörten, verbeugten sich die anderen drei Mönche voller Ehrfurcht. Die Suche hätte Jahre, womöglich Jahrzehnte, dauern können, und doch war der Junge schon nach wenigen Wochen gefunden worden.
Schließlich hob einer von ihnen den Kopf.
«Und was ist mit der Goldenen Urne?»
«Ein Losentscheid war nicht nötig. Es gibt keine anderen Kandidaten. Im Verlauf der Prüfungen, die der Junge ablegen musste, wurde mir bald deutlich, dass ihm gar nicht bewusst war, dass man ihn auf die Probe stellte. Er ging wie selbstverständlich darauf ein, mit traumwandlerischer Sicherheit. Unmöglich, dass ihm all dies beigebracht wurde.»
Es entstand eine längere Pause, in der die Mönche über die Bedeutung dessen nachdachten, was ihnen gesagt worden war. Der jüngere im grünen Gewand schaute sich mit hellen Augen um.
«Wir müssen Xigaze kundtun, dass der neue Führer gefunden wurde.»
Der Mönch im roten Gewand schüttelte so entschieden den Kopf, dass die Kerzen flackerten und die Schatten an den Wänden in Bewegung gerieten.
«Nein. Wir sagen es niemandem. Die Identität des Jungen muss um jeden Preis geheim gehalten werden. Falls sich die Nachricht herumspricht, werden andere, die mächtiger sind als wir, ihn in ihre Hände bringen wollen. Wir müssen schnell handeln, Brüder, anderenfalls droht uns ein schreckliches Schicksal.»
Er drehte langsam den Kopf und schaute jedem einzelnen ins Gesicht.
«Wir haben ein Geheimnis von äußerster Wichtigkeit zu hüten», sagte er und richtete den Zeigefinger nach oben. «Das Schicksal Tibets liegt nun in unserer Hand.»
4.KAPITEL
Der Abstieg war relativ einfach.
Bill wurde von Luca abgeseilt und fühlte sich schon bald sehr viel besser. Die lähmende Lethargie, die ihn weiter oben am Berg befallen hatte, schwand mit jedem Atemzug dickerer Luft. Mit der Zeit ging es immer schneller bergab, und in die müden Muskeln kehrte Kraft zurück.
Schließlich konnte Bill sogar fast wieder mit Luca Schritt halten. Als das Schneeloch erreicht war, in dem sie biwakiert hatten, war ihm die Erschöpfung nicht mehr anzumerken, abgesehen davon, dass er manchmal noch husten musste.
Seine Stimmung aber war auf dem Nullpunkt. Er fürchtete, sich ein Lungenödem zugezogen zu haben, und ahnte, in welcher Gefahr er schwebte. Luca und er waren früher einmal am Nordpfeiler des Montblanc auf einen Kletterer gestoßen, als schlechtes Wetter aufzuziehen drohte und sie alle zur Umkehr zwang. Der Mann war in der Wand geblieben, während sie Zuflucht im Refuge des Cosmiques suchten, einer Schutzhütte unter dem Gipfel des Aguille du Midi.
Während der Nacht mussten sie über ihr Funkgerät die Geräusche des sterbenden Bergsteigers mit anhören.
Zuerst hatte er unablässig gehustet, dann gab er nur noch ein tiefes, angestrengtes Gurgeln von sich wie aus einer mit Wasser gefüllten Lunge. Er war bereits ins Koma gefallen, als in der Morgendämmerung der Hubschrauber kam.
Tags darauf waren Bill und Luca nach Chamonix zurückgekehrt, wo sie erfuhren, dass der Kletterer auf dem Weg ins Krankenhaus gestorben war, erstickt an seiner eigenen Körperflüssigkeit.
Daran musste Bill denken, als er schweigend vor Luca her über den schmalen Grat abstieg. Plötzlich blieb er stehen und stieß seinen Eispickel in den Schnee. Er schob die Brille in die sonnenverbrannte Stirn und drehte sich blinzelnd zu seinem Partner um.
«Du wolltest mich da oben allein lassen!»
Luca schloss zu ihm auf und holte das Seil ein. «Doch nur für eine Weile, Mensch. Wir waren dicht unter dem Gipfel. Ich hätte nicht mehr lange gebraucht, zwanzig Minuten vielleicht. Dann wäre ich zu dir zurückgekommen.»
«Erzähl keinen Blödsinn. So nahe dran waren wir nicht.»
«Reden wir später darüber», entgegnete Luca ruhig. «Wir sind beide fix und fertig und haben bis zum Lager noch ein paar Stunden vor uns.»
Bill nahm seinen Eispickel zur Hand und rückte den Rucksack zurecht. Er blickte über den Grat und schien nachzudenken.
«Sag mal, Luca, wie war das eigentlich am Everest? Genauso?»
Lucas Miene verhärtete sich schlagartig. Seine grauen Augen wirkten plötzlich so ausdruckslos wie polierter Marmor. Er setzte den Rucksack ab und schien um Fassung bemüht. Auf seinen Wangen aber zeigten sich rote Flecken, und als er sprach, war nur ein Flüstern zu hören.
«Pass auf, was du sagst. Du weißt genau, was passiert ist.»
Bill zuckte mit den Achseln und drehte sich um, um weiterzugehen. Doch jetzt blieb Luca stehen und hielt ihn zurück. «Es ist mir ernst, Bill. Sag das nicht noch einmal. Du weißt, was mich die Sache gekostet hat.»
«Wie konntest du dann überhaupt in Erwägung ziehen, mich da oben allein zu lassen? Hast du deine Lektion nicht gelernt?»
«Meine Lektion? Verdammt, Bill! Würdest du bitte auch mal in Betracht ziehen, dass ich da oben womöglich selbst nicht ganz bei mir gewesen bin? Auf extreme Höhen reagiert jeder anders. Vielleicht habe ich mich getäuscht, aber ich dachte, wir wären dicht unterm Gipfel.»
«Dass dir überhaupt in den Sinn gekommen ist, mich…»
«Es reicht», unterbrach ihn Luca und hob die Hand. Er schulterte den Rucksack und setzte sich in Bewegung. Nach ein paar Schritten blieb er wieder stehen, drehte sich um und sagte: «Ich habe mich vier Stunden mit dir abgeplagt und dir heruntergeholfen. Ohne mich wärst du da oben verreckt.»
Die beiden starrten einander wütend an. Doch plötzlich wandte sich Luca um und setzte ohne ein weiteres Wort seinen Weg fort. Die Hände in den Handschuhen waren zu Fäusten geballt.
Zwei Wochen später, nach mehreren Flügen und Zugfahrten durch Tibet und Nepal, waren sie zurück in England.
Während der Reise war das Streitgespräch nicht wiederaufgenommen, geschweige denn beigelegt worden. Beide hatten sich für das entschuldigt, was auf dem Berg gesagt worden war, doch es schien, als sei ein Schatten über ihre Freundschaft gefallen, ein schleichendes Gefühl von Misstrauen, das es bislang zwischen ihnen nie gegeben hatte. Zwar plauderten sie miteinander, aber alles, was sie sagten, klang zögernd oder gar unecht. Es war, als schämten sie sich für die gemeinsame Zeit am Makalu, und davon, dass sie einen der schwierigsten Gipfel der Welt fast bezwungen hätten, war mit keinem Wort die Rede.
Jetzt standen sie befangen am Bahnsteig des Heathrow Express. Mit ihren bunten Rucksäcken und gebräunten Gesichtern zogen sie die neugierigen Blicke der Passanten auf sich.
Normalerweise wären die beiden noch ins Windsor Castle gegangen, um den Abschluss ihrer Reise feierlich zu begießen, doch diesmal schien stillschweigend abgemacht, dass sie darauf verzichteten.
«Tja, da sind wir also wieder», sagte Luca und versuchte, heiter zu klingen. «Dein Herzblatt wird froh sein, dich heil zurück zu haben. Du kannst ihr sagen, dass die Verspätung auf meine Kappe geht.»
«Yeah… vielleicht.» Bill rang sich ein Schmunzeln ab.
Luca streckte die Hand aus. Sie verabschiedeten sich betont beiläufig.
«Wir sehen uns», sagte Bill, und für einen Moment zeigte sich in seiner für gewöhnlich heiteren Miene ein Anflug von Ernst. Dann hob er entschlossen den Kopf, packte seinen Rucksack bei den Gurten, drehte sich um und verschwand in der Menge der Pendler.
Luca schaute ihm nach. Am liebsten hätte er ihm noch etwas zugerufen. Zwei lange Wochen hatte er Zeit gehabt, darüber nachzudenken, wie das Eis zwischen ihnen gebrochen werden könnte – mit einer weiteren Entschuldigung, dem Eingeständnis, dass er die Sache verbockt hatte. Nach dem, was passiert war – er hatte den Freund noch nie so wütend erlebt–, glaubte Luca ahnen zu können, wie gekränkt er war.
Aber die Worte blieben ihm im Hals stecken. Bills Anspielung auf den Everest war wie ein Tiefschlag gewesen, von dem er sich immer noch nicht richtig erholt hatte. Er konnte die Sache einfach nicht vergessen. Luca hob seinen Rucksack von dem schmutzigen Betonboden hoch und ging auf ein hellerleuchtetes Café zu, das voller Gäste war, die Milchkaffee tranken und in der Morgenzeitung blätterten. Er rückte sich einen der Metallhocker zurecht, bestellte bei der Kellnerin einen doppelten Espresso und ließ den Blick über die Menge der Menschen schweifen, die auf dem Bahnsteig wie Ameisen durcheinanderliefen.
Als er zu der dreieckigen Glasdachkonstruktion des alten Bahnhofs aufschaute, kam ihm das Bild des pyramidenförmigen Berges in den Sinn. Er hatte immer wieder daran denken müssen, und sooft er die Augen schloss, tauchte es wieder vor ihm auf. Während der Rückreise hatte er einmal, von einer Wolkenpyramide vor dem Flugzeugfenster auf den Gedanken gebracht, mit Bill darüber sprechen wollen, dann aber doch darauf verzichtet.
Jetzt hatte er den Berg wieder vor sich, so, wie er ihn vom Felssims aus gesehen hatte: eine Seite glänzend im Sonnenlicht, die Kanten wie glattgefeilt und mit Eis und Schnee überzogen, sehr viel klarer noch proportioniert als das Matterhorn – wie die Kinderzeichnung eines perfekten Berges.
Jedes Mal, wenn Luca daran dachte, ärgerte er sich, kein Foto gemacht zu haben. Doch als er Bill schließlich über den Rand gehievt hatte, war der seltsame Berg mitsamt den anderen Gipfeln, die ihn umringten, wieder hinter Wolken verschwunden gewesen. Die Gelegenheit, eine Aufnahme zu machen, war Bills wegen vertan, so wie auch die eine kurze Chance, den Makalu zu bezwingen.
Von einem Mann angerempelt, der einen regennassen Mantel trug, verschüttete Luca seinen Espresso. Als er fluchend nach einer Serviette griff, wurde über Lautsprecher die Einfahrt seines Zuges angekündigt. Auf schnellstem Weg zurück nach Hause, das hatte er sich vorgenommen, ein heißes Bad nehmen, seine schmutzigen Sachen in den Wäschekorb stopfen und alle Gedanken an Phantasieberge beiseiteschieben.
Jetzt aber drängte es ihn in eine andere Richtung, denn er kannte eine Person, von der er wusste, dass sie ihn verstehen würde.
Zum ersten Mal seit Wochen lächelte Luca. Er warf das Geld für den Espresso auf den Tisch, schulterte seinen Rucksack und steuerte geradewegs auf einen Münzfernsprecher zu.
5.KAPITEL
Aus der Ferne war von den beiden Militärjeeps nur eine dichte Staubwolke zu sehen, die sie hinter sich herzogen. Dicht hintereinander fuhren sie mit heulenden Motoren, denen die Höhe zu schaffen machte, über die von Schlaglöchern ramponierte Schotterpiste.
Leutnant Chen Zhi wurde seit nunmehr drei Stunden auf dem harten Beifahrersitz durchgerüttelt. Seine olivgrüne Uniform war grau von Staub, und so, wie er da hockte – den massigen Oberkörper nach vorn und zur Seite gebeugt–, schien es, als wollte er sehen, was sich unter dem Seitenspiegel abspielte. Tatsächlich versuchte er nur, sein schmerzendes Hinterteil zu entlasten und sich gegen das nächste Schlagloch zu wappnen.
Während er nach draußen starrte, wünschte er sich sehnlichst, die Fahrt wäre endlich vorbei, obwohl ihm vor dem grauste, was er am Ende zu erwarten hatte. Wieder traf eines der Vorderräder in ein Loch, so tief, dass der Radkasten aufsetzte. Alles, was auf dem Armaturenbrett lag, wirbelte durch die Luft. Chen warf einen vorwurfsvollen Blick auf den Fahrer, sagte aber nichts. Er hätte sich bei dem Motorlärm ohnehin kaum verständlich machen können.
Stattdessen griff er in die Brusttasche seines Hemdes und zog ein Lederetui daraus hervor. Hinter seinem Dienstausweis steckte ein Streifen mit vier Passfotos, die in einem Automaten am Bahnhof von Lhasa aufgenommen worden waren. Sie zeigten seinen zehnjährigen Sohn auf den Knien seiner Mutter und ihn selbst, in Zivil und in verrenkter Haltung hinter den beiden kniend. Der Junge versuchte, sich freizustrampeln, während seine Frau hilfesuchend über die Schulter zurückblickte. Er fragte sich, warum ihm ausgerechnet dieses Foto so sehr ans Herz gewachsen war. Vielleicht, weil es so echt und spontan wirkte und doch einen Moment festhielt, der eine Ewigkeit zurückzuliegen schien.
Der Fotostreifen war vor vier Jahren aufgenommen worden, kurz bevor er den Militärdienst angetreten hatte.
Inzwischen hatte sich für ihn fast alles verändert. Gleich geblieben war nur, dass er, wenn er auf Wochenendurlaub war und mit seinem Sohn unterwegs, um Mah-Jongg zu spielen, immer an diesem Bahnhof vorbeikam. Die anderen Mitspieler verloren nie ein Wort darüber, dass er den Jungen mitbrachte. Sie hätten es wohl auch kaum gewagt, nicht einverstanden zu sein, denn alle wussten, dass Chen inzwischen dem Büro für öffentliche Sicherheit angehörte – und dessen Mitglieder waren unantastbar.
Den Kopf bis über das Lenkrad vorgereckt, schaltete der Fahrer einen Gang zurück und ließ die Kupplung unsanft kommen, worauf der Wagen abrupt abbremste und Chen nach vorn geschleudert wurde. Als er sich wieder gefangen hatte, erblickte er durchs Fenster eine Ortschaft, die in der Mittagssonne brütete.
Der Fahrer schloss zu dem führenden Jeep auf. Als sie hielten, sprangen die Soldaten eilig aus den Fahrzeugen und schwärmten über den Dorfplatz aus. Alle waren mit Gewehren bewaffnet. Die Bewohner wichen erschrocken und verängstigt in ihre Hütten zurück.
Chen schaute durch die verdreckte Windschutzscheibe nach draußen. Trotz der stickigen Hitze im Jeep und obwohl er sich liebend gern die Beine vertreten hätte, wünschte er, sich nicht von der Stelle bewegen zu müssen.
Seine Vorgesetzten in Peking mussten wissen, wie sehr er all dies hier verabscheute. Es war immer das Gleiche. Immer eine Prüfung. Und der würde er sich stellen müssen, sobald er den Wagenverschlag öffnete und ausstieg. Die Würfel waren gefallen.
Jemand klopfte vorsichtig an die Scheibe. Chen fuhr herum und sah einen Mann dicht vor der Beifahrertür. Mit einem Schlenker aus dem Handgelenk forderte er ihn auf zurückzutreten und öffnete seufzend den Verschlag.
Die Hitze war unerträglich, und alles war voller Staub, festgebacken auf Hütten, Fahrzeugen und Menschen. Alles grau und grabesstill.
Chen straffte die Schultern, richtete sich zur vollen Größe auf und winkte den Mann herbei. Er war kein Tibeter. Inder vielleicht oder eine Mischung aus beidem. Seine Blicke huschten hin und her, unstet wie eine Fliege, die nirgends länger verweilt. Seine Zähne waren stark abgenutzt und die verfärbten Zahnhälse sichtbar unter krummen Stummeln.
«Wo ist er?», fragte Chen und starrte sein Gegenüber an.
«Zuerst das Geld», entgegnete der Mann und rieb langsam Daumen und Zeigefinger aneinander. Chen griff in seine Gesäßtasche und zog ein kleines Bündel daraus hervor, Fünfzig-Yuan-Scheine, zusammengehalten von einem Gummiband. Er warf es ihm zu und hielt Abstand.
Der Mann zählte die Scheine, indem er die Ecken aufblätterte, und ließ sich Zeit. Schließlich hob er den Arm und zeigte auf eine unauffällige Hütte am Rand des Platzes.
«Bist du sicher?»
«Ja», antwortete der Mann leise. «Ich habe aufgepasst.»
Chen gab den Soldaten ein Zeichen, ein Kommando mit der Hand, die in zackiger Bewegung die Luft durchschnitt. Sie kehrten zurück und nahmen hinter ihm Aufstellung. Als er sie auf die Hütte zu führte, spürte er auf seinem Rücken und unter den Achseln Schweiß ausbrechen. Als er die ramponierte Holztür erreichte, stieß er sie schwungvoll auf.
Es war so finster, dass er auf Anhieb nichts erkennen konnte. Als sich seine Augen an die Dunkelheit gewöhnt hatten, machte er in dem spärlichen Licht, das durch die Ritzen in den Bretterwänden drang, eine winzige Wohnstube aus: eine zentrale Feuerstelle, ein paar Töpfe und Pfannen und niedrige Holzhocker. Eine junge Frau mit schmutziger Schürze tauchte plötzlich auf und stieß beim Anblick der Soldaten einen spitzen Schrei aus. Chen gab wieder ein Zeichen, worauf zwei seiner Männer auf die Frau zu stürzten und sie nach draußen zerrten.
Den Kopf wegen der niedrigen Decke eingezogen, durchsuchte Chen die Hütte und fand zwei weitere Räume. In dem einen hockte ein Junge mit verschränkten Beinen auf dem Boden. Seine braunen Augen, vor Schreck weit aufgerissen, folgten jeder Bewegung des Leutnants. Er war klein und drahtig, sein Gesicht dreckverschmiert, und obwohl noch ein Kind, wirkte er ruhig und beherrscht. Es schien, als hätte er sich noch nicht entscheiden können, ob er Verwirrung oder Angst empfinden sollte.
Er blieb sitzen und legte den Kopf in den Nacken, um dem großen Mann, der vor ihm stand, ins Gesicht zu sehen.
«Wie heißt du?», fragte Chen auf Tibetisch und hatte das Gefühl, als kämen die Wörter wie von selbst aus seinem Mund.
«Gedhun», antwortete der Junge leise.
Als er den Namen hörte, schloss Chen für einen Moment die Augen, wie, um sich der Welt zu entziehen.
«Komm her», sagte er und winkte den Jungen zu sich.
Der stand zögernd auf und trat auf ihn zu. Die kleinen Hände waren zu Fäusten geballt.
«Keine Angst», hörte sich Chen sagen. «Mach die Augen zu.»
Er betrachtete diese Hände und versuchte, nicht an seinen eigenen Sohn zu denken.
«Na los», sagte er. «Mach die Augen zu.»
Der Junge kniff die Augen zusammen. Ein paar Tränen rollten über die schmutzigen Wangen und ließen zwei helle Spuren darauf zurück.
Seine Lippen bewegten sich im stillen Gebet, als die Kugel kam. Sein kleiner Körper wurde durch den Raum geschleudert, prallte an die Wand und sackte schlaff zu Boden.
Auf den betäubend lauten Schuss folgte gespenstische Stille. Chen sank auf die Knie. Sein Magen verkrampfte sich. Er glaubte ersticken zu müssen.
Und das war nicht nur bloße Einbildung. Er bekam tatsächlich keine Luft mehr: Der Atem versagte ihm. Er griff sich an den Hemdkragen und versuchte verzweifelt, die Krawatte zu lösen. Taumelnd eilte er zurück in die Wohnstube, riss dabei einen Topf vom Rand der Feuerstelle und hörte ihn polternd zu Boden fallen, als er die Tür erreicht hatte und hinaus in die schreckliche Hitze wankte.
Sie standen alle da und starrten ihm mit leeren Blicken entgegen. Chen schleppte sich auf die Jeeps zu, lehnte sich an eines der Fahrzeuge und schnappte nach Luft. Hektisch riss er die Tür auf und suchte nach der Zigarettenschachtel des Fahrers. Er fand sie unter dem Sitz und steckte sich eine Zigarette in den Mund. Sein Versuch zu inhalieren misslang. Er schaffte es nicht, so fest er auch am Filter saugte.
Warum klappte es nicht?
Es war der Sergeant, der seine zitternden Hände ergriff, sie für eine Weile still hielt und ihm dann Feuer gab. Chen inhalierte tief, einmal, zweimal und ein drittes Mal in rascher Folge. Schließlich atmete er keuchend aus und blies eine Rauchwolke in den Himmel.
«Holt die Leiche. Peking will sie sehen», murmelte er. «Und schafft die verdammten Leute aus dem Haus.»
Der Sergeant nickte, eilte davon und brüllte seine Order. Chen schaute ihm nach, dann ging er um die beiden Jeeps herum und verzog sich in den Schatten einer nahe stehenden Hütte. Nach einem weiteren tiefen Zug aus der Zigarette beugte er sich vornüber, stützte sich mit den Händen auf den Knien ab und erbrach.
6.KAPITEL
«Duhast drei Monate nichts von dir hören lassen, stehst dann mir nichts, dir nichts mit einem Rucksack voll dreckiger Wäsche auf der Matte und verlangst von mir, dass ich ein paar alte Satellitenkarten für dich raussuche… Wie kommt’s, dass mich all das kaum überrascht?»
Luca lächelte. Er saß auf einem Ledersessel, hatte die Beine ausgestreckt und dachte zurück an die Zeit, in der er sich vor Jack Miltons zerfurchtem Gesicht und seinem bohrenden Blick noch gefürchtet hatte. Als Junge hatte er oft hier in dessen Arbeitszimmer, genau auf diesem alten Polsterstuhl, gesessen und unter der drückenden Schwere gelitten, die sich immer dann einstellte, wenn der Onkel in Schweigen verfiel, woran er offenbar Gefallen fand.
Für den jungen Luca waren Jacks vorzeitig gealtertes Gesicht und die zitternden Hände Zeichen seiner Außergewöhnlichkeit gewesen. Er war Professor für Geologie an der Cambridge University und irgendwie anders als alle anderen, in allem, was er tat, unvorhersehbar, oft chaotisch und planlos. Erst als Erwachsener hatte Luca die Absonderlichkeiten des Onkels als das ansehen können, was sie im Grunde waren – Folgen der Alkoholsucht, der Jack erst sehr spät entkommen war. Inzwischen trank er nur noch Kaffee, und so zwanghaft wie früher seine Sucht war nun sein Studium der Gesteine.
Das Arbeitszimmer hatte sich in all den Jahren kaum verändert. Die Wände waren vom Boden bis zur Decke mit Regalen zugestellt, die unter der Last der verstaubten Folianten einzustürzen drohten. Auf Schulterhöhe waren an mehreren Stellen die Bücher zur Seite geräumt worden, um Platz für Gesteinsproben zu schaffen, die in kleinen Häufchen nebeneinanderlagen.
«Du bist der einzige Mensch, von dem ich sicher weiß, dass es ihm scheißegal ist», sagte Luca und tunkte einen Keks in seinen Kaffee.
«Freut mich, an erster Stelle einer langen Liste zu stehen», lachte Jack, wobei sich die Fältchen um seine Augen vertieften. «Aber lass dich nicht unterbrechen. Erzähl mir alles. Der Makalu hat’s wohl in sich, nicht wahr?»
Luca schwieg.
«Ist was?», fragte Jack sichtlich irritiert.
«Bill hat die Höhe nicht vertragen. Wir mussten knapp unterm Gipfel umkehren, und beim Abstieg hat’s Stunk gegeben. Irgendwie ist immer noch dicke Luft zwischen uns.»
«Oh, das tut mir leid», sagte Jack. «Ich weiß, wie viel ihr in die Sache investiert habt. Sei’s drum, als alte Freunde, die ihr seid, rauft ihr euch bestimmt wieder zusammen.»
«Ja, wahrscheinlich.»
«Es wird doch wohl nichts passiert sein, das nicht wiedergutzumachen wäre, oder?»
Luca zuckte mit den Achseln. «Mir wär’s lieber, wir würden das Thema wechseln.»
Jack zog die Brauen zusammen und nahm einen Schluck Kaffee. «Na schön. Du wolltest mir ein bisschen mehr von dieser Bergpyramide erzählen.»
Luca lächelte, seine Miene heiterte sich auf.
«Ich wünschte, du hättest sie gesehen, Jack. Einfach unglaublich. Allein die Lage, inmitten eines Kranzes aus Bergen. Hast du je davon gehört?»
«Nein», antwortete Jack. Er stand auf und ging zum Schreibtisch. «Nach deinem Anruf war ich in der Bibliothek und habe mich über die Gegend im Osten des Makalu schlau zu machen versucht. Hat ’ne Ewigkeit gedauert, bis ich das hier gefunden und den Staub abgepustet habe. Es sind wohl nicht gerade die am meisten nachgefragten Dokumente der Welt.»
Er nahm die Karten, breitete sie auf dem kleinen Beistelltisch aus und ging davor in die Knie. Dann fischte er seine Lesebrille aus der Brusttasche und hielt den ersten großen Bogen ans Licht.
«Das ist eine Satellitenaufnahme, ziemlich aktuell, gerade mal sechs Monate alt.»
Er betrachtete sie von nahem, studierte die Feldeinteilung und folgte mit dem Finger den Konturen des Himalaja. Plötzlich hielt er inne, deutete auf eine Stelle und sagte: «Da, der Makalu.»
Luca rückte um den Tisch herum und schaute seinem Onkel über die Schulter. Die Satellitenaufnahme zeigte einen perspektivisch verzerrten Ausschnitt einer zerklüfteten Gebirgswelt mit zahllosen Gipfeln, Wolken und Tälern.
«Ich schätze, die Pyramide befindet sich circa achtzig Kilometer östlich», sagte Luca. «Irgendwo hier.»





























