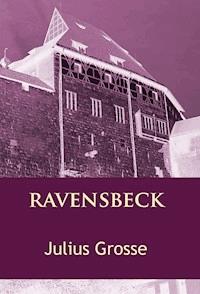4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Deutscher Novellenschatz
- Sprache: Deutsch
Der "Deutsche Novellenschatz" ist eine Sammlung der wichtigsten deutschen Novellen, die Paul Heyse und Hermann Kurz in den 1870er Jahren erwählt und verlegt haben, und die in vielerlei Auflagen in insgesamt 24 Bänden erschien. Um die Lesbarkeit zu verbessern, wurden in dieser Edition die sehr alten Texte insofern überarbeitet, dass ein Großteil der Worte und Begriffe der heute gültigen Rechtschreibung entspricht. Dies ist Band 20 von 24. Enthalten sind die Novellen: Grosse, Julius: Vetter Isidor. Ludwig, Julie: Das Gericht im Walde. Ungern-Sternberg, Alexander von: Scholastika.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 287
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Deutscher Novellenschatz
BAND 20
Deutscher Novellenschatz, Band 20
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
86450 Altenmünster, Loschberg 9
Deutschland
ISBN: 9783849661281
Das Korpus „Deutscher Novellenschatz“ ist lizenziert unter der Namensnennung 4.0 International (CC BY 4.0) Lizenz und Teil des Deutschen Textarchivs. Eine etwaige Gemeinfreiheit der reinen Texte bleibt davon unberührt. Näheres zum Korpus und ein weiterführender Link zu den Lizenzbestimmungen findet sich unter https://www.deutschestextarchiv.de/novellenschatz/. Um die Lesbarkeit zu verbessern, wurden die sehr alten Texte insofern überarbeitet, dass ein Großteil der Worte und Begriffe der heute gültigen Rechtschreibung entspricht.
www.jazzybee-verlag.de
INHALT:
Scholastika.1
Vetter Isidor.52
Das Gericht im Walde.120
Scholastika.
A. von Sternberg.
Vorwort.
Alexander Freiherr von Ungern-Sternberg, geb. den 10. April 1806 auf dem Gute Noistser bei Reval in Estland, wo sein Vater Landrat war, wurde nach dem Tode desselben, von einem Oheim in Dorpat erzogen, besuchte dort das Gymnasium und die Universität, auf der er sich mit der Jurisprudenz, die er studieren sollte, wenig beschäftigte Im Jahre 1829 ging er nach Petersburg, um sich nach dem Wunsche seines Oheims für eine Staatsanstellung vorzubereiten. Das Missbehagen an den dortigen Verhältnissen und seine Unkenntnis des Russischen vereitelte diesen Plan. Von der Kaiserin, die sich für sein bedeutendes Zeichentalent interessierte zum Zwecke künstlerischer Ausbildung unterstützt, begab er sich 1830 nach Dresden. Die von der Bekanntschaft mit Tieck erhaltenen Anregungen führten ihn zur literarischen Produktion, gegen welche die Übung des anderen Talents mehr und mehr zurücktrat (eine Probe desselben erschien 1848 in seinen Illustrationen zu „Tutu“). 1831 reiste er nach Süddeutschland, hielt sich 1832 in Stuttgart auf, wo durch G. Schwabs Vermittlung seine Novellen „die Zerrissenen“, die Fortsetzung derselben „Eduard“ (1833), „Lessing“ (1834) und „Molière“ (1834) im Cottaschen Verlage erschienen. Von Stuttgart siedelte er nach Mannheim über, zu dreijährigem Aufenthalt, kehrte nach Stuttgart zurück (Bekanntschaft mit Lenau) und wandte sich dann wieder dem Norden zu, wo er Berlin endlich zu seinem dauernden Wohnsitz wählte. Zu Anfang der 50er Jahre verheiratete er sich mit einem Fräulein von Waldow und hielt sich meist in Dresden auf. Vom Jahre 1862 an durch ein Gehirnleiden in seinen geistigen Fähigkeiten mehr und mehr gelähmt, starb er im Irrsinn auf dem Gute Dannenwald in Mecklenburg-Strelitz am 24. Aug. 1868.
Sternberg ist der Schule Tiecks niemals ganz entwachsen, und in so mancherlei Stoffen er sich versucht hat, ist es ihm so wenig, wie seinem Meister, gelungen, seinen oft geistreich erfundenen Figuren volle Lebenskraft einzuhauchen. Das leichtbewegliche Spiel seiner Phantasie bringt es selten zu wahrhafter Illusion, und seltener noch scheint es ihm mit den sittlichen Motiven rechter Ernst zu sein; so ist denn auch sein Stil, bei aller scheinbaren Gewandtheit, im Grunde unlebendig und konventionell, der echte Naturlaut steht ihm nicht zu Gebote (der Monolog auf S. 36 und 37 unserer Erzählung !), und nur bei der Beschreibung äußerlicher Dinge oder Zustände kommt sein Zeichentalent dem Erzähler glücklich zu Statten Gleichwohl durfte ein so vielgenannter Name, wie der seinige in unserer Sammlung nicht übergangen werden, und der sehr charakteristische Hintergrund der hier mitgeteilten Erzählung wird ihre Wahl hoffentlich auch bei solchen Lesern rechtfertigen, denen die Durchführung des psychologischen Problems viel zu wünschen übrig lässt.
***
In der Nähe von Kiew befindet sich ein Nonnenkloster, dessen Bewohnerinnen sämtlich Malerinnen sind; doch möchten sie schwerlich vor dem Richterstuhle der Kunstkritik Gnade finden. Diese einsamen und in strenger Zurückgezogenheit lebenden Religiosen führen den Pinsel und die Palette, wie ihre Schwestern wenige Meilen aufwärts in dem neugegründeten Kloster die Nähnadeln und die Schere führen: lediglich in mechanischer Tätigkeit. Aus den Zellen unsrer künstlerischen Nonnen gehen Christusbilder, Johannesköpfe und Magdalenen- und Marien-Gestalten hervor, wie aus dem benachbarten Kloster Kattunschürzen, Florhäubchen und gestickte Mieder hervorgehen; es ist dies ein Zweig der Handgeschicklichkeit wie jeder andre. Russland hat in seinen zahllosen Kirchen und Klöstern eine Unmasse von Heiligenbildern nötig; dazu kommt, dass jede Privatwohnung, von dem Palast des russischen Großen an bis in die Hütte des Bauern hinab, eines „Obras“ (Heiligenbildes) bedarf, und um den Bestellungen und Nachfragen zu genügen, sind hier und da im Lande Heiligenbilderfabriken angelegt, wo die Schöpfung dieser stereotypen Gemälde noch viel handwerksmäßiger betrieben wird, als in den Klöstern. In diesen letzteren Behausungen kann man doch immer annehmen, dass irgend religiöser Sinn einwirkt und das tote Machwerk belebt, anders ist es aber, wo nur leidige Konkurrenz zu flüchtigen und gedankenlosen Produktionen hintreibt.
Unserm Kloster war das Privilegium, Heiligenbilder zu malen, schon sehr frühzeitig gegeben worden. Die darauf bezügliche Urkunde war verbrieft und mit der Unterschrift des großen Gregorius versehen, des zweiten Metropoliten dieses Namens, der seine bischöfliche Behausung in den Mauern von Kiew aufgeschlagen hatte, und dessen Lebensende durch die Streitigkeiten mit dem Mönche Simon getrübt wurde, der anmasslich als Nachfolger des heiligen Andreas von Nowgorod die Würden dieses Priesters sich aneignete und die Ruhe des Sprengels auf eine höchst betrübende Weise störte. Der ehrwürdige Patriarch wandte, ehe diese zänkischen Ereignisse sich in den Frieden seiner Tage mischten, einen großen Teil seiner Aufmerksamkeit und seiner apostolischen Liebe den Nonnen des Klosters der heiligen Anna zu. Er schenkte dem Altar ihrer Kirche einige Messgewänder und Decken von einem, für die damaligen Zeiten, außerordentlichen Werte; dann ließ er sich herab, die Bibliothek des Klosters mit einer Anzahl von Skripturen zu dotieren, die sämtlich aus vermorschten Pergamentrollen bestanden, deren Schriftzüge Niemand mehr enträtseln konnte; ein Umstand, der nicht wenig dazu beitrug, dass man sie mit einer andächtigen Scheu betrachtete und sie gewissenhaft den Motten und dem Schimmel preisgab zur Weiterbeförderung ins Reich der Vergänglichkeit. Die Liebe des ehrwürdigen Kirchenfürsten für die Bräute Christi ging sogar so weit, dass er sein eigenes Schlafgemach eines kostbaren Heiligenbildes beraubte und dasselbe in einer eigens dazu erbauten Seitenkapelle des Klosters aufstellen ließ. Dieses Gemälde stellte den heiligen Georg vor, den Schutzpatron Russlands und unseres Patriarchen. Es war hier nicht die Rede davon, zu erkennen, als was und wie der Maler sich den Gegenstand seines Bildes ausgedacht hatte, das Ganze war ein einziger tintenschwarzer Grund, eingefasst in eine Glorie von Goldblech, die ungefähr die Formen eines Ritters zu Pferde angab, jedoch äußerst unvollständig, und zwar in der Art, wie, wenn Kinder aus einem Bilderbogen eine Gruppe herausgeschnitten haben, die übriggebliebenen Papierreste noch anzuzeigen fähig sind, ob der entnommene Gegenstand ein Pferd, ein Turm oder ein Triumphbogen war. Die Goldverbrämung dieses undeutbaren Bildes war auch unstreitig die Hauptsache; die Perlen, die Diamanten, die im Golde schwammen, die fingerlangen Buchstaben in slawonischer Sprache, die um den Rand des Bildes herumliefen, und wo ebenfalls kleine schwarze Kleckse anzeigten, dass einst kleine Miniaturen sich hier eingeschoben hatten, gaben den alleinigen Gegenstand der Bewunderung und der Verehrung her. Man zählte sieben große und siebenzig kleine Perlen; die ersteren von der Größe kleiner Haselnüsse, die letzteren wie Erbsen groß, und noch dazu eine Anzahl sogenannter Staubperlen, die immer zu einer Gruppe von zehn bis dreißig vereinigt einen Edelstein von glänzender und schöner Farbe einschlossen und somit in den Ecken Rosen bildeten, die aus dem abwechselnd matt und glänzend gearbeiteten Goldfelde erblühten. Die Märtyrerkrone des Heiligen, die von zwei noch erkennbaren Engeln in roten und fleischfarbenen Gewändern getragen wurde, bestand aus einem byzantinischen Diadem mit siebenzehn Eckzacken in Form von Kreuzen und jede in eine Spitze auslaufend, die ein Rubin vom schönsten Wasser zierte. Der Patriarch, als er auf diese Krone wies, machte die Bemerkung, dass drei dieser Steine ein Dorf von der Größe und Ausdehnung des Klostergebiets an Wert aufwögen, und dass man für die übrigen die Gerichtsbarkeit einer kleinen Stadt an sich kaufen könne. Als das Bild in Prozession ins Kloster gebracht wurde, ereignete sich das Wunder, dass eine weiße Taube, den Zug begleitend, mit in die Kirche drang und ihren Platz auf der ersten Altarstufe einnahm, wo sie neben dem diensttuenden Priester und unbekümmert um die Geschäftigkeit, die um den Altar herum herrschte, ausharrte, bis die Feierlichkeit der Einsegnung vorüber war, und sie erhob sich, als der ambrosianische Lobgesang ertönte, um, auf den makellosen Fittichen daher schwebend und gleichsam getragen von den süßen, bläulichen Wölkchen des Weihrauchs, in raschem und lieblichem Fluge die Kirche zu verlassen. Die Nonnen, die hinter ihrem Gitter dem Wunder zuschauten, erklärten die Taube für den Geist der heiligen Anna, die da gekommen war, dem herrlichen Wundertäter Georg, diesem christlichen Helden und Ritter ohne Furcht und Tadel, ihre Begrüßung in den ihr geheiligten Mauern darzubringen.
Als es bekannt wurde, dass das Bild des heiligen Georgs in dem Besitze der Nonnen war, gingen aus weiter Ferne Bestellungen ein, die eine Kopie dieses Bildes forderten. Es war dies eine schwierige Aufgabe. Etwas zu malen, was gar nicht existierte, eine Kopie von einem Gegenstand zu geben, der im Original gleichsam gar nicht vorhanden war, — man musste die guten Nonnen entschuldigen, wenn sie in diesem Falle auf seltsame Auswege gerieten. Das heilige Bild durfte nicht herabgenommen und noch weniger ganz in der Nähe mit einer profanen Aufmerksamkeit betrachtet, wohl gar durch ein Glas untersucht werden; was man jedoch aus erlaubter Ferne gewahrte, war, wie gesagt, nichts als ein schwarzer Klecks von einiger Ausdehnung. Wenn das Auge, das sich an das Dämmerlicht der Kapelle gewöhnt hatte, mit einer leidenschaftlichen und nicht ermüdenden Anstrengung hinstarrte, so wurde aus dem Dunkel ein einzelner dürftiger heller Farbenfleck bemerkbar; dies musste nun das Gesicht des Heiligen sein. Allein wenn hier sein Kopf war, so wurde damit das Pferd zu einer Größe herabgedrückt, die es wie einen mäßigen Ziegenbock erscheinen ließ, abgesehen davon, dass der unter dem Pferde befindliche Drache dann wie ein Hündchen in einer vollgepfropften Postkutsche unter den Füßen der Reisenden zusammengedrückt zu liegen kam. Diese Annahme wurde daher verworfen und der helle Punkt im Gemälde für den feuerspeienden Rachen der Untiers erklärt. Aber diese Interpretation fand auch ihre Schwierigkeiten; man wusste nicht wohin jetzt mit dem Kopfe des Ritters und mit der Figur des Pferdes; endlich, da alles Grübeln nichts half, überzog man eine Leinewand mit schwarzer Farbe und legte dann das Goldblech darauf, das man auf minutiöseste Weise in allen Ausschnitten, Ausbeugungen und Beulen wiedergab. Die Käufer waren vollkommen zufrieden. Wir haben diesen Umstand so ausführlich behandelt, weil sich hieraus der Standpunkt angeben lässt, auf dem die Kunst der Bilderfabrikation damals in unserm Kloster stand. Sie ist seitdem nicht viel höher gerückt.
Einige Jahrzehnte nach den obigen Ereignissen erlitt das Kloster einen Brand und eine Plünderung. Durch den Mut und die Aufopferung des weltlichen Schutzherrn wurden dem heiligen Hause seine Schätze und Kleinodien erhalten, allein die Mauern hatten so arge Beschädigungen hinnehmen müssen, dass die Bewohnerschaft auf ein Jahr auswandern und sich in einem ehemaligen Jagdschlosse einquartieren musste. Die Nonnen mit ihren Farbentöpfen, ihren Paletten und Staffeleien pilgerten mit Gesang aus den Ruinen ihres Klosters und zogen ebenso mit Gesang in die Hallen ein, die mit wilden Schweinsköpfen, Rehgeweihen und Bärentatzen geziert waren, und die von dem wilden Lärm einer zechenden Jagdbrüderschaft einst widerhallten. Nach wieder hergestellter Ruhe wurde in dem darauf folgenden Jahre eine Deputation nach Petersburg gesendet, und diese kehrte heim, mit Geschenken und Ehrenbezeigungen beladen. Der Ankauf von drei gutversehenen Höfen nebst einigen Bezirken Waldes war die Folge der steigenden Reichtümer des Klosters. Die Nonnen gaben jetzt das Bildermalen auf und lebten wie reiche Frauen im Schoß des Nichtstuns und der Üppigkeit fast ein halbes Jahrhundert hindurch. Dann traf in jenen unruhigen Zeiten, die der Thronbesteigung Peters des Ersten vorangingen, das Kloster aufs Neue Missgeschick und Verfolgung. Es verlor seine Schätze, und die Nonnen kehrten zu ihrer ausgespannten Leinewand und ihren Holztafeln zurück, indem sie sich von Neuem anschickten, Glorienscheine von Goldblech und Blumen aus Silberzindel zu verfertigen. Es kostete Mühe, wieder die alte Kundschaft zu erlangen und den Ruf des Klosters zu erneuen, den es in den Jahren des Müßiggangs und der Schwelgerei eingebüßt hatte, allein das glückte dennoch, und die Bestellungen liefen von Jahr zu Jahr zahlreicher ein.
Bis zu den neuesten Zeiten, in denen unsre Geschichte spielt, war das Glück und die Wohlhabenheit des Klosters im Steigen; gleichwohl war der Grad der Vervollkommnung seiner Kunstproduktionen seit Jahrhunderten immer derselbe geblieben und ist es noch an dem heutigen Tage. Ohne Zweifel ist die altbyzantinische Kunst, wie sie nach Italien überwanderte und noch den Bildern des Giotto und Cimabue kenntlich ihren Stempel aufdrückte, der Typus der russischen Heiligenbilder. Es ist die gänzliche Entfernung aller freien Bewegung, aller Individualisierung der Hauptcharakter dieser frühen Epoche. Ein langes, schmales, blasses Antlitz, stets von vorne aufgefasst, mit hellbraunen Augen, langer, dünnrückiger Nase, schmalem und geschlossenem Munde und einem von einem zierlich gekräuselten, in hergebrachter Form bald in zwei, bald in Eine Spitze auslaufenden Barte umgebenen Kinne, langem, lichtbraunem, gescheiteltem Haar — ist ein Christusbild. Eine schmale, langfingerige Hand, deren drei Finger erhoben, zwei in den Ballen der Hand niedergedrückt sind, gehört ebenfalls unerlässlich zum Bilde, ebenso wie das rote Leibgewand und der blaue Überwurf. Ein langes, schmales, weibliches Antlitz, mit eben solch hellbraunen, ausdruckslosen Augen, derselben langen und dünnen Nase, demselben dünnlippigen, geschlossenen Munde ist die Madonna. Sie trägt das Kind, das mager und unkindlich geformt ist und nach altkirchlichem Stil die Hand nach oben beschriebener Weise emporhebt. In dieser Weise folgen die Heiligen und Märtyrerinnen, genau in demselben Charakter, wenn man die völlige Charakterlosigkeit Charakter nennen kann, aufgefasst. Nur der Name und eine dazu gefügte kurze Gebetformel lässt den Beschauer erkennen, welchen Würdenträger der Legende er gerade vor sich habe. Diese Bilder werden in Kisten verpackt und zu Hunderten versendet. Sie haben ihren bestimmten Preis, wie jede andre Ware, und bei ihrer Bestellung wird nur über das Beiwerk von Metall und Schmucksachen, nie über das Bild gehandelt.
Wir treten nun in das Kloster selbst ein. Es ist ein niedriges Gebäude mit plattem Dach und rundgewölbter Tür und Fensteröffnungen, völlig abweichend von dem pittoresken und romantischen Baustil der mittelalterlichen Klöster in Deutschland, England und Frankreich. Nur ein verdeckter Gang, der im Inneren des Hofes den Nonnen zum Lustwandeln dient, kann an die Kreuzgänge jener alten Mönchssitze erinnern. Die Kirche zeigt eine vergoldete Kuppel in der byzantinischen Form, wie sie die Kirchen Moskaus und aller altrussischen Städte vorweisen. Die Hauptkuppel ist von vier kleineren Kuppeln, auf schlanke Türmchen gesetzt, eingefasst, die eine Anzahl Glocken in ihrem Inneren bewahren, welche an den Festtagen des Klosters einen betäubenden Lärm erregen. Die Wirtschaftsgebäude liegen in einem weiten Halbzirkel um die Kirche herum nach Osten zu; auf der entgegengesetzten Seite breitet sich ein Landsee aus; an diesem hin führt die Straße nach Kiew, die sich ungefähr auf der Mitte des Weges teilt, um zu dem Landsitz eines Edelmanns hinzuleiten, der der nächste Nachbar des Klosters ist, und mit dem sich gut zu stehen die Klosterpolitik erfordert. Denn nicht allein, dass es unter den Nonnen Leckermäuler gibt, die das Geflügel und das Wild der Küche des Edelhofes den dürftigen Braten vorziehen, wie sie ihnen der Klosterpächter liefert, sondern die Gunst des jedesmaligen Eigentümers des Herrenhauses kann durch Protektion und tätige Verwendung bei den Provinzialgerichten, ja sogar bei den Gewalthabern der Residenz den hilflosen Frauen, die in eine Einöde verbannt sind, von großem Nutzen sein. Der jetzige Bewohner des Schlosses war den Nonnen persönlich bekannt, doch wussten sie seinen Namen nicht. Sie nannten ihn nur schlechtweg „Väterchen“. Nie war es ihnen eingefallen nach seinen Titeln und Würden zu fragen, noch kümmerten sie sich irgendwie um die Schicksale, die das Väterchen in der Welt betroffen haben mochten. Sie begnügten sich anzunehmen, dass die Narben, die er auf Stirn und Wangen vorwies, in einem ehrlichen Kampfe, gleichviel welchem, empfangen worden seien, und dass das Podagra und die rote Nase ihres Nachbars eine natürliche Folge seines Alters seien. Wenn sie an rauen Herbstabenden die Flintenschüsse hörten, die über den einsamen See daher schallten, freuten sie sich darüber, dass jetzt „Väterchen“ sich auf der Jagd befinde, und sie wünschten ihm einen guten Fang; wenn in finstrer Winternacht, beim Brausen des Sturmwindes und dem Geprassel eines eisigen Schneegestöbers an die Klosterfenster, das Geklingel eines Schlittens sich hören ließ, der, von dem See kommend, die Einöde entlang sich dem Walde zu bewegte, so schlossen sie das Väterchen in ihr Gebet und ersuchten die heilige Anna, den Schlitten des Reisenden vor Versinken in den Schneetriften und vor Irrefahren zu bewahren.
Es war in einer solchen dunkeln und stürmischen Nacht, als in der sogenannten Speisekammer des Klosters, einer kleinen, räucherigen und baufälligen Halle, die einen Teil des Erdgeschosses einnahm und zur Aufbewahrung einiger noch im Rohen befindlichen Speisevorräte diente, drei Nonnen noch spät beisammensaßen. Zwei derselben saßen auf einer Holzbank dem Feuer des Ofens gegenüber, die dritte hatte sich an die schwarze glasierte Wand desselben gelehnt und schien in Schlummer gesunken. Die beiden vor der Flamme Sitzenden waren liebliche, graziöse Gestalten; man hätte sie für Schwestern halten können, ein solches gleichförmiges Ebenmaß war den feinen, zarten Gesichtern aufgedrückt, derselbe Zug von Jungfräulichkeit und Sanftmut verschönte die wohlgeformten Züge, dieselbe feine und durchscheinende Röte färbte die Wangen dieser kaum dem Kindesalter entwachsenen lieblichen Mädchen. Noch erkannte man, näher hinblickend, in dem Ausdruck der Einen eine höhere Reife, eine ausgeprägtere Form, es trug dieses Antlitz schon eine Geschichte zur Schau; es waren Leiden und Freuden auf den Blättern dieser weißen jungfräulichen Rose verzeichnet, ein leichter und flüchtiger Schatten war über den Spiegel dieser schönen Stirn schon hingeglitten, während aus dem klaren Auge der Schwester die volle Frische der unberührten Seele herausschaute, mit einer Innigkeit, einem Glanz und einer Unschuldsfreudigkeit, wie sie nur dieses glückliche, noch von den Engeln gehütete Alter gewährt. Beide Nonnen hielten sich umschlungen, die feine langgeformte Hand Scholastikas, der älteren der Freundinnen, ruhte in der vollen, gerundeten Feodoras. Der Ärmelüberwurf von grobem Wollgewebe war aufgeschlagen und ließ die Arme der Mädchen sehen. Die Form der einen zeigte Fülle und Gedrungenheit, die der Andern war zierlich, aber abgemagert, ein leichter bläulicher Streifen unter dem Handgelenk wies die Spur des Malerstocks; dieses Zeichen anhaltender und anstrengender Arbeit fehlte an dem runden Arm Feodoras; dagegen schimmerte etwas höher hinauf und unter dem Ärmel nur wenig sichtbar ein goldener Reif, mit einem Schlösschen in Herzform. Die junge Nonne trug diesen weltlichen Putz nur verstohlen; es war das Andenken einer geliebten Schwester, die auf ihrem Sterbelager das Armband, zugleich mit manchem Segens- und Liebeskuss, der Trauernden übergeben hatte. Ein solches Geschenk entweiht auch den Arm einer Nonne nicht.
Du bist heute ganz besonders niedergeschlagen, mein teures Schätzchen, hob Feodora an, indem sie mit ihren großen, blitzenden Kinderaugen zur Schwester empor sah. Was ist dir denn, Scholastika? Du erzählst mir heute keine von deinen schönen Geschichten. Willst du, dass ich Marfa wecke? Die Stille um uns her hat sie in Schlaf gewiegt; und in der Tat, es erregt Grausen, den Sturm um die alten Mauern heulen zu hören und dabei ein ernstes und schweigsames Menschenantlitz vor sich zu sehen.
Wenn ich heute stiller bin, wie gewöhnlich, entgegnete Scholastika, so ist der Grund Ermüdung und Abspannung. Denke nur, wie angestrengt ich habe arbeiten müssen, um das Dutzend Bilder, die morgen in aller Frühe abgehen sollen, fertig zu haben. Und wenn Anna nicht bald kommt, so werde ich dennoch nicht der Äbtissin Wort halten können, denn mir fehlt Ultramarin. Das letzte Stäubchen in der Büchse ist aufgebraucht, und der Mantel des heiligen Andreas muss noch mit jener Farbe übermalt werden.
Anuschka wird schon kommen, gute Schola! rief Feodora und schmiegte sich liebkosend an die ernste und bekümmerte Schwester. Du weißt, das Wetter ist bei ihr kein Hindernis; sie reitet trotz einem Donkosaken durch Sturm und Öde. Es wird keine halbe Stunde vergehen, und du hast dein Ultramarin. Aber, arme Schola, du darfst nicht so fleißig sein. Es taugt nicht. Deine Augen leiden darunter. Als ich ins Kloster kam, hattest du noch nicht die bläulichen Schatten, und deine Augen befanden sich nicht so tief in ihren Höhlen, wie jetzt. Du lachtest öfter, und man hörte dich sogar zur Balalaika singen. Es wäre ein Wunder, wenn dies jetzt noch geschähe. Die lustigen Possen hast du mir und Marfa überlassen.
Scholastika sah ihre jüngere Genossin mit einem kummervollen Blick an und sagte dann: Du weißt, was mich ernst und nachdenklich gemacht hat. Warum spielst du jetzt die Unwissende?
Ein Traum! rief Feodora.
Still! unterbrach sie die Nonne. Marfa könnte uns hören; und für die ist dergleichen nicht.
Aber hörst du nicht, wie sie Atem zieht? Sie schläft so tief und sicher. Lass uns von deinem Traume sprechen. Ich höre dergleichen in so stürmischer Nacht so gerne. Es kommen Engel und Teufel in deinem Traume vor, nicht wahr? Oh, wie schön ist das!
Scholastika war in Nachdenken versunken, sie hatte ihr Haupt gesenkt, eine ungewöhnliche Blässe hatte Stirn und Wangen überzogen. Doch wie eine Blume ihre schwere, tau-beperlte Krone aus den Schatten der Nacht hebt, so gewann das Haupt und der Nacken der schönen, stolz gewachsenen Jungfrau nach und nach seine erhabene Haltung wieder. Sie öffnete die Augen weit, und ein Feuer, wie es die erregte Seele in ihrem ersten Aufwallen spendet, strahlte aus diesen großen dunkeln Kreisen hervor. Es war, als wenn der Engel der Begeisterung seine Fittiche um die Gestalt der einsamen Nonne schlüge und jede ihrer Seelenkräfte um das Zweifache erhöhte. Die Trauer, die Anstrengung und die Kümmernis der langen Arbeitsstunden glitten plötzlich wie ein Schatten vor der Gestalt hinweg, und die ewige Liebe, die süße, verzehrende Sehnsucht, die strebende Glut der Andacht, Alles zusammen hob und umglänzte die Priesterin.
Ach! rief Feodora staunend. Wie schön du bist! Der Geist kommt über dich, Schola!
Hast du nie die großen Unsterblichen erschaut, rief Scholastika, deren irdisches Abbild du auf deine Leinwand bringst? Sahst du ihre leuchtenden Mienen niemals? Kamen sie nie, um sich dir in ihrer Herrlichkeit zu zeigen?
Nie! rief Feodora. Aber wie sollten sie auch. Leben sie nicht im Himmel, und sind wir nicht auf die Erde gebannt. Können sie und wir wohl miteinander verkehren?
Es ist sträflich, dies zu glauben, erwiderte Scholastika; aber dennoch, das arme Herz hat Augenblicke, wo es so stolz und herrisch in seiner Liebe ist, dass es durch sein unruhiges Pochen den Himmel selbst herab zu beschwören sich unternimmt. Es ist in uns ein Gebet, das so glühend und so stark ist, dass es unmittelbar an die goldene Pforte rührt, die den Himmelssaal verschließt.
Was hat dies aber mit den Bildern zu tun, die wir malen? fragte Feodora.
Höre mich. Ich zählte elf Jahre, als meine Verwandten, denen mein Dasein störend und lästig war, in diese Klostermauern mich begruben. Ich war von der Stunde an für sie tot. Sie konnten ihre habsüchtigen Plane nach allen Richtungen hin ins Werk richten; niemals trat ihnen mehr das blasse kleine Mädchen in den Weg, das flehend um Brot und Kleid die magern Arme ihnen entgegenhielt. Ich war tot. Hier im Kloster erhielt ich eine andere Mutter, eine andere Familie. Man unterrichtete mich im Malen, und es wurde mir gesagt, je schneller und in je größerer Masse ich die Arbeit lieferte, um desto gnadenvoller würden die Heiligen, deren Züge ich malte, auf mich herabsehen. Diese Gnade bestand in Butter und Fischen, die man mir aufs trockene Brot gab, und die eine Auszeichnung für die fleißigen Arbeiterinnen bildeten. Jetzt ist es nicht mehr so streng.
Dem Himmel sei Dank! rief Feodora, ihre runden Händchen betrachtend. Die widrigen Farbenkleckse, man kann nie die Finger völlig rein erhalten.
Ein Jahr vorher, ehe du kamst, fuhr die Nonne in ihrer Erzählung fort, war ich beschäftigt, ein großes Bild unserer Schutzheiligen zu malen. Ein Kaufmann in Twer hatte es bestellt. Auf das Gemälde wurde nur wenig verwandt, sehr viel aber auf den Rahmen. Ich nahm das alte Muster und schickte mich an, wie es gebräuchlich ist, die ausgeschnittene Form mit Farben auszufüllen. Es wurde über der Arbeit Nacht, und ich legte mich aufs Bette. Eine Stunde mochte ich geschlummert haben, als ein Glanz empfindlich auf meine Augenlider sich legte. Ich öffnete die Augen nicht, und dennoch sah ich. Der Glanz floss in einen warmen roten See zusammen, auf dessen zitternden Wellen, die halb durchsichtiges Wasser, halb Blumenflocken schienen, eine weibliche Gestalt daherflog, mit einer Krone und einem Mantel geziert. Sie kam so eilig, dass sie plötzlich, ehe ich es mir versah, dicht vor mir stand und ein leichter Wind den Zipfel ihres Mantels auf meine nackten Füße heranspielte. Ihr Antlitz schimmerte in einem süßen Lächeln, ihre weißen, vollen Schultern blühten wie zwei Schneehügel unter dem dunkelblauen, weichen, wolligen Mantelüberwurf hervor. In ihren Augen lachte eine Schalkheit des Himmels, so ungefähr wie man sich eine junge Heilige, berauscht von den üppigen Freuden des Paradieses in glücklicher Wonne erglühend, denken mag. Sie legte ihre Hand auf meine Stirn, und eine holdselige Stimme rief: Male mich so, wie ich bin, nicht wie der traurige Erdentraum mich gestaltete. Ich bin schön, ich bin eine Blume, ich bin ein Engel! — Damit entschwand sie. Der Zauber ihrer Schönheit lag noch lange auf mir, wie eine Blütendecke auf dem schwarzen Erdreich. Als die Nachtglocke zum Gebet rief, ging die schöne Heilige mir zur Seite und färbte wie mit Rosenschimmer die dunkeln Gewölbe des Kreuzganges; überall sah ich sie. Als der Morgen erglühte, stand ich, von Kummer und Schrecken erdrückt, vor der Staffelei. Welch ein mattes, farb- und glanzloses Antlitz sah mir von der Tafel entgegen! Das sollte meine blühende Anna sein? Das die schöne Erkorene der Heiligen? Das das hübsche Weib, das durch ihr Lächeln die Träne von den Wangen des Märtyrers küsste, das mit weicher Hand den ehrwürdigen Bart des Apostels kosend berühren durfte? Nimmermehr. Mit raschem Pinselzug überfuhr ich die eckigen, gebrochenen Linien, unter denen das schöne Bild meines Traumes seufzend wie hinter den Gitterstäben des Kerkers sich krümmte und wand, und setzte es glänzend in Befreiung. Damals lebte noch unsere fromme Äbtissin. Sie wusste etwas von der Kunst. Als sie in meine Zelle trat und jenes Bild sah, sprach sie zum ersten Mal zornige und drohende Worte zu mir. Du sollst eine Heilige malen, sagte sie, und du hast eine Sünderin gemalt. Wie darfst du ein Gesicht wie dieses mit der Glorie unsers Herrn umkleiden? Vernichte das Bild; ich dulde es nicht in meinem Hause.
Getroffen von ihrem Zorn, erbebte ich und weinte. Ich vernichtete das Bild. Gerührt von meinem Gehorsam, schloss sie mich in ihre Arme, drückte sie mich an ihren mütterlichen Busen. Mein Kind, sagte sie, die Welt hat der Verführungen eine große Zahl; eine der listigsten und verderblichsten ist die, dass sie die Kunst, die wir üben, mit dem falschen Glanz und Schimmer der Augenlust bekleidet. Jene Gestalt, die du gesehen, ist eine Anfechtung dieser Art. Möge sie dir zum letzten Mal in deinem Leben erschienen sein. Wache, bete und arbeite.
Ich verstehe dies nicht recht, nahm Feodora das Wort, indem sie ihr Köpfchen auf den Arm stützte und fragend der Freundin ins Auge sah; sollten denn die Heiligen wirklich so ausgesehen haben, wie wir sie malen? Alsdann hatten sie ohne Zweifel eine ungemein große Familienähnlichkeit untereinander.
Meine fromme Mutter, sagte Scholastika, belehrte mich auch hierüber. Sie zeigte mir, wie das wahre und echte Bildnis der heiligen Jungfrau und Mutter, vom Apostel Lucas gemalt, noch vorhanden sei, und wie nach diesem Bilde alle die übrigen Kopien gefertigt worden. Was die ersten Märtyrer und Wundertäter der Kirche betrifft, so sind ihre Bildnisse von inspirierten Männern gemalt worden, nicht durch irdische Mittel, sondern durch Einwirkung der himmlischen Mächte. Es wäre demnach Verbrechen, an jenen Formen etwas zu ändern. Dass sie einander ähnlich sehen, wäre eine natürliche Folge der Heiligung, die sie alle auf gleiche Weise durchdrungen. Auch die Liebe macht die Geschöpfe Gottes untereinander ähnlich, und ohne Zweifel lieben sich die Heiligen mit der festesten und unzerstörbarsten Liebe.
Oh, dann muss auch ich dir ähnlich werden! rief Feodora und schlang ihre Arme fest um den schlanken Leib der Nonne. Ich liebe dich so sehr.
Scholastika neigte sich herab und küsste die Stirn ihrer jüngeren Genossin. Seit dieser Zeit, fuhr sie fort, haben Gebet und die strenge Regel des Klosters jene Versuchungen fern gehalten. Über meiner Staffelei schwebt nicht mehr jener gefährliche Geist eignen Schaffens und Bildens; ich finde Ruhe und Seligkeit darin, das Werk mit knechtischem Sinne zu fördern. Ich male so, wie ihr Alle malt.
Nein, nein! rief Feodora lebhaft, nicht so — nicht ganz so wenigstens. Deine Bilder haben etwas Durchscheinendes, ich möchte sagen, Geistiges. Die Form ist dieselbe, aber du legst einen fremdartigen Ausdruck hinein. Ich kann dir offen bekennen, dass die Augen, die du deinen Bildern gibst, eine wundersame Gewalt auf mich ausüben. Ich werde nicht müde, sie anzusehen; es kommt mir ein Gefühl wie aus der frühesten Kinderzeit, ich möchte es ein Gebet, eine Träne, eine Ahnung nennen. Erklären lässt es sich nicht. Aber während die Heiligenbilder der andern Nonnen mich gleichgiltig lassen, sprechen die deinen lebhaft und eindringlich zu meinem innersten Wesen. Ihre sanften braunen Augen bergen so viel rührende Liebe, es sind deine eignen Augen, und du weißt, dass deine Augen dir alle Herzen gewinnen. Mit dem meinigen hast du den Anfang gemacht. Ja, ja, so ist es. Ich war flatterhaft und nichts weniger als ergeben und demütig, als ich in dies paradiesische Eiland kam, diese glückselige Insel der Farbentöpfe, dies Eldorado der Pinsel, und was hast du aus mir gemacht in ganz kurzer Zeit! Ich denke nicht mehr an die Welt; ich will nicht mehr fort, ich bleibe bei dir, denn bei dir ist mein Herz.
Dieses zärtliche Geständnis wurde unterbrochen durch eine raue Stimme, die sich trotz der Stöße des Sturmwindes bemerkbar machte, und die die Strophen eines beliebten Volksliedes sang. Zu gleicher Zeit geschah ein Schlag ans Fenster, wie mit einem dünnen Stock oder einer Reitpeitsche geführt. Die schlummernde Nonne wurde dadurch aufgeweckt, und sie taumelte auf, sich die Augen reibend und ihre Schwestern, die unverändert in ihrer ruhigen Stellung blieben, anstarrend. Nun, rief Feodora, was blickst du uns so an, als wären wir Nachtgespenster? Beliebt es dir endlich, faule Marfa, aus deinem Schlaf aufzuwachen? Geh und öffne, der Kosak ist vor der Tür.
Die Gescholtene, ein junges Mädchen, das die echt russische Nationalphysiognomie zeigte, ein breites, rundes Gesicht, einen lachenden, starklippigen Mund, Grübchen in den Wangen, kleine, schwarze, blitzende Augen und ein keckes Stumpfnäschen, sprang, ohne ein Wort zu erwidern, in die Ecke der Halle, brachte die Laterne hervor, zündete das Stümpfchen Licht an und ging lachend hinaus.
Der Ankömmling, der unter dem Namen „der Kosak“ angekündigt worden, war eine Bewohnerin dieser heiligen Mauern, aber nirgends hätte man eine Gestalt wie diese weniger gesucht, als gerade hier. Wir wollen sie ankommen sehen. Marfa bleibt in einiger Entfernung halb im Torwege stehen, denn die Massen flockigen Schnees, die ihr entgegengewirbelt werden, verhindern ihr Vorwärtsschreiten; sie begnügt sich, die Laterne so hoch und so weit hinauszuhalten, als es ihr Arm vermag. Beim Schein dieser Leuchte sehen wir aus dem Schneegewölk und den Nebeln der Nacht eine abenteuerliche Gestalt sich entwickeln. Auf einem kleinen, widerspenstigen und borstigen Rosse hockt ein in Pelze gehülltes Wesen, von dem man nicht errät, ob es Mann oder Weib ist. Der Kopf ist in Tücher gewickelt, die über die Pelzmütze hinlaufen und unten am Kinn geknüpft sind, ein schwarz und rot gewürfelter Shawl von grober Wolle ist vor den Unterteil des Gesichts gebunden und bildet hinten einen kolossalen Knoten, dessen Enden wie zwei Fledermausflügel in die Nacht flattern. Stiefel von grobem Leder und großen Dimensionen umhüllen die Beine bis übers Knie, Fausthandschuhe von Büffelleder bekleiden die Hände. Auf Schulter, Rücken, Kopf und Beinen dieser Figur liegt hoher Schnee, und die zwei Körbe, die hinten dem Klepper aufgebunden sind, scheinen keinen andern Inhalt zu haben als die Fülle des flockigen, reinen Schnees, der sich in einen einzigen Hügel vereinigt und aufgetürmt hat. Die Nonne schiebt den durchnässten Shawl vom Munde weg und schreit: Aufgemacht das Tor! Ich komme mit meinen Körben nicht hinein. Ihr Katzen, könnt ihr nicht besser aufpassen, wenn ich komme! Und während Marfa mit großer Mühe den zweiten Torflügel aufriegelt, zieht die Nonne im Triumph ein, indem sie singt: „Schöne Minka, ich muss scheiden“ —
Der Klostername der fünfzigjährigen Nonne war Anna, ihr Taufname jedoch Ljubow. Ihr Vater, der ein heruntergekommener Krämer in Jekatarinoslav war, ließ seinen drei Töchtern die Namen der drei christlichen symbolischen Tugenden, Glaube, Liebe und Hoffnung geben. Er war mit dieser Wahl nicht glücklich. Die Hoffnung (Nadéschda) kam zusamt mit dem Glauben (Véra) in ein Zuchthaus wegen einiger Unregelmäßigkeit im Privatleben und wegen der Unfähigkeit, die Begriffe von Eigentum gründlich einzusehen. Die dritte, die Liebe (Ljubow), war von einer so beleidigenden Hässlichkeit, dass die Verführungen, welchen der Glaube und die Hoffnung ausgesetzt gewesen waren und denen sie nicht zu widerstehen vermocht hatten, an sie nie sich heranwagten. Doch ja, um eines Umstandes nicht zu vergessen, man sagt, dass, während die Franzosen Moskau einnahmen, ein unglücklicher französischer Zahlmeister auf den Einfall geriet, Ljubow zu entführen. Sie blieben beide, Entführer und Entführte, buchstäblich im Schnee stecken, und der Franzose, der nicht die starke Natur seiner Dame hatte, kam ums Leben, während Ljubow bei den Flammen von Moskau zurückflüchtete, um als eine reumütige Tochter an die Tür der Wohnung ihrer Tante zu klopfen. Als Niemand öffnete, aus dem natürlichen Grunde, weil Niemand mehr im Hause war, bemächtigte sich Ljubow eines kleinen Säckels mit gesparten Silberrubeln und entfloh. Nach einigen Jahren zwecklosen Herumirrens erschien Ljubow vor der Klosterpforte der heiligen Anna und begehrte Einlass. Sie brachte einen Teil des zersprengten Warenlagers ihres Vaters mit, eine Anzahl Flaschen mit Ocker und Berlinerblau, ein Säckchen Zinnober und eine Flasche Firniss. Man nahm sie an, und während Ljubow vor dem Altar kniete, um in die Hände des Priesters ihre Gelübde niederzulegen, fand man für nötig, ein Quantum Räucherpulver mehr auf die Pfanne zu streuen, weil sich ein unerträglicher Duft von Knoblauch und Branntwein im heiligen Tempel zu verbreiten anhob. Die neue Braut Christi empfing den Schleier, wie man an heißen Tagen ein Tuch entgegennimmt, um sich die Stirne und die Wangen zu trocknen, sie setzte den Kelch mit einer erschreckenden Sicherheit an die Lippen, und eine Stunde nach der heiligen Zeremonie sah man sie schon ihre Stiefeln anziehen und hörte sie stampfend durch den Korridor dahinschreiten, einen Gassenhauer singend. Erst nach und nach gewöhnte sich die widerspenstige Nonne an den Zwang und die Sitten eines Klosters, völlig und durchaus drang sie jedoch nie in die weiblichen und sanften Gewohnheiten ein. Ihre ehrliche und derbe Natur machte sie geschickt, diejenigen Arbeiten fürs Kloster zu übernehmen, die wegen der Mühen und Beschwerlichkeiten, die sie erforderten, früher einem Klosterdiener übertragen waren. Aber Anuschka, wie sie jetzt hieß, wog einen, wohl zwei Männer auf. Sie ermüdete nicht und tummelte sich Tage und Nächte lang auf ihrem Klepper umher. Sie zog in das nächste Dorf, in die Stadt, ja über Kiew hinaus sogar an die Grenze des Gouvernements, handelte und unterhandelte, machte Einkäufe, schloss Kontrakte und kam immer bepackt und nach wohlverrichteter Arbeit fröhlich nach Hause. Zum Malen ebenso wie zum Chorsingen konnte sie nicht gebraucht werden. Ihren großen, roten und behaarten Händen entglitt der Pinsel, wie der Tatze eines Bären ein Fingerhut und eine Nähnadel entgleiten würden, und was den Gesang betrifft, so nannte die fünfzigjährige Nonne die Noten kleine jämmerliche Bestien, die ihren eignen Kopf hätten und die ihr nie hätten gehorchen wollen. Die Gutmütigkeit der alten Klosterfrau war allgemein bekannt; in jedem Dorfe, durch das sie kam, war sie sogleich von Kindern umringt, die sich an ihre Stiefeln hingen und sie vom Pferde herabzuziehen versuchten. Sie teilte Bilderbogen aus und empfing dafür von den Eltern der Kleinen Tabak, Knoblauchpastetchen und Branntwein. In einer Schenke, wo sie oft einkehrte, hatte man ihr Bild an der Wand, und es fehlte diesem Bilde nie an einem frischen Kranze, oder an einem bunten Bande. Man nannte sie den Mönch, den Kosaken, den alten Trinker — lauter männliche Spitznamen, denn in der Tat, wie hätte man bei einem Wesen dieser originellen Art an ein Weib und noch dazu an eine Nonne denken mögen.
Wie Anuschka die Halle betrat, war das Erste, dass sie sich den Schnee von den Kleidern klopfte, ihre Tücher abriss und ihr rotes, gedunsenes Gesicht, dessen Kinn und Oberlippe ein sehr kenntlicher Bart zierte, sehen ließ, dann sich auf die Ofenbank warf und ihre Hände und Füße dem Feuer hinhielt.
Hast du meinen Ultramarin gebracht? fragte Scholastika.
Ja, mein Kätzchen. Wie sollte ich die Befehle meiner schönen Königin jemals vernachlässigen! Nimm ihn dort aus der Jagdtasche heraus, die kleine Dose befindet sich neben den zwei Birkhühnern.
Ach, rief die junge Nonne unwillig, konntest du keinen besseren Platz finden. Sieh her, das Schächtelchen ist halb vom Blute der Tiere besudelt. Sie ging mit ihrem Schatze fort, um sich noch bei der Lampe an die Vollendung ihres Bildes zu machen. Unterdessen verzehrte Anuschka ein kräftiges Nachtmahl. Einige Nonnen, neugierig auf die Berichte der Ankömmlingin, hatten sich eingefunden und hörten, die Hände frierend in die Ärmel verborgen, halb gähnend und halb lachend den Worten der Erzählerin zu.
Ich will euch eine Neuigkeit sagen, hob sie an. Unser Väterchen hat Besuch auf seinem Schloss, Gäste aus der Zarenstadt, aus Petersburg. Ich sah die Fenster des Flügels erleuchtet, wo die Gastgemächer liegen. Man kann nicht wissen, ob nicht einige der Herren und Frauen unser Kloster zu besehen kommen werden.
Konntest du nicht erfahren, wer sie sind? fragte Marfa.