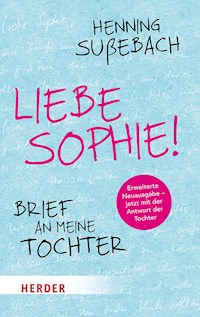9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der «Zeit»-Reporter Henning Sußebach zeichnet ein großes, glänzend geschriebenes Porträt unseres Landes. 6,2 Prozent Deutschlands sind asphaltiert und betoniert. Sußebach sucht das Abenteuer – und betritt den Rest: Er verlässt die Straßen und die Städte und durchwandert das deutsche Hinterland, vom Darßer Leuchtturm bis auf den Gipfel der Zugspitze. Seine Wanderung führt ihn in Gegenden, die wir kaum kennen, obwohl sie vor unserer Haustür liegen, und zu Menschen, die das Land bewirtschaften, aber von Städtern kaum wahrgenommen werden; Maisbauern und Hippies, AfD-Wähler und Schlachter. Und gerade hier, im Hinterland, reift die beunruhigende Erkenntnis: Die gesellschaftliche Spaltung verläuft nicht allein zwischen Armen und Reichen, sondern vor allem zwischen Stadt und Land. Den Atomausstieg oder Sanktionen gegen Russland kann man in der Stadt richtig oder falsch finden, auf dem Land können diese Entscheidungen einen den Job kosten. Doch diese existenziellen Nöte – sie werden in der Stadt kaum erkannt. Henning Sußebach erzählt mit großer literarischer Kraft von seiner Reise, auf der er die Straßen verließ und in lauter Leben trat.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 180
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Henning Sußebach
Deutschland ab vom Wege
Eine Reise durch das Hinterland
Über dieses Buch
Der «Zeit»-Reporter Henning Sußebach zeichnet ein großes, glänzend geschriebenes Porträt unseres Landes.
6,2 Prozent Deutschlands sind asphaltiert und betoniert. Sußebach sucht das Abenteuer – und betritt den Rest: Er verlässt die Straßen und die Städte und durchwandert das deutsche Hinterland, vom Darßer Leuchtturm bis auf den Gipfel der Zugspitze. Seine Wanderung führt ihn in Gegenden, die wir kaum kennen, obwohl sie vor unserer Haustür liegen, und zu Menschen, die das Land bewirtschaften, aber von Städtern kaum wahrgenommen werden; Maisbauern und Hippies, AfD-Wähler und Schlachter. Und gerade hier, im Hinterland, reift die beunruhigende Erkenntnis: Die gesellschaftliche Spaltung verläuft nicht allein zwischen Armen und Reichen, sondern vor allem zwischen Stadt und Land. Den Atomausstieg oder Sanktionen gegen Russland kann man in der Stadt richtig oder falsch finden, auf dem Land können diese Entscheidungen einen den Job kosten. Doch diese existenziellen Nöte – sie werden in der Stadt kaum erkannt.
Henning Sußebach erzählt mit großer literarischer Kraft von seiner Reise, auf der er die Straßen verließ und in lauter Leben trat.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, Mai 2017
Copyright © 2017 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
Umschlaggestaltung Anzinger und Rasp, München
Umschlagabbildung Michael Wendt/EyeEM/Getty Images
Karte Peter Palm, Berlin
ISBN 978-3-644-05541-4
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Für Nicole, Marie und Henri,
die mich gehen ließen
IDer Norden
An einem Morgen im August, an dem die Nachrichtensprecher das Land vor Sturm und Regen warnten, ging ich los. Ihre Radiostimmen hatten beleidigt geklungen, als ich sie beim Bäcker zum letzten Mal hörte; ein Tiefdruckgebiet war dabei, den Sommer über der Ostsee zu zermalmen. In den Straßen von Prerow, Mecklenburg-Vorpommern, lag Urlaubsstille. Nur ein paar Männer liefen durch den Ort, unterwegs zum Brötchenholen. Es war acht Uhr früh und der Boden taunass; ich bog ab in ein Küstenwäldchen. Als ich den Dünenkamm überblicken konnte, war der Strand leer, das Meer vom Wind schraffiert, über mir ein Himmel voll zerzauster Wolken.
Ein bisschen meteorologische Melodramatik – ich fand das ganz passend, damals.
Seit einem Jahr war der Tag im Kalender vermerkt. D-Wanderung stand da, als handele es sich um etwas Alltägliches wie einen Zahnarzttermin, einen Elternabend, einen Geburtstag in der Verwandtschaft. Doch die darauffolgenden Felder waren frei, für Tage, Wochen, Monate. Immer schneller war das Datum näher gerückt, plötzlich hatte ich ein letztes Mal im eigenen Bett geschlafen, ein letztes Mal zu Hause geduscht, ein letztes Mal die Zeitung aus dem Briefkasten geholt, ein letztes Mal die Nachbarn in ihren Autos zur Arbeit fahren sehen, ein letztes Mal vier Teller vom Tisch geräumt. Ich hatte den Führerschein aus meinem Portemonnaie genommen, den ADAC-Mitgliedsausweis, die Flugmeilenkarte, Kundenkarten von Cafés, Kaufhäusern und Wäschereien, all die in Plastik gepressten Daseinsnachweise eines Normalbürgers. Mitten im Sommer hatte ich eine Mütze in den Rucksack gedrückt und war an die Ostsee gefahren. Ich würde lange weg sein.
Vielleicht bemerkten die wenigen Urlauber, die sich im Laufe des Tages atmungsaktiv verpackt aus Hotels und Pensionen wagten, am Strand einen Mann, der in Richtung Süden ging und etwas zu dick angezogen war. Für einen Tagesausflug hatte er zu viel Gepäck dabei, seine Haare waren auf Vorrat geschnitten. Aber das konnte nur ich wissen, der ich froh war, mich nicht durch Hitze an tausend Halbnackten vorbeiwinden zu müssen. Der aufkommende Sturm war mir dabei Kumpan: Ich lehnte mich gegen den Wind und gegen das Gewicht des Rucksacks. Gesenkten Blickes sah ich meine Stiefel wie zwei fremde, braunhäutige Wesen im Wechsel über den Sand wischen. Für unbestimmte Zeit sollte dies mein Blick auf die Welt sein. Nicht gerahmt von einer Windschutzscheibe, nicht begrenzt durch einen Bildschirm.
Das Küstengetöse aus Baumrauschen und Wellenbrechen umgab mich wie ein Schutzwall. Und das war gut. Denn eine Frage wollte ich am ersten Tag nicht gestellt bekommen: «Wohin soll’s gehen?» Die Antwort erschien mir selbst irrsinnig: Ich werde einmal durch ganz Deutschland laufen, vom Meer bis in die Berge, von der Ostsee auf die Zugspitze. Und das, möglichst ohne Straßen zu benutzen, ohne Asphalt zu betreten.
Die Idee hatte im Wald auf mich gewartet, ein halbes Jahr zuvor. Es war Neujahr, ein glaskalter Wintertag. Äste und Zweige siebten das Sonnenlicht zu einem wirren Muster, unter meinen Schuhen brach gefrorenes Laub. Nach dem Mittagessen hatte ich mich ins Auto gesetzt und war an den Stadtrand gefahren; eine kleine Unternehmung zum Ende einer Schreibtischwoche und kurz vor dem Beginn einer nächsten.
Meine Frau, meine Kinder und ich; wir leben in einer Kleinstadt bei Hamburg. 30000 Einwohner, Kaufhaus, Tankstelle, Schulzentrum, Schwimmbad und das übliche Siedlungsgeschachtel aus Häusern, Hecken, Carports. Hinter der Bahnlinie, die unseren Wohnort mit Hamburg verbindet, liegt ein Moor. Eine rostige Brücke spannt sich über die Gleise, dahinter führt ein morscher Holzsteg durch eine Senke. Links und rechts Schilf und Gräser, die sich im Wasser spiegeln, einige Windungen, später dann Wald. An jenem Wintertag war das Schilf in Eis gefangen, leises Rascheln in trockenen Dolden. Ich hauchte Atemwölkchen in die Kälte, mir begegneten Herren und Hunde. Etwas in mir entschied, weiter als sonst zu laufen, mich dem Rhythmus der eigenen Schritte zu überlassen. Ich ging und ging, und irgendwann ließ mich das Gehen vergessen, dass ich ging.
Bis da diese Straße war.
Zweispurig zerschnitt sie den Wald, zerschnitt auch die Schritt für Schritt erlaufene Selbstvergessenheit. Auf solch einer Straße war ich bis zum Moor gefahren. Auf solchen Straßen war ich täglich unterwegs. Was störte mich jetzt daran?
Die Straße schien mir etwas zu sagen: So, hier ist Schluss. Dreh um und geh nach Hause, du Sonntagsspaziergänger.
Sonntagsspaziergang.
Das Wort hatte ich nie gemocht. Für ein Kind klingt es nach Langeweile. Einem Erwachsenen verrät es, dass sein Leben zu einer ewigen Wiederkehr von Werktagen und Wochenenden geworden ist, an denen in zweckmäßiger Unzweckmäßigkeit Fahrräder bestiegen, Badeseen besucht oder Wälder durchwandert werden – wobei nie gewiss ist, ob es eher darum geht, Abstand von der Arbeit zu gewinnen oder Nähe zur Natur zu finden. Einen fremden Kontinent würde ich so nicht mehr entdecken, sondern am nächsten Morgen wieder zur Arbeit fahren. In der Spur bleiben. Ein Ziel verfolgen. Nach vorne schauen statt zur Seite. Dafür war die Straße in diesem Augenblick Symbol.
Zu Hause ging ich ins Internet. Über Deutschland, las ich, liege ein dicht geknüpftes Straßennetz von 650000 Kilometern Länge. 13,6 Prozent des Landes sind als Siedlungs- und Verkehrsfläche kartiert: Straßen, Häuser, Parkplätze, Gärten, Garagen, Verkehrsinseln. Und 6,2 Prozent der Republik sind komplett versiegelt, zusammengenommen entspricht das der Größe von Rheinland-Pfalz. Überall stand, wie schlecht das ist. Wo betoniert und asphaltiert wird, kann Wasser nicht versickern, häufen sich Überschwemmungen und Erosion, stirbt Leben.
Mich schreckte eher etwas anderes. Ich bin ein Mann von Mitte vierzig, und wie so viele Menschen Mitte vierzig dachte ich, ich käme viel rum, hatte aber das betonierte Rheinland-Pfalz lange nicht mehr verlassen. Bürgersteige, Bahnhöfe, Bundesstraßen, Büros. Von Sonntagsspaziergängen abgesehen, spielt sich mein Leben auf toter Fläche ab, der Alltag ist asphaltiert, die Bewegungsabläufe sind begradigt, alle scheinbar individuell gewählten Wege deckungsgleich mit dem Verkehrsnetz. Wir sind eine hochmobile Gesellschaft, mehr und schneller unterwegs als jede Generation zuvor. Drei von vier Deutschen leben in Städten; ihre Wege werden deshalb nicht kürzer. Wir pendeln von Zentrum zu Zentrum, Hochgeschwindigkeitszüge halten Wochenendbeziehungen zusammen, Handys begleiten und beraten uns mit Staumeldern, Taxi-Apps und dem Verspätungsalarm der Bahn. Die am häufigsten verschickte Textnachricht der Jetztzeit lautet sicher: «Bin noch unterwegs.»
Aber wer «noch unterwegs» ist, ist nicht zwangsläufig in der Welt. Hessen kenne ich fast nur aus den Fenstern des ICE, Thüringen als düsteres Waldland hinter Leitplanken und den Frankenwald als Raststätte. Wann ich zuletzt mit einem Bauern geredet habe, kann ich nicht sagen.
Vermutlich geht es nicht anders in einer arbeitsteiligen, auf Effizienz getrimmten Gesellschaft. Wir spezialisieren uns, wir machen Termine, wir verschwenden keine Zeit. Bei Herzchirurgen macht das Sinn. Auch Piloten sollten routiniert sein. Ich aber bin Journalist bei der Wochenzeitung Die Zeit, und etwas beunruhigte mich: Ich bin kein Fachredakteur, kein Experte für Konjunkturfragen, Sicherheitspolitik oder angloamerikanische Literatur. Als Reporter habe ich die Aufgabe, rauszugehen, loszuziehen, Realität zutage zu fördern wie einen Rohstoff. Das ist der aufregendste Job, den ich mir denken kann. Jeden Monat mache ich etwas anderes. Mal interviewe ich Fußball-Nationalspieler, mal begleite ich aus Syrien vertriebene Dorfbewohner in ihr neues Leben in europäischen Städten, mal beobachte ich wochenlang einen aufstrebenden Politiker. Meine Arbeit hat mich nach Afrika, Asien, Amerika und Australien katapultiert. Langeweile kenne ich nicht. So sollte das auch sein in einem Beruf, dessen Kern die Neugier ist. Dessen größte Routine daraus besteht, Routinen zu brechen, Gewohnheiten zu hinterfragen und Perspektiven zu wechseln.
Nun fragte ich mich: Hat es etwas zu bedeuten, wenn sich auch ein Reporter fast nur auf jenen 6,2 Prozent des Landes bewegt, die besonders leicht zugänglich sind? «In München sein» heißt auch für mich: wie zig andere Geschäftsleute am Mietwagenschalter des Flughafens ein Auto abholen, eine Adresse ins Navigationssystem eintippen, dem Pfeil folgen, am Ziel einen Parkplatz suchen, in einer Parteizentrale, einer Fabrik, auf einem Trainingsplatz auf den Gesprächspartner warten, reden – und anschließend alles wieder zurück. Je wohlhabender und organisierter das Land ist, in dem ich unterwegs bin, desto geordneter verläuft eine Recherche. In Deutschland passiert selten etwas richtig Unverhofftes.
Habe ich keine auswärtigen Termine, ähnelt mein Alltag dem eines normalen Angestellten noch mehr: Dann geht es darum, morgens um 8.12 Uhr den Pendlerzug nach Hamburg zu erwischen, der um 8.25 Uhr im Hauptbahnhof einfährt, von wo aus ich fünfzehn Minuten ins Büro laufe, mich dort gegen 9 Uhr am Computer einlogge, und der Takt des Arbeitstages beginnt, Telefonieren, Konferieren, Produzieren, ehe ich mit Glück um 17.34 Uhr den Pendlerzug zurück erreiche, der immer von Gleis 5 abfährt und um 17.51 Uhr wieder in der Vorstadt ankommt – tut er das nicht, bricht im Waggon sofort hektisches Telefonieren aus, wird jede verlorene Minute gemeldet. So sehr sind wir Planmäßigkeit gewohnt. In aller Regel weiß ich, wann ich wo bin und wen ich dort treffe: Im Morgenzug die Nachbarn, mittags in der Kantine die Kollegen, im Abendzug wieder die Nachbarn. An Bürotagen gibt es zu fast jeder Zeit einen zugehörigen Ort, zu jedem Ort eine zugehörige Zeit und zu jeder Zeit und jedem Ort ein zugehöriges Tun und zugehöriges Personal, bei der Zeit zum Beispiel donnerstags um 11.45 Uhr im sechsten Stock eine Redaktionskonferenz – deren Beginn manchmal verschoben werden muss, weil der ICE von Berlin nach Hamburg liegengeblieben ist, die Weltlage aber erst dann besprochen werden kann, wenn jene Autoren eingetroffen sind, die Stunden ihres Lebens eingekapselt in einem Zug zwischen den beiden größten deutschen Städten verbringen.
In einem derart getakteten, spurtreuen Alltag schleifen sich auch Denkrillen ein. Wichtig wird, wovon im Zugabteil die Rede ist, was in der Reiselektüre geschrieben steht, worüber im Autoradio berichtet wird, was im Facebook-Profil passiert, während draußen das Land vorbeizieht. Dazu kommt, dass wir auch im Privatleben meist Freunde und Nachbarn mit ähnlichen Jobs, vergleichbaren Einkommen und verwandten Ansichten haben. So pendeln wir präzise getaktet zwischen Wohn- und Arbeitsort. Das Dazwischen überwinden wir so geradlinig wie möglich. Wir führen ein Leben, wie wir nicht Urlaub machen möchten: im Hop on hop off-Modus.
Wie klein und eng der Raum ist, den wir unsere Welt nennen! Was für ein Irrtum zu glauben, er dehne sich im Zeitalter der Mobilität und Globalisierung aus. Wir springen nur weiter und schneller von Punkt zu Punkt.
Ehrlich gesagt, weiß ich heute nicht mehr genau, was davon ich schon an der Straße im Wald an jenem Neujahrstag dachte. Damals hatte sich in den Vereinigten Staaten ein Präsidentschaftsbewerber namens Donald Trump in den Augen der politischen Klasse durch allerlei Unsinn und Hetze disqualifiziert. Niemand benutzte das Wort «postfaktisch». Kaum jemand sprach von «Abgehängten». Allenfalls Computernerds und Soziologen interessierten sich für filter bubbles, für Informationsblasen, die jeden von uns umhüllen. Als ich ein halbes Jahr später loslief, hatten die Briten dann für den Austritt aus der Europäischen Union gestimmt, und in den USA war Trump inzwischen zum Präsidentschaftskandidaten der Republikaner bestimmt worden, unterstützt vor allem von Männern und Frauen auf dem Land. Beim Aufbruch ahnte ich allenfalls vage, dass meine Wanderung und das Weltgeschehen etwas miteinander zu tun haben könnten. Zugleich war da noch ein spielerischer Grundgedanke, die reine Neugier, die mich trieb: Als Reporter wollte ich das Unbekannte kennenlernen, das Abseitige erkunden – zumal wenn das Abseitige so groß ist, dass man es genau genommen nicht abseitig nennen kann: fast das ganze Land!
So beschloss ich, in die Fläche zu gehen. Auf das Territorium zwischen den Linien und Punkten, auf denen wir uns bewegen. Meine Füße mit derselben Konsequenz, mit der ich bislang den betonierten Teil des Landes betreten hatte, auf frei gebliebenen Boden zu setzen. Auf die anderen – kann man wirklich sagen: die restlichen? – 93,8 Prozent. Auf Äcker statt Straßen, in Wälder statt Parkplatzwüsten.
Mir stand eine Expedition in eine naheliegende Ferne jenseits der Seitenstreifen bevor, auf einen unentdeckten Kontinent gleich nebenan. Auf einmal lag das eigentlich vertraute, von Geographen vermessene, von Satelliten fotografierte Land da wie eine terra incognita. Wäre es einfach oder schwierig, voranzukommen? Wie viele Straßen, Zäune und Gesetze würde ich überschreiten müssen? Wenn man der Langsame unter Schnellen ist: Läuft einem dann die Zeit weg – oder gibt es keine Eile mehr? Ist die Natur Freund oder Feind? Welchen Tieren begegnet man? Was für Menschen? Wird das Land da draußen gefährlicher sein als an U-Bahnhöfen, Tankstellen, Flughäfen? Was wird zwischen den vertrauten Punkten passieren?
Und: Führte mich mein Vorhaben von etwas weg – oder zu etwas hin?
Plötzlich waren da lauter Fragen, pausenlos, kaskadengleich. Werde ich, unterwegs in Wäldern und auf Feldern, politisch eher grün oder schwarz denken? Inwieweit wird das Land abseits der Straßen und jenseits der Städte mit dem Bild übereinstimmen, das wir als Zeitungsleser und Fernsehzuschauer von ihm haben? Aber auch: Wie werde ich an Wasser kommen? Wie an Nahrung? Und was, wenn ich krank werde?
So unwissend, so ausgeliefert, aber auch so fiebrig und erwartungsvoll hatte ich mich schon ewig nicht mehr gefühlt.
Tagelang saß ich über Karten gebeugt, sah den vertraut gekrümmten Umriss Deutschlands, suchte darin nach freiem Terrain, fand aber nur Zerstricheltes und Zerschnittenes und beschloss, vom Darßer Leuchtturm an der Ostsee bis zur Zugspitze zu gehen, von Mecklenburg nach Bayern. Nach geographischen Koordinaten eine Wanderung von Norden nach Süden, politisch betrachtet vom Osten in den Westen. Ein Weg, vier Himmelsrichtungen, knapp achthundert Kilometer Luftlinie und etwa tausend Kilometer über Land. Wobei «tausend Kilometer» nur eine Berechnung von Google war, die sich wieder auf Straßen bezog. Würde meine Route kürzer oder länger sein? Kein Computerprogramm, kein Navigationsgerät, kein Atlas wusste eine Antwort. Meteorologen können das Wetter vorhersagen, Biologen klonen Schafe, Weltraumforscher lassen Sonden auf fernen Planeten landen. Wie lange ein Mensch zu Fuß und querfeldein durch Deutschland braucht, weiß niemand. Würde ich vierzig, sechzig oder achtzig Tage laufen? Überhaupt ankommen? Bevor ich den ersten Schritt gesetzt hatte, hatte das Abenteuer begonnen.
Der erste Tag war stumpfes Gehen. Links der Strand, rechts das Meer, vor mir Ungewissheit, hinter mir ein Vorsatz, den ich bald gebrochen hatte: mich nicht allzu oft umzudrehen. Noch lange sah ich durch das Gischtweiß über dem Küstenstreifen den Leuchtturm, an dem ich losgelaufen war, erst backsteinrot, dann vergrauend. Brach die Sonne durch, folgte mir ein Schatten; ein Fremder mit Kapuzenkopf und Rucksackbuckel.
Regen hatte den Sand gefestigt, der Boden ließ die Schuhe federn wie zur Ermutigung. Ich trat auf Algenfäden, die an Magnetbänder aus Musikkassetten erinnerten. Am Horizont das Dreieckssegel eines Windsurfers. Noch ging ich durch touristisches Gebiet, auf dem Saum zwischen Zivilisation und Wildnis, wenn man einen Badestrand so nennen mag. An diesem Tag würde keine Straße stören, die Küstenlinie zeichnete den Weg vor, ein sandiger Korridor ins Wagnis. Das war mir recht. Ich kannte das Ufer aus früheren Sommern. Zugleich merkte ich, wie sehr mich mein Vorhaben schon am ersten Tag von Vertrautem entfremdete: Die wenigen Urlauber, denen ich begegnete, pendelten zwischen ihren Windburgen und dem Wasser, bewegten sich aus meiner Sicht quer zum Strand, ich lief nun längs. Vor jedem Schauer konnten sie jederzeit in ihre Autos oder Ferienhäuser fliehen, nummerierte Aufgänge führten durch die Dünen in eine Welt, zu der ich mir den Zutritt versagt hatte. Die Cafés, Minigolfplätze, Bademode-Boutiquen außer Sichtweite: All das ging mich nichts mehr an. Ich ging nicht schwimmen, zog nicht die Schuhe aus wie sonst und duckte mich unter Seebrücken hindurch. Die Dinge verloren die ihnen zugeschriebene Bedeutung. Ein Strand, Ort des Verweilens, diente jetzt dem Vorankommen.
Stur lief ich nach Süden, Ahrenshoop blieb ein Name auf der Landkarte, das Mittelalter-Spektakel im Ostseebad Dierhagen eine Buchstabenfolge auf einem welken Plakat. Sonderbar, was wenige Stunden des Laufens und das Wissen um eine selbstgewählte Sonderrolle mit mir machten. Als ich eine junge Strandverkäuferin um ein Käsesandwich bat, ließ sie mich warten, bis sie ein Foto der Wellen gemacht hatte, die sich an den Buhnen brachen. Die Frau, fast noch ein Mädchen, sagte «’tschuldigung, erstes Mal chier». Sie kam aus Bulgarien und sprach schleppendes, kehliges Deutsch. Obwohl wir nichts gemein hatten außer einer gewissen Verlorenheit, fühlte ich Komplizenschaft mit ihr. Als es Abend wurde, kalt und klamm, mochte ich dreißig Kilometer gelaufen sein. Auf einem Campingplatz in den Dünen schlug ich mein Zelt auf. Aus einem Sanitärhaus drangen Geschirrklappern und Duschrauschen. Nach dem Sonnenuntergang zogen einige Gäste in Gruppen in den nächsten Ort, in die geteerte Welt mit ihren Restaurants, Bars und Andenkenläden. Ich legte mich hin und wartete auf Schlaf.
Am nächsten Morgen verließ ich den Strand. Wäre ich weiter der Küste gefolgt, hätte ich irgendwann am Rostocker Hafen gestanden. Ich betrat einen moorigen Wald, dunkel und feucht, erfüllt vom Geruch faulen Laubes, gesättigt vom Regen des vergangenen Tages. Jägerhochsitze ragten aus dem Dickicht. Über den Pfaden flirrten weiße Schmetterlinge, unterwegs in ihrer eigenen Sphäre, nach menschlichen Maßstäben kniehoch. Dieser zweite Tag war eigentlich ein erster: Kein Ufer gab mehr die Richtung vor. Hier begann das Dazwischen, die Fläche zwischen den Punkten. Hier lief ich durch einen Tunnel aus Tönen, die nicht mehr menschengemacht waren. Tieralarme, ausgelöst von: mir. Manchmal schrie ein Vogel auf, manchmal raschelte ein flüchtendes Tier durchs Gebüsch. Manchmal erschrak ich, weil keines der Geräusche vorhersehbar war, dann wieder erheiterte mich meine Ahnungslosigkeit. Ich war hier Analphabet. Ich wusste nicht, ob sich im Gestrüpp vor meinen Füßen bloß eine Amsel verbarg oder eine Natter. Ich wusste an diesem Morgen nicht mal mehr, wo ich abends sein würde. Es gab kein Datum, an dem ich etwas erreicht haben müsste, keine Uhrzeit, zu der ich eine Verabredung einzuhalten hätte, kein Hotelzimmer, das ich vorab reserviert hatte. Es gab nur ein Ziel, unendlich und unkenntlich fern im Süden.
Irgendwann im Laufe des Tages aber würde ich aus dem Wald treten und an einer Straße stehen.
«Und was machst du dann!?»
Die Frage hatte jeder gestellt, dem ich von meiner Idee erzählt hatte. In der andauernden Wiederholung der immer gleichen Worte schwang oft ein triumphierender Tonfall mit. Ich verstieß gegen Gewohnheiten. Ich tat etwas Abwegiges. Ich war ab vom Wege. Das löste Aversionen aus.
Was also tun, wenn ich an eine Straße käme? Freunde, Nachbarn, Kollegen führten eine endlose Prinzipiendebatte mit mir, wochenlang wogte eine Diskussion, die – das begriff ich währenddessen – schon Teil des Experimentes war.
Jene meiner Bekannten, die im Alltag auf ein Auto angewiesen waren, wollten mir kompromisslos jedes Betreten von Asphalt, auch jedes Überqueren von Wegen verbieten. Nach ihren Maßstäben wäre die Reise an der ersten durchgehenden Küstenstraße beendet gewesen und mein Vorhaben als Spinnerei entlarvt. Ihre Strenge hatte ein Scheitern zum Ziel. Und gescheitert wäre ich: Einer wissenschaftlichen Analyse von Satellitenbildern zufolge gibt es weltweit nur noch 600000 unbebaute, unzerschnittene Gebiete, die mindestens einen Kilometer von der nächsten Straße entfernt liegen. In Deutschland so gut wie keines.
Die Umweltbewegten in meinem Freundeskreis wiederum, also jene, die sich selbst viel verboten – die einen Fleisch, andere Billigstrom, wieder andere den Einsatz von Schneckenkorn im Garten –, waren liberaler. Ihnen war an einem Gelingen gelegen; sie schlugen ein Guthaben von tausend freien Straßenüberquerungen zwischen Meer und Bergen vor.
Auch über Hilfsmittel wurde gesprochen. Einige Eingeweihte meinten, ich solle auf Stelzen über Straßen gehen. Oder mich tragen lassen. Oder im Baumarkt einige Meter Kunstrasen kaufen und als grünes Band über das graue Band der Straßen rollen.
Allen Vorschlägen war eines gemein: Immer ging es um einen Verhaltenskodex für das betonierte 6,2-Prozent-Gebiet, alles Denken und Diskutieren bezog sich noch auf die Straßen, die vorgegebenen Bahnen. Was ich im offenen 93,8-Prozent-Territorium erleben würde, wie ich mich dort verhalten sollte, leicht ver-rückt in der Landschaft stehend, davon war nie die Rede, dafür fehlte uns allen die Vorstellungskraft. Doch genau dort wollte ich hin. Dort wollte ich etwas sehen, nicht unbedingt gesehen werden. Auf Stelzen oder mit einer Teppichrolle hätte ich im Mittelpunkt gestanden, wie ein Performancekünstler, ein Öko-Aktivist, ein Ideologe. Ich wäre als wandelndes Ausrufezeichen unterwegs gewesen. Dabei war ich voller Fragen.