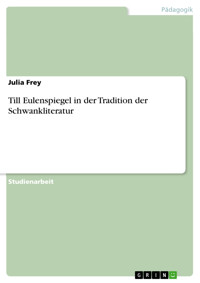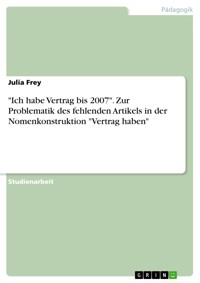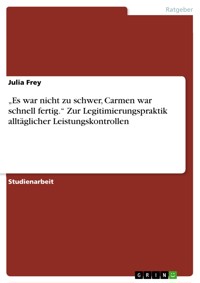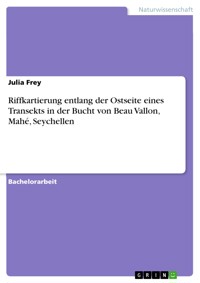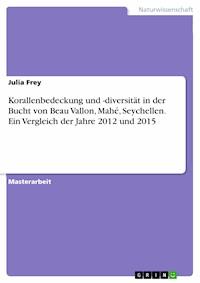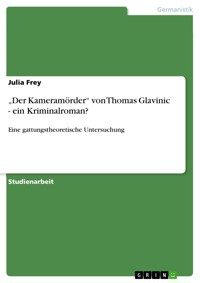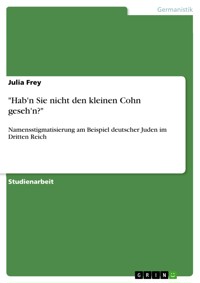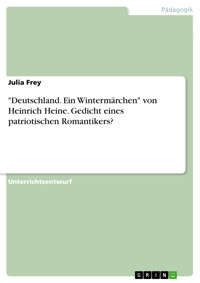
"Deutschland. Ein Wintermärchen" von Heinrich Heine. Gedicht eines patriotischen Romantikers? E-Book
Julia Frey
15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Unterrichtsentwurf aus dem Jahr 2015 im Fachbereich Didaktik für das Fach Deutsch - Pädagogik, Sprachwissenschaft, Note: 1,3, Georg-August-Universität Göttingen (Fachdidaktik Deutsch), Sprache: Deutsch, Abstract: Die Stundenfrage „Deutschland. Ein Wintermärchen“ – Gedicht eines patriotischen Romantikers? schafft die Voraussetzung zum Verständnis des Einwirkens damaliger gesellschaftlicher und politischer Umstände auf Heines Biografie und sein literarisches Schaffen. Wegen seiner politischen Ansichten angefeindet und der Zensur in Deutschland überdrüssig, emigriert er 1831 nach Paris, bleibt jedoch in stetem Austausch mit seinem Vaterland. Von seiner Heimatliebe zeugt u.a. das Gedicht „In der Fremde“, worin er wehmütig von seinem „einst schönen Vaterland“ erzählt. Das Gefühl von Sehnsucht, Heimatlosigkeit und gleichzeitig der Ärger über die deutschen Verhältnisse provozieren eine zunehmende Radikalisierung des literarischen Tons Heines. Das Fundament in der durchzuführenden Stunde bezüglich Heines Identität und literarischer Entwicklung, welche die Überwindung oder vielmehr die Veränderung des Romantik-Begriffs hin zu einer poetischen Ironisierung seiner Werke im Zuge deren zunehmender Politisierung beinhaltet, bildet das Pflichtmodul „Was ist der Mensch? Lebensfragen und Sinnentwürfe“. Für die SuS ist das Stundenthema auch insofern von Bedeutung, als dass sie sich schon jetzt für eine bestimmte Positionierung bezüglich aktueller, und gesellschaftspolitischer Ereignisse entscheiden. Schließlich sind die Themen – wie jene im Gedicht angedeutet: z.B. Disparität zwischen Arm und Reich, Religionen und ihre Berechtigung usw. – gesellschaftspolitisch auch in der heutigen Zeit noch aktuell (wenn auch nicht nur in Deutschland). Es ist wichtig, dass diesbezügliche Meinungen und auch das Engagement selbige zu vertreten ständig reflektiert werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Impressum:
Copyright (c) 2015 GRIN Verlag / Open Publishing GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten.
Jetzt beiwww.grin.com
Inhaltsverzeichnis
1. Lerngruppe
2. Das Thema aus pädagogischer, fachwissenschaftlicher und fachdidaktischer Perspektive
2.1. Pädagogische Relevanz
2.2. Sachanalyse
2.3. Didaktische Reduktion
3. Lernziele und Kompetenzen
4. Methodische Überlegungen
5. Reflexion
6. Literatur
7. Anhang
1. Lerngruppe
Die Lerngruppe, in der ich nach drei Doppelstunden Hospitation zusammen mit meinem Teamteaching-Partner, Herrn V., eine Unterrichtseinheit durchführen werde, besteht aus 22 Schülerinnen und Schülern (SuS) des 11. Jahrgangs. Davon sind 12 Jungen und 10 Mädchen. Ihrer Deutschlehrerin, Frau O. zufolge, handelt es sich um einen „wirklich netten, und aufgeschlossenen Grundkurs“. Diese Auffassung kann ich – insofern man das nach dieser kurzen Zeit des „Kennenlernens“ einschätzen kann, nur bestätigen. Das Leistungsniveau in diesem Kurs liegt, dem Bericht Frau O’s zufolge, im mittleren bis (vereinzelt) sehr guten Bereich. Die mündliche Beteiligung ist gut. Etwa die Hälfte der Klasse arbeitet regelmäßig aktiv mit. Darunter befinden sich zwei besonders leistungsstarke Schülerinnen, die komplexe Aspekte durchschauen und diese auch auf einer abstrakten Ebene formulieren können. Die andere Hälfte beteiligt sich aus eigener Initiative eher selten am Unterrichtsgeschehen. Allerdings befinden sich darunter ca. 5 SuS, die gute bis sehr gute Antworten geben, wenn sie aufgefordert werden. Die anderen 5 , genannt „die Sportabteilung“, bilden eine komplett männlich besetzte Sitzreihe und halten sich fast völlig aus dem Unterricht heraus, stören ihn bisweilen sogar, wobei sie sich aber immer wieder selbst gegenseitig zur Räson bringen und die Lehrperson (LP) nur selten eingreifen muss. Insgesamt zeichnet sich der Kurs durch eine angenehme und angstfreie Lernatmosphäre aus. Der Umgang untereinander ist geprägt von gegenseitiger Akzeptanz, Toleranz und Rücksichtnahme, was auch bei der methodischen Planung der später durchzuführenden Unterrichtseinheit eine Rolle spielen wird.