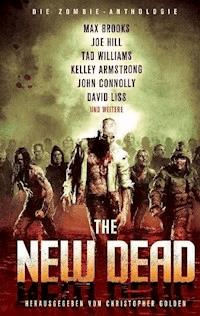5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
In der Nacht kommen sie aus den Wäldern. Sie jagen ihre Beute: dich.
In den Bergen, am Fuße eines Vulkans, liegt Greenloop, eine exklusive Gemeinschaft von Aussteigern. Ein Idyll in der Wildnis, in dem Katherine und Dan auf eine neue Heimat unter Gleichgesinnten hoffen – und auf einen Neuanfang für ihre Ehe. Doch dann bricht der Vulkan aus, und Greenloop ist von der Außenwelt abgeschnitten. Tag für Tag wird die Lage in der Siedlung angespannter – und nachts hören sie die Schreie. In den Wäldern reißen gnadenlose Jäger ihre Beute, hochentwickelte affenähnliche Kreaturen, getrieben vom Instinkt zu überleben. Und jede Nacht kommen die Schreie näher ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 473
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Buch
In den Bergen, am Fuße eines Vulkans, liegt Greenloop, eine exklusive Gemeinschaft von Aussteigern. Ein Idyll in der Wildnis, in dem Katherine und Dan auf eine neue Heimat unter Gleichgesinnten hoffen – und auf einen Neuanfang für ihre Ehe. Doch dann bricht der Vulkan aus, und Greenloop ist von der Außenwelt abgeschnitten. Tag für Tag wird die Lage in der Siedlung angespannter – und nachts hören sie die Schreie. In den Wäldern reißen gnadenlose Jäger ihre Beute, hochentwickelte affenähnliche Kreaturen, getrieben vom Instinkt zu überleben. Und jede Nacht kommen die Schreie näher …
Weitere Informationen zu Max Brooks
sowie zu lieferbaren Titeln des Autors
finden Sie am Ende des Buches.
Max Brooks
Devolution
Thriller
Aus dem Amerikanischen
von Thomas Bauer
Die amerikanische Originalausgabe erschien 2020 unter dem Titel »Devolution« bei Del Rey, an imprint of Random House, a division of Penguin Random House LLC, New York.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Deutsche Erstveröffentlichung September 2020
Copyright © der Originalausgabe 2020 by Max Brooks
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2020
by Wilhelm Goldmann Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur, München
Umschlagmotiv: FinePic®, München
Kartenillustration: © 2020 by David Lindroth Inc.
Redaktion: Alexander Groß
LS · Herstellung: kw
Satz: KompetenzCenter; Mönchengladbach
ISBN: 978-3-641-25144-4V002
www.goldmann-verlag.de
Besuchen Sie den Goldmann Verlag im Netz
Für Henry Michael Brooks:
Auf dass du alle deine Ängste überwindest.
Was für ein hässliches Tier ist der Affe, und wie sehr ähnelt er uns.
– Marcus Tullius Cicero
Einleitung
»Bigfoot zerstört Ortschaft.« So lautete die Überschrift eines Artikels, den ich nicht lange nach dem Ausbruch des Mount Rainier zugeschickt bekam. Ich hielt ihn für Spam, für die unvermeidliche Folge umfangreicher Online-Recherche. Zu dem Zeitpunkt war ich gerade damit beschäftigt, meinen gefühlt hundertsten Kommentar zum Mount Rainier fertigzustellen, in dem ich jeden Aspekt einer Naturkatastrophe analysierte, die eigentlich vorhersehbar gewesen wäre – und vermeidbar. Wie der Rest des Landes brauchte ich Fakten statt Effekthascherei. Mein Fokus hatte bei vielen meiner Kommentare darauf gelegen, mich auf Tatsachen zu stützen, denn von all dem menschlichen Versagen am Mount Rainier – in politischer, wirtschaftlicher, logistischer Hinsicht – hatte der psychologische Aspekt, die von Übertreibungen genährte Hysterie, letzten Endes die meisten Menschenleben gekostet. Und da war sie wieder, diese Hysterie, mitten auf meinem Laptop-Bildschirm: »Bigfoot zerstört Ortschaft.«
Vergiss es einfach, sagte ich mir. Die Welt wird sich nicht über Nacht ändern. Atme tief durch, lösch es und mach weiter.
Und das hätte ich auch beinahe getan, wäre da nicht dieses eine Wort gewesen.
»Bigfoot.«
Während das ganze Land den Blick auf Rainiers Zorn richtete, hieß es in dem Artikel, der auf einer obskuren Kryptozoologie-Website veröffentlicht worden war, es habe sich ein paar Meilen entfernt, in der edlen Hightech-Ökogemeinde Greenloop, eine kleinere, aber nicht weniger blutige Katastrophe ereignet. Der Verfasser des Artikels, Frank McCray, schilderte, dass Greenloop nach dem Vulkanausbruch nicht nur von der Außenwelt abgeschnitten, sondern obendrein einem Rudel ausgehungerter, affenähnlicher Kreaturen schutzlos ausgeliefert gewesen sei, die vor derselben Katastrophe geflüchtet waren.
Die Details der Belagerung hatte die Greenloop-Bewohnerin Kate Holland, Frank McCrays Schwester, in ihrem Tagebuch festgehalten.
»Ihre Leiche wurde nie gefunden«, schrieb mir McCray in einer nachfolgenden E-Mail, »aber wenn Sie ihr Tagebuch veröffentlichen könnten, wird es vielleicht jemand lesen, der sie gesehen hat.«
Als ich ihn fragte, wie er auf mich gekommen sei, antwortete er: »Weil ich alle Ihre Kommentare zum Mount Rainier gelesen habe. Sie schreiben nichts, was Sie nicht vorher gründlich recherchiert haben.« Und als ich von ihm wissen wollte, weshalb er glaube, ich sei an Bigfoots interessiert, schrieb er zurück: »Ich habe Ihren Fangoria-Artikel gelesen.«
Ich war zweifellos nicht der Einzige, der wusste, wie man etwas recherchierte. Irgendwie hatte McCray eine jahrzehntealte Liste meiner »Top Five der Bigfoot-Filmklassiker« für das Kult-Horror-Magazin aufgestöbert. In diesem Beitrag hatte ich erwähnt, »am Höhepunkt der Bigfoot-Hysterie« aufgewachsen zu sein, und die Leser aufgefordert, sich diese alten Filme »mit den Augen eines sechsjährigen Kindes anzusehen, dessen Blick unentwegt vom Grauen auf dem Bildschirm zu den dunklen, raschelnden Bäumen vor dem Fenster abschweift«.
Bei der Lektüre dieses Beitrags war McCray offenbar zu der Überzeugung gelangt, dass ein Teil von mir noch nicht ganz bereit war, die Obsession meiner Kindheit hinter sich zu lassen. Außerdem muss er gewusst haben, dass meine Skepsis als Erwachsener mich zwingen würde, seine Geschichte genau unter die Lupe zu nehmen. Und das tat ich auch. Bevor ich McCray wieder kontaktierte, fand ich heraus, dass es tatsächlich eine Gemeinde namens Greenloop gegeben hatte, über die in den Medien ausgiebig berichtet worden war. Es war viel über ihre Gründung geschrieben worden – und über ihren Gründer, Tony Durant. Außerdem hatte Tonys Frau Yvette im Gemeinschaftshaus der Siedlung etliche Yoga- und Meditations-Onlinestunden gegeben, bis zu dem Tag des Vulkanausbruchs. Doch an jenem Tag kam alles zum Stillstand.
Das war nichts Ungewöhnliches für Ortschaften, die im Weg der brodelnden Schlammlawinen des Mount Rainier lagen, aber ein Blick auf die offizielle Karte der Bundesagentur für Katastrophenschutz verriet, dass es Greenloop nicht erwischt hatte. Und während verwüstete Orte wie Orting und Puyallup ihren digitalen Fußabdruck irgendwann wiederhergestellt hatten, blieb Greenloop ein schwarzes Loch. Es gab keine Pressemeldungen, keine Amateuraufnahmen. Nichts. Selbst bei Google Earth, wo man so gewissenhaft gewesen war, die Satellitenbilder von der Gegend auf den neuesten Stand zu bringen, war immer noch die ursprüngliche Aufnahme von Greenloop und Umgebung aus der Zeit vor dem Vulkanausbruch zu sehen. Wie seltsam all diese Warnsignale auch gewesen sein mochten, was mich schließlich dazu bewog, wieder mit McCray in Kontakt zu treten, war die Tatsache, dass der einzige Hinweis auf Greenloop aus der Zeit nach der Katastrophe, den ich finden konnte, aus einem Bericht der örtlichen Polizei stammte. Darin hieß es, die offiziellen Untersuchungen seien »noch nicht abgeschlossen«.
»Was wissen Sie?«, fragte ich ihn nach einigen Tagen Funkstille. Daraufhin schickte er mir mit AirDrop den Link zu einem Album mit Fotos, die Senior Ranger Josephine Schell gemacht hatte. Schell, die ich für dieses Projekt später interviewte, hatte den ersten Such- und Rettungstrupp in die verkohlten Ruinen des ehemaligen Greenloop geführt. Zwischen den Leichen und Trümmern hatte sie das Tagebuch von Kate Holland (geborene McCray) entdeckt und jede einzelne Seite abfotografiert, bevor das Original konfisziert wurde.
Zunächst hielt ich das Ganze trotzdem für einen Schwindel. Ich bin alt genug, um mich an die berüchtigten »Hitler-Tagebücher« erinnern zu können. Nachdem ich die letzte Seite gelesen hatte, blieb mir allerdings nichts anderes übrig, als ihrer Geschichte Glauben zu schenken. Das tue ich noch immer. Vielleicht liegt es an ihrem schlichten Schreibstil, an ihren frustrierend glaubwürdigen Wissenslücken in Sachen Sasquatch oder einfach nur an meinem eigenen irrationalen Wunsch, mich von Kindheitsängsten zu befreien. Deshalb habe ich Kates Geschichte veröffentlicht, zusammen mit einigen Pressemeldungen und Hintergrundinterviews, die Lesern, die mit der Bigfoot-Legende nicht vertraut sind, hoffentlich einen gewissen Kontext liefern werden. Beim Zusammenstellen dieser Informationen fiel es mir sehr schwer, mich zu entscheiden, wie viel ich davon verwenden sollte. Es gibt buchstäblich Dutzende Wissenschaftler, hunderte Jäger und tausende dokumentierte Begegnungen. Sich mit allen auseinanderzusetzen, hätte Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte gedauert, und so viel Zeit hat diese Geschichte einfach nicht. Deshalb habe ich beschlossen, mich auf Interviews mit den beiden Menschen, die persönlich in die Angelegenheit involviert waren, und auf Textverweise zu Steve Morgans The Sasquatch Companion zu beschränken. Andere Bigfoot-Enthusiasten wissen bestimmt, dass es sich bei Morgans Companion um den umfassendsten, aktuellsten Leitfaden zu dem Thema handelt, der historische Schilderungen, neuere Augenzeugenberichte und wissenschaftliche Analysen von Fachleuten wie Dr. Jeff Meldrum, Ian Redmond, Robert Morgan (nicht mit dem Autor verwandt) und dem inzwischen verstorbenen Dr. Grover Krantz miteinander verbindet.
Womöglich werden einige Leser meine Entscheidung infrage stellen, bestimmte geografische Details zur genauen Lage von Greenloop auszusparen. Dadurch sollen Touristen und Plünderer davon abgehalten werden, einen Tatort zu verunreinigen, an dem die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen sind. Abgesehen von diesen Details und den erforderlichen Korrekturen, was Rechtschreibung und Grammatik anbelangt, wurde das Tagebuch von Kate Holland original belassen. Ich bedaure nur, dass ich Kates Psychotherapeutin (die sie dazu ermunterte, dieses Tagebuch zu schreiben) aufgrund der ärztlichen Schweigepflicht nicht interviewen kann. Und trotzdem wirkt das Schweigen dieser Psychotherapeutin (zumindest auf mich) wie ein Hoffnungseingeständnis. Denn warum sollte sich eine Ärztin an die Schweigepflicht in Bezug auf ihre Patientin halten, wenn sie nicht davon ausgeht, dass diese Patientin noch am Leben ist?
Während ich das hier schreibe, gilt Kate seit dreizehn Monaten als vermisst. Sofern sich daran nichts ändert, wird sie beim Erscheinen dieses Buches seit mehreren Jahren verschwunden sein.
Im Moment besitze ich keine handfesten Beweise für die Geschichte, die Sie gleich lesen werden. Vielleicht bin ich von Frank McCray hereingelegt worden, oder vielleicht sind wir beide von Josephine Schell hereingelegt worden. Ich werde Sie, meine Leserinnen und Leser, selbst entscheiden lassen, ob Sie die folgenden Seiten für plausibel erachten und ob sie bei Ihnen – wie bei mir – eine Angst wiedererwecken, die lang unter dem Bett der Kindheit verborgen war.
1. Kapitel
Geht in die Wälder und vergesst Anblick und Erinnerung der Verbrechen eurer Zeitgenossen.
– Jean-Jacques Rousseau
1. Tagebucheintrag
22. September
Wir sind da! Zwei Tage Autofahrt mit einer Übernachtung in Medford, und wir sind endlich da! Und es ist perfekt! Die Häuser stehen tatsächlich im Kreis. Okay, wie denn sonst, aber Sie haben mir gesagt, ich soll nicht lange überlegen, soll nichts überarbeiten, soll nichts löschen und es noch einmal schreiben. Deshalb haben Sie mir auch geraten, von Hand auf Papier zu schreiben. Keine Backspace-Taste. »Schreiben Sie einfach drauflos.« Okay. Meinetwegen. Wir sind da!
Wie schade, dass Frank nicht hier ist. Ich kann es kaum erwarten, ihn heute Abend anzurufen. Er wird sich bestimmt wieder dafür entschuldigen, dass er bei einer Konferenz in Guangzhou festhängt, und ich werde ihm wieder versichern, dass das kein Problem ist. Er hat schon so viel für uns getan! Hat das Haus hergerichtet und die ganzen FaceTime-Video-Führungen gemacht. Er hat recht, dass sie dem Ort nicht gerecht werden. Vor allem dem Wanderweg nicht. Ich wünschte, er hätte heute bei meinem ersten Spaziergang dabei sein können. Es war magisch.
Dan wollte nicht mitkommen. Keine Überraschung. Er sagte, er würde dableiben und beim Auspacken helfen. Er sagt immer, dass er helfen will. Ich erklärte ihm, dass ich mir die Füße vertreten wolle, müsse. Zwei Tage im Auto! Die schlimmste Fahrt aller Zeiten! Ich hätte nicht die ganze Zeit Nachrichten hören sollen. Ich weiß schon, ich soll »das aktuelle Zeitgeschehen dosiert aufnehmen, mich auf die Fakten beschränken und mich nicht hineinsteigern«. Sie haben recht. Ich hätte es nicht tun sollen. Wieder Venezuela, Aufstockung der Truppen. Flüchtlinge. Noch ein Boot in der Karibik gekentert. So viele Boote. Hurrikan-Saison. Wenigstens war es nur im Radio. Wenn ich nicht gefahren wäre, hätte ich wahrscheinlich versucht, es mir auf meinem Handy anzusehen.
Ich weiß. Ich weiß.
Wir hätten zumindest die Küstenstraße nehmen sollen, wie damals, nachdem Dan und ich geheiratet hatten. Ich hätte darauf drängen sollen. Aber Dan dachte, über die Interstate 5 ginge es schneller.
Bäh.
Überall schreckliche industrielle Landwirtschaft. All die armen Kühe, zusammengepfercht in der sengenden Sonne. Der Gestank. Sie wissen ja, wie geruchsempfindlich ich bin. Als wir ankamen, hatte ich das Gefühl, als würde er immer noch in meiner Kleidung hängen, in meinen Haaren, in meiner Nase. Ich musste spazieren gehen, die frische Luft spüren, meine Nackenmuskulatur trainieren.
Ich ließ Dan vor sich hin wursteln und ging den markierten Wanderpfad hinter unserem Haus hinauf. Der Pfad ist wirklich nicht anspruchsvoll, er steigt sanft an, und etwa alle hundert Meter gibt es eine terrassenförmige Stufe aus Holzpflöcken. Er führt am Haus unserer Nachbarin vorbei, und ich sah sie. Die alte Dame. Entschuldigung, ältere Dame. Ihr Haar ist eindeutig grau. Kurz, würde ich sagen. Durch das Küchenfenster konnte ich es nicht genau erkennen. Sie stand am Spülbecken und war mit irgendetwas beschäftigt. Als sie aufblickte, bemerkte sie mich. Sie lächelte und winkte. Ich lächelte und winkte zurück, blieb aber nicht stehen. Ist das unhöflich? Ich dachte mir, dass ich, wie fürs Auspacken, noch genug Zeit hätte, um Leute kennenzulernen. Na gut, vielleicht habe ich mir das gar nicht gedacht. Eigentlich habe ich überhaupt nicht nachgedacht. Ich wollte einfach weitergehen. Ich hatte ein schlechtes Gewissen, aber nicht lange.
Was ich sah …
Okay, erinnern Sie sich noch, dass Sie meinten, ich solle einen Plan von hier zeichnen, weil mir das womöglich dabei helfen würde, das Bedürfnis zu kanalisieren, meine Umgebung zu ordnen? Ich denke, das ist eine gute Idee, und wenn mir die Zeichnung einigermaßen gelingt, scanne ich sie vielleicht ein und schicke sie Ihnen. Aber keine Zeichnung und auch kein Foto können jemals einfangen, was ich bei diesem ersten Spaziergang gesehen habe.
Die Farben. In L.A. ist alles grau und braun. Der graue, diesig grelle Himmel, der mir immer in den Augen wehtat. Die braunen Hügel mit verdorrtem Gras, von dem ich immer niesen musste und Kopfschmerzen bekam. Hier ist es richtig grün, wie an der Ostküste. Nein. Besser. Unzählige Farbtöne. Frank hat mir erzählt, dass es hier eine Dürre gegeben hat, und ich glaube, entlang der Schnellstraße etwas verblichenes Gras gesehen zu haben, aber hier draußen gibt es einen wahren Regenbogen von Grüntönen: von leuchtend goldfarben bis dunkelblau. Die Büsche, die Bäume.
Die Bäume.
Ich erinnere mich noch, als ich in L.A. das erste Mal im Temescal Canyon wandern ging. An die niedrigen grauen, knorrigen Eichen mit ihren kleinen spitzen Blättern und ihren gewehrkugelförmigen Eicheln. Sie wirkten so feindselig. Das mag übertrieben dramatisch klingen, doch so kam es mir vor. Als wären sie wütend, weil sie in dem heißen, harten, staubigen, toten Lehm wachsen mussten.
Die Bäume hier wirken glücklich. Ja, glücklich. Warum auch nicht in der weichen, fruchtbaren, regenfeuchten Erde? Ein paar mit heller, fleckiger Rinde und goldfarbenen, herabfallenden Blättern. Sie mischen sich unter große, kräftige Kiefern. Einige von ihnen besitzen Nadeln mit silberfarbener Unterseite oder welche von der flacheren, weicheren Sorte, die mich sanft streiften, als ich vorbeiging. Beruhigende Säulen, auf denen der Himmel ruht, höher als alles in L.A., einschließlich der dürren, schwankenden Palmen, bei denen mir der Nacken schmerzte, wenn ich an ihnen hinaufblickte.
Wie oft haben wir über den Knoten unmittelbar unter meinem rechten Ohr gesprochen, der sich bis unter meinen Arm fortsetzt? Er ist verschwunden. Sosehr ich den Hals auch reckte, keine Schmerzen. Und dabei hatte ich nichts eingenommen. Eigentlich wollte ich. Ich hatte sogar für meine Rückkehr zwei Schmerztabletten auf der Küchenarbeitsplatte bereitgelegt. Kein Bedarf. Alles in Ordnung. Mein Nacken, mein Arm. Entspannt.
Ich stand vielleicht zehn Minuten lang da und betrachtete die hellen, verschwommenen Sonnenstrahlen, die durch die Blätter fielen. Funkelnd. Ich streckte die Hand aus, um einen zu fangen, einen vierteldollargroßen Wärmepunkt, der meine Anspannung löste. Der mich erdete.
Was sagten Sie über Personen mit Zwangsneurosen? Dass es uns enorm schwerfällt, in der Gegenwart zu leben? Nicht hier, nicht jetzt. Ich spürte jede einzelne Sekunde. Geschlossene Augen. Tiefe, reinigende Atemzüge. Die kühle, feuchte, duftende Luft. Lebendig. Natürlich.
Was für ein Unterschied zu L.A. mit seinen transplantierten Rasenflächen und Palmen, wo die Leute vom geklauten Wasser anderer leben. Eigentlich sollte da Wüste sein und kein ausufernder Ziergarten. Vielleicht ist das der Grund, warum dort alle so unglücklich sind. Jeder weiß, dass er in einer Scheinwelt lebt.
Ich nicht. Nicht mehr.
Ich weiß noch, dass ich dachte: Besser kann es nicht mehr werden. Doch es wurde noch besser. Als ich die Augen öffnete, fiel mein Blick auf einen großen smaragdgrünen Busch, ein paar Schritte entfernt, der mir zuvor entgangen war. Ein Beerenstrauch! Die Beeren sahen aus wie Brombeeren, aber ich ging kurz ins Internet, um mich zu vergewissern. (Übrigens, hervorragender WLAN-Empfang, selbst so weit vom Haus entfernt!) Es waren tatsächlich welche, ein absoluter Glücksfund! Frank hatte behauptet, die Wildbeerenernte wäre der Trockenheit im Sommer zum Opfer gefallen. Und doch stand hier dieser Busch, genau vor mir. Er wartete auf mich. Erinnern Sie sich noch, dass Sie mir sagten, ich solle offener für Gelegenheiten sein, solle nach Zeichen Ausschau halten?
Es spielte keine Rolle, dass die Beeren ein klein bisschen säuerlich waren. Genau genommen machte sie das sogar noch besser. Ihr Geschmack versetzte mich zurück zu dem Heidelbeerstrauch hinter unserem Haus in Columbia.1 Ich wollte damals nie bis August warten, bis sie reif waren, und musste mir immer schon im Juli unbedingt ein paar halb-violette Kügelchen stibitzen. All diese Erinnerungen kehrten mit einem Mal zurück, all jene Sommer, in denen Dad mir Blueberries for Sal vorlas und ich lachte, wenn sie dem Bären begegnet. Dann fing meine Nase an zu brennen, und meine Augen begannen zu tränen. Wahrscheinlich wäre ich völlig ausgeflippt, wenn mich nicht ein kleiner Vogel buchstäblich gerettet hätte.
Genauer gesagt waren es zwei. Mir fiel ein Pärchen Kolibris auf, die zwischen hohen violetten Wildblumen wie in einem Disneyfilm auf einem Fleck Sonne umherflatterten. Ich sah, wie einer von ihnen vor einer Blume Halt machte. Der andere kam neben ihn geschwirrt, und dann geschah etwas ganz Entzückendes. Der zweite Kolibri bewegte sich mit seinem kupferfarbenen Gefieder und seinem rötlich pinkfarbenen Rachen in der Luft vor und zurück und gab dabei dem ersten kleine Küsse.
Okay, mir ist bewusst, dass Sie Vergleiche wahrscheinlich inzwischen satthaben. Tut mir leid. Ich muss einfach immer wieder an die Papageien denken. Erinnern Sie sich an sie? Wir haben über sie gesprochen. Der wilde Schwarm. Wir haben eine ganze Sitzung darüber gesprochen, dass mich ihr Gekreische in den Wahnsinn getrieben hat. Tut mir leid, dass ich damals nicht erkannt habe, welche Verbindung Sie herstellen wollten.
Die armen Kreaturen. Sie klangen so verängstigt und wütend. Wie kann man ihnen das verdenken? Wie hätten sie denn sonst empfinden sollen, nachdem irgendeine schreckliche Person sie in einer Umgebung freigelassen hatte, für die sie nicht geboren waren? Und ihre Jungen? Geschlüpft mit einem nagenden Unbehagen in ihren Genen, während sich jede ihrer Zellen nach einer Umgebung sehnte, die sie nicht finden konnten. Sie gehörten nicht dorthin! Nichts gehörte dorthin! Schwer zu erkennen, was falsch ist, bis man es mit dem vergleicht, was richtig ist. Dieser Ort, mit seinen hohen, gesunden Bäumen und seinen kleinen glücklichen Vögeln, die verliebte Küsse tauschten – alles, was es hier gibt, gehört auch hierher.
Ich gehöre hierher.
Aus der American-Public-Media-Radiosendung Marketplace. Niederschrift des Interviews von Moderator Kai Ryssdal mit Greenloop-Gründer Tony Durant.
RYSSDAL: Aber warum entscheidet man sich dafür, sich so weit draußen in der Wildnis abzuschotten – vor allem, wenn man das Leben in der Stadt oder am Stadtrand gewohnt ist?
TONY: Wir schotten uns überhaupt nicht ab. Unter der Woche spreche ich mit Menschen in aller Welt, und übers Wochenende fahren meine Frau und ich meistens nach Seattle.
RYSSDAL: Aber der Zeitaufwand, um nach Seattle zu kommen …
TONY: Ist nichts im Vergleich zu den vielen Stunden, die andere jeden Tag im Auto verschwenden. Überlegen Sie sich mal, wie viel Zeit Sie damit verbringen, zur Arbeit und wieder zurück zu fahren, und dabei die Stadt um sich herum entweder ignorieren oder sich über sie ärgern. Wenn man draußen auf dem Land lebt, weiß man die Zeit in der Stadt wieder zu schätzen, weil sie freiwillig ist und kein Muss, eine Belohnung und nicht eine lästige Verpflichtung. Der revolutionäre Lebensstil in Greenloop ermöglicht es uns, das Beste eines städtischen Lebens mit dem Besten eines ländlichen Lebens zu verbinden.
RYSSDAL: Lassen Sie uns kurz über diesen »revolutionären Lebensstil« sprechen. Sie haben Greenloop einmal als das nächste Levittown bezeichnet.
TONY: Das ist es. Levittown war der Prototyp für Wohlstand. Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es unzählige junge, frisch verheiratete GIs, die es kaum erwarten konnten, eine Familie zu gründen, und sich nach einem Eigenheim sehnten, für das ihnen allerdings die finanziellen Mittel fehlten. Gleichzeitig fand eine Revolution bei der Produktion von Gütern statt: optimierte Herstellungsverfahren, verbesserte Logistik, vorgefertigte Teile … alles aus dem Krieg, aber mit enormem Potenzial in Friedenszeiten. Die Levitts erkannten dieses Potenzial als Erste und nutzten es für Amerikas erste »geplante Gemeinde«. Und diese bauten sie so schnell und kostengünstig, dass sie zum Modell für die moderne Vorstadt wurde.
RYSSDAL: Und Sie sagen, dass sich dieses Modell etabliert hat?
TONY: Nicht ich sage das, das ganze Land hat es bereits in den 1960er-Jahren anerkannt, als uns bewusst wurde, dass uns unser Lebensstandard umbringt. Was nützt der ganze Fortschritt, wenn der Meeresspiegel ansteigt, bis das Land überschwemmt und unbewohnbar wird und man seine Nahrungsmittel nicht mehr essen und die Luft nicht mehr atmen kann? Wir wissen seit einem halben Jahrhundert, dass wir eine nachhaltige Lösung brauchen. Aber welche? Die Uhr zurückdrehen? In Höhlen leben? So wollten es die Umweltschutz-Pioniere, oder so kamen sie zumindest rüber. Erinnern Sie sich an die Kultszene in Eine unbequeme Wahrheit, in der uns Al Gore eine Waage mit Goldbarren auf der einen Seite und Mutter Erde auf der anderen zeigt? Was ist das denn für eine Wahl?
Man kann von den Leuten nicht verlangen, dass sie konkrete persönliche Annehmlichkeiten für irgendein ätherisches Ideal aufgeben. Deshalb ist auch der Kommunismus gescheitert. Deshalb sind all die primitiven »Zurück zur Natur«-Hippiekommunen gescheitert. Selbstloses Leiden fühlt sich bei kurzen Kampagnen gut an, ist aber als Lebensform nicht haltbar.
RYSSDAL: Bis Sie Greenloop erfanden.
TONY: Noch einmal: Ich habe gar nichts erfunden. Ich habe nur das Problem durch die Linse der Misserfolge der Vergangenheit betrachtet.
RYSSDAL: Sie haben sich sehr kritisch über frühere Versuche geäußert …
TONY: Kritisch würde ich es nicht nennen. Hätte es meine Vorgänger nicht gegeben, stünde ich jetzt nicht hier. Aber sehen Sie sich riesige, staatlich geförderte Ökostädte wie Masdar2 oder Dongtan3 an. Zu groß. Zu teuer. Und ganz bestimmt zu ehrgeizig für ein Amerika nach der Budget-Sequestrierung4. Die kleineren europäischen Modelle wie BedZED5 oder Sieben Linden6 sind genauso Totgeburten, weil sie auf harter Entbehrung basieren. Mir gefiel das Dunedin-Projekt7 in Florida. Es ist behaglich und überschaubar, hat aber einfach keinen Wow-Effekt, und das …
RYSSDAL: Wir sollten zur Kenntnis nehmen, dass Tony auf die Häuser deutet und auf die Landschaft, von der wir umgeben sind.
TONY: Ist das etwa nicht die Definition von Wow-Effekt?
RYSSDAL: Stimmt die Geschichte, dass Sie in einer Cygnus-Tagungsstätte Geiseln genommen und ihnen das Projekt erst dann präsentiert haben, nachdem Sie sie hier raufgeschleift hatten?
TONY: (lacht) Schön wär’s. Sie wussten, dass sie ein Verkaufsgespräch erwartet, und sie wussten, dass es etwas mit einem Stück Land zu tun hat, das die Regierung an den privaten Sektor versteigern wollte, aber sie bekamen meinen Plan erst zu hören, als wir genau an der Stelle standen, an der wir jetzt gerade stehen.
RYSSDAL: Und das Gespräch führte die Natur.
TONY: Und ich. (beide lachen) Im Ernst, so wie Steve Jobs das Orchester spielt.8 Mein Orchester ist diese Landschaft. Wenn man hier ist, von ihr umgeben ist und auf einer instinktiven Ebene eine Verbindung mit ihr eingeht, wird einem bewusst, dass unser Planet nur durch diese Verbindung gerettet werden kann. Das Problem bestand schon immer darin, dass wir die Natur zerstören, weil wir eine so große Distanz zu ihr geschaffen haben.
Ich bat meine Freunde bei Cygnus, sich zwei unterschiedliche Szenarien für dieses bald privatisierte Land vorzustellen: Abholzung durch ein chinesisches Holzunternehmen oder … oder … den minimalen Fußabdruck einer Mikro-Ökosiedlung, welche die neue Grüne Revolution verkörpert. Sechs Wohnhäuser, nicht mehr, die ein Gemeinschaftsgebäude umringen wie bei einer auf dem Rücken liegenden Schildkröte, die nach dem Glauben mancher amerikanischen Ureinwohner das Fundament darstellt, auf dem die Welt ruht.
Ich beschrieb ihnen, dass die Häuser im Tlingit-Stil aussehen würden, als wären sie buchstäblich aus dem Waldboden gewachsen.
RYSSDAL: Was man jetzt sehen kann.
TONY: Genau, aber was man nicht sieht, ist, dass diese Häuser alle zu hundert Prozent aus recycelten Materialien bestehen. Holz, Metall, Dämmung aus recycelten Bluejeans. Das einzige neue Material ist Bambus für die Fußböden. Bambus ist für den Planeten von großer Bedeutung. Deshalb sehen Sie es überall in der Umgebung wachsen. Es ist nicht nur eines der vielseitigsten und regenerativsten Baumaterialien, sondern hilft auch dabei, Kohlendioxid zu binden. Außerdem gibt es sogenannte »passive Elemente«, wie etwa die riesigen raumhohen Fenster im Wohnzimmer, die es einem ermöglichen, das ganze Haus aufzuheizen oder zu kühlen, indem man die Vorhänge öffnet oder schließt.
Aber die passiven Elemente sind längst nicht alles. Was aktive grüne Technologie anbelangt, haben wir auf nichts verzichtet. Sehen Sie die bläulich violette Färbung der Dächer? Das sind Solarpaneele. Abziehen und aufkleben, wie altmodische Tapeten, und mit Dreifach-Solarzellen, damit sie auch an bedeckten Tagen jedes Photon sammeln können. Und die umgewandelten Ampere werden in patentierten Batterien von Cygnus gespeichert, die sich nicht nur unsichtbar in eine Wand integrieren lassen, sondern auch um 13,5 Prozent effizienter sind als Konkurrenzprodukte.
RYSSDAL: Ätsch, bätsch, Elon Musk.
TONY: Nein, nein, ich mag Elon, er ist ein Klasse-Typ, aber er hat einiges aufzuholen.
RYSSDAL: Wie zum Beispiel das Solar-Profitprogramm?
TONY: Genau. Wenn man mehr Energie erntet, als man benötigt, warum sollte man sie dann nicht dem Stromnetzbetreiber verkaufen? Und ich meine damit nicht, um einen Rabatt zu bekommen, sondern ich meine verkaufen, für Geld, wie es in Deutschland seit fast zwei Jahrzehnten gehandhabt wird. Das hat nichts mit Technologie zu tun, sondern ist einfach ein gutes Geschäft: Man verdient Geld, während man faul herumhockt.
RYSSDAL: Und apropos hocken …
TONY: Dazu wollte ich noch kommen. Die Häuser ernten nicht nur Sonnenlicht, sondern gewinnen auch Methangas aus – und jetzt halten Sie sich fest – den eigenen Exkrementen. Aber auch das ist nichts Neues. In Entwicklungsländern wird seit Jahren Biogas genutzt. Sogar einige amerikanische Städte zapfen ihre eigenen Mülldeponien an. Greenloop hat diese mühsam gewonnenen Erfahrungen auf amerikanische Vorstadt-Standards gebracht. Jedes der Häuser wurde auf einem Biogas-Generator errichtet, der alles zerlegt, was man hinunterspült. Ohne dass man es sieht oder riecht oder sich auch nur Gedanken darüber zu machen braucht. Alles wird vom »Smart Home«-System von Cygnus geregelt.
RYSSDAL: Können Sie ein bisschen von diesem System erzählen?
TONY: Auch hier, nichts Neues. Viele Eigenheime werden smarter. Bei Greenloop ging es einfach nur schneller. Das zentrale Haus-Programm lässt sich entweder sprach- oder fernsteuern und zielt ständig auf maximale Energieeffizienz ab. Es denkt immer mit, ist immer am Rechnen, stellt immer sicher, dass man keine Ampere und keine Joule verschwendet. Jeder Raum ist bespickt mit Temperatur- und Bewegungssensoren. Auf höchster Effizienzstufe schalten sie automatisch in allen gerade nicht bewohnten Bereichen die Beleuchtung und Heizung aus. Und man braucht nicht mehr zu tun, als einfach so weiterzuleben, wie man es bisher immer getan hat. Man braucht dafür kein bisschen Komfort und Zeit zu opfern.
RYSSDAL: Und das geht auf denselben politischen Willen zurück, der es dem Bundesstaat Washington erlaubt hat, seine Solarenergiebestimmungen zu ändern.
TONY: Und die Hälfte der Mittel für den Bau bereitgestellt, die Privatstraße von der Hauptverkehrsstraße hinauf gebaut und unzählige Meilen Glasfaserkabel verlegt hat.
RYSSDAL: Grüne Jobs.
TONY: Grüne Jobs. Wer hält die ganze raffinierte Elektronik am Laufen? Wer reinigt die Solarpaneele? Wer mistet die verbrauchten Abfälle in den Biogas-Generatoren aus und transportiert sie zusammen mit dem Restmüll und den wiederverwertbaren Abfällen und den Küchenabfällen weg, um die organischen Abfälle dann in Form von Kompost, der zwischen den Obstbäumen verteilt wird, wieder zurückzubringen?
Wussten Sie, dass jeder Bewohner von Greenloop zwischen zwei und vier Dienstleistungsjobs für seine amerikanischen Mitbürgerinnen und Mitbürger generiert? Sie werden alle mit Elektro-Kleinbussen angekarrt, die am Gemeinschaftshaus wieder aufgeladen werden. Und das ist nur der Dienstleistungssektor. Was ist mit der Herstellung der Solarpaneele und Biogas-Generatoren und Wandbatterien? Fertigung. Made in America. Das ist die Grüne Revolution, der Grüne New Deal und was jetzt gerne als »Green Green Society« bezeichnet wird. Greenloop zeigt, was möglich ist, genau wie davor Levittown.
RYSSDAL: Wobei man nicht ignorieren darf, dass Levittown eine Rassentrennungspolitik hatte.
TONY: Nein, das sollte man nicht ignorieren. Im Grunde genommen ist das genau mein Punkt. Levittown war abgegrenzt, Greenloop ist offen. Levittown wollte Menschen trennen, Greenloop möchte sie vereinen. Levittown wollte Menschen von der Natur abschotten, Greenloop möchte sie wieder mit ihr vertraut machen.
RYSSDAL: Aber die meisten Leute können es sich nicht leisten, in einer solchen Gemeinde zu leben.
TONY: Nein, aber sie können sich ein Stück davon leisten. Genau darum ging es bei Levittown: Es sollten nicht nur die Häuser zur Schau gestellt werden, sondern auch alle neuartigen Annehmlichkeiten, die sich darin befanden: Geschirrspüler, Waschmaschinen, Fernsehgeräte. Eine ganze Lebensart. Das versuchen wir mit Greentech, und was Solarenergie und Smart Homes anbelangt, ist es bereits Realität. Und wenn es uns gelingt, all diese planetenrettenden Ideen sprichwörtlich unter ein Dach zu bringen und genug Greenloops über das ganze Land zu verteilen, damit diese Ideen zur breiten Masse durchsickern, dann haben wir endlich unsere Grüne Revolution. Keine Opfer mehr, kein schlechtes Gewissen mehr. Keine Konflikte mehr zwischen Profit und Planet. Die Amerikanerinnen und Amerikaner können alles haben, und was ist amerikanischer, als alles zu haben?
1 Kate McCray wuchs in Columbia im Bundesstaat Maryland auf.
2 Masdar City: ein nachhaltiges Stadt-Projekt in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate.
3 Dongtan: eine geplante Ökostadt auf der Insel Chongming Dao in Shanghai, China.
4 Budget-Sequestrierung: ein Sparetat-Gesetz, das 2013 vom amerikanischen Kongress verabschiedet wurde.
5 BedZED: eine nachhaltige Wohnsiedlung, bestehend aus hundert Häusern, die 2002 im Londoner Vorort Hackbridge fertiggestellt wurde.
6 Sieben Linden: ein vom öffentlichen Versorgungsnetz abgekoppeltes Ökodorf in Deutschland.
7 Dunedin-Projekt: eine Ökosiedlung in Dunedin in Florida, USA.
8 Die Formulierung »Ich spiele das Orchester« aus dem Spielfilm Steve Jobs von 2015 wurde von Drehbuchautor Aaron Sorkin geschrieben und von Hauptdarsteller Michael Fassbender gesprochen; es ist allerdings nicht belegt, dass Jobs diese Worte jemals selbst geäußert hat.
2. Kapitel
Glück besteht aus einem soliden Bankkonto, einer guten Köchin und einer tadellosen Verdauung.
– Jean-Jacques Rousseau
2. Tagebucheintrag
23. September
Gestern Abend waren wir zu einem Begrüßungs-Potluck-Dinner im Gemeinschaftshaus eingeladen.
Mir wird bewusst, dass ich dieses Gebäude noch gar nicht beschrieben habe. Es sieht aus, wie man sich das typische Hauseigentümer-Gemeinschaftsgebäude einer Plansiedlung vorstellt, und ist wie ein traditionelles nordwestpazifisches Langhaus gestaltet. Ich habe »Langhaus« gestern Abend gegoogelt. Die Bilder waren unserem Gemeinschaftshaus sehr ähnlich. Es besitzt einen großen Mehrzweckraum mit einer Toilette und einer Kochnische auf der einen Seite und einem gemütlichen offenen Kamin aus Pflastersteinen auf der anderen. Das wunderschöne Glühen des Feuers darin vermischte sich mit dem Schein der Kiefernduftkerzen und dem natürlichen Licht der Abenddämmerung. Das Gemeinschaftshaus erstreckt sich in Ost-West-Richtung, sodass wir nur die Flügeltür am Eingang offen stehen zu lassen brauchten, um den spektakulären Sonnenuntergang zu sehen. Ich bin überrascht, wie warm es war, ganz sicher nicht kälter als die Nächte in L.A.
Was für eine idyllische Atmosphäre, und das Essen! Salat aus schwarzen, buttrigen Edamame-Bohnen, Quinoa mit gegrilltem Gemüse und Lachs aus den nahe gelegenen Flüssen! Los ging es mit dem ersten Gang, einer ausgezeichneten Suppe: Gemüse-Soba, zubereitet von den Boothes. Sie wohnen im übernächsten Haus links von uns. Vegane Feinschmecker. Die beiden haben die Suppe tatsächlich gemacht, nicht nur die Zutaten vermischt und zubereitet. Die Soba-Nudeln haben sie eigenhändig aus Rohwaren hergestellt, die am selben Tag frisch geliefert worden waren. Seit meinem Umzug nach L.A. habe ich oft Soba-Nudelsuppe gegessen. Einmal sogar im Nobu, wo Dan und seine ehemaligen Geschäftspartner die Gründung ihrer Firma feiern wollten, und ich bin mir ziemlich sicher, dass sie nicht mit dieser hier mithalten konnte.
»Aus unserer eigenen Hand.« Vincents Worte. Ich mag ihn und seine Frau Bobbi. Sie sind in ihren Sechzigern, sind beide klein und wirken glücklich. So wie sie stellt man sich die typische Tante und den typischen Onkel vor.
Außerdem hatten sie keine Vorbehalte gegenüber denjenigen von uns, die nicht vegan leben. Klingt das so, als hätte ich Vorbehalte? Sie wissen schon, was ich meine: all die Veganer in Venice, vor allem die neuen. Wie sie Dans Lederschuhe ansahen oder meine Seidenbluse, und wie einer von ihnen ein Aquarium als Gefängnis bezeichnete. Wir waren bei jemandem zu Hause auf eine Party eingeladen, und dieser Typ ging voll auf die Gastgeber los, weil sie einen Koi-Teich hatten. »Wie fänden Sie es denn, wenn Sie in einer winzigen Luftblase auf dem Meeresgrund eingeschlossen wären?« Die Boothes waren nicht so. Sie waren richtig nett. Und Dan war hin und weg von ihrem Hauseinweihungsgeschenk.
Stellen Sie sich ein auf den Kopf gestelltes »T« aus Metall vor, das Sie in der geschlossenen Hand halten. Der Hals des »Ts« ragt zwischen Ihren Fingern heraus, ein langer, schmaler, geschärfter Löffel, der sich zu einer Spitze verjüngt. Bobbi zufolge handelt es sich dabei um einen Kokosnussöffner, der besonders gut in die »Poren« eindringt. So nennt man die kleinen schwarzen, bedeckten Öffnungen. Das hatte ich nicht gewusst. Was ich auch nicht gewusst hatte, war, dass Kokosnusswasser der beste natürliche Durststiller überhaupt ist. Vincent erklärte, dass es der Flüssigkeit in unseren Blutzellen am nächsten kommt. Bobbi scherzte: »Nicht, dass wir hausgemachte Transfusionen bräuchten«, wurde aber wieder ernst, als sie die Vorzüge von Kokosnusswasser bei einer Wanderung erklärte. Die beiden gehen jeden Vormittag wandern und verbrauchen im Sommer ganze Berge von Kokosnüssen.
»Und ich nehme an, man kann damit jemandem ein Auge ausstechen«, fügte Bobbi hinzu und blickte dabei Dan an.
Er hatte den Öffner in der Hand und fuchtelte damit herum. Dabei sah er aus, als wäre er ungefähr zwölf Jahre alt, und klang auch so. »Mann, das ist total krass! Danke!«
Wahrscheinlich hätte ich mich für ihn schämen sollen, doch die Boothes lächelten ihn nur an wie stolze Eltern.
Echte Eltern waren auch da. Die Familie Perkins-Forster. Sie sind erst seit ein paar Monaten hier und vor uns als Vorletzte hergezogen.
Carmen Perkins ist … Ich bin mir nicht sicher, ob sie Mysophobikerin ist, schließlich habe ich sie gerade erst kennengelernt. Aber das Handdesinfektionsmittel – sie benutzte es sofort, nachdem sie uns die Hand geschüttelt hatte, sorgte dafür, dass ihre Tochter es ebenfalls benutzte, und bot es allen anderen Anwesenden an. Trotzdem ist sie total nett. Sie sagte immer wieder, wie wunderbar es wäre, dass wir, Dan und ich, »den Kreis schließen« würden. Sie ist Kinderpsychologin und hat gemeinsam mit ihrer Frau Effie ein Buch über Heimunterricht im digitalen Zeitalter geschrieben. Carmen nannte sie immer »Euphemia«.
Effie ist ebenfalls Kinderpsychologin, nehme ich an. So hat Carmen sie zumindest vorgestellt. »Na ja, eigentlich habe ich keine Zulassung …«, setzte Effie an, doch Carmen legte ihr die Hand auf den Arm und schnitt ihr das Wort ab.
»Sie arbeitet an ihrem Abschluss und ist bereits viel schlauer als ich«, sagte sie, was Effie leicht erröten ließ.
Ich weiß nicht, ob Effie tatsächlich kleiner ist als Carmen, aber ihre Haltung lässt es so wirken. Hängende Schultern. Leise Stimme. Wenig Blickkontakt. Bevor sie unsere Fragen beantwortete, warf sie Carmen manchmal einen schnellen Blick zu. Erlaubnis? Manchmal danach. Zustimmung?
Auch ihrer gemeinsamen Tochter Palomino widmete Effie eine Menge Zeit und Aufmerksamkeit. Carmen zufolge ist der Name ein »Platzhalter«, den sie ihr während der Adoption gaben. Ich spürte eine gewisse Abwehrhaltung, vor allem, als Effie lang und breit erklärte, ein »Platzhalter«-Name sei etwas, das Palomino ändern könne, falls sie jemals einen fände, der ihr besser gefiel. Carmen erzählte, bei ihrem ersten Treffen in einem Waisenhaus in Bangladesch habe sie ein zerlesenes Bilderbuch über Pferde umklammert. Ich fragte sie nach Pferden, und Dan wollte von ihr wissen, ob sie gerne hier wohne. Keiner von uns beiden bekam eine Antwort.
Kennen Sie das berühmte National-Geographic-Foto von dem afghanischen Mädchen mit den grünen Augen? Palominos Augen sind braun, haben aber den gleichen gequälten Ausdruck. Einen Moment lang starrte sie uns mit diesen Augen einfach an, ohne etwas zu sagen, dann widmete sie sich wieder ihrem Anti-Stress-Spielzeug, einem kleinen selbstgemachten, mit Bohnen gefüllten Säckchen. Effie umarmte sie und entschuldigte sich: »Sie ist ein bisschen schüchtern.«
Carmen fiel ihr ins Wort mit: »Und es ist nicht ihre Aufgabe, uns mit Konversation zu bespaßen.« Dann erzählte sie uns, dass das Buch das Einzige gewesen sei, was sie besessen habe, das Buch und einen Laib Brot in einer Plastiktüte. Als sie ihr das erste Mal begegnet waren, wusste sie nicht, wann sie das nächste Mal etwas zu essen bekommen würde. Effie schüttelte den Kopf, umarmte das Mädchen noch einmal und sagte, es sei völlig unterernährt gewesen und habe alle möglichen Vitaminmängel, Mundfäule und Rachitis gehabt. Sie fing an zu erzählen, was Palominos Familie, die der Rohingya-Minderheit angehörte (was ich später googeln muss), unter der Regierung Myanmars durchgemacht hatte. Carmen brachte sie mit einem weiteren Blick zum Schweigen und sagte: »Aber wir brauchen sie nicht mit diesen Erinnerungen zu triggern. Wichtig ist, dass sie jetzt in Sicherheit und gesund ist und geliebt wird.«
Das veranlasste Alex Reinhardt, die bedauernswerte Situation vieler ethnischer Minderheiten anzusprechen. Haben Sie schon einmal von Dr. Reinhardt gehört? Er sieht aus wie der Autor von Game of Thrones ohne die griechische Fischermütze. Er trägt allerdings ein Barett, was ihm vermutlich auch zusteht. Seinen Namen habe ich ein paarmal in der Schule gehört, und ich habe seine Bücher auf Amazon gesehen. Ich glaube, dass ich das Ende seines TED-Talks aufgeschnappt habe, den sich jemand neben mir im Flugzeug ansah.
Ich nehme an, er ist eine ziemlich große Nummer. Sein Buch Rousseau’s Children war anscheinend »bahnbrechend« – dieses Wort benutzte zumindest Tony Durant. Reinhardt reagierte darauf mit einem leichten, beinahe beschämten Schulterzucken, beschrieb aber daraufhin, warum es ihn ins akademische Rampenlicht befördert hat.
Hoffentlich bekomme ich das richtig hin. Ich werde versuchen wiederzugeben, was er mir erklärt hat. Jean-Jacques Rousseau – nicht zu verwechseln mit Henry David Thoreau, wie Dan es an diesem Abend tat – war ein Genfer Philosoph, der im 18. Jahrhundert lebte. Er war der Auffassung, frühe Menschen seien im Grunde genommen gut gewesen, distanzierten sich jedoch von der Natur und damit auch von ihrer eigenen Natur, als sie anfingen, sich in Städten niederzulassen. In Reinhardts Worten, »können sämtliche Übel von heute auf die Korrumpierung durch die Zivilisation zurückgeführt werden«. In Rousseau’s Children belegt Reinhardt Rousseaus These, indem er das Jäger- und Sammlervolk der Kung San aus der afrikanischen Kalahari studiert. »Sie haben keines der Probleme, die unsere sogenannten fortschrittlichen Gesellschaften quälen«, sagte er. »Keine Kriminalität, keine Süchte, keine Kriege. Sie sind die Personifikation von Rousseaus These.«
»Und im Gegensatz zu Rousseaus Ideal werden Frauen nicht darauf reduziert, tugendhafte Sex-Sklavinnen in einer von Männern dominierten Gesellschaft zu sein«, ergänzte Carmen. Sie sagte es in nettem Tonfall, mit einem Lächeln, verdrehte dazu aber sarkastisch die Augen. Effie brachte das zum Kichern, und Reinhard, der sich noch eine Portion Quinoa nahm, machte den Eindruck, als würde er jeden Moment etwas nicht gerade Freundliches erwidern.
»Rousseau war auch nur ein Mensch«, sagte Tony, »aber er hat unzählige Generationen auf unzähligen Gebieten beeinflusst, darunter auch Maria Montessori.« Das lockerte die Situation auf – das und sein unglaubliches Lächeln. Seine Augen. Letztere richteten sich auf mich, und ich spürte ein Kribbeln auf meinen Unterarmen.
»Alex hier«, sagte Tony und stieß mit seinem Glas gegen das von Reinhardt, »war die spirituelle Inspiration für Greenloop. Als ich Rousseau’s Children las, konkretisierte sich meine Vision von nachhaltigem Wohnen. Mutter Natur sorgt dafür, dass wir ehrlich bleiben, erinnert uns daran, wer wir sein sollen.« Daraufhin hakte sich seine Frau Yvette bei ihm ein und stieß einen leisen, stolzen Seufzer aus.
Die Durants.
O mein Gott … oder meine Götter!
Es ist fast schon absurd, wie gutaussehend die beiden sind. Und einschüchternd! Yvette sieht aus wie ein … Yvette ist engelsgleich. Alterslos. Dreißig? Fünfzig? Sie ist groß und schlank und könnte Harper’s Bazaar entstiegen sein. Honigblondes Haar, makellose Haut, strahlende, funkelnde haselnussbraune Augen. Ich hätte sie nicht schon im Voraus googeln sollen. Das machte alles noch schlimmer. Sie hat tatsächlich eine Zeit lang gemodelt. Für ein paar ältere Zeitschriften wie Cargo und Lucky. Hätte ich mir denken können. All die märchenhaften Fotos von ihr auf Aruba und an der Amalfi-Küste. Niemand hatte es verdient, im Bikini so gut auszusehen. Und niemand, der so gut aussah, aussieht, sollte auch noch so nett sein.
Sie war auch diejenige, die uns ursprünglich zum Abendessen eingeladen hatte. Unmittelbar nachdem ich von meinem Spaziergang zurückkam, total verschwitzt und eklig, und Dan auf dem Sofa schlief und überall Kartons mit Müll herumstanden, klingelt es an der Tür, und vor mir steht diese bezaubernde, strahlende Nymphe. Ich glaube, ich habe irgendetwas Eloquentes gesagt wie »ähm-äh«, bevor sie mich zur Begrüßung fest umarmte (wozu sie sich bücken musste) und mir sagte, wie sehr sie sich freue, dass wir uns für Greenloop entschieden hätten.
Ihr leichter britischer Oberklasse-Akzent lässt sie ohnehin schon wie ein Genie klingen, und obendrein promoviert sie auch noch in Therapie psychosomatischer Erkrankungen. Ich weiß nicht, wer Dr. Andrew Weil ist (noch etwas, was ich recherchieren muss), aber anscheinend war sie früher sein Schützling, und sie hat mich eingeladen, an ihrer »integrativmedizinischen Yogastunde« teilzunehmen, die täglich Heerscharen von Online-Subscribern mitverfolgen.
Bildhübsch, brillant und großzügig. Sie überreichte uns eine sogenannte »Glückslampe« als Begrüßungsgeschenk, die das Sonnenspektrum simuliert und damit saisonale affektive Störungen verhindern soll. Ich wette, sie braucht so etwas nicht, weder gegen Depressionen, noch um ihren makellosen Ganzkörperteint zu erhalten.
Tony scherzte, dass er keine brauche, da Yvette seine Glückslampe sei.
Tony.
Okay, ich soll ehrlich sein, richtig? Darum haben Sie mich doch gebeten. Außer uns beiden wird das hier niemand lesen. Keine Zurückhaltung. Keine Lügen. Nichts als das, was ich im jeweiligen Moment denke und fühle.
Tony.
Er ist auf jeden Fall älter. In den Fünfzigern vielleicht, aber mit dem markanten Aussehen eines älteren Filmstars. Dan hat mir einmal von einem alten Comicheft erzählt – G.I. Joe? –, in dem die Bösen aus der DNA sämtlicher Diktatoren der Vergangenheit einen perfekten Superbösewicht erschaffen. Ich habe das Gefühl, das ist ungefähr das Gegenteil von dem, wie es bei Tony gelaufen ist, nur mit George Clooneys Haut und Brad Pitts Lippen. Okay, vielleicht noch Sean Connerys Haaransatz, aber der hat mich nie gestört. Schließlich toleriere ich sogar Dans Männerdutt. Und diese Arme – die erinnern mich irgendwie an den Typen, von dem Frank früher ein Poster in seinem Zimmer hängen hatte. Henry Rollins? Nicht so dick und muskulös, aber drahtig und tätowiert. Als er seine Hand ausstreckte, um Dan die Hand zu schütteln, sah ich, wie sich seine Muskeln unter den Tätowierungen kräuselten. Es wirkte, als wären sie lebendig, die Tribal-Linien und die asiatischen Schriftzeichen. Alles an Tony war lebendig.
Okay. Ehrlich. Er erinnerte mich an Dan. Wie er früher war. Energiegeladen, engagiert. Wie er früher mühelos einen Raum beherrschte, jeden Raum. Die Rede, die er vor unserem Abschlussjahrgang hielt. »Wir müssen nicht für die Welt bereit sein. Die Welt sollte sich lieber für uns bereit machen!« Vor acht Jahren? So lange ist das her?
Ich versuchte, keine Vergleiche anzustellen, als ich neben dem Menschen saß, zu dem er geworden war, während er am Tisch dem Menschen gegenübersaß, der er hatte werden wollen.
Dan.
Ich bekomme gerade beim Schreiben ein schlechtes Gewissen, dass ich ihm beim Abendessen so wenig Beachtung geschenkt und ihm nicht einmal reflexartig die Hand gereicht habe, als der Boden zu beben begann.
Es war nur ein ganz leichtes Rütteln. Die Gläser klirrten, mein Stuhl wackelte.
Anscheinend ist das im vergangenen Jahr immer wieder geschehen. Nur ein leichtes Beben, das vom Mount Rainier kommt, sagten die anderen. Nichts, worüber man sich Sorgen machen müsste. Vulkane tun das nun einmal. Es erinnerte mich an unseren ersten Monat in Venice Beach, als unser Bett anfing zu schlingern, nicht zu beben, sondern zu schlingern wie ein Schiff bei schwerer See. Von der San-Andreas-Verwerfung hatte ich gehört, ich wusste allerdings nichts von all den winzigen Verwerfungslinien, die kreuz und quer unter L.A. verlaufen. Ich kann gut verstehen, warum so viele Oststaatler ihr erstes Erdbeben nicht überstehen. Wenn Dan nicht so auf »Silicon Beach« versessen gewesen wäre, hätte ich ganz bestimmt das Handtuch geworfen. Ich bin froh, dass ich geblieben bin, froh, dass mir der riesige Unterschied zwischen ein paar kleineren Beben und dem mutmaßlichen Megabeben bewusst wurde. Die leichten Erschütterungen in Greenloop, schwächer als die eines vorbeifahrenden Lastwagens, riefen mir in Erinnerung, was Sie über den Unterschied zwischen Verleugnung und Phobie sagten.
Verleugnung ist das irrationale Verkennen einer Gefahr.
Eine Phobie ist die irrationale Furcht vor einer vermeintlichen Gefahr.
Ich bin froh, dass ich mich in der besagten Situation rational verhalten habe, vor allem deshalb, weil es allen anderen nichts auszumachen schien. Yvette schenkte mir sogar ein einfühlsames Lächeln und sagte: »Wie unfair es ist, kalifornischen Erdbeben für so was den Rücken zu kehren.«
Wir lachten alle, bis es zum nächsten Beben kam – einem menschlichen Beben!
Das war, als Mostar auftauchte.
Die alte Dame, die ich zuvor hinter dem Fenster gesehen hatte. Nicht Ms oder Mrs oder Mostar Irgendetwas. Nur »Mostar«. Sie hatte Verspätung und entschuldigte sich dafür, dass sie in der »Werkstatt« abgelenkt gewesen sei und die zusätzliche Zeit gebraucht habe, um die Tulumba abkühlen zu lassen. So nannte sich ihre Nachspeise: Tulumba. Ein großer Teller mit etwas, das aussah wie in Stücke geschnittene Churros unter einer Sirup-Glasur. Wir hatten bereits einen Nachtisch gehabt. Die Durants hatten ihn zusammen mit ihrem Lachs mitgebracht. Mit Honig beträufelte Apfelscheiben direkt von ihrem Baum und glutenfreies, handwerklich hergestelltes Speiseeis mit Beeren aus der Region. Ich freute mich darauf, Letzteres mit meiner allabendlichen Dosis Halo Top zu vergleichen, erst recht nachdem mich alle gewarnt hatten, wie gut es angeblich war. Bei Mostar war die Botschaft offenbar nicht angekommen. Oder war es ihr egal? Dan hatte kein Problem damit, dass es noch mehr Nachtisch gab. Er stürzte sich auf die Tulumba und verschlang bestimmt fünf oder sechs davon. Als er sie in sich hineinstopfte, stöhnte er genüsslich. Total ekelhaft.
Ich nahm aus Höflichkeit eine. Den frittierten Teig konnte ich bereits riechen. Ich möchte lieber nicht darüber nachdenken, wie viele Kalorien er hat. Vielleicht nahm deshalb kaum jemand eine. Die Boothes sagten irgendetwas von wegen tierischer Butter. Die Perkins-Forsters erwähnten Palominos Glutenallergie. Ziemlich unbedacht von Mostar, schließlich muss sie von all den Ernährungseinschränkungen gewusst haben. Vielleicht aß auch Reinhardt deshalb nur eine. Bei seinem Äußeren hätte ich das nicht erwartet. Tut mir leid. Bodyshaming. Aber im Ernst, so, wie er sich durch alles andere durchackerte, rechnete ich damit, dass er sich Dan bei seiner Fressorgie anschließen würde. Stattdessen knabberte er jedoch nur an einer Tulumba herum. Höflich und unterkühlt. Man spürte die Temperatur im Raum sinken.
»Essen Sie.« Mostar ließ sich an einem Ende des Tisches auf einen Stuhl plumpsen. »Los, machen Sie schon, damit ein bisschen Fleisch auf die Knochen kommt.« Sie ist die stereotype altmodische Oma, bis hin zum ausländischen Akzent. Was für ein Akzent? Russisch? Israelisch? Eine Menge gerollte »Rs«.
Sie ist wirklich klein, noch kleiner als Mrs Boothe, die mir nur bis zur Stirn reicht, glaube ich. Vielleicht eins fünfzig oder kleiner? Und gebaut wie ein Fass – als hätte jemand ein Fass in ein Kleid gesteckt. Ihre olivfarbene Haut ist faltig, vor allem um die Augen herum. Faltig und dunkel. Waschbärartig, als hätte sie seit einem Jahr nicht mehr geschlafen. Ist das gemein? Ich möchte nicht gemein sein. Es ist nur eine Feststellung. Sie hat allerdings schöne Augen, hellblaue, die von den dunklen Augenringen betont werden. Ihr Haar ist silberfarben, nicht grau oder weiß, und zu einem Dutt nach hinten gebunden.
Ihre Energie unterschied sich deutlich von der aller anderen. Während die Schwingungen der meisten im Raum langsame, gewellte Linien zu sein schienen, glichen sie bei ihr einem harten, scharfen Zickzack. Mein Gott, ich habe zu lange in Südkalifornien gelebt.
Aber an ihr war tatsächlich alles hart: wie sie sich bewegte, wie sie sprach. Sie starrte mich unentwegt an, beobachtete, wie ich an ihrem Nachtisch herumpickte. Auch alle anderen sahen mich an. Es fühlte sich irgendwie merkwürdig an, als hätte es eine tiefere Bedeutung, wie ich auf ihre Tulumba reagierte. Ich weiß, dass ich viel zu viel in das Ganze hineininterpretiere. Sie sagten, ich solle auf meinen Instinkt vertrauen, aber ich fühlte mich wirklich so unbehaglich, dass mir der Appetit verging.
Tony muss es gespürt haben, Gott sei Dank, denn er eilte mir zu Hilfe, indem er Mostar ausführlich vorstellte. »Wir können uns glücklich schätzen«, sagte er, »eine weltberühmte Künstlerin unter uns zu haben.« Ihr Medium ist Glas, das sie seit Jahren gestaltet. So hatte er sie kennengelernt, bei der »Chihuly Garden and Glass«-Ausstellung in Seattle. Yvette fügte hinzu, sie sei damals gerade auf dem Weg gewesen, eine »Crystal«-Yogastunde zu geben, als sie zufällig ihre Ausstellung sahen. Tony schloss die Geschichte nahtlos ab, indem er erklärte, dass er eine »epische Zusammenarbeit« zwischen ihnen beiden vorgeschlagen habe: ein maßstäbliches Modell ihres Heimatorts, wo auch immer sich dieser befindet, das ganz dem 3D-Drucker entstammt.
Für Cygnus ist es von großer Bedeutung, eine 3D-Glas-Technologie zu perfektionieren, die »Karlsruhe um Welten voraus« ist.9 Ich rechnete damit, dass mich diese Unterhaltung langweilen würde. Dans Unizeit hat mich mehr als genug über 3D-Druck gelehrt. Doch Tonys Enthusiasmus konnte man nur schwer widerstehen, als er davon sprach, dass Mostars Projekt ein »bahnbrechender Erfolg für alle« sei. Cygnus stellt seinen neuen Durchbruch zur Schau, Mostar darf mietfrei im Paradies wohnen, und die Welt wird letzten Endes ein wieder zum Leben erwecktes Stück Geschichte zu sehen bekommen.
»Das ist das Thema meines neuen Buches«, warf Reinhardt ein. »Ressourcenkonflikte in den 1990er-Jahren.«
Ressourcenkonflikte?
Ich war mir nicht sicher, was dieses Thema mit unserer Unterhaltung zu tun hatte und warum Mostars Heimatort wieder »zum Leben erweckt« werden musste. Außerdem war ich mir nicht sicher, ob es beim Abendessen angebracht war, zu tief nachzubohren. Ich wollte Palomino nicht triggern. Während ich mit einer Entscheidung rang, nahm Mostar sie mir ab, indem sie sich an Reinhardt wandte und abwinkte. »Oh, diese netten jungen Leute möchten das alles nicht hören.«
Dann drehte sie sich zu mir und fragte: »Und, wie sind Sie hier gelandet?«
Das machte mich etwas nervös, und meine Kiefermuskeln spannten sich leicht an. Wenn ich sie nur mit meiner Geschichte ablenkte, dachte ich mir, dann würde sie sich vielleicht nicht nach Dan erkundigen. Ich erzählte von meinem Job, doch der war einfach zu langweilig. Nein, ich mache mich nicht wieder selbst herunter. Meine Arbeit macht mir Spaß, und ich weiß, dass ich gut darin bin, aber wer möchte schon etwas über eine Rechnungsprüferin in einer Vermögensverwaltung in Century City hören? Ich gab mir Mühe, mich mehr auf meine Verbindung zu diesem Ort zu fokussieren. Jeder kannte und mochte Frank, und Mr Boothe (ein ehemaliger Arbeitskollege von ihm) erzählte mir, dass er derjenige war, der Frank und Gary darin bestärkt hatte, hier heraufzuziehen, als die Siedlung gebaut wurde. Bobbi schüttelte traurig den Kopf, als sie sagte: »Tut mir leid, dass es mit den beiden nicht funktioniert hat.«
Doch dann fügte Yvette heiter hinzu: »Aber ihre schmerzlose Trennung hat uns Sie beide beschert.«
Das hellte die Stimmung wieder auf, bis Mostar sie verdarb. Das kann ich ihr wahrscheinlich nicht verübeln. Ich meine, warum hätte sie nicht fragen sollen? Schließlich wusste sie es nicht. Niemand wusste es. Das ist einfach nur Smalltalk, Kennenlerngeschwafel. Es ist die Standardfrage. »Und was machen Sie?«
Meine Eingeweide verkrampften sich, als sie sich an Dan wandte. Die Worte schienen in Zeitlupe herauszurollen.
»Und … was … machen … Sie?«
Dan sah von seinem Teller auf, kniff die Augen zusammen, als hätte er in eine Zitrone gebissen, und sagte, er sei »Unternehmer in der Digitalbranche«. In L.A. rettete uns das meistens, was wahrscheinlich daran liegt, dass sich dort niemand wirklich um jemanden kümmert, außer um sich selbst. Selbst hier nickten alle nur und schienen bereit zu sein, zum nächsten Thema überzugehen. Doch Mostar …
»Dann haben Sie also keinen Job.«
Im Raum wurde es vollkommen still. Ich spürte die Haut in meinem Gesicht. Was sagt man? Wie antwortet man?
Gott segne dich, Tony Durant.
»Dan ist Künstler, Mosty, genau wie Sie und ich.« Er lächelte und tippte sich an die Schläfe. »Wie viel von unserem Arbeitsprozess spielt sich hier oben ab? Ungesehen, ungemessen und ganz bestimmt unbezahlt!«
Carmen meldete sich zu Wort mit: »Wurden Sie für all Ihre Skulpturen bezahlt, bevor sie fertiggestellt waren?«, was ein Nicken und ein kleinlautes »Yeah« von ihrer Frau auslöste.
»Es gibt Gehaltsscheckarbeit und Projektarbeit«, sagte Vincent mit einem Schulterzucken, was Reinhardt dazu bewog, sich darüber auszulassen, dass Europäer einen wesentlich ausgeglicheneren Sinn für Identität hätten als Amerikaner. »Jenseits des großen Teichs definiert man sich nicht nur über seinen Job.« Das war ein wenig verwirrend, da er es zu einer Europäerin (glaube ich) sagte, doch es war mir egal. Ich war einfach nur froh, dass sich alle eingemischt und die Situation gerettet hatten.
Vielleicht war es ein bisschen zu viel des Guten gewesen, da Tony jetzt wieder eine etwas neutralere Haltung einnahm. »Mosty versucht nur, Dans Weg zu verstehen, allerdings auf ihre ganz eigene Weise.« Und als er hinzufügte: »Und sie ist ziemlich eigen«, wurde das gedämpfte Lachen im Raum lauter.
Selbst Mostar schien jetzt mit im Boot zu sein. Sie lächelte und hob die Hände zu einer »Ihr habt mich erwischt«-Geste. Offenbar machte es ihr überhaupt nichts aus. Kein einziger Verbündeter im Raum, doch sie schien damit kein Problem zu haben. Ich wäre gestorben.
Leid tat sie mir allerdings nicht, schon gar nicht, als wir Gute Nacht sagten und sie Dan von der Seite einen Blick zuwarf. Oder eher ein fieses Grinsen, wie: »Ich hab dich auf dem Kieker.« Das ist bestimmt der Grund, weshalb ich letzte Nacht nicht schlafen konnte. Ich zwang mich zu lesen, anstatt mir noch einmal Die Braut des Prinzen anzuschauen. Diesen Film liebe ich schon mein ganzes Leben. Er ist die melatoninreduzierende Strahlung des Bildschirms wert. Ich brauchte die Vertrautheit, die Geborgenheit.
Ich habe das Gefühl …
Ich wünschte …
Ich kann nicht bis zu unserer Skype-Sitzung nächste Woche warten. Vielleicht rufe ich Sie einfach an und frage, ob wir den Termin vorverlegen können. Ich habe ihn wirklich nötig. Vor allem nach dem heutigen Tag.
Dan und ich haben nicht darüber gesprochen, was beim Abendessen vorgefallen ist. Warum auch? Wann haben wir das letzte Mal wirklich über etwas gesprochen? Ich sah, dass er aufgebracht war. Das lässt sich immer daran ablesen, wie lange er auf der Couch sitzen bleibt. Wenn er eine Stunde nach mir ins Bett kommt, ist er angefressen. Ist es bereits mitten in der Nacht, macht ihm etwas richtig zu schaffen. Wenn ich ihn am Morgen schlafend antreffe, sein iPad auf dem Bauch …
Jetzt sitzt er auch gerade da. Er ist wach, hilft mir aber nicht. Ich nehme an, er hört, dass ich im Obergeschoss beim Auspacken bin. Ich habe gerade die Regale aufgebaut. Drei Stück, zwei hohe und ein hüfthohes, mit langen Metallstützen. Sie sind schwer und laut. Er muss es gehört haben, als ich mit ihnen herumgeklappert habe. Vielleicht hat seine Musik es auch übertönt. Habe ich schon erwähnt, dass man jeden Raum auf unterschiedliche Geräte abstimmen kann? Ich nehme an, das soll jedem seine persönliche Zone bieten, aber nachdem Dan das Wohnzimmer für sich in Anspruch genommen hat und sich dort die größten Lautsprecher befinden …
Ich höre die Musik durch die Tür. Seine Frühe-Neunzigerjahre-Schleife.
Gottverdammtes »Black Hole Sun«.
Wow, ich bin echt wütend. Ich bin es nicht gewohnt, so zu empfinden. Es gefällt mir nicht. Vielleicht mache ich später einen Spaziergang, gehe ein bisschen wandern, damit ich einen klaren Kopf bekomme.
Das habe ich nötig. Der Knoten ist wieder da.
Aus meinem Interview mit Frank McCray jr.
Kate Hollands Bruder ist seit den vor nicht einmal einem Jahr aufgenommenen Fotos in den sozialen Medien erheblich gealtert. Sein volles Gesicht hat sich verschmälert, sein Haar ist dünner und grau geworden. Der ehemalige Cygnus-Anwalt wirkt angespannt und ungeduldig, und bei jedem seiner Worte schwingt unterdrückte Wut mit. Als er mir die rechte Hand hinstreckt, fällt mir auf, dass seine andere Hand auf einem Smith-&-Wesson-500-Revolver im Halfter ruht.
Wir treffen uns bei seinem »provisorischen Basislager«, einem Wohnmobil, das am Ende einer asphaltierten Straße am Fuß der Kaskadenkette geparkt ist. Vor unserem Treffen warnte er mich, dass er nicht allzu viel Zeit hätte, um sich mit mir zu unterhalten. Daran erinnert er mich noch einmal, als er mich hereinbittet. Das Innere des Fahrzeugs ist gepflegt, sauber und akribisch geordnet, aber bis unters Dach mit Equipment vollgestopft. Ich sehe Campingausrüstung, gefriergetrocknete Nahrung, den schwarzen Transportkoffer eines sehr teuren Zielfernrohrs und mehrere Schachteln mit Munition für verschiedene Schusswaffen.