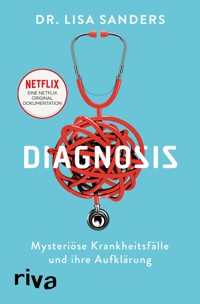
15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Riva
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Rätselhafte Krankheitsfälle – spannend wie ein Krimi! Das offizielle Buch zum Netflix-Doku-Serien-Hit Diagnosis Eine Frau, die unter unerträglichen Muskelschmerzen leidet. Ein Mann, der regelmäßig von heftigen Ohnmachtsepisoden befallen wird. Ein Mädchen, das bis zu Hunderte Male am Tag kurzzeitig gelähmt ist. Nicht immer ist bei einer Erkrankung sofort klar, was die Ursache ist. Manchmal vergehen Jahre, sogar Jahrzehnte, bis die Diagnose feststeht – und die Patienten werden mit ihrem Leid alleingelassen. Die bekannte Internistin Dr. Lisa Sanders, deren New York Times Magazine-Kolumne »Diagnosis« erfolgreich von Netflix adaptiert wurde, nimmt sich dieser hoffnungslosen Fälle an und lässt uns an der nervenaufreibenden Suche teilhaben. Wie bei Dr. House schauen wir den Ärzten über die Schulter, spüren die Unsicherheit der Betroffenen und durchleben ihre Ängste und den Nervenkitzel – bis das Rätsel mithilfe des Internets, über das Ärzte, Patienten und Angehörige aus aller Welt ihr Wissen teilen, endlich gelöst ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 366
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Für die Patienten, die mir ihre Geschichte anvertraut haben – in meiner Praxis, in meiner Kolumne und in diesem Buch.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://d-nb.de abrufbar.
Die Kolumnen in diesem Buch erschienen ursprünglich im New York Times Magazine.
Für Fragen und Anregungen
1. Auflage 2020
© 2020 by riva Verlag, ein Imprint der Münchner Verlagsgruppe GmbH
Nymphenburger Straße 86
D-80636 München
Tel.: 089 651285-0
Fax: 089 652096
Die englische Originalausgabe erschien 2019 bei Broadway Books, an imprint of Random House, a division of Penguin Random House LLC, New York, unter dem Titel Diagnosis. Solving the Most Baffling Medical Mysteries. Copyright © 2019 by Lisa Sanders. All rights reserved. The translation published by arrangement with Broadway Books, an imprint of Random House, a divison of Penguin Random House, LLC.
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Übersetzung: Martin Rometsch
Redaktion: Silke Panten
Umschlaggestaltung: Michael Morris, Marc-Torben Fischer
Umschlagabbildung: GrandeDuc/Shutterstock
Layout: Susan Turner, Daniel Förster
Satz und E-Book: Daniel Förster
ISBN Print 978-3-7423-1441-3
ISBN E-Book (PDF) 978-3-7453-1102-0
ISBN E-Book (EPUB, Mobi) 978-3-7453-1103-7
Weitere Informationen zum Verlag finden Sie unter
www.rivaverlag.de
Beachten Sie auch unsere weiteren Verlage unter www.m-vg.de
Inhalt
EinführungDes Rätsels Lösung
Teil 1Glühendes Fieber
Nur ein Fieber
Die Grippe, die stur blieb
Nächtliche Glut
Krank auf der Hochzeitsfeier
Vergessene Auslöser
Eine tödliche Grippe
Teil 2Schmerzen im Bauch
Qualvolle Episoden
War der Fisch schuld?
Magenbeschwerden verschlimmern sich
Ein Hockeyschläger im Darm
Peinliches Alter
Das tut so weh
Messerattacken
Plötzlich krank, schon wieder
Teil 3Fürchterliches Kopfweh
Das sehe ich anders
Es begann mit Nebenhöhlenschmerzen
Der Elefantentrainer bekommt Kopfweh
Ein Meer aus Grau
Alle lügen
Das schlimmste Eiscreme-Kopfweh, ohne die Eiscreme
Ein Eispickel im Kopf
Teil 4Atemnot
Ein tödlicher Juckreiz
Ich fließe über
Muskelbepackt
Ein harter Kampf
Ein gebrochenes Herz
Kollabiert
Teil 5Wahnvorstellungen und Sinnestäuschungen
Flitterwochen in der Hölle
Ein anderer Mensch
Unerwartet betrunken
Totale Verwirrung
Anzeichen für Traurigkeit
Ein schrecklicher Wahnsinn
Unter Hochdruck verrückt
Teil 6Bewusstlosigkeit
Ohnmächtig an einem Samstagabend
Häufige Ohnmachten
Kälteschock
Der tiefste Schlaf
Ein ermattetes Herz
Ohne Puls
Teil 7Ein seltsamer Ausschlag
Roter Schrecken
Nahtod in den Händen der Ärzte
Altmodische Haut
Überall rot und entzündet
Ein schwarzer Daumen
Line Dance
Teil 8Extreme körperliche Schwäche
Eine schreckliche Stille
Totaler Zusammenbruch
Sturzangst
Eine überwältigende Schwäche
Ein langer Weg
Unaufhaltsames Siechtum
Übersehene Anzeichen
Danksagung
Über die Autorin
EinführungDes Rätsels Lösung
Das Licht in der Arztpraxis war für die fünfzigjährige Frau fast unerträglich hell, aber sie zwang sich, die Augen zu öffnen. Eine junge Ärztin klopfte kurz an die Tür, trat dann ins Untersuchungszimmer und stellte sich vor. Sie schien mitfühlend und interessiert zu sein, als ihre Patientin von ihrer grauenhaften Woche und von der Reise, die ihr vorausgegangen war, erzählte.
Sie hatte sich nicht wohlgefühlt, seit sie und ihre Kinder nach ihrer zweiwöchigen Reise zu den Eltern in Kenia zurückgekehrt waren. Es war ihr erster Besuch seit fast zehn Jahren gewesen – seit der Geburt ihrer Kinder. Und da sie jetzt alt genug waren, wollte sie ihnen unbedingt zeigen, wo sie selbst aufgewachsen war. Sie hatte alle wichtigen Impfungen veranlasst und darauf geachtet, dass die Kinder jeden Tag das Medikament einnahmen, das Malaria verhindern sollte. Sie wollte nicht, dass die Reise oder die Erinnerungen an den Ort, den sie so sehr liebte, durch eine Krankheit getrübt würden. Es war eine wunderbare Reise. Aber die Rückkehr war schlimm gewesen. Die Kinder hatten sich nach ein, zwei Tagen vom Jetlag erholt, sie nicht.
Sie wartete eine Woche, fühlte sich aber jeden Tag schlechter. Sie war müde, als hätte sie wochenlang nicht geschlafen. Ihr war übel und sie fühlte sich heiß und verschwitzt, als hätte sie Fieber. Außerdem tat ihr der ganze Körper weh, als litte sie an Grippe. Sie rief in der Praxis ihrer Ärztin an, aber die war nicht in der Stadt. Darum versuchte sie es bei einer anderen Ärztin, und die gab ihr einen Termin am folgenden Tag – ein Wunder. Und jetzt war sie da.
»Ich glaube, das ist mir schon einmal passiert«, sagte die Patientin. Als sie sieben Jahre alt gewesen war – sie lebte damals in Kenia – hatte sie einen Malariaanfall gehabt. Hatte sie jetzt wieder einen? Zumindest fühlte es sich ganz danach an.
Die Ärztin nickte. Das war eine vernünftige Annahme. Malaria ist eine endemische Krankheit in Regionen südlich der Sahara und die häufigste Ursache für Fieber bei Reisenden, die von dort zurückkehren. Da sie diese Krankheit schon einmal gehabt hatte, kannte sie die schmerzhaften, grippeähnlichen Symptome, die der blutgierige Parasit auslöst.
Trotzdem brauche sie einige weitere Informationen, erklärte die Ärztin. Sonstige gesundheitliche Probleme? Überhaupt nicht. Vor ihrer Reise war die Patientin völlig gesund gewesen. Sie nahm keine Medikamente. Sie rauchte und trank nicht. Sie arbeitete in einem Büro. Sie war geschieden und lebte mit ihren beiden Kindern zusammen. Die Arzneien, die der Vorbeugung dienten, hatte sie jeden Tag eingenommen und zwei Wochen vor dem Antritt der Reise damit begonnen – wie verordnet.
Die Ärztin führte die Patientin zum Untersuchungstisch. Sie hatte kein Fieber, doch sie hatte früher am Tag Paracetamol eingenommen. Sie schwitzte ein wenig und ihr Puls war hoch; doch sonst war die Untersuchung unauffällig.
Malaria ergab für die Ärztin Sinn. In Teilen Kenias findet man einen Malariatyp, vor dem die üblichen vorbeugenden Medikamente nicht schützen können. Und da die Patientin die Infektion schon länger als eine Woche gehabt hatte, war es wichtig, mit der Behandlung sofort zu beginnen. Die Ärztin gab ihr ein Rezept für eine dreitägige Kur mit Antiparasitika. Die Patientin nahm das Rezept dankbar entgegen. Endlich würde es ihr wieder besser gehen. Sie freute sich darauf.
Das ist die übliche Diagnosegeschichte. Eine Patientin fühlt sich krank. Sie merkt, dass etwas nicht stimmt, aber sie wartet einen oder zwei Tage, ehe sie Hilfe sucht. Oft bessert sich der Zustand von selbst. Wenn nicht, geht sie oft zu ihrem Arzt.
Von da an ist es Aufgabe des Arztes, das Rätsel zu lösen. Es ist wichtig, sich die Geschichte der Patientin anzuhören. In fast 80 Prozent aller Fälle* finden sich darin die wichtigsten Anhaltspunkte. Eine Untersuchung liefert mitunter weitere Hinweise. Es ist Aufgabe des Arztes, alles zusammenzufügen und die Diagnose zu stellen.
Bevor ich Medizin studierte, wusste ich über Diagnosen nur das, was ich im Fernsehen gesehen hatte. Es waren kurze Begriffe, die in einem dramatischen Augenblick fast sofort formuliert wurden – gleich nachdem die Patienten über ihre Symptome und Beschwerden berichtet hatten und kurz bevor sie zu einer lebensrettenden Behandlung geschoben wurden. Ich hielt Diagnosen für Rätsel, die ich, sobald ich Ärztin war, mühelos lösen würde.
Während des Studiums verbrachte ich Stunden damit, die Bausteine einer Diagnose zu erlernen: Chemie und organische Chemie, Physik, Physiologie, Pathologie und Pathophysiologie. Als ich nach dem Studium mit dem praktischen Teil meiner Ausbildung begann, stellte ich eine Reihe von »Krankheitsskripten« zusammen, wie Ärzte es ausdrücken. Das sind detaillierte Sammlungen von Symptomen und ihren Varianten, von Verläufen und Vorgehensweisen, die zusammen ein Bild einer bestimmten Krankheit liefern. Sobald man sich diese Szenarios eingeprägt und verstanden hatte, konnte man sie bei Bedarf nutzen. Übelkeit, Erbrechen und Durchfall, die sich rasch in einer Familie ausbreiten, sind eine virale Gastroenteritis. Plötzliches Fieber, Schmerzen im Körper und verstopfte Atemwege während der Grippesaison deuten auf Grippe hin. In dem zuvor beschriebenen Fall sind sie wahrscheinlich ein Zeichen für Malaria, weil die Patientin gerade aus Kenia zurückgekehrt war. Wir sehen die Symptome. Wir erkennen das Muster und deshalb kennen wir sofort die Diagnose.
Zum Glück ist dies der Normalfall, einer Studie zufolge in bis zu 95 Prozent aller Fälle.** Diese Skripte helfen uns meist weiter. Aber was ist mit den anderen Fällen? Mit den 5 Prozent, auf die der Arzt keine Antwort weiß? Oder schlimmer noch: die falsche Antwort?
Die kranke Frau glaubte Malaria zu haben. Auch ihre Ärztin dachte das. Doch nachdem die Patientin drei Tage lang Tabletten geschluckt hatte, ging es ihr noch schlechter. Sie war so schwach, dass sie sich kaum bewegen konnte. Sie erbrach sich ständig und fühlte sich fiebrig. Sie schwitzte und ihr Herz schlug heftig. Sie konnte tagelang nicht essen und zwei Tage lang nicht einmal das Bett verlassen. Schließlich rief sie ihre Ärztin an, die sie prompt in die Notaufnahme schickte.
Dort zeigte eine Untersuchung, dass das Herz der Frau raste und der Blutdruck zu hoch war. Die Zahl der weißen Blutkörperchen war gefährlich hoch und es gab Hinweise auf einen Leberschaden. Es war nicht klar, was ihr fehlte, deshalb wurde sie ins Krankenhaus aufgenommen.
Die Ärzte dort gaben ihr ein Medikament gegen das Erbrechen. Es half. Doch nach mehreren Tagen war immer noch unklar, was die Patientin so krank gemacht hatte. Malaria war es nicht. Man hatte drei Blutausstriche im Labor untersucht. Und obwohl sie kein Fieber hatte, als das Blut entnommen wurde – was der beste Zeitpunkt für einen Malariatest ist –, wies keiner dieser Ausstriche Anzeichen für den Parasiten auf, der diese potenziell tödliche Krankheit verursacht.
Ihre Ärzte vermuteten, dass die Symptome eine Reaktion auf die Medikamente waren, die ihr gegen die Malaria verordnet worden waren, die sie, wie man jetzt wusste, gar nicht hatte. Das schien möglich zu sein, zumal es ihr jetzt etwas besser ging. Sobald sie essen konnte, wurde sie aus dem Krankenhaus entlassen.
Doch als sie wieder zu Hause war, begann sie erneut, sich zu übergeben. Sie hielt eine Woche durch, schleppte sich dann aber in dieselbe Klinik zurück. Die Ärzte dort waren so besorgt, dass sie die Frau ins Rush University Medical Center überwiesen, wo viele von ihnen ausgebildet worden waren. Sie waren sich sicher, dass ihre Kollegen dort das Rätsel lösen konnten.
Die Ärzte im Rush konsultierten einen Infektiologen. Was sonst konnte diese Frau haben? Sie blieb eine Woche im Krankenhaus, begegnete vielen Ärzten und wurde zahlreichen Tests unterzogen. Als das Erbrechen aufhörte und sie wieder essen konnte, schickte man sie nach Hause und wies sie an, für die Nachbehandlung den Infektiologen aufzusuchen. Doch nach wenigen Tagen wurde sie wieder ins Rush gebracht, so krank, wie sie beim ersten Mal gewesen war.
Mehr Ärzte, mehr Tests. Ihr Urin, ihr Stuhl und ihr Blut wurden untersucht. Dann folgten Computer- und Kernspintomografien, sogar eine Leberbiopsie. Nicht alle Werte waren normal, aber sie ergaben auch keine klare Diagnose. Man gab ihr ein halbes Dutzend Antibiotika und Medikamente gegen Viren und Parasiten. Wenn die Ärzte schon nicht herausfinden konnten, woran die Patientin litt, konnten sie wenigstens versuchen, sie wegen einer Krankheit zu behandeln, die sie möglicherweise hatte. Doch keines der Medikamente half. Was konnte sie sich in Kenia eingefangen haben? Die etwa ein Dutzend Ärzte, die sie untersucht hatten, stellten alle die gleiche Frage.
Das Schlimmste, was es in der Medizin gibt, ist wohl Ungewissheit. Sie ist unangenehm für die Patienten, denn sie leiden weiter unter den Symptomen, deretwegen sie gekommen sind, und sie kennen ihre Ursache nicht. Werden sie von selbst verschwinden? Bei unserer Patientin war das nicht der Fall. Gibt es einen Test dafür? Bei ihr waren Dutzende von Tests – manchmal sind es mehr – unergiebig. Würde sie daran sterben? Wie kann man ohne Diagnose eine Prognose geben?
Für den Arzt ist diese Situation ebenfalls ungemütlich. Einer der Gründe dafür, dass Ärzte bisweilen mehrere Versuche brauchen, bevor sie zur richtigen Diagnose gelangen, liegt darin, dass ungewöhnliche Krankheiten anfangs oft ihren banalen Gegenstücken ähnlich sind. Der Körper hat nur ein paar fundamentale Möglichkeiten, uns zu zeigen, dass etwas nicht stimmt. Wir sprechen dann von Symptomen. Doch diese Symptome können viele Ursachen haben. Es ist wie mit der Beziehung zwischen Buchstaben und Worten. Wir haben nur 26 Grundbuchstaben, aber es gibt viele Millionen Wörter. In der Medizin gibt es Dutzende von Symptomen; doch der Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten zufolge gibt es fast 90 000 Diagnosen.
Natürlich kennt kein Arzt alle 90 000 – obwohl viele Ärzte viel mehr wissen als andere. Sobald eine ungewöhnliche Diagnose als möglich erscheint, gibt es mehrere Methoden, das Wissen zu erlangen, das dem Arzt fehlt. Eine altmodische, aber oft erfolgreiche Methode besteht darin, einen Kollegen zu fragen. Oder man wendet die viel neuere Methode an und fragt das externe Gehirn – das Internet.
Doch selbst wenn wir über alle Informationen verfügen, kann eine Krankheit ohne Diagnose bleiben. Eine Krankheit, die auf einer Buchseite oder in einer Datenbank steht, sieht oft ganz anders aus als die Krankheit im lebenden Patienten. Die ersten Studien über Diagnosen, die in den 1970er-Jahren durchgeführt wurden, belegten, dass der Arzt, dem eine schwierige Diagnose gelingt, meist derjenige ist, der die Krankheit schon gesehen hat. Die persönliche Erfahrung kann wichtiger sein als Bücherweisheit.
Nach mehreren Wochen im Krankenhaus und zu Hause war die Patientin zu schwach, um ihre Kinder zu versorgen. Sie rief ihre beste Freundin an und bat sie, bei ihr und den Kindern zu bleiben, während sie versuchte, gesund zu werden. »Natürlich«, versicherte ihr die Freundin und packte sofort einen Koffer. Als sie bei der Frau ankam, erschrak sie über deren Aussehen. Ihr Gesicht war eingefallen und grau, die Lippen waren blass. »Du musst deine Ärztin rufen«, sagte die Freundin, sobald sie die Geschichte der Frau gehört hatte. »Dr. Brown wird wissen, was zu tun ist.«
Dr. Marie T. Brown war seit über zwanzig Jahren die Ärztin der Frau. Die Kranke rief in der Praxis an und vereinbarte einen Termin in derselben Woche. Dr. Brown war ebenfalls entsetzt vom Aussehen der Frau, die sie so gut kannte. Normalerweise kam sie einmal im Jahr zu einer Routineuntersuchung. Sie sprachen über das Leben und die Gesundheit der Frau und verabschiedeten sich dann bis zum folgenden Jahr. Sie hatte immer gesund und robust ausgesehen. Aber jetzt nicht.
Als Dr. Brown das Zimmer betrat, fand sie die Patientin über ein Waschbecken gebeugt vor und der scharfe Geruch von Erbrochenem erfüllte den Raum. Sie war stark abgemagert und ihre Augen und Wangenknochen ragten aus ihrem nun viel zu dünnen Gesicht. Ihr linkes Bein zitterte und zuckte unwillkürlich. »Was in aller Welt ist mit Ihnen passiert?«, fragte die Ärztin.
Die Patientin berichtete ihr mit Unterstützung ihrer Freundin von den Ereignissen der vergangenen Wochen. Dr. Brown hatte keinen Zugang zu den Krankenhausakten; darum wusste sie nur, was die Patientin ihr sagen konnte: dass sie sich seit ihrer Rückkehr aus Kenia nicht mehr wohlgefühlt hatte, dass die Ärzte anfangs an Malaria gedacht hatten, sich jetzt aber nicht mehr sicher waren. Und dass sie in ihrem ganzen Leben noch nie so krank und schwach gewesen war.
Die Ärztin bat sie, sich auf den Untersuchungstisch zu legen. Sie und die Freundin halfen der Frau hinauf.
Dr. Brown begann am Kopf und arbeitete sich dann systematisch nach unten. Am Hals hielt sie inne. Die Schilddrüse der Patientin war viel größer als normal. Sie war nicht druckempfindlich, aber sie war dick. Dr. Brown war sich ziemlich sicher, dass das neu war.
Sie beendete die Untersuchung rasch. Die Reflexe der Patientin waren wild. Ein kleines Antippen setzte Arme und Beine in Bewegung. Und das linke Bein schien ein Eigenleben zu haben: Es zitterte und zuckte. Die Ärztin entschuldigte sich und ging hinaus, um »etwas nachzuschlagen«.
Als Dr. Brown ein paar Minuten später zurückkam, war sie sich ihrer Diagnose ziemlich sicher: Die Frau litt an Hyperthyreose – an einer Überfunktion der Schilddrüse. Vielleicht sogar an einer thyreotoxischen Krise, der schwersten Form der Krankheit. Alles passte ins übliche Krankheitsbild: der rasende Puls, die Schweißausbrüche, das Zittern, der Juckreiz, das gelegentliche Fieber und die Gewichtsabnahme. Alles außer dem Erbrechen. Sie hatte sich entschuldigt, um sich zu vergewissern, dass Erbrechen ein Teil der Diagnose »Hyperthyreose« sein konnte, und sie fand heraus, dass es zwar ein ungewöhnliches Symptom war, aber auch bei anderen Patienten mit Hyperthyreose vorkam. Am Spätnachmittag bestätigte sich die Diagnose und Dr. Brown sorgte dafür, dass die Patientin sofort einen Endokrinologen konsultieren konnte.
Wenn man die Lösung kennt, wird einem oft klar, warum sie übersehen wurde. Sicherlich spielte die Annahme der Patientin, dass ihre Krankheit während ihrer Reise nach Kenia begonnen hatte, eine Rolle. Ihre Deutung ihrer Symptome – dass sie fieberte und dass sie sich so fühlte wie vor vierzig Jahren während ihrer Malariaerkrankung – führte die Krankenhausärzte auf den falschen Weg. Doch die Schuld lag nicht allein bei der Patientin. Als die Ärzte erkannten, dass es nicht Malaria war, beschränkten sie die möglichen Diagnosen weiter auf Infektionskrankheiten.
Keiner der Ärzte im Krankenhaus befasste sich mit der Schilddrüse. Vielleicht haben sie die Vergrößerung schlicht übersehen? William Osler (1849–1919) zufolge – er gilt als Philosophenkönig der frühen inneren Medizin – kommt es häufiger vor, dass Ärzte etwas übersehen, als dass sie etwas nicht wissen. Andererseits ist ein Kropf (so nennen wir eine vergrößerte Schilddrüse) in Amerika ungewöhnlich, während er in Gebieten wie der Subsahara sehr häufig vorkommt, weil dort Jodmangel herrscht. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation bekommt mehr als ein Viertel der Kinder, die in Afrika aufwachsen, einen Kropf.*** Und wenn die Schilddrüse einmal vergrößert ist, bleibt sie es meist. Deshalb ist ein Kropf bei einer Frau, die in Kenia aufgewachsen ist, für einen durchschnittlichen Arzt vielleicht nicht ungewöhnlich. Die Hausärztin der Frau erkannte hingegen sofort, dass die vergrößerte Schilddrüse neu war.
Solche Fälle, die sich einer sofortigen Diagnose entziehen, können am erschreckendsten sein. Aber sie können auch am faszinierendsten und lehrreichsten sein. Sie enthüllen, wie Ärzte über ihre Patienten denken und wie sie ihr Wissen anwenden, und sie zeigen, wie Ärzte und Patienten zusammenarbeiten können, um die entscheidende Frage des Patienten zu beantworten: »Was fehlt mir?«
Über solche Fälle schreibe ich in meiner Kolumne »Diagnosis« im New York Times Magazine. Einige von ihnen stelle ich in diesem Buch vor. Jeder einzelne Fall ist eine Detektivgeschichte. Hier ist der Einsatz hoch und das Risiko groß. Hier muss die Ärztin ihre Sherlock-Holmes-Mütze aufsetzen und versuchen, das Rätsel zu lösen. Wenn wir die Entwicklung dieser Fälle verfolgen, verstehen wir, wie schwierig es ist, eine Diagnose zu stellen, die vom Skript abweicht und nicht auf der Liste der üblichen Verdächtigen steht. Dabei werden zugleich die Fehler in den Systemen enthüllt, die unsere medizinische Praxis anleiten – Fehler, die nur sichtbar werden, wenn die Maschinerie stark belastet wird.
Ich habe die folgenden Kapitel nach Symptomen geordnet – acht der häufigsten Probleme, die einen Patienten in die Arztpraxis oder in die Notaufnahme führen. Jede Geschichte in einem Kapitel beginnt zwar mit dem gleichen Grundsymptom – mit Fieber, mit rasenden Kopfschmerzen, mit Übelkeit –, aber alle entwickeln sich fast sofort in ihre eigene, unerwartete Richtung. So wenige Symptome, so viele Diagnosen.
In diesem Buch versuche ich, Sie als Leser an die Stelle des Arztes zu setzen. Ich möchte, dass Sie sehen, was der Arzt sieht. Ich möchte, dass Sie die Ungewissheit einer rätselhaften Störung spüren – und die freudige Erregung, wenn das Rätsel gelöst ist.
*Hampton, J. R., Harrison, M. J. G., Mitchell, J. R. A., Prichard, J. S., Seymour, C., British Medical Journal, 1975, Bd. 2, S. 486–89.
**Singh, H., Meyer, A. N. D., Thomas, E. J., BMJ Qual Saf, 9/2014, Bd. 23, S. 727–31.
*** Andersson, M., Takkouche, B., Egli, I., Allen, H. E., de Benoist, B.: »Iodine Status Worldwide«, WHO Global Database.
Teil 1Glühendes Fieber
Nur ein Fieber
Ich fürchte, ich verliere diesen Kampf«, sagte der 57-jährige Mann vor fast einem Jahr an einem Samstagabend zu seiner Frau. Während sie im Theater gewesen war – sie hatten die Karten schon vor Wochen gekauft –, musste er auf Händen und Knien die Treppe hinaufkriechen, um ins Bett zu kommen. Ein fürchterlicher Schüttelfrost jagte durch seinen Körper, trotz mehrerer Decken. Dem Schüttelfrost folgten Fieberanfälle und Schweißausbrüche, die seine Kleider durchnässten und ihn zwangen, die Decken abzuwerfen, nur um sie zurückzuholen, wenn der Zyklus sich wiederholte.
»Du musst unbedingt wieder die Notaufnahme aufsuchen«, sagte seine Frau. Ihre Stimme spiegelte ihre Enttäuschung und ihre Besorgnis deutlich wider. Er war schon dreimal in der Notaufnahme gewesen. Dort hatte man ihm irgendwelche Spritzen verabreicht und ihn dann mit der Diagnose »virales Syndrom« nach Hause geschickt. Es werde ihm bald besser gehen, hatten die Ärzte jedes Mal versichert. Aber es ging ihm nicht besser.
Alles hatte neun Tage zuvor angefangen. Am ersten Tag meldete er sich an seinem Arbeitsplatz als Physiotherapeut krank. Er fühlte sich fiebrig, als hätte er Grippe. Er trank reichlich, nahm es leicht und kehrte am nächsten Tag an seinen Arbeitsplatz zurück. Doch am Tag danach ging es ihm noch schlechter. Jetzt bekam er auch Fieber und Schüttelfrost. Er nahm abwechselnd Paracetamol und Ibuprofen ein, doch das Fieber legte sich nicht. Da die Schweißausbrüche die Bettlaken durchnässten und der Schüttelfrost das Bett erschütterte und seine Frau weckte, begann er im Gästezimmer zu schlafen.
Nach vier Tagen ging er zum ersten Mal in die Notaufnahme des Yale New Haven Hospital. Er wurde bereits wegen einer anderen Infektion behandelt. Drei Wochen zuvor war sein Ellbogen angeschwollen und die Haut hatte sich gerötet. Daraufhin war er ins ambulante Behandlungszentrum gegangen, wo man ihm ein Antibiotikum verabreicht hatte. Er nahm es wie angeordnet zehn Tage durch, aber sein Ellbogen quälte ihn noch immer. Wieder ging er ins Behandlungszentrum und bekam dort ein Breitbandantibiotikum, das er fast aufgebraucht hatte. Jetzt war sein Ellbogen in Ordnung. Aber der Rest seines Körpers tat weh.
Doch der Grippetest war negativ. Ebenso der Röntgen-Thorax. Es sei wahrscheinlich nur ein Virus, sagte man ihm. Die Antibiotika, die er bereits einnahm, würden so gut wie alle Bakterien abtöten, die in Betracht kämen. Er solle einfach Geduld haben und zurückkommen, falls es ihm doch schlechter gehen sollte.
Am nächsten Tag stieg sein Fieber auf knapp unter 42 Grad. Also ging er wieder in die Notaufnahme. Dort fand er eine große Menschenmenge vor – eine Menge Leute, die wie er glaubten, Grippe zu haben. Es werde Stunden dauern, bis er an die Reihe komme, sagte jemand. Entmutigt ging er nach Hause und legte sich ins Bett. Eine Schwester in der Notaufnahme rief ihn am nächsten Morgen an. Ob er jetzt vorbeikommen könne – das Chaos sei vorbei. Er war froh darüber.
Vielleicht habe ich ja keine Grippe, dachte er. Aber er war sicher, dass er krank war. Doch der Arzt in der Notaufnahme fand nichts. Der Patient hatte keine Schmerzen in der Brust und war nicht kurzatmig. Kein Husten, keine Kopfschmerzen, kein Ausschlag, kein Bauchweh, keine Harnwegsbeschwerden. Das Herz schlug stark und schnell, doch ansonsten war die Untersuchung unauffällig. Die Anzahl der weißen Blutkörperchen war niedrig, was etwas seltsam war, weil diese Zahl während einer Infektion erhöht ist. Allerdings kann ein Virus sie senken. Die Anzahl der Blutplättchen – der winzigen Blutzellen, die eine wichtige Rolle bei der Blutgerinnung spielen – war ebenfalls niedrig. Auch das kommt bei Virusinfektionen vor, wenn auch seltener.
Die Leute in der Notaufnahme schickten die abnormen Ergebnisse der Blutuntersuchung an den Hausarzt des Patienten und empfahlen dem Mann, sich in der Hausarztpraxis weiterbehandeln zu lassen. Er hatte bereits versucht, dort einen Termin zu bekommen, aber der Terminkalender des Arztes war voll. Es war die schlimmste Grippesaison seit Jahren. Als er erneut anrief, erfuhr er, dass er frühestens in der folgenden Woche kommen könne.
Aber die Praxis war damit einverstanden, ihm ein Rezept für Bluttests auszustellen, um das Blut auf Borreliose und andere von Zecken verursachten Krankheiten prüfen zu lassen. Immerhin befand man sich in Connecticut. Er schleppte sich ins Labor und wartete dann auf einen Anruf seines Arztes und auf die Ergebnisse. Der Anruf kam nie. In Gedanken feuerte er seinen Arzt. Er war nun seit über einer Woche krank und der Arzt konnte ihn nicht empfangen und ihn nicht einmal anrufen, um ihn über den Laborbericht zu informieren.
Am Sonntagmorgen ging er wieder in die Notaufnahme. Am Abend zuvor war seine Frau allein im Theater gewesen und hatte nach ihrer Rückkehr darauf bestanden, dass er sich erneut untersuchen ließ. Seine vorherigen Besuche und die abnormen Blutwerte weckten die Aufmerksamkeit der Arzthelferin, die an diesem Morgen Dienst hatte. Sie verordnete ihm eine Reihe von Bluttests, die alles Mögliche prüfen sollten, von HIV bis zum Pfeifferschen Drüsenfieber. Außerdem ließ sie eine neue Thoraxaufnahme machen und verabreichte ihm ein Breitbandantibiotikum und Doxycyclin, ein Antibiotikum gegen Infektionen, die von Zecken verursacht werden. Gegen das Fieber bekam er Tylenol. Außerdem wurde er ins Krankenhaus eingewiesen. Als er die Notaufnahme verlassen wollte, kam das Ergebnis des Grippetests. Es war positiv. Er war ziemlich sicher, dass er keine Grippe hatte, und er hatte noch nie von einer Grippe gehört, die so lange dauerte. Doch wenn er im Krankenhaus bleiben durfte, wo jemand beobachten konnte, ob sein Zustand sich verschlimmerte, war er gerne bereit, Tamiflu einzunehmen.
Später am Tag rief das Labor an und teilte mit, der Test sei nicht korrekt gewesen; er habe keine Grippe. Dann trafen die anderen Testergebnisse ein. Sein Ellbogen war mit Sicherheit nicht das Problem; das sagte der orthopädische Chirurg und eine Röntgenaufnahme bestätigte es. Er litt auch nicht an Aids oder am Pfeifferschen Drüsenfieber oder an Borreliose und er hatte auch keine der anderen viralen Atemwegserkrankungen, die viele Patienten im Krankenhaus plagten. Trotzdem fühlte sich der Patient nach einigen Tagen besser. Sein Fieber fiel. Der heftige Schüttelfrost verschwand. Die Anzahl der weißen Blutkörperchen und der Blutplättchen nahm zu. Offensichtlich erholte er sich – aber wovon? Weitere Blutuntersuchungen wurden verordnet und ein Infektiologe wurde hinzugezogen.
Gabriel Vilchez, ein Infektiologe in Ausbildung, prüfte die Krankenakte und untersuchte den Patienten. Auch er kam zu dem Schluss, dass der Patient höchstwahrscheinlich an einer Zeckeninfektion litt. Das Krankenhaus hatte Blutproben verschickt, um sie auf die üblichen Verdächtigen im Nordosten der USA testen zu lassen: Borreliose, Babesiose, Ehrlichiose und Anaplasmose. Abgesehen vom Borreliosetest, der negativ ausfiel, waren die Resultate noch nicht eingetroffen. Angesichts der Symptome des Patienten und seiner Reaktion auf die Antibiotika glaubte Vilchez, dass einer dieser Tests positiv verlaufen werde.
Doch sämtliche Tests auf Zeckeninfektionen stellten sich als negativ heraus. Allerdings gab es auch andere Zeckeninfektionen, die in dieser Region seltener, aber denkbar waren. Am wahrscheinlichsten war nach Vilchez’ Ansicht das Rocky-Mountain-Fleckfieber (RMSF), obwohl es in den Smoky Mountains viel häufiger vorkommt als in den Rocky Mountains. Die meisten Erkrankten, aber nicht alle, bekommen einen Ausschlag. In Connecticut ist diese Infektion ungewöhnlich, aber nicht unbekannt. Vilchez schickte Blut an ein Labor, um es auf RMSF und erneut auf die anderen Infekte testen zu lassen. Am folgenden Tag ging es dem Patienten so gut, dass er nach Hause gehen konnte. Einige Tage später bekam er einen Anruf. Er litt am Rocky-Mountain-Fleckfieber.
Wie sich herausstellte, hatte der Patient das Pech gehabt, mitten in einer Grippeepidemie Fieber und grippeähnliche Symptome aufzuweisen. Unter diesen Umständen wird oft schnell gefragt: »Hat er Grippe?« anstatt: »Was hat er?« Wenn er keine Grippe hat, ist es schwer, wieder die breitere Frage aufzugreifen.
Der Genesungsprozess des Patienten verlief schwierig. Das Doxycyclin linderte zwar die akuten Symptome, aber es dauerte Monate, bis er seine Arbeit wieder aufnehmen konnte. Er hatte einfach nicht die Kraft und das Stehvermögen dafür. Heute ist er der Meinung, dass die Krankheit ihn dem Tod näher gebracht hat als jede andere Krankheit zuvor. In der Tat ist RMSF die gefährlichste aller Zeckeninfektionen und hat eine Sterblichkeitsrate von bis zu 5 Prozent, trotz der modernen Antibiotika.
In einem Punkt war er sich jedoch sicher: Er brauchte einen neuen Hausarzt. Und er fand einen.
Die Grippe, die stur blieb
Dr. John Henning Schumann war besorgt. Sein bester Freund im College, ein ziemlicher Hypochonder, rief ihn oft an und stellte ihm medizinische Fragen. Vor ein paar Wochen hatte er eine Virusinfektion erwähnt – Fieber und Unwohlsein, nichts Alarmierendes. Doch nun hörte er von einem gemeinsamen Freund, dass diese Symptome sich nie legten, und das war bedenklich. Schumann riet seinem Freund, sofort zum Arzt zu gehen.
Einige Tage später erhielt Schumann eine E-Mail von seinem fiebernden Freund. Er war im Krankenhaus. Sein Arzt hatte ihm eine Computertomografie verordnet. Die Aufnahme zeigte eine Geschwulst von der Größe eines Softballs in seiner Leber. Sein Arzt schickte ihn zu weiteren Tests ins Mount Auburn Hospital in Cambridge, Massachusetts.
Dr. Andrew Modest war der Internist, der ihm zugewiesen wurde. Bevor er den neuen Patienten aufsuchte, schaute er sich die digitalisierte Krankenakte an: Der Mann war vierzig Jahre alt, Universitätsprofessor und völlig gesund – bis jetzt. Der Bluttest enthüllte eine leichte Anämie und auf der Schichtaufnahme war natürlich die Geschwulst zu sehen.
Der Patient saß bequem in seinem Bett und hatte ein Notebook auf dem Schoß. Er sah etwas blass aus, aber sonst ging es ihm anscheinend gut. »Ich schreibe für meine Familie und meine Freunde über meine Krankheit«, erklärte er fröhlich. »Sind Sie damit einverstanden?«
Das Fieber hatte eine Woche nach seiner Rückkehr von einer Konferenz in der Schweiz begonnen, berichtete der Patient. Es kam nur nachts, aber jede Nacht. Zuerst kam das Fieber und einige Stunden später hatte er heftige Schweißausbrüche, manchmal so stark, dass er den Pyjama und das Betttuch wechseln musste. Obendrein plagte ihn ein Kitzelhusten. Ansonsten hatte er keine Beschwerden. Er hatte im Laufe eines Monats gut 7 Kilogramm abgenommen, aber er versicherte, das liege an seiner neuen Diät.
Die Untersuchung ergab nichts Ungewöhnliches. Der Patient hatte kein Fieber, obwohl seine Temperatur in der vergangenen Nacht auf bis zu 39 Grad gestiegen war. Der Puls und der Blutdruck waren normal, alles andere ebenfalls.
Der Patient litt seit vier Wochen an Fieber und hatte ordentlich abgenommen. Der Arzt hielt es für unwahrscheinlich, dass die kleinen Änderungen an der Ernährungsweise daran schuld waren. Handelte es sich um eine Infektion? Vielleicht, obwohl der Mann nicht krank aussah. War es eine Autoimmunkrankheit, zum Beispiel Lupus? Oder sogar Krebs? Das alles war möglich.
War die enorme Geschwulst in der Leber die Ursache des Fiebers? Oder handelte es sich dabei um ein Inzidentalom – eine Abnormität, die man findet, wenn man nach etwas anderem sucht? Die schiere Größe ließ darauf schließen, dass sie seit geraumer Zeit vorhanden sein musste, wahrscheinlich seit Jahren. Warum bekam er gerade jetzt Fieber? Und wenn die Leber nicht schuld war, was dann? Zeckeninfektionen wie Borreliose und Anaplasmose können hartnäckiges nächtliches Fieber verursachen. Das Gleiche gilt für Aids, Tuberkulose, Hepatitis und Dutzende andere Infekte.
Modest bat einen Radiologen, sich die Aufnahmen der Lebergeschwulst anzusehen. Dessen erster Gedanke war, dass es sich um ein sehr großes Hämangiom handeln könnte, um einen abnormen, aber gutartigen Blutschwamm. Doch diese Geschwülste haben meist glatte Grenzen, und das war hier nicht der Fall. Zudem lösen Hämangiome in der Regel kein Fieber aus.
Was konnte es sonst sein? Es gibt bösartige Hämangiome, die Fieber verursachen können, aber extrem selten sind. War es vielleicht ein infiziertes gutartiges Hämangiom? Das konnte Fieber verursachen und müsste sofort mit Antibiotika behandelt werden. Doch um diese Diagnose zu stellen, musste man herausfinden, welche Flüssigkeit sich in der Geschwulst befand. Wenn es Eiter war, musste man ihn ausleiten und dann Antibiotika verabreichen. Wenn keine Infektion vorlag, konnte man auf Antibiotika verzichten, zumindest vorläufig.
An diesem Nachmittag führte der Radiologe eine lange Hohlnadel in die Geschwulst im Unterleib des Patienten ein. Dann zog er den Kolben der Spritze zurück und der Zylinder füllte sich mit dunkelrotem Blut. Das Labor berichtete bald, dass sich kein Eiter im Blut befand und dass es keine Anzeichen für eine Infektion gab. Modest informierte den Patienten darüber und fügte hinzu, dass er die Ursache des Fiebers nicht kenne. Ein Infektiologe werde ihn später an diesem Tag untersuchen und am Wochenende werde ein Gastroenterologe vorbeikommen. Er, Modest, werde am Montag wieder da sein.
In dieser Nacht machte der Patient sich so große Sorgen, dass er kaum schlafen konnte. Am nächsten Morgen rief er Schumann an. Er habe viele Tests hinter sich, berichtete er, darunter auch Tomografien und Kernspinuntersuchungen. Er sei gestochen, beklopft und gezwickt geworden. Und nun seien sich die Ärzte ziemlich sicher, dass er viele Krankheiten nicht habe: Es war anscheinend kein Krebs, man könne keine Infektion feststellen und es handle sich auch nicht um Aids oder Hepatitis oder Lupus. Doch keiner seiner Ärzte habe herausfinden können, was ihm fehle. Und diese Unsicherheit mache ihm Angst.
Schumann machte sich ebenfalls Sorgen. Er wohnte fast 1600 Kilometer entfernt, zu weit weg, um seinen Freund zu besuchen. Außerdem schickte der Patient alle seine Testergebnisse an seine Angehörigen und Freunde; daher konnte Schumann den Fall aus der Ferne verfolgen. Trotzdem wusste er nicht, was los war. Wenn er die zweite Meinung war, dann brauchte der Patient mit Sicherheit eine dritte. Plötzlich hatte Schumann eine Idee. Wie wäre es, die rätselhaften Symptome anderen Ärzten zu übermitteln? Sie konnten den Fall doch ins Internet stellen – auf einem Blog, der hauptsächlich von Ärzten gelesen wurde – und ein paar neue Augen und Hirne an diesem Problem arbeiten lassen. Der Patient war begeistert von dieser Idee.
An diesem Nachmittag stellte Schumann den Fall auf seinem Blog vor (www.glasshospital.com) und kontaktierte Kevin Pho, der einen beliebten medizinischen Blog hatte (www.kevinmd.com). Pho veröffentlichte die Daten ebenfalls. Innerhalb von Stunden kamen ein Dutzend Antworten. Mehrere wiesen auf eine Reihe ähnlicher Berichte hin. Es ging um Patienten mit großen Hämangiomen und hartnäckigem nächtlichem Fieber. In mehreren Fällen legte sich das Fieber, sobald der Blutschwamm entfernt wurde.
Hämangiome sind die häufigsten gutartigen Geschwülste in der Leber. Die meisten bleiben klein und lösen keine Symptome aus. Manchmal werden sie jedoch ziemlich groß, und wenn das geschieht, klagen die Patienten oft über Schmerzen oder Völlegefühl. In sehr seltenen Fällen und aus Gründen, die noch nicht ganz klar sind, können diese Geschwülste Fieber, Gewichtsabnahme und Anämie verursachen – eben die Symptome, die dieser Patient hatte.
Kaum hatte Schumann diese Fallgeschichten gelesen, war er zuversichtlich, dass die Diagnose richtig war. Auch der Patient war optimistisch.
Modest sah diese Fallgeschichten nie. Dennoch gelangte er zur gleichen Diagnose, wenn auch auf einem eher traditionellen Weg. Der Patient wurde vom Gastroenterologen Dr. Frederick Ruymann untersucht. Der hatte im selben Jahr einen gleich gelagerten Fall gesehen und erkannte das Problem sofort. Weil jedoch niemand wusste, ob diese gutartige Geschwulst tatsächlich die Ursache des Fiebers war – dazu hätte man sie entfernen müssen –, musste Modest zunächst möglichst viele alternative Diagnosen ausschließen, bevor er seinen Patienten an die Chirurgen überwies. Alle Tests waren unergiebig gewesen, aber Mitte der Woche war Modest sich ziemlich sicher, dass das Hämangiom die Ursache der Symptome war.
Der Blutschwamm wurde im April entfernt. Obwohl die Genesung des Patienten länger dauerte als erwartet, ist er heute wieder gesund. Kein Fieber und keine Müdigkeit mehr; sogar der Husten verschwand.
Ärzte räumen ein, dass in der Medizin niemand alles weiß. Unser Wissen wird von unseren Erfahrungen, unserer Ausbildung und unseren Interessen geformt. Wir alle greifen auf die Gemeinschaft der Ärzte zurück, wenn wir mit unserem Latein am Ende sind. Meist sind es Freunde und Kollegen; aber das Internet hat eine größere Gemeinschaft zu bieten – eine enorme Zahl von Fremden, die durch unsere medizinische Neugier und unsere Computertastatur miteinander verbunden sind.
Nächtliche Glut
Ihre Mutter sei gestürzt und zu schwach gewesen, um aufzustehen, erklärte die Stimme am Telefon. Nach dem Anruf einer Tante war die junge Frau zu ihrer Mutter geeilt, die nur eine Ortschaft entfernt im ländlichen Alabama wohnte. Die Tante hatte ihre 68-jährige Schwester nackt und verwirrt im Wohnzimmer gefunden. Sie hatte ihre Schwester angerufen, so wie jeden Tag, seitdem die Schwester krank geworden war. Als die Schwester nicht antwortete, machte sie sich Sorgen und fuhr hinüber zum Haus. Als ihre Nichte eintraf, war die alte Frau immer noch verwirrt, aber vollständig angezogen.
Obwohl die Mutter seit mehreren Jahren krank war, erschrak die Tochter, als sie den bleichen, abgemagerten Schatten sah, zu dem die Mutter geworden war. Sie war schon oft in der örtlichen Notaufnahme gewesen, sogar bei Fachärzten in Tuscaloosa. Aber niemand schien zu wissen, was mit ihr nicht stimmte.
Als die Rettungssanitäter ihre Mutter in den Krankenwagen luden, fragte die Tochter, ob sie den weiten Weg nach Birmingham fahren könnten. Als sie im Jahr zuvor mit Drillingen schwanger gewesen war, war sie die 80 Kilometer gefahren, um Fachärzte in der Universitätsklinik Alabama zu konsultieren. Vielleicht konnten die Ärzte dort ihrer Mutter helfen.
Die Ärzte in der Notaufnahme in Birmingham gaben der Patientin zu trinken, um den Blutdruck zu erhöhen. Daraufhin wurde sie ein wenig munterer. Wichtiger noch: Die Ärzte rieten ihr, sich in der Ambulanz der Universitätsklinik weiterbehandeln zu lassen.
Einen Monat später stellte sich Dr. Jori May, eine Internistin im zweiten Jahr ihrer Facharztausbildung, der mageren, blassen Frau und ihren beiden Töchtern vor. Die Frauen überreichten Dr. May einen dicken Stapel mit Krankenakten, den sie mitgebracht hatten, und die Ärztin legte ihn beiseite, um ihn sich später anzusehen. Zuerst wollte sie wissen, was passiert war.
Es hatte einige Jahre zuvor begonnen, berichtete die ältere Frau. Fast jede Nacht packte sie dieses verrückte Fieber. Zuerst kam ein Schüttelfrost, den sie bis in die Knochen spürte – sie wurde dann nicht einmal unter mehreren Decken warm. Dann wurde sie plötzlich glühend heiß und schwitzte heftig. Ihre Temperatur stieg auf 39 Grad und der ganze Körper tat ihr weh bis ins Mark. Gegen das Fieber und die Schmerzen schluckte sie ständig Tylenol.
Eine Stunde nach dem Fieberhöhepunkt fühlte sie sich krank und erbrach sich, bis der Magen leer war. Das geschah fast jede Nacht.
Tagsüber fühlte sie sich schwach und müde. Ihre Ärzte nannten das Fibromyalgie. Und sie hatte einen Ausschlag – Nesselsucht sagten die Ärzte. Er juckte nicht und niemand fand die Ursache. Zudem, fügten die Töchter hinzu, hatte sie keinen Appetit. Schon der Gedanke an Essen löste Brechreiz aus, sagte die Patientin. Im laufenden Jahr habe sie 36 Kilo verloren.
Dr. May sah, dass die Kleider, die Augen und sogar die Haut der Frau zu groß aussahen. Ansonsten war die Untersuchung unauffällig. Die Patientin hatte kein Fieber und keinen Ausschlag. Die Ärztin versprach ihr, die Krankenakten durchzusehen und dann einen Behandlungsplan zu erstellen.
Beim Studium der Akten fiel Dr. May auf, dass die Zahl der weißen Blutkörperchen bei der Patientin seit längerer Zeit erhöht war. Normal ist ein Wert unter zehn; bei ihr lag er fast bei zwanzig, und das seit mehreren Jahren. Eine Computertomografie zeigte vergrößerte Lymphknoten in ihrem gesamten Körper. Die Ursache konnte eine chronische Infektion sein. Oder Krebs. Aber die Ärzte in ihrer Stadt hatten nichts dergleichen gefunden.
Dr. May beschloss, über Krankheiten nachzudenken, auf die andere Ärzte die Patientin nicht getestet hatten. Sie musste auch auf HIV getestet werden. Menschen über 55 Jahren stellen ein Viertel der Fälle, wenn man die nicht diagnostizierten und diejenigen mit einer formellen Diagnose zusammenzählte; aber ältere Patienten werden viel seltener auf HIV untersucht. Eine weitere Möglichkeit war Syphilis, die auch »große Imitatorin« genannt wird, weil sie viele unterschiedliche Symptome haben kann. Und wegen der hartnäckigen Magen-Darm-Probleme wollte Dr. May auch einen Test auf Zöliakie veranlassen. Auch nach einem Blutkrebs namens Multiples Myelom wollte sie Ausschau halten. Er greift das Blut und die Knochen an und kommt bei Patienten über fünfzig vor.
Dr. May wartete nervös auf die Ergebnisse. Es war nicht Aids. Es war auch nicht Syphilis oder Zöliakie. Die Patientin hatte kein Multiples Myelom, obwohl dieser Test, der die Zahl der Antikörper misst – sie sind Teil des Immunsystems –, abnorm war: Ein Antikörpertyp, IgM genannt, war erhöht. Dr. May überwies die Patientin an einen Infektiologen, der jedoch keine Infektion fand. Der Onkologe fand keinen Krebs. Und der Dermatologe bestätigte nur, was die Ärztin bereits wusste: Die Patientin litt an Nesselsucht und es war nicht klar, warum. Sie stellte ihre erstaunliche Patientin jedem schlauen Arzt vor, den sie kannte, wann immer sie durch die Flure der Klinik ging oder eine Konferenz besuchte. Doch nach sieben Monaten voller Tests und Überweisungen und Diskussionen war Dr. May einer Diagnose nicht näher als am ersten Tag.
Es gehörte zu Dr. Mays täglicher Routine, die Krankenakte der Patientin auf neue Anmerkungen von Kollegen und auf neue Testergebnisse zu überprüfen. Eines Nachmittags bemerkte sie zu ihrer Überraschung eine elfseitige Stellungnahme eines Assistenzarztes für Pathologie namens Forest Huls, der, soviel sie wusste, mit dem Fall gar nichts zu tun hatte. Es war eine sorgfältige Zusammenfassung aller Symptome der Patientin und aller bisherigen Tests. Huls war der Meinung, dass die Patientin an einer Krankheit litt, von der Dr. May noch nie gehört hatte: am Schnitzler-Syndrom. Das ist, wie der Assistenzarzt schrieb, eine seltene und kaum erforschte Immunstörung.
Nach dem heutigen Stand der Wissenschaft läuft der primitivste Teil des Immunsystems – weiße Blutkörperchen, die Makrophagen heißen – beim Schnitzler-Syndrom Amok und weist den Organismus an, sich so zu verhalten, als wäre er infiziert. Der Körper reagiert dann mit Fieber und Schüttelfrost, Appetitlosigkeit, grippeähnlichen Beschwerden, Nesselsucht und hohen Werten eines bestimmten Antikörpers: IgM. Warum und wie das geschieht, ist immer noch unklar.
Die französische Dermatologin Liliane Schnitzler beschrieb die Störung im Jahr 1972 als Erste. Sie hatte fünf Patienten identifiziert, die an Nesselsucht, längeren Fieberschüben, Knochenschmerzen und vergrößerten Lymphknoten litten. Die Ärztin war der Meinung, dass diese Symptome eine neue Krankheit beschrieben.
Dr. May kannte Huls nicht persönlich, aber sie hatte von ihm gehört. Obwohl er sich noch in der Ausbildung befand, stand er im Ruf, Diagnosen zu stellen, die andere Ärzte verblüfften. »Wenn ich Menschen leiden sehe und wenn ich weiß, dass ich ihnen helfen kann, wenn ich mir die Zeit dafür nehme und mir Mühe gebe«, sagte er mir, »dann muss ich etwas tun.« Er hält Ausschau nach unerklärlichen pathologischen Befunden – in diesem Fall nach dem erhöhten IgM-Spiegel.
Auch Huls hatte das Schnitzler-Syndrom nicht gekannt. Er stieß darauf, als er in der Datenbank PubMed nach einer Krankheit suchte, die zu den Symptomen der Patientin passte. Er stellte eine Liste der Symptome und Anomalien zusammen. Um ein vollständiges Bild zu erhalten, durchkämmte er auch ihre früheren elektronischen Krankenakten, die inzwischen in einem alten Lagerhaus archiviert waren, und stellte fest, dass ihre Symptome vor etwa zehn Jahren begonnen hatten. Dann suchte er nach einer dazu passenden Krankheit. Es dauerte Stunden, bevor Artikel über diese seltsame Störung auftauchten. Als er sie las, hatte er den Verdacht, dass die Patientin diese Krankheit hatte.
Nachdem Dr. May die Anmerkungen ihres Kollegen gelesen hatte, informierte sie sich über das Schnitzler-Syndrom. Die Fallgeschichten von Patienten, die an diesem Syndrom litten, entsprachen denen ihrer Patientin genau.
Es war eine wichtige Diagnose, auch deshalb, weil es heute eine sehr wirksame Behandlung dafür gibt. Die Krankheit führt zu einer Überproduktion eines Proteins namens Interleukin 1 durch die Makrophagen.
Dieses Protein weist den Organismus an, krank zu werden und Fieber, Schmerzen und alle anderen grippeähnlichen Symptome auszulösen, die für die Krankheit typisch sind. Und vor einigen Jahren entwickelte ein Pharmaunternehmen ein Medikament, das dieses Protein hemmt. Als die Versicherung der Frau sich weigerte, dieses neue und sehr teure Medikament zu bezahlen, wandte sich Dr. May an den Hersteller, und dieser erklärte sich nach mehreren Monaten bereit, das Medikament zur Verfügung zu stellen. Kaum hatte die Patientin begonnen, das Mittel einzunehmen, hörten der Schüttelfrost und das Fieber auf, ebenso die Übelkeit, das Erbrechen, die Nesselsucht und die Knochenschmerzen.
Wenn die Patientin heute auf ihr Leben mit dieser Krankheit zurückblickt, erkennt sie sich kaum wieder. Vor ihrer Krankheit war sie stolz auf ihren Elan gewesen. Sie hatte nie still sitzen wollen. All diese Jahre auf dem Sofa und später im Bett, zu krank, zu schwach und zu sehr von Schmerzen geplagt, um sich bewegen zu können, schienen nun ein Kapitel im Leben eines anderen Menschen zu sein.
Huls beendete seine Facharztausbildung und kehrte an die University of Alabama zurück. In seinem neuen Job wird er an den schwierigsten Diagnosen arbeiten, an Fällen, die seine Neugier und seine Fertigkeiten mit Sicherheit herausfordern werden.
Krank auf der Hochzeitsfeier
Entweder du steigst zu mir ins Auto und fährst mit mir zurück ins Krankenhaus, oder ich rufe einen Krankenwagen«, sagte die Frau zu ihrem 38-jährigen Mann. Er war erst vor einem Tag aus dem Krankenhaus entlassen worden, doch er sah kränker aus als je zuvor. Die Frau brachte es nicht über sich, es zu sagen, aber sie fürchtete, dass er todkrank war. Sie hatte recht.
Es begann auf der Hochzeit seines jüngeren Bruders vor etwa einer Woche in Colorado. Schon beim Ausstieg aus dem Flugzeug fühlte er sich furchtbar. Sein Kopf pulsierte. Der ganze Körper schmerzte. Die Augen fühlten sich verquollen an. Als er an diesem ersten Abend zu Bett ging, warf er sich schlaflos hin und her. Und als er sich am Morgen aus dem Bett quälte, war die Bettwäsche nass von seinem Schweiß.





























