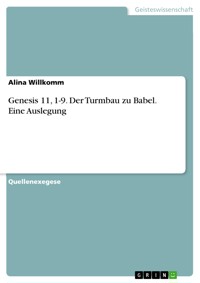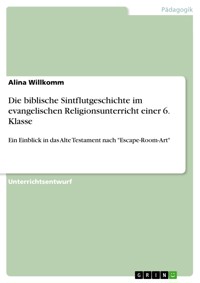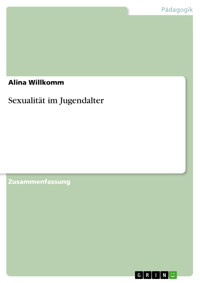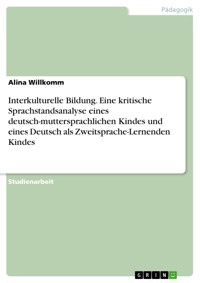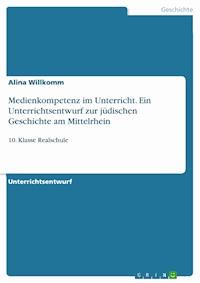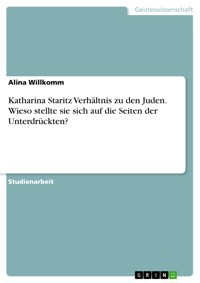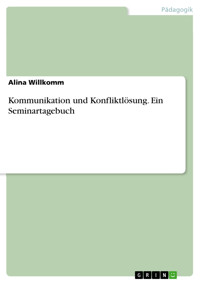Didaktik der Christologie. Die Christologie in den Evangelien und ihre religionspädagogische Umsetzung E-Book
Alina Willkomm
29,99 €
Mehr erfahren.
In den vier Evangelien wird die Geschichte eines Menschen beleuchtet, den wir heute Jesus nennen. Während das Leitthema zwar gleich bleibt, unterscheiden sich die Erzählungen doch in ihrem Blickwinkel auf die Thematik. Ob die Christologie, also die Lehre von Christus, hierbei einheitlich bleibt, untersucht Alina Willkomm in dieser Publikation. Wie wird die Jesusfigur in den Evangelien dargestellt? Intention und Quellenlage der Autoren bestimmen Inhalt und Ton einer Erzählung, auch in den christlichen Evangelien. Dieses Buch erörtert, wie genau sich das auf die Darstellung von Jesus auswirkt und ob sich trotzdem ein deckungsgleiches Bild ergibt. Die theoretischen Ergebnisse werden anschließend in einer didaktischen Ausarbeitung für eine Unterrichtsstunde zum Thema Christologie gebündelt. Dieser Unterrichtsentwurf dient als Vorlage für Lehrkräfte der Klassenstufe 6. Aus dem Inhalt: - Religionspädagogik; - Jesusbild; - Matthäusevangelium; - Markusevangelium; - Lukasevangelium; - Johannesevangelium
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 83
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Impressum:
Copyright © Studylab 2019
Ein Imprint der GRIN Publishing GmbH, München
Druck und Bindung: Books on Demand GmbH, Norderstedt, Germany
Coverbild: GRIN Publishing GmbH | Freepik.com | Flaticon.com | ei8htz
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Die Christologie in den Evangelien
2.1 Der Name Jesus
2.2 Die Immanuel-Verheißung
2.3 Der Weg Jesu
2.3.1 Gleichnisse
2.3.2 Wunder
2.3.3 Heilungen
2.4 Die Jünger
2.5 Kreuzestod und Auferstehung
2.5.1 Der Kreuzestod bei Markus
2.5.2 Der Kreuzestod bei Matthäus
2.5.3 Der Kreuzestod bei Lukas
2.5.4 Der Kreuzestod bei Johannes
3 Fazit: Christologie in den Evangelien
4 Die religionspädagogische Umsetzung als Didaktik der Christologie
4.1 Elementarisierung im Religionsunterricht (Schweitzer)
4.1.1 Einführung als religionsdidaktischer Ansatz
4.1.2 Christologie bei Jugendlichen
4.1.3 Elementarisierung in der religionsdidaktischen Diskussion
5 Fazit: Religionspädagogische Umsetzung als Didaktik der Christologie
6 Unterrichtsstunde
6.1 Verortung im Kernlehrplan evangelische Religionslehre Realschule
6.2 Thema und Lernzielschwerpunkte der Unterrichtsstunde
6.2.1 Thema der Unterrichtsstunde
6.2.2 Lernzielschwerpunkt der Unterrichtsstunde
6.3 Didaktische Schwerpunkte
6.3.1 Überlegungen zur Sache für die Stunde
6.3.2 Didaktische Überlegungen
6.3.3 Methodische Begründungen
7 Fazit: Unterrichtsstunde
Anhang
Tabellen
Arbeitsblätter
Literaturverzeichnis
Primärliteratur
Sekundärliteratur
1 Einleitung
Die vorliegende Masterarbeit soll im ersten Teil einen Überblick über die Christologie in den Evangelien bieten und im zweiten Teil eine didaktische Auseinandersetzung mit der Christologie im Religionsunterricht, inklusive einer Musterstunde beinhalten. Im ersten Teil wird sich anhand einer übersichtlichen Aufteilung und unter Berücksichtigung aktueller Forschungsliteratur mit den Berichten über Jesus in den Evangelien auseinandergesetzt. Dazu wird ein kurzer allgemeiner Überblick über die Christologie in den Evangelien gegeben, um im Weiteren anhand einer systematischen Gliederung der Jesuserzählungen einen konkreteren Überblick über Jesus zu erhalten. Dies geschieht im ersten Schritt durch die Erläuterung des Namens Jesu an der sich das matthäische Phänomen der Immanuel-Verheißung anschließt. Hierbei wurde auf die Dissertation von Jin Man Chung aus dem Jahr 2018 ein besonderer Wert gelegt, da das Werk zum einen durch seine Aktualität besticht und der Forschungsfokus des Doktoranten auf dem Matthäusevangelium lag. Im Anschluss daran wird der Weg Jesu beschrieben und anhand weiterer Unterpunkte die Gleichnisse, Heilungen und Wunder in ihrer Funktion aufgezählt. Darauf folgt ein Abschnitt über die Jünger Jesu, um den Aspekt der Nachfolge zu klären. Abschließend findet der Kreuzestod und die Auferstehung Ansprache, wobei die Thematik aufgrund ihres Umfangs in die jeweiligen Evangelien unterteilt wird. Hier wurde zum größten Teil auf das Werk von Theißen/Merz zurückgegriffen, welches bereits in der 4. Auflage erschienen ist und sich deshalb in der aktuellen Forschung besonderer Popularität erfreut.
Der zweite Teil dieser Arbeit beschäftigt sich mit der Umsetzung der Thematik Christologie in der Schule. Dazu wird der Elementarisierungsansatz herangezogen und auf das Grundlagenwerk von Schweitzer besonders eingegangen, da sich dieser ausführlich mit der Elementarisierung auseinandersetzt. Im Detail geht es darum zu erklären was man unter der Elementarisierung im Religionsunterricht versteht, um daraufhin auf die Christologie bei Jugendlichen einzugehen. Im Anschluss sollen die Nachteile der Elementarisierung zur Sprache kommen, um mögliche Verbesserungen des Ansatzes zu diskutieren.
Darauf folgt die praktische Umsetzung der Elementarisierung in konkreten Fällen. Dazu wird im ersten Schritt die Verortung der Christologie im Kernlehrplan veranschaulicht und eine eigene fiktive Unterrichtsstunde zum Thema Christologie – Kreuzestod (und Auferstehung) unter Berücksichtigung aller zuvor erforschten Kriterien didaktisch aufbereitet. Diese wird schriftlich unter referendariatsähnlichen Voraussetzungen beschrieben und berücksichtigt sowohl den Elementari-
sierungsansatz mit seinem wichtigsten Argument dem Lebensweltbezug, als auch eine ansprechende Materialauswahl, ein klar formuliertes Lernziel und eine Begründung der gewählten Methoden.
2 Die Christologie in den Evangelien
Man kann die Evangelien nicht mit einer heutigen Art von Biografie über eine Person vergleichen. Sie sprechen vielmehr von den Taten einer Person, die wir heute Jesus nennen. Sie setzen den Glauben an Jesus als messianischen Retter des Volkes Israel voraus und zweifeln nicht an seiner, durch Gott verliehenen, Allmacht. Alle Evangelien haben gemein, dass sie den Tod Jesu als einen Auftakt, eine Wende darstellen. Was sie voneinander unterscheidet, sind die Betonungen unterschiedlicher Aspekte des Lebens Jesu. Matthäus und Lukas hatten das Markusevangelium zur Quelle, wodurch sie viel miteinander gemein haben. Da sich sowohl Lukas, als auch Matthäus an derselben Logienquelle orientieren, man spricht hier von der Zwei-Quellen-Theorie, ähneln sie sich am meisten. Lukas jedoch muss als Autor der Apostelgeschichte, in der es um die Ausbreitung des Evangeliums geht, separiert von Markus und Matthäus betrachtet werden. Johannes bezieht sich auf andere Quellen und zeichnet Jesus anhand eines von ihm selbst ausgewählten Jüngers nach und setzt sich dadurch zum einen selbst eine Tradition[1] und erwartet von seinen Lesern ein höheres Maß an synoptischer Kenntnis.[2]
Die vier Evangelien bilden eine Einheit, der gemein ist, dass sie von ein und demselben Jesus handeln. In einigen Punkten steht jedes Evangelium dennoch für sich und betrachtet die Lebensgeschichte Jesu aus einem anderen Blickwinkel. Jeder Autor nutze andere Quellen, wenngleich die Synoptiker traditionell nahezu identisch sind. Jeder Autor wollte eine andere Bevölkerungsschicht mit seinem Evangelium ansprechen. Das Johannesevangelium zeigt eine völlig andere Seite von Jesus, die nach dem Lesen von Matthäus, Markus und Lukas zunächst erschüttern mag, jedoch dem Bild von Jesus als Erlöser treu bleibt. Alle Autoren haben die nachösterliche Erfahrung gemein unter dessen Gesichtspunkt sie schreiben. Rein die Evangelien haben einen historischen Quellenwert. Alle vier Autoren überliefern die Lebensgeschichte eines Mannes namens Jesus. Durch seine Taten wird eine christlich vorbildliche Person gezeichnet. Er redet nicht nur von der Nächstenliebe, er lässt sie jedem zuteilwerden, sogar seinen Feinden.
Er redet nicht nur von der Rettung, er rettet die Ungläubigen wirklich und führt sie auf den Weg zu Gottes Heil. Jesus ist ein Mann der Tat und das bedeutet wahres Menschsein: Das zu tun, wovon man überzeugt ist.[3]
2.1 Der Name Jesus
Der Name Jesus stünde nach Karrer gleichwohl für die Beständigkeit zwischen dem irdischen und dem auferstandenen Jesus und einer sich daraus entwickelnden Dynamik. In der Antike war die Wahl eines Namens und das was er dadurch transportieren und bei seinem Leser assoziieren wollte in einem stärkeren Fokus, als heute. Deswegen muss zunächst die Sprache, in der der Name Jesus geschrieben ist, betrachtet werden. Seine Wurzeln sind hebräisch-aramäisch „Jeschua“. Kontakt hat Jesus meist im griechisch-lateinischen Kontext, sodass sein Name Aufsehen erregt. Des Weiteren sind im griechisch-lateinischen häufig zwei Vornamen[4] anzutreffen. Jesus hat nur einen Vornamen. Er gibt sich auch keinen zeitgenössischen Zweitnamen, wie es durchaus möglich gewesen wäre und hebt sich damit bewusst aus der Menge hervor.[5]
„Nomen est omen.“[6]
Der Name Jesus lässt sich auf die Worte „Rettung, Heil, retten, befreien und helfen“ zurückführen. Er ist das Mittel zur Rettung der Menschheit vor den Sünden und gleichzeitig Messias, der den Heilswillen Gottes erfüllt. Matthäus betont den Zusammenhang der Namensgebung mit der Rettung und des Heils an folgender Stelle: „(...) und du sollst seinen Namen Jesus nennen, denn er wird sein Volk retten von seinen Sünden.“ (Mt 1,21).[7] Die Besonderheit bei der Namensgebung in Matthäusevangelium, im Gegensatz zum Evangelium nach Lukas, ist das Erscheinen eines Engels (Mt 1,20). Dieser Engel beinhaltet eine Botschaft Gottes, in Bezug auf die Offenbarung.
Gleichzeitig rechtfertigt er Maria als Mutter Jesu, die von Josef angenommen werden soll (Mt 1,20). Matthäus verwendet in seinem Evangelium das Traum-Motiv, der Engel erscheint Josef im Traum (Mt 1,20), was bedeutet, dass Josef eine Botschaft über ein nicht greifbares Medium erfährt. Die Traumwelt ist eine nicht durch Sinne zu erfassende Wirklichkeit, die durch das folgende Handelns Josefs einen Weg in die tatsächliche Welt findet. Man könnte sagen, dass der Traum für eine göttliche Botschaft steht.[8]
Wie bereits ersichtlich wurde, ist Josef eine tragende Gestalt im ersten Teil des Matthäusevangeliums. Er leistet den Worten des Engels aus seinem Traum folge und nimmt Maria zu seiner Frau, und mit ihr den Sohn Jesus als den Seinen an. Matthäus‘ Fokus liegt hier nicht auf Maria. Josefs zentrale Rolle betont er, indem er ihn „gerecht“ (Mt 1,19) nennt und ihm die Rolle des Empfängers der Offenbarung zuspricht. Er befolgt die Worte des Engels und zeigt sich dadurch Gottes Botschaft gegenüber gehorsam. Diese Gehorsamkeit gibt er an seinen Sohn weiter.[9] Betreffend des Matthäusevangeliums und seinem Umgang mit dem Namen Jesu lässt sich sagen, dass die Nennung des Namens bei ihm quantitativ am häufigsten vorkommt. Im Gegensatz zum Lukasevangelium, wo Maria ihrem Sohn den Namen verleihen soll (Lk 1,31), kommt diese Rolle bei Matthäus Josef zuteil, der damit dessen Vaterschaft rechtfertigen möchte.[10]
„Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele.“ (Mk 10,45)
Die Gottessohnschaft wird nach dem Markusevangelium durch Gott selbst begründet, da Gott Jesus gegenüber Johannes, Petrus und Jakobus als seinen Sohn bezeichnet (Mk 9,7), sie ihm diese Begegnung jedoch erst nach seiner Auferstehung offenbaren dürften (Mk 9,9).[11]Kein Jude darf Jesus Gottes Sohn nennen, da dies für sie die Verletzung des Ersten Gebots bedeutet.
Deswegen nutzt das Markusevangelium Jesus selbst als durchführende Gewalt, um dieses Gebot zu wahren, indem er Jesus sich selbst nicht als göttlich bezeichnen lässt: „Niemand ist gut als nur einer Gott.“ (Mk 10,18).[12]