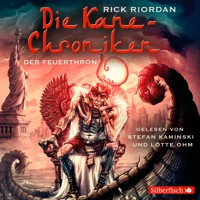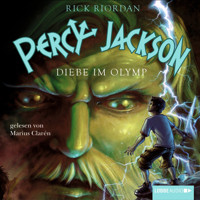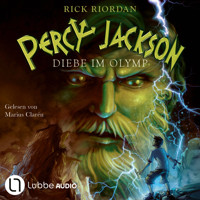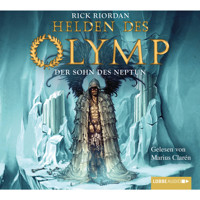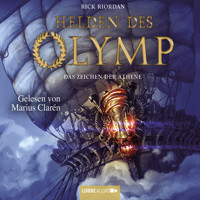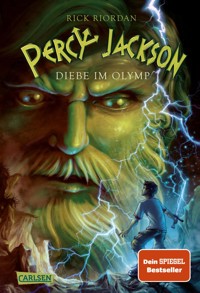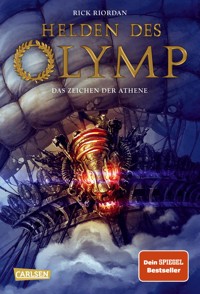12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Carlsen
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Der finale Kampf um das Orakel von Delphi Eigentlich haben Apollo und seine Freundin Meg schon so viel geschafft. Das Camp Jupiter ist gerettet, die grausamen Herrscher Caligula und Commodus sind zurückgeschlagen und eine ganze Zombiearmee ist besiegt – und trotzdem steht ihnen die größte Aufgabe noch bevor: Sie müssen das mächtige Orakel von Delphi aus den Fängen des magischen Python befreien. Eine geheimnisvolle Weissagung soll ihnen dabei helfen. Die etwas andere Heldenreise: Zeit für Apollo, den egozentrischsten Gott aller Zeiten! Einmal Mist im Olymp gebaut und schon landet Gott Apollo auf direktem Wege in einer Gasse in New York. Ohne seine göttlichen Kräfte und im Körper eines Teenagers muss er sich der modernen Welt stellen. Dabei stolpert er von einem Abenteuer ins nächste und lernt, dass das Leben als Sterblicher nicht ganz so glamourös ist, wie er dachte – aber vielleicht viel bedeutungsvoller. "Die Abenteuer des Apollo" ist ein Spin-off von Riordans vorherigen Reihen "Percy Jackson" und "Helden des Olymp". In der fünfteiligen Fantasy-Buchserie überführt Rick Riordan alte Sagen und Legenden in moderne Geschichten und begeistert Leser*innen überall auf der Welt für seine Hauptfigur Apollo, dem seine maßlose Arroganz und Selbstverliebtheit immer wieder im Weg steht. ***Ein selbstverliebter Held, epische Abenteuer und viel Humor – für Leser*innen ab 12 Jahren und für alle Fans der griechisch-römischen Mythologie***
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Rick Riordan: Die Abenteuer des Apollo. Der Turm des Nero
Aus dem Englischen von Gabriele Haefs
Camp Jupiter ist gerettet, die grausamen Herrscher Caligula und Commodus sind zurückgeschlagen und eine ganze Zombiarmee ist besiegt. Doch Lester (zu anderen Zeiten auch bekannt als der Gott Apollo) und seine Freundin Meg haben noch eine große Aufgabe vor sich: Sie müssen das mächtige Orakel von Delphi aus den Fängen des magischen Python befreien. Zum Glück hilft ihnen eine alte Weissagung, die die Harpyie Ella ihnen enthüllt. Die Hinweise führen sie nach New York zum Turm des Nero – und weiter bis nach Griechenland …
Der letzte Band aus Rick Riordans Welt der griechischen und römischen Mythologie!
Wohin soll es gehen?
Buch lesen
Glossar
Viten
Für Becky,jede Reise führt mich zu dir nach Hause.
1
Doppelkopfschlange
Versaut mir die schöne Fahrt.
Und Megs Schuh’ stinken.
Auf einer Fahrt durch Washington, D. C., rechnet man ja damit, ein paar Schlangen in menschlicher Bekleidung zu sehen. Aber als an der Union Station eine zweiköpfige Boa constrictor in unseren Zug einstieg, wurde ich doch nervös.
Diese Kreatur hatte sich in einen eleganten blauen Anzug gewunden und ihren Körper durch Ärmel und Hosenbeine geschlängelt, sodass er menschlichen Gliedern ähnelte. Zwei Köpfe ragten aus dem Kragen ihres Oberhemdes wie ein Doppelperiskop. Angesichts der Tatsache, dass das Wesen im Grunde doch nur ein überdimensionales Luftballontier war, bewegte es sich mit überraschender Eleganz. Es suchte sich einen Platz am anderen Ende des Wagens und schaute in unsere Richtung.
Die anderen Fahrgäste achteten nicht darauf. Zweifellos verzerrte der Nebel ihre Wahrnehmung und ließ sie einfach einen weiteren Pendler sehen. Die Schlange tat nichts Bedrohliches. Sie sah uns nicht einmal an. Es konnte sich also durchaus um ein feierabendmüdes Monster auf dem Weg nach Hause handeln.
Und doch durfte ich nicht davon ausgehen …
Ich flüsterte Meg zu: »Ich will dich ja nicht beunruhigen …«
»Pssst«, sagte sie.
Meg nahm die Vorschriften, die im Ruhebereich galten, sehr ernst. Seit wir eingestiegen waren, war fast aller Lärm im Wagen dadurch entstanden, dass Meg mich zischend zum Schweigen brachte, wann immer ich etwas sagte, nieste oder mich räusperte.
»Aber da ist ein Monster.« Ich ließ nicht locker.
Sie schaute von dem im Wagen ausliegenden Zugmagazin auf und hob eine Augenbraue über ihre mit Strass besetzte Schmetterlingsbrille. Wo?
Ich bewegte mein Kinn in Richtung des Schlangenwesens. Als unser Zug aus dem Bahnhof fuhr, starrte sein linker Kopf gedankenverloren aus dem Fenster. Der rechte ließ seine gespaltene Zunge in eine Wasserflasche schnellen, die statt von einer Hand von einer Schlinge gehalten wurde.
»Das ist eine Amphisbaena«, flüsterte ich und fügte dann hilfsbereit hinzu: »Eine Schlange mit einem Kopf an jedem Ende.«
Meg runzelte die Stirn und zuckte mit den Schultern, was ich als Für mich sieht die aber friedlich aus interpretierte. Danach vertiefte sie sich wieder in ihre Zeitschrift.
Ich unterdrückte meinen Drang, ihr zu widersprechen. Vor allem, weil ich nicht schon wieder zum Schweigen gebracht werden wollte.
Ich konnte Meg keinen Vorwurf machen, dass sie eine ruhige Fahrt wollte. In der vergangenen Woche hatten wir uns durch eine Meute von wilden Zentauren in Kansas hindurchgeschlagen, hatten in Springfield, Missouri, einem wütenden Hungergeist gegenübergestanden (ich konnte in der Eile kein Selfie machen) und waren einem Paar blauer Kentucky-Drachen entronnen, die uns mehrere Male um die Pferderennbahn in Louisville gejagt hatten. Nach diesen Erlebnissen war eine zweiköpfige Schlange in Schlips und Kragen vielleicht kein Grund zur Beunruhigung. Und im Moment belästigte der Amphisbaen uns ja auch nicht weiter.
Ich versuchte, mich zu entspannen.
Meg vergrub ihr Gesicht in ihrer Zeitschrift, total absorbiert von einem Artikel über Urban Gardening. Meine junge Begleiterin war in den Monaten, in denen ich sie nun kannte, gewachsen, aber sie war noch immer klein genug, um bequem ihre roten Schaftturnschuhe gegen den Rücken des Sitzes vor ihr zu stemmen. Bequem für sie, aber nicht für mich oder die anderen Fahrgäste. Meg hatte seit unserem Lauf um die Rennbahn in Kentucky ihre Schuhe nicht gewechselt, und sie rochen und sahen aus wie das Hinterteil eines Pferdes.
Wenigstens hatte sie ihr zerfetztes grünes Kleid gegen Jeans aus einem Billigladen und ein grünes T-Shirt mit der Aufschrift UNICORNES IMPERANT eingetauscht, das sie im Andenkenladen von Camp Jupiter gekauft hatte. Mit ihrem Pagenschnitt, der langsam zu lang wurde, und einem wütenden roten Pickel, der auf ihrer Wange zu bersten drohte, sah sie nicht mehr aus wie eine Vorschülerin. Sie sah fast so alt aus, wie sie war: eine Sechstklässlerin kurz vor dem Eintritt in den Kreis der Hölle, der Pubertät genannt wird.
Ich hatte diese Beobachtungen Meg gegenüber für mich behalten. Erstens konnte ich mir über meine eigene Akne genug den Kopf zerbrechen, und zweitens könnte Meg mir als meine Herrin befehlen, mich aus dem Zugfenster zu stürzen, und ich würde ihr gehorchen müssen.
Der Zug fuhr durch die Vororte von Washington. Die späte Nachmittagssonne flackerte zwischen den Gebäuden auf wie die Lampe eines alten Filmprojektors. Es war eine wunderbare Tageszeit, zu der ein Sonnengott eigentlich Feierabend machen, sich zu den Stallungen begeben, seinen Wagen abstellen und es sich dann in seinem Palast gemütlich machen sollte – mit einem Kelch Nektar, ein paar Dutzend ihn anbetenden Nymphen und einer neuen Staffel von Die wahren Göttinnen des Olymp.
Aber mir war das alles verwehrt. Für mich gab es nur einen knirschenden Sitz in einem Amtrak-Zug, von dem aus ich stundenlang Megs stinkende Schuhe anstarren konnte.
Am anderen Ende des Wagens machte der Amphisbaen noch immer nichts Bedrohliches … sofern man das Trinken von Wasser aus einer Einwegflasche nicht für einen Akt der Aggression hält.
Warum also sträubten sich mir die Haare im Nacken?
Ich hatte meinen Atem nicht mehr unter Kontrolle. Ich fühlte mich auf meinem Fenstersitz gefangen.
Vielleicht war ich einfach nervös, weil uns in New York so einiges erwartete. Nach sechs Monaten in diesem elenden sterblichen Leib näherte ich mich jetzt meinem Endspiel.
Meg und ich waren einmal quer durch die Vereinigten Staaten und zurück gestolpert. Wir hatten uralte Orakel befreit, Legionen von Monstern besiegt und die unbeschreiblichen Schrecken des amerikanischen öffentlichen Verkehrssystems erlitten. Endlich, nach vielen Tragödien, hatten wir in Camp Jupiter zwei der abgrundtief bösen Kaiser des Triumvirats bezwungen: Commodus und Caligula.
Aber das Schlimmste stand uns noch bevor.
Wir kehrten dorthin zurück, wo unsere Probleme ihren Anfang genommen hatten – nach Manhattan, zum Hauptquartier des Nero Claudius Caesar, Megs grausamer Stiefvater und der Geiger, den ich am allerwenigsten leiden konnte. Selbst, wenn es uns auf irgendeine Weise gelänge, ihn zu besiegen, lauerte im Hintergrund eine noch mächtigere Bedrohung; meine Nemesis, mein Erzfeind Python, der sich im mir geweihten Orakel von Delphi niedergelassen hatte wie in einer Airbnb-Unterkunft zum Sonderpreis.
In den nächsten Tagen würde ich entweder diese beiden Feinde besiegen und wieder zum Gott Apollo werden (falls mein Vater Zeus das gestattete) oder ich würde bei dem Versuch mein Leben verlieren. So oder so ging meine Zeit als Lester Papadopoulos ihrem Ende entgegen.
Vielleicht war es ja doch kein Mysterium, dass ich so nervös war …
Ich versuchte, mich auf den prachtvollen Sonnenuntergang zu konzentrieren und nicht ständig an meine unmögliche Aufgabenliste oder die zweiköpfige Schlange in Reihe sechzehn zu denken.
Ich schaffte es bis Philadelphia, ohne einen Nervenzusammenbruch zu erleiden. Aber als wir aus dem Bahnhof fuhren, gingen mir zwei Dinge auf: 1.) der Amphisbaen saß noch immer im Zug, was bedeutete, dass er wohl doch kein täglicher Bahnpendler war, und 2.) mein Gefahrenradar piepte heftiger denn je.
Ich kam mir gestalkt vor. Ich hatte dieses Gefühl von Ameisen auf der Haut, wie früher, wenn ich mit Artemis und ihren Jägerinnen im Wald Verstecken gespielt hatte, eine Sekunde ehe sie aus dem Unterholz hervorsprangen und mich mit Pfeilen durchsiebten.
Ich wagte einen Blick auf den Amphisbaen und wäre fast aus meinen Jeans gesprungen. Das Monster starrte mich jetzt an, seine vier gelben Augen blinzelten nicht und … fingen die jetzt etwa an zu glühen? Oh nein, nein, nein. Glühende Augen sind nie ein gutes Zeichen.
»Ich muss hier raus«, sagte ich zu Meg.
»Psssst.«
»Aber diese Kreatur. Ich muss mir den Typen mal genauer ansehen. Seine Augen glühen.«
Meg musterte Mr Schlange aus zusammengekniffenen Augen. »Nein, tun sie nicht. Sie leuchten. Und er sitzt doch einfach nur da.«
»Er sitzt verdächtig da!«
Die Fahrgäste hinter uns flüsterten: »Psst!«
Meg hob die Augenbrauen und sah mich an. Meine Rede!
Ich wies auf den Mittelgang und machte ein Schmollgesicht.
Meg verdrehte die Augen, befreite sich aus ihrer Hängemattenposition und ließ mich durch. »Fang ja keinen Streit an«, befahl sie.
Super. Jetzt würde ich warten müssen, bis das Monster mich angriff, ehe ich mich verteidigen konnte.
Ich blieb im Mittelgang stehen und wartete darauf, dass das Blut in meine gefühllosen Beine zurückkehrte. Wer auch immer den menschlichen Blutkreislauf erfunden hatte, hatte lausige Arbeit geleistet.
Der Amphisbaen hatte sich nicht bewegt. Seine Augen waren noch immer auf mich gerichtet. Er schien sich in irgendeiner Art von Trance zu befinden. Vielleicht sammelte er seine Energie für einen gewaltigen Angriff. Machten Amphisbaenen so was?
Ich durchwühlte meine Erinnerung nach Kenntnissen über diese Wesen, aber die Ausbeute war mager. Der römische Autor Plinius behauptete, es sorge für eine komplikationslose Schwangerschaft, sich ein lebendiges Amphisbaenenbaby um den Hals zu wickeln (das half mir nicht weiter). Sich in eine Amphisbaenenhaut zu wickeln, mache attraktiv für mögliche Partnerinnen und Partner. (Hm. Nein, das half mir auch nicht weiter.) Die Amphisbaenenköpfe konnten Gift speien. Aha! Das musste es sein. Das Monster bereitete sich auf eine doppelmündige Giftkotzespülung des ganzen Zugwaggons vor!
Was tun …?
Trotz meiner gelegentlichen Ausbrüche von göttlicher Kraft und Geschicklichkeit konnte ich mich nicht darauf verlassen, dass einer kam, wenn ich ihn brauchte. Meistens war ich weiterhin nur ein jämmerlicher Siebzehnjähriger.
Ich könnte meinen Bogen und meinen Köcher aus der Gepäckablage über uns nehmen. Bewaffnet zu sein wäre nett. Aber das würde meine feindseligen Absichten signalisieren. Meg würde mich vermutlich zusammenstauchen, weil ich die Sache übertrieb. (Tut mir leid, Meg, aber diese Augen haben geglüht, nicht geleuchtet.)
Wenn ich doch nur eine kleinere Waffe unter meinem Hemd versteckt hätte, einen Dolch vielleicht. Warum war ich nicht der Gott der Dolche?
Ich beschloss, durch den Mittelgang zu schlendern, als ob ich einfach nur zur Toilette wollte. Wenn der Amphisbaen mich dabei angriff, würde ich schreien. Hoffentlich würde Meg ihre Zeitschrift dann lange genug sinken lassen, um mich zu retten. Dann hätte ich wenigstens die unvermeidliche Konfrontation erzwungen. Wenn die Schlange nicht reagierte, war sie ja vielleicht doch harmlos. Dann würde ich zur Toilette weitergehen, weil ich tatsächlich dringend musste.
Ich stolperte auf meinen prickelnden Beinen weiter, was beim »lässigen Auftritt« nicht gerade half. Ich spielte mit dem Gedanken, eine unbeschwerte kleine Melodie zu pfeifen, aber dann fiel mir die Sache mit dem Ruhebereich wieder ein.
Vier Reihen bis zum Monster. Mein Herz hämmerte. Diese Augen glühten eindeutig, und sie waren eindeutig auf mich gerichtet. Das Monster saß unnatürlich bewegungslos da, sogar für ein Reptil.
Noch zwei Reihen. Der Anzug des Amphisbaen sah teuer und maßgeschneidert aus. Als Riesenschlage konnte er seine Kleidung vermutlich nicht von der Stange kaufen. Seine schimmernde, braungelb gemusterte Haut schien mir nicht geeignet, um auf einer Dating-App attraktiver zu wirken, es sei denn, man wollte Boa constrictors daten.
Als der Amphisbaen zuschlug, glaubte ich, darauf vorbereitet zu sein.
Das war ich nicht. Er schleuderte sich mit unvorstellbarem Tempo vorwärts und fing mein Handgelenk mit einer Schlinge aus seinem falschen linken Arm ein, wie mit einem Lasso. Ich war zu überrascht, um auch nur zu wimmern. Wenn er mich hätte töten wollen, wäre ich tot gewesen.
Stattdessen festigte er seinen Griff nur, brachte mich zum Stehen und klammerte sich an mich wie ein Ertrinkender.
Dann sprach er mit einem leisen, doppelten Zischen, das in meinem Knochenmark widerhallte:
»Der Sohn des Hades wird zum Höhlenläufergesellen,
den geheimen Weg zum Thron sie dir zeigen,
für euer Leben musst du Neros eigen fällen.«
So plötzlich, wie er mich gepackt hatte, ließ er mich auch wieder los. Muskelkontraktionen liefen wie Wellen seinen Körper entlang, als ob er sich langsam dem Siedepunkt näherte. Er setzte sich gerade hin und reckte die Hälse, bis er fast Nase an Nase mit mir war. Das Glühen verschwand aus seinen Augen.
»Was mach ich hier …?« Sein linker Kopf sah den rechten an. »Wie …?«
Der rechte Kopf wirkte genauso verwirrt. Er sah mich an. »Wer sind …? Moment, hab ich die Haltestelle Baltimore verpasst? Meine Frau bringt mich um!«
Ich war zu geschockt, um etwas zu erwidern.
Was er da gesagt hatte … ich hatte das Versmaß erkannt. Dieser Amphisbaen hatte eine poetische Botschaft überbracht. Mir ging auf, dass dieses Monster vielleicht wirklich nur ein gewöhnlicher Pendler war, der von den Launen des Schicksals besessen und benutzt worden war, weil … Natürlich. Er war eine Schlange. Seit uralten Zeiten hatten Schlangen die Weisheit der Erde weitergeleitet, weil sie am Boden lebten. Eine Riesenschlange musste für Orakelstimmen besonders aufnahmefähig sein.
Ich wusste nicht so recht, was ich machen sollte. Sollte ich ihn für die Unannehmlichkeiten um Entschuldigung bitten? Sollte ich ihm ein Trinkgeld geben? Und wenn nicht er die Bedrohung war, die meinen Gefahrenradar aktiviert hatte, wer war es dann?
Mir wurde diese peinliche Unterredung erspart, und dem Amphisbaen wurde es erspart, von seiner Frau umgebracht zu werden, da zwei Armbrustbolzen durch den Wagen jagten und ihn ihrerseits umbrachten, indem sie die Hälse der armen Schlange an die Rückwand nagelten.
Ich kreischte los. Mehrere in der Nähe sitzende Fahrgäste machten ärgerlich »pst!«.
Der Amphisbaen zerfiel zu gelbem Staub und hinterließ nur einen maßgeschneiderten Anzug.
Ich hob langsam die Hände und drehte mich um mich selbst, als ob ich auf einer Landmine stünde. Ich rechnete fast damit, dass ein weiterer Armbrustbolzen meine Brust durchbohren würde. Nie im Leben würde ich dem Geschoss eines so zielsicheren Schützen ausweichen können. Das Einzige, was ich tun konnte, war, nicht auszusehen wie eine Bedrohung. Darin war ich gut.
Am gegenüberliegenden Ende des Wagens standen zwei gewaltige Gestalten. Die eine war ein Germane, wenn ich von seinem Bart und den schlampig geflochtenen Haaren, der Lederrüstung, den Beinschienen und seinem Brustpanzer aus Kaiserlichem Gold ausgehen konnte. Ich kannte diesen Germanen nicht, aber in letzter Zeit waren mir zu viele seiner Art begegnet. Ich hatte keine Zweifel daran, für wen er arbeitete. Neros Leute hatten uns gefunden.
Meg saß noch immer, sie hielt ihre magischen goldenen Zwillings-Sicae in der Hand, aber der Germane drückte die Schneide seines Breitschwertes an ihren Hals und ermunterte sie dadurch, sich still zu verhalten.
Seine Gefährtin war die Armbrustschützin. Sie war noch größer und schwerer als er, und sie trug eine Schaffner-Uniform der Amtrak, die aber niemanden täuschen konnte – abgesehen offenbar von allen Sterblichen im Wagen, die die Neuankömmlinge keines Blickes würdigten. Der Schädel der Schützin war unter ihrer Schaffnermütze auf den Seiten rasiert, und die glänzende braune Mähne in der Mitte ringelte sich als geflochtener Zopf über ihre Schulter. Ihr kurzärmliges Hemd spannte dermaßen an ihren muskulösen Schultern, dass ich dachte, die Schulterklappen und ihr Namensschild würden abplatzen. Ihre Arme waren bedeckt von verschlungenen Tätowierungen und um den Hals trug sie einen dicken goldenen, vorne offenen Reif – eine Torque.
So ein Ding hatte ich seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Diese Frau war eine Gallierin! Bei dieser Erkenntnis erstarrte mein Magen zu Eis. In den alten Tagen der Römischen Republik waren Gallier noch gefürchteter gewesen als Germanen.
Sie hatte ihre Doppelarmbrust bereits wieder geladen und zielte damit auf meinen Kopf. An ihrem Gürtel hing eine Vielzahl von anderen Waffen: ein Gladius, eine Keule und ein Dolch. Na toll, sie hatte einen Dolch!
Sie starrte mich weiterhin an und riss ihr Kinn zu ihrer Schulter herum, das universale Signal für komm her, sonst knall ich dich ab.
Ich berechnete meine Chancen, durch den Mittelgang zu rennen und unsere Feinde anzugreifen, ehe sie Meg und mich umbrachten. Null. Meine Chance, mich vor Angst hinter einem Sitz zusammenzukauern, während Meg sich um die beiden kümmerte, war etwas besser, aber noch immer nicht umwerfend.
Ich ging mit wackligen Knien den Mittelgang entlang. Die sterblichen Fahrgäste runzelten die Stirn, als ich vorbeikam. Wenn ich das richtig verstanden hatte, hielten sie meinen Entsetzensschrei für eine Störung, die sich in einem Ruhebereich einfach nicht gehörte, weshalb ich nun von der Zugbegleiterin hinausgeführt wurde. Die Tatsache, dass die Zugbegleiterin eine Armbrust schwenkte und soeben eine zweiköpfige Pendlerschlange getötet hatte, schien bei ihnen nicht angekommen zu sein.
Ich erreichte meinen Sitz und warf einen Blick auf Meg, um mich davon zu überzeugen, dass sie unversehrt war – und außerdem, weil ich wissen wollte, warum sie sich nicht wehrte. Meg ein Schwert an die Kehle zu halten, reichte normalerweise nicht aus, um sie zu entmutigen.
Meg starrte die Gallierin schockiert an. »Luguselwa!«
Die Frau nickte kurz, was mir zwei entsetzliche Dinge verriet: Erstens, Meg kannte sie. Zweitens, sie hieß Luguselwa. Als sie Meg ansah, flaute die Wut in den Augen der Gallierin etwas ab, von jetzt bring ich alle um zu bald bring ich alle um.
»Ja, Setzling«, sagte die Gallierin. »Und jetzt leg deine Waffen weg, ehe Gunther dir den Kopf abhacken muss.«
2
Wer will ein Croissant?
Dir bekommt das nicht, Lester.
Muss pissen. Bis dann.
Der Schwertschwenker sah begeistert aus. »Kopf abhacken?«
Sein Name, GUNTHER, stand auf einem Amtrak-Namensschild, das er an seiner Rüstung trug – sein einziges Zugeständnis an die Tatsache, dass er hier verkleidet auftreten musste.
»Noch nicht.« Luguselwa ließ uns nicht aus den Augen. »Wie ihr seht, hackt Gunther Leuten nur zu gern den Kopf ab, also seid schön folgsam. Mitkommen.«
»Lu«, sagte Meg. »Warum?«
Wenn es darum ging, Verletzungen zum Ausdruck zu bringen, war Megs Stimme ein fein regulierbares Instrument. Ich hatte gehört, wie sie den Tod unserer Freunde beklagte. Ich hatte gehört, wie sie den Mord an ihrem Vater beschrieb. Ich hatte sie gegen Nero wüten gehört, der ihren Dad umgebracht und Meg durch Jahre des psychischen Missbrauchs verstört hatte.
Aber als sie nun mit Luguselwa sprach, klang Megs Stimme ganz anders. Sie hörte sich an, als ob ihre beste Freundin ohne Grund oder Vorwarnung ihre Lieblingspuppe zerlegt hätte. Sie klang verletzt, verwirrt, ungläubig – als ob in einem Leben voller Erniedrigungen dies hier die eine Verletzung wäre, mit der sie nie und nimmer gerechnet hätte.
Lus Wangenmuskeln spannten sich an. An ihren Schläfen traten die Adern hervor. Ich war nicht sicher, ob sie wütend war, sich schuldig fühlte oder uns ihre warmherzige Seite zeigte.
»Weißt du noch, was ich dir über Pflicht beigebracht habe, Setzling?«
Meg würgte ein Schluchzen hinunter.
»Weißt du das noch?«, wiederholte Lu, jetzt mit schärferer Stimme.
»Ja«, flüsterte Meg.
»Dann hol deine Sachen und komm mit.« Lu drückte Gunthers Schwert von Megs Hals weg.
Der große Kerl machte »hmpf«. Ich nahm an, das war Germanisch und bedeutete »nie darf ich meinen Spaß haben«.
Meg erhob sich mit verwirrtem Gesichtsausdruck und öffnete das Gepäckfach über ihr. Ich konnte nicht begreifen, warum sie sich Luguselwas Befehlen so widerspruchslos fügte. Wir hatten schon in viel schlechteren Ausgangssituationen gekämpft. Wer war diese Gallierin bloß?
»Das wars?«, flüsterte ich, als Meg mir meinen Rucksack reichte. »Wir geben auf?«
»Lester«, murmelte Meg. »Tu einfach, was ich dir sage.«
Ich schulterte meinen Rucksack, Köcher und Bogen. Lu und Gunther schien es nichts auszumachen, dass ich jetzt mit Pfeilen bewaffnet war und Meg über eine reiche Auswahl an Saatgut-Raritäten verfügte. Während wir uns aufbruchbereit machten, warfen die sterblichen Fahrgäste uns gereizte Blicke zu, aber niemand sagte »pst«; vermutlich, weil sie sich nicht mit den beiden riesigen Zugbegleitern anlegen wollten, die uns hinausführten.
»Da lang.« Lu zeigte mit ihrer Armbrust auf den Ausgang hinter ihr. »Die anderen warten.«
Die anderen?
Ich wollte keine weiteren Gallier oder Gunther treffen, aber Meg folgte Lu brav durch die automatische Doppeltür aus Plexiglas. Ich ging hinterher, und Gunther hielt sich dicht hinter mir und dachte vermutlich darüber nach, wie leicht es wäre, meinen Kopf von meinem Körper zu trennen.
Ein lärmender, schlingernder Durchgang verband unseren Wagen mit dem nächsten, mit automatischen Türen an jedem Ende, einer besenkammergroßen Toilette und an Backbord und Steuerbord Türen zum Aussteigen. Ich spielte mit dem Gedanken, mich aus einem dieser Ausgänge zu stürzen und aufs Beste zu hoffen, fürchtete aber, »das Beste« wäre dann, beim Aufprall auf den Boden ums Leben zu kommen. Nach dem Dröhnen des rostigen Stahls unter meinen Füßen zu urteilen, fuhr unser Zug über hundertfünfzig Stundenkilometer.
Durch die Plexiglastüren auf der anderen Seite konnte ich den Bistrowagen sehen: ein hässlicher Verkaufstresen, eine Reihe von Nischen zum Sitzen und ein halbes Dutzend kräftiger Kerle, die dort herumlungerten – weitere Germanen. In dem Bistro wartete nichts Gutes auf uns. Wenn Meg und ich einen Fluchtversuch machen wollten, dann wäre jetzt die Gelegenheit.
Ehe ich irgendeine Verzweiflungstat begehen konnte, blieb Luguselwa plötzlich vor der Tür zum Bistrowagen stehen und drehte sich zu uns um.
»Gunther«, fauchte sie. »Durchsuch die Toilette nach Infiltratoren.«
Das schien Gunther ebenso zu verwirren wie mich, entweder weil er nicht begriff, wozu das gut sein sollte, oder weil er keine Ahnung hatte, was ein Infiltrator war.
Ich fragte mich, warum sich Luguselwa so paranoid verhielt. Befürchtete sie, dass wir in der Toilette eine Legion von Halbgöttern zwischengeparkt hatten, die nur darauf warteten, hervorzuspringen und uns zu retten? Oder hatte sie (so wie ich) schon mal einen Zyklopen auf dem Porzellanthron überrascht und misstraute nun allen öffentlichen Toiletten?
Nach einem kurzen, intensiven Blickwechsel machte Gunther »hmpf« und tat, wie ihm geheißen.
Sowie er seinen Kopf ins Klo gesteckt hatte (in die Klokammer, nicht ins Klo an sich), starrte Lu uns durchdringend an. »Wenn wir durch den Tunnel nach New York reinfahren«, sagte sie, »werdet ihr beide darum bitten, die Toilette benutzen zu dürfen.«
Ich hatte mir ja schon eine Menge blödsinniger Befehle erteilen lassen, meistens von Meg, aber das hier war ein neuer Tiefpunkt.
»Eigentlich muss ich jetzt schon«, sagte ich.
»Reiß dich zusammen«, sagte Lu.
Ich schaute zu Meg hinüber, um zu sehen, ob das für sie irgendeinen Sinn ergab, aber sie starrte düster den Boden an.
Gunther kam von seiner Pisspottpatrouille zurück. »Niemand.«
Armer Kerl. Wenn man schon auf einer Zugtoilette nach Infiltratoren suchen muss, hofft man ja wenigstens auf Erfolg, damit man sie umbringen kann.
»Na gut«, sagte Lu. »Dann weiter.«
Sie führte uns in den Bistrowagen. Sechs Germanen fuhren herum und starrten uns an. Sie hatten Croissants und Kaffeetassen in der Hand. Barbaren! Wer sonst isst abends wohl Frühstücksgebäck? Die Krieger waren wie Gunther in Felle und goldene Rüstungen gekleidet, die sie mit Amtrak-Namensschildern getarnt hatten. Einer der Männer, AEDELBEORT (der beliebteste germanische Jungenname im Jahr 162 Allgemeiner Zeitrechnung), bellte eine an Lu gerichtete Frage in einer Sprache, die ich nicht erkannte. Lu antwortete. Ihre Antwort schien die Krieger zufriedenzustellen und sie widmeten sich wieder Kaffee und Gebäck. Gunther gesellte sich zu ihnen und knurrte, wie schwer es doch sei, gute Feinde zum Enthaupten aufzutreiben.
»Dahin«, sagte Lu zu uns und wies auf einen Fenstertisch.
Meg glitt mit düsterer Miene auf einen Sitz, ich nahm ihr gegenüber Platz und packte meinen Bogen, meinen Rucksack und meinen Köcher neben mich. Lu blieb in Hörweite stehen, für den Fall, dass wir über einen Fluchtplan diskutierten. Sie brauchte sich keine Sorgen zu machen: Meg wich meinem Blick noch immer aus.
Wieder fragte ich mich, wer diese Luguselwa sein mochte und was sie für Meg bedeutete. Auf unserer monatelangen Reise hatte Meg sie kein einziges Mal erwähnt. Diese Tatsache beunruhigte mich. Ich hatte langsam den Verdacht, dass sie von sehr großer Bedeutung war.
Und warum eine Gallierin? In Neros Rom hatte es nicht viele Gallier gegeben. Als er zum Kaiser geworden war, waren die meisten von ihnen besiegt und zwangsweise »zivilisiert« worden. Die, die noch tätowiert waren, Torques trugen und ihre alten Sitten beibehielten, waren in die Bretagne oder auf die Britischen Inseln vertrieben worden. Der Name Luguselwa … Gallisch war noch nie meine Stärke gewesen, aber ich glaubte, es bedeutete, vom Gott Lugus geliebt. Mir schauderte. Diese keltischen Gottheiten waren eine seltsame, wilde Bande.
Meine Gedanken waren zu durcheinander, um das Rätsel der Lu zu lösen. Ich musste immer wieder an den armen Amphisbaen denken, den sie getötet hatte – ein harmloses Pendlermonster, das nie wieder zu seiner Frau nach Hause kommen würde, und das nur, weil eine Weissagung ihn zur Spielfigur gemacht hatte.
Seine Botschaft hatte mich erschüttert – ein Vers in Terza Rima wie der, den wir in Camp Jupiter gehört hatten.
Oh Sohn des Zeus, nun kommt der letzte Schritt,
allein zu zweit sollst dich dem Turm des Nero stellen,
und dann die Bestie vom angestammten Platze tritt.
Ja, ich hatte diesen verfluchten Vers auswendig gelernt.
Jetzt hatten wir unsere zweite Portion an Instruktionen, die deutlich mit der ersten verbunden war, da sich die erste und die dritte Zeile auf »stellen« reimten. Der blöde Dante und seine blöde Idee für eine niemals endende Reimstruktur:
Der Sohn des Hades wird zum Höhlenläufergesellen,
den geheimen Weg zum Thron sie dir zeigen,
für euer Leben musst du Neros eigen fällen.
Ich kannte einen Sohn des Hades: Nico di Angelo. Er hielt sich vermutlich noch in Camp Half-Blood auf Long Island auf. Vielleicht kannte er einen geheimen Weg zu Neros Thron. Aber er würde ihn uns niemals zeigen können, wenn wir nicht aus diesem Zug entkamen. Ich hatte allerdings keine Ahnung, was Nico mit irgendwelchen »Höhlenläufern« zu tun haben sollte.
Die letzte Zeile der neuen Strophe war einfach grausam. Wir waren schließlich gerade umgeben von »Neros eigen«, und natürlich hing unser Leben von ihnen ab. Ich wollte glauben, dass diese Zeile noch eine andere Bedeutung hatte, eine positive … die vielleicht irgendwie damit zusammenhing, dass Lu uns zur Toilette schicken wollte, wenn wir in den Tunnel nach New York eingefahren waren. Aber angesichts von Lus feindseliger Miene und der Anwesenheit ihrer sieben schwer koffeinisierten und von Zucker aufgeputschten germanischen Freunde war ich nicht gerade optimistisch.
Ich rutschte auf meinem Sitz hin und her. Oh, warum nur hatte ich an die Toilette gedacht? Ich musste jetzt wirklich dringend!
Draußen jagten die beleuchteten Reklametafeln von New Jersey vorüber: Werbung für Autohändler, bei denen man einen unpraktischen Rennwagen erstehen konnte, Rechtsanwälte, die man anheuern konnte, um die Schuld den anderen Fahrern zuzuschieben, wenn man den Wagen zu Schrott gefahren hatte, Casinos, wo man den vor Gericht erstrittenen Schadensersatz verzocken konnte. Der große Kreislauf des Lebens.
Die Haltestelle Newark Airport kam und ging. Bei allen Göttern, ich war so verzweifelt, dass ich mit dem Gedanken an einen Fluchtversuch spielte. In Newark.
Meg blieb sitzen, also tat ich das auch.
Bald würden wir den Tunnel nach New York erreichen. Vielleicht könnten wir, statt zur Toilette zu gehen, einen Angriff auf unsere Gefangenenwärter starten …
Lu schien meine Gedanken gelesen zu haben. »Gut, dass ihr euch ergeben habt. Nero hat allein in diesem Zug noch drei solche Teams. Jeder Zugang nach Manhattan – jeder Zug, Bus und Flug – wird überwacht. Nero hat das Orakel von Delphi auf seiner Seite. Er wusste, dass ihr heute Abend kommen würdet. Ihr hättet es nie bis in die Stadt geschafft, ohne gefangen zu werden.«
Nette Art, meine Hoffnungen zu zerschmettern, Luguselwa. Mir zu erzählen, dass Nero seinen Kumpel Python für sich in die Zukunft linsen ließ und damit mein geheiligtes Orakel gegen mich verwandte … echt krass.
Meg dagegen schien plötzlich aufzuleben, als ob Lus Worte ihr auf irgendeine Weise Hoffnung gemacht hätten. »Und wieso hast ausgerechnet du uns gefunden, Lu? Pures Glück?«
Lus Tätowierungen wogten, als sie die Muskeln an ihren Armen spielen ließ, und von den wirbelnden keltischen Schnörkeln wurde ich seekrank.
»Ich kenne dich eben, Setzling«, sagte sie. »Ich weiß, wie ich dich ausfindig mache. Es gibt kein Glück.«
Ich könnte ihr mehrere Gottheiten des Glücks nennen, die das anders sehen würden, aber ich widersprach nicht. Die Gefangenschaft hatte mein Verlangen nach Small Talk gedämpft.
Lu drehte sich zu ihren Gefährten um. »Sowie wir in der Penn Station angekommen sind, übergeben wir unsere Gefangenen dem Begleitteam. Ich will keine Fehler. Niemand bringt das Mädchen oder den Gott um, solange das nicht unbedingt nötig ist.«
»Ist es jetzt nötig?«, fragte Gunther.
»Nein«, sagte Lu. »Der Princeps hat Pläne für sie. Er will sie lebend.«
Der Princeps. Der Geschmack in meinem Mund war bitterer als der bitterste Amtrak-Kaffee. Durch Neros Eingangstür geführt zu werden war nicht die Art, auf die ich ihm gegenübertreten wollte.
Im einen Augenblick ratterten wir noch durch eine Wildnis von Lagerhäusern und Werften in New Jersey und schon im nächsten tauchten wir in den dunklen Tunnel, der uns unter dem Hudson durchführen würde. Über Lautsprecher kündigte eine verzerrte Stimme als nächsten Halt die Penn Station an.
»Ich muss pissen«, erklärte Meg.
Ich starrte sie sprachlos an. Wollte sie wirklich Lus seltsamen Befehl befolgen? Die Gallierin hatte uns gefangen genommen und eine unschuldige zweiköpfige Schlange getötet. Warum sollte Meg ihr vertrauen?
Meg trat mir energisch auf den Fuß.
»Ja«, quietschte ich. »Ich muss auch pissen.« Bei mir war das immerhin eine schmerzliche Wahrheit.
»Zusammenreißen!«, knurrte Gunther.
»Ich muss aber wirklich pissen!« Meg hüpfte auf ihrem Platz auf und ab.
Lu seufzte genervt. Ihre Verärgerung klang ungeheuer echt. »Na gut.« Sie drehte sich zu ihrem Team um. »Ich geh mit. Ihr bleibt hier und bereitet euch aufs Aussteigen vor.«
Keiner der Germanen wagte einen Widerspruch. Sie hatten von Gunther vermutlich genug Klagen über die Pisspottpatrouille gehört. Sie fingen an, sich den Mund mit ein paar letzten Croissants vollzustopfen und ihre Ausrüstung zusammenzusuchen, während Meg und ich uns aus unserer Sitznische herauswanden.
»Eure Sachen«, mahnte mich Lu.
Ich blinzelte. Klar doch. Wer geht schon ohne Bogen und Köcher aufs Klo? Das wäre ja total unsinnig. Ich schnappte mir meine Sachen.
Lu trieb uns zurück in den Durchgang. Sowie sich die Doppeltüren hinter uns geschlossen hatten, murmelte sie: »Jetzt!«
Meg rannte in Richtung Ruhewagen los.
»He!« Lu schob mich beiseite und hielt lange genug inne, um zu murmeln: »Die Türen blockieren. Und die Wagen auseinanderkoppeln!«, dann stürzte sie hinter Meg her.
Was sollte ich tun?
In Lus Händen blitzten zwei Krummschwerter auf. Moment – hatte sie Megs? Nein. Unmittelbar vor Ende des Durchgangs drehte sich Meg zu ihr um, rief ihre eigenen Klingen herbei und die beiden gingen wie die Dämoninnen aufeinander los. Waren sie etwa beide Dimachaeren, die seltenste Art von Gladiator? Das bedeutete – ich hatte keine Zeit, mir zu überlegen, was das bedeutete.
Hinter mir brüllten die Germanen. Sie würden jeden Moment durch die Türen kommen.
Ich begriff nicht genau, was hier gerade passierte, aber mein stumpfsinniges sterbliches Gehirn kam auf den Gedanken, dass Lu vielleicht, ganz vielleicht, versuchte, uns zu helfen. Wenn ich nicht die Türen blockierte, wie sie gesagt hatte, würden wir von sieben wütenden Barbaren mit klebrigen Fingern überrannt werden.
Ich stemmte meinen Fuß gegen den unteren Teil der Doppeltür. Es gab keine Griffe. Ich musste meine Handflächen gegen die Türen drücken und sie zusammenpressen, damit sie geschlossen blieben.
Gunther warf sich in vollem Tempo gegen die Türen und der Aufprall hätte mir fast den Kiefer ausgerenkt. Die anderen Germanen drängten sich hinter ihm zusammen. Meine einzigen Vorteile waren der enge Raum, in dem sie sich befanden, und die Dummheit der Germanen. Statt zusammenzuarbeiten, um die Türen auseinanderzudrücken, stießen und schoben sie sich einfach gegenseitig und benutzten Gunthers Gesicht als Rammbolzen.
Hinter mir fochten Lu und Meg, und ihre Krummschwerter klirrten wütend gegeneinander.
»Gut, Setzling«, sagte Lu ganz leise. »Du hast dein Training nicht vergessen.« Dann lauter, für unser Publikum bestimmt: »Dumme Göre, ich bring dich um!«
Ich stellte mir vor, wie dieser Anblick auf die Germanen auf der anderen Seite des Plexiglases wirken musste: ihre Gefährtin Lu im Kampf gegen eine entlaufene Gefangene, während ich versuchte, die Germanen aufzuhalten. Meine Hände verloren jegliches Gefühl. Meine Arm- und Brustmuskeln taten weh. Ich hielt verzweifelt Ausschau nach einem Türverschluss für Notfälle, es gab aber nur einen Notfall-Türöffner. Wozu sollte das denn gut sein?
Der Zug dröhnte weiter durch den Tunnel. Ich schätzte, dass uns nur noch wenige Minuten bis zur Penn Station blieben, wo Neros »Begleitteam« uns erwartete. Ich wollte nicht begleitet werden.
Die Wagen auseinanderkoppeln, hatte Lu mir befohlen.
Wie sollte ich das denn schaffen, zumal ich doch die Türen des Durchgangs verschlossen halten musste? Ich war schließlich kein Eisenbahningenieur. Eisenbahnen waren ja wohl eher was für Hephaistos.
Ich schaute mich über die Schulter um und suchte den Durchgang ab. Zu meiner Empörung gab es keinen deutlich beschrifteten Schalter, mit dem ein Fahrgast den Zug auseinanderkoppeln konnte. Was dachten die sich eigentlich bei Amtrak?
Da! Auf dem Boden entdeckte ich eine Serie aus Metallklappen, die eine sichere Fläche bildeten, über die Fahrgäste auch dann gehen konnten, wenn der Zug wackelte und schlingerte. Eine dieser Klappen war mit einem Tritt geöffnet worden, vielleicht von Lu, und darunter war die Kupplung zu sehen.
Selbst, wenn ich von der Stelle, wo ich stand, hätte hinreichen können (was ich nicht konnte), hätte ich wohl kaum die Kraft und die Geschicklichkeit besessen, meinen Arm in die Lücke zu schieben, die Kabel zu durchtrennen und die Verklammerung zu öffnen. Der Spalt zwischen den Bodenklappen war zu eng, die Kupplung zu tief unten. Und um sie von hier aus zu treffen, hätte ich der größte Bogenschütze aller Zeiten sein müssen.
Oh. Moment …
Die Türen an meiner Brust drohten, unter dem Gewicht von sieben Barbaren nachzugeben. Eine Axtschneide bohrte sich neben meinem Ohr durch den mit Gummi beklebten Rand. Mich umzudrehen, um einen Pfeil abzuschießen, wäre Wahnsinn.
Genau, dachte ich hysterisch. Dann wolln wir mal!
Ich erkaufte mir eine Sekunde, indem ich einen Pfeil aus dem Köcher riss und ihn durch den Spalt in der Tür zwischen die Germanen rammte. Gunther heulte auf. Der Druck ließ kurz nach, als sich der Germanenklumpen neu zusammenfügte. Ich fuhr herum und presste meinen Rücken gegen das Plexiglas, mein einer Absatz war unten gegen die Türen gedrückt. Dann machte ich mich an meinem Bogen zu schaffen und konnte einen Pfeil anlegen.
Mein neuer Bogen war eine Waffe von göttlicher Qualität aus den Schatzkammern von Camp Jupiter. Meine Schützenfähigkeiten hatten sich in den vergangenen sechs Monaten gewaltig verbessert. Aber es war trotzdem eine grottenschlechte Idee. Es war unmöglich, sicher zu schießen, während ich meinen Rücken gegen eine harte Oberfläche presste. Ich konnte die Bogensehne einfach nicht weit genug spannen.
Trotzdem schoss ich. Der Pfeil verschwand im Spalt im Boden und verfehlte die Kupplung total.
»In einer Minute erreichen wir die Penn Station«, sagte eine Lautsprecherstimme. »Ausstieg links.«
»Wir haben keine Zeit mehr!«, brüllte Lu. Sie schlug nach Megs Kopf. Meg stach weiter unten zurück und hätte fast den Oberschenkel der Gallierin durchbohrt.
Ich gab noch einen Pfeil ab. Diesmal ließ die Spitze an der Kupplung Funken sprühen, aber die Wagen hingen weiterhin starrköpfig aneinander.
Die Germanen hämmerten gegen die Türen. Eine der Plexiglasscheiben sprang aus ihrem Rahmen. Eine Faust schob sich hindurch und packte mein Hemd.
Mit einem Verzweiflungsschrei sprang ich von den Türen weg und schoss ein letztes Mal, diesmal mit weit gespannter Bogensehne. Der Pfeil durchschlitzte die Kabel und bohrte sich in die Kupplung. Die gab mit einem Schütteln und einem Stöhnen nach.
Germanen strömten in den Durchgang, als ich über die breiter werdende Öffnung zwischen den Wagen sprang. Ich wäre fast von Megs und Lus Krummschwertern aufgespießt worden, aber irgendwie konnte ich das Gleichgewicht wiederfinden.
Ich drehte mich um. Der restliche Zug vor uns jagte mit über hundert Stundenkilometern in die Dunkelheit, während sieben Germanen ungläubig zu uns zurückstarrten und Beleidigungen schrien, die ich hier nicht wiederholen werde.
Unser abgekoppelter Zugteil rollte durch den eigenen Schwung noch einige Dutzend Meter weiter, dann kam er langsam zum Stillstand.
Meg und Lu ließen ihre Waffen sinken. Eine mutige Passagierin aus dem Ruheraum wagte es, herauszuschauen und zu fragen, was denn los sei.
»Pst«, gab ich zurück.
Lu sah mich wütend an. »Hast ja ganz schön lange gebraucht, Lester. Und jetzt los, ehe meine Männer zurückkommen. Ihr zwei seid gerade von Bitte lebend fangen zu Beweis des Todes genügt avanciert.«
3
Oh, Pfeil der Weisheit,
weißt du ein Versteck für mich?
Nein, nicht das da. NEIN!
»Ich versteh nur Bahnhof«, sagte ich, als wir durch die dunklen Tunnel stolperten. »Sind wir noch immer Gefangene?«
Lu warf zuerst mir einen Blick zu, dann Meg. »Ganz schön blöd für einen Gott, oder?«
»Du hast ja keine Ahnung«, knurrte Meg.
»Arbeitest du nun für Nero oder nicht?«, fragte ich. »Und wie genau …« Ich zeigte zuerst auf Lu und dann auf Meg und fragte lautlos: Woher kennt ihr euch eigentlich? Oder seid ihr miteinander verwandt? Schließlich seid ihr beide gleich nervig!
Dann fing ich das Funkeln ihrer identischen Goldringe auf, einer an jedem ihrer Mittelfinger. Ich dachte daran, wie Lu und Meg gekämpft hatten, wie ihre vier Klingen perfekt synchron geschlitzt und gestochen hatten. Die offenkundige Wahrheit traf mich wie eine Ohrfeige.
»Du hast Meg trainiert«, erkannte ich. »Als Dimachaera.«
»Und sie hat ihre Fähigkeiten bewahrt«, Lu versetzte Meg einen liebevollen Rippenstoß. »Das gefällt mir, Setzling.«
Ich hatte Meg noch nie so stolz gesehen!
Sie umarmte ihre alte Trainerin überfallartig. »Ich hab ja gewusst, dass du nicht zu den Bösen gehörst.«
»Hmmm.« Lu schien nicht zu wissen, wie sie mit Megs Umarmung umgehen sollte. Sie streichelte ihre Schulter. »Und wie ich zu den Bösen gehöre, Setzling. Aber ich werde nicht zulassen, dass Nero dich wieder foltert. Also weiter jetzt.«
Foltert. Das war das richtige Wort, ja.
Ich fragte mich, wie Meg dieser Frau trauen konnte. Sie hatte den Amphisbaen getötet, ohne mit der Wimper zu zucken. Ich bezweifelte nicht, dass sie das auch mit mir machen würde, wenn sie es für nötig hielt.
Schlimmer noch: Sie stand auf Neros Gehaltsliste. Egal, ob Lu uns aus der Gefangenschaft gerettet hatte oder nicht, sie hatte Meg trainiert, was bedeutete, dass sie jahrelang zugesehen hatte, wie Nero meine junge Freundin emotional und mental folterte. Lu war ein Teil des Problems gewesen – ein Teil von Megs Indoktrinierung in der gestörten Familie des Kaisers. Ich hatte Angst, dass Meg in ihre alten Verhaltensmuster zurückfallen könnte. Vielleicht hatte Nero eine Möglichkeit gefunden, sie indirekt durch diese ehemalige Lehrerin zu manipulieren, der sie vertraute.
Andererseits wusste ich nicht so recht, wie ich dieses Thema zur Sprache bringen sollte. Wir wanderten durch ein Labyrinth aus U-Bahn-Wartungstunneln, mit Lu als einziger Führerin. Sie hatte viel mehr Waffen als ich. Und Meg war meine Herrin. Sie hatte mir gesagt, wir müssten Lu folgen, also taten wir das auch.
Wir setzten unseren Marsch fort, Meg und Lu trotteten Seite an Seite dahin, ich stolperte hinterher. Ich würde euch gern erzählen, dass ich »ihnen Rückendeckung gab« oder irgendeine andere wichtige Aufgabe erfüllte, aber ich glaube, Meg hatte mich ganz einfach vergessen.
Über uns warfen in Stahlkäfige eingeschlossene Arbeitslampen Gefängnisgitterschatten auf die Klinkermauern. Der Boden war schlammbedeckt und verströmte einen Geruch wie die alten Weinfässer, die Dionysos unbedingt in seinem Keller aufbewahren wollte, obwohl der »Wein« schon vor ewigen Zeiten zu Essig geworden war. Wenigstens rochen Megs Turnschuhe jetzt nicht mehr nach Pferdekacke. Sie waren mit neuem Giftmüll überzogen.
Nachdem wir eine weitere Million von Meilen dahingestolpert waren, wagte ich die Frage: »Miss Lu, wohin gehen wir?« Ich war überrascht von der Lautstärke meiner Stimme, die in der Dunkelheit widerhallte.
»Weg von der Rasterfahndung«, sagte sie, als läge das auf der Hand. »Nero hat unter anderem die Überwachungskameras in Manhattan angezapft. Wir müssen aus seinem Radar weg.«
Es war ein bisschen widersinnig, eine gallische Kriegerin über Radar und Kameras reden zu hören.
Ich fragte mich ein weiteres Mal, wie Lu in die Dienste Neros geraten war.
So ungern ich es auch zugab, die Kaiser des Triumvirats waren im Grunde Götter minderen Ranges. Sie überlegten sich genau, welche Gefolgsleute die Ewigkeit mit ihnen verbringen durften. Das mit den Germanen schien sinnvoll. Sie mochten dumm und grausam sein, aber als kaiserliche Leibwächter waren sie von unerschütterlicher Treue. Doch wieso eine Gallierin? Luguselwa war für Nero sicher nicht allein wegen ihrer Schwertkünste wertvoll. Ich mochte mich nicht darauf verlassen, dass sich eine solche Kriegerin nach zwei Jahrtausenden gegen ihren Herrn wenden würde.
Mein Misstrauen strahlte offenbar von mir ab wie Hitze von einem Ofen. Lu schaute sich um und registrierte mein Stirnrunzeln. »Apollo, wenn ich deinen Tod wollte, dann wärst du bereits tot.«
Stimmt, dachte ich, aber Lu hätte auch hinzufügen können: Wenn ich dich dazu bringen wollte, mir zu folgen, damit ich dich Nero lebend übergeben kann, dann würde ich es genauso anstellen.
Lu ging jetzt schneller. Meg starrte mich an, als wollte sie sagen Mach meine Gallierin nicht an, dann lief sie los, um Lu einzuholen.
Ich verlor jegliches Zeitgefühl. Das Adrenalin vom Kampf im Zug ebbte ab und ich war nur noch müde und fühlte mich wie gerädert. Klar, ich lief noch immer um mein Leben, aber ich hatte die letzten sechs Monate damit verbracht, um mein Leben zu laufen. Ich konnte nicht ewig im dynamischen Zustand der Panik bleiben. Tunnelschleim sickerte in meine Socken. Meine Schuhe fühlten sich an wie matschige Tontöpfe.
Eine Zeit lang war ich beeindruckt, wie gut Lu sich in den Tunneln auskannte. Sie marschierte voran und führte uns um eine Ecke nach der anderen. Aber als sie an einer Kreuzung einen Moment zu lange zögerte, ging mir die Wahrheit auf.
»Du weißt nicht, wohin wir gehen«, sagte ich.
Sie starrte mich wütend an. »Hab ich doch gesagt. Weg von …«
»Überwachungskameras. Ja, aber wohin gehen wir?«
»Irgendwohin. Wo es sicher ist.«
Ich lachte. Es überraschte mich, dass ich wirklich erleichtert war. Wenn Lu keine Ahnung hatte, wohin wir unterwegs waren, dann fiel es mir gleich leichter, ihr zu vertrauen. Sie hatte keinen Masterplan. Wir hatten uns verirrt. Was für eine Freude!
Lu wusste meinen Sinn für Humor nicht zu schätzen.
»Entschuldige bitte, wenn ich improvisieren musste«, sagte sie verärgert. »Ihr könnt von Glück sagen, dass ich euch in dem Zug gefunden habe und nicht einer der anderen kaiserlichen Greiftrupps. Sonst säßet ihr jetzt in Neros Arrestzelle.«
Meg starrte mich ebenfalls wütend an. »Genau, Lester. Außerdem haben wir gar kein Problem.«
Sie zeigte auf eine Fläche aus alten Fliesen mit klassisch griechischen Mustern an der Wand des linken Ganges, vielleicht ein Überbleibsel einer stillgelegten U-Bahn-Linie. »Das da kenne ich. Da müsste es eigentlich einen Aufgang geben.«
Ich wollte fragen, woher sie das wissen wollte. Dann fiel mir ein, dass Meg einen großen Teil ihrer Kindheit damit verbracht hatte, sich in dunklen Gassen, verlassenen Gebäuden und anderen ungewöhnlichen Gegenden von Manhattan herumzutreiben, und das mit Neros Segen – das war die böse kaiserliche Version von Erziehung zur Eigeninitiative.
Ich konnte mir vorstellen, wie eine jüngere Meg diese Tunnel erforschte, im Schlamm Räder schlug und an vergessenen Stellen Pilze züchtete.
Wir folgten ihr … ich weiß nicht, zehn oder elf Kilometer? So kam es mir jedenfalls vor. Einmal blieben wir abrupt stehen, als ein tiefes und fernes BUMM im Gang widerhallte.
»Zug?«, fragte ich nervös, obwohl wir die Schienen schon längst verlassen hatten.
Lu legte den Kopf schräg. »Nein, das war Donner.«
Ich begriff nicht, wie das möglich war. Als wir in New Jersey in den Tunnel gefahren waren, hatte es keine Anzeichen von Regen gegeben. Die Vorstellung von plötzlichen Gewittern so dicht am Empire State Building gefiel mir nicht – direkt am Eingang zum Olymp, dem Wohnsitz des Zeus, alias der Große Papa mit dem Blitzstrahl.
Meg lief unangefochten weiter.
Endlich endete unser Tunnel an einer Leiter aus Metall. Über uns lag ein lockerer Gullydeckel. Licht und Wasser sickerten an einer Seite am Rand durch, wie bei einem weinenden Halbmond.
»Ich weiß noch, dass man hier in eine Gasse kommt«, verkündete Meg. »Eine ohne Kamera – jedenfalls, als ich zuletzt hier war.«
Lu grunzte, wie um zu sagen, gute Arbeit, oder vielleicht auch das geht nie im Leben gut.
Die Gallierin kletterte als Erste hoch. Gleich darauf standen wir drei in einem Durchgang zwischen zwei Wohnblocks. Über uns zerfetzten Blitze den Himmel und durchsetzten die düsteren Wolken mit Gold. Regentropfen stachen mir ins Gesicht und in die Augen.
Woher kam dieser Sturm? War das ein Willkommensgeschenk meines Vaters oder eine Warnung? Vielleicht war es auch einfach ein Sommergewitter. Leider hatte ich in meiner Zeit als Lester gelernt, dass nicht jedes meteorologische Ereignis mit mir zu tun hatte.
Donner ließ die Fenster zu unseren beiden Seiten klirren. Aufgrund der gelben Klinkerfassaden der Gebäude nahm ich an, dass wir uns irgendwo in der Upper East Side befanden, obwohl das von der Penn Station aus eine unmöglich lange Untergrundwanderung wäre. Am Ende des Durchgangs jagten Taxis eine geschäftige Straße entlang: Park Avenue? Lexington?
Ich schlang mir die Arme um den Leib. Meine Zähne klapperten. Mein Köcher füllte sich mit Wasser und der Riemen auf meiner Schulter wurde schwerer. Ich drehte mich zu Lu und Meg um. »Ich nehme an, keine von euch hat ein magisches Mittel, um den Regen aufhören zu lassen?«
Lu zog aus der unendlichen Auswahl von Waffen an ihrem Gürtel etwas, das für mich wie ein Gummiknüppel aussah. Sie drückte auf einen Knopf und das Teil öffnete sich zu einem Regenschirm. Natürlich war darunter nur gerade so eben Platz für Lu und Meg.
Ich seufzte. »Das habe ich mir jetzt selbst eingebrockt, was?«
»Genau«, stimmte Meg zu.
Ich zog mir den Rucksack über den Kopf, was genau 0,003 Prozent des Regens davon abhielt, mein Gesicht zu treffen. Meine Kleider klebten an meiner Haut. Mein Herz wurde langsamer und hämmerte dann grundlos wieder los, als ob es sich nicht entscheiden könnte, ob es erschöpft oder verängstigt war.
»Was jetzt?«, fragte ich.
»Wir suchen uns einen Ort, wo wir weiter überlegen können«, sagte Lu.
Ich betrachtete den nächststehenden Müllcontainer. »Nero hat doch so viele Immobilien in Manhattan. Hast du da keinen einzigen geheimen Unterschlupf, den wir benutzen könnten?«
Lus Lachen war das Einzige in diesem Durchgang, was trocken war. »Ich hab euch doch gesagt, dass Nero alle Sicherheitskameras in New York unter Kontrolle hat. Was glaubst du wohl, wie genau er seinen eigenen Besitz überwacht? Willst du das riskieren?«
Es ärgerte mich furchtbar, dass sie da recht hatte.
Ich wollte Luguselwa vertrauen, weil Meg ihr vertraute. Ich musste zugeben, dass Lu uns im Zug gerettet hatte. Und mir wirbelte immer wieder die letzte Zeile der amphisbaenischen Weissagung durch den Kopf: Für euer Leben musst du Neros eigen fällen.
Das könnte sich auf Lu beziehen, aber bedeutete es, dass wir ihr vertrauen durften?
Andererseits hatte Lu den Amphisbaen getötet. Und ich konnte nicht wissen, ob er, wenn er noch einige Minuten länger gelebt hätte, vielleicht noch ein Stückchen jambischen Pentameter ausgespuckt hätte: Nicht Lu. Vertrau nie der Gallierin.
»Wenn du auf unserer Seite bist«, sagte ich, »warum die ganze Nummer im Zug? Warum hast du den Amphisbaen umgebracht? Warum dieses Schauspiel mit der Toilette?«
Lu grunzte. »Zuallererst: Ich bin auf Megs Seite. Du bist mir ziemlich egal.«
Meg feixte. »Gutes Argument.«
»Und was dieses Monster angeht …« Lu zuckte mit den Schultern. »Das war ein Monster. Es wird sich irgendwann im Tartarus regenerieren. Kein großer Verlust.«
Ich nahm an, dass seine Frau Mrs Schlange das vielleicht anders sehen würde. Andererseits war es noch nicht lange her, dass ich Halbgötter ungefähr so gesehen hatte wie Lu den Amphisbaen.
»Und was das Schauspiel angeht«, fügte sie hinzu. »Wenn ich meine Kameraden angegriffen hätte, dann hätte ich euer Leben aufs Spiel gesetzt, und mein eigenes, oder einer meiner Männer hätte entkommen und Nero über alles informieren können. Und ich wäre als Verräterin entlarvt worden.«
»Aber sie sind alle entkommen«, widersprach ich. »Sie werden allesamt Nero informieren, und … Oh. Sie werden Nero erzählen …«
»Dass sie mich zuletzt gesehen haben, als ich wie eine Irre kämpfte und versuchte, euch an der Flucht zu hindern«, sagte Lu.
Meg trat von Lu weg und riss die Augen auf. »Nero wird dich für tot halten! Du kannst bei uns bleiben!«
Lu lächelte sie traurig an. »Nein, Setzling. Ich muss bald zurück. Wenn ihr Glück habt, dann vertraut Nero mir noch immer.«
»Aber warum?«, fragte Meg. »Du kannst nicht zurück!«
»Das ist die einzige Möglichkeit«, sagte Lu. »Ich musste dafür sorgen, dass ihr bei eurer Rückkehr in die Stadt nicht gefangen werdet. Aber jetzt … ich brauche Zeit, um euch zu erklären, was hier vor sich geht … was Nero vorhat.«
Ihr Zögern gefiel mir nicht. Was immer Nero vorhaben mochte, Lu war davon erschüttert.
»Außerdem«, fügte sie hinzu, »wenn ihr irgendeine Chance haben wollt, ihn zu besiegen, werdet ihr eine Kontaktperson in seiner Nähe brauchen. Nero muss glauben, dass ich versucht habe, euch aufzuhalten, dass es mir nicht gelungen ist und dass ich dann mit eingezogenem Schwanz zu ihm zurückgekehrt bin.«
»Aber …« Ich hatte inzwischen zu viel Wasser im Gehirn, um irgendeine weitere Frage zu formulieren. »Egal. Du kannst uns das erklären, wenn wir einen trockenen Ort gefunden haben. Und apropos trocken …«
»Ich hab eine Idee«, sagte Meg.
Sie lief zum Ende des Durchgangs. Lu und ich stapften schwappenden Schrittes hinter ihr her. Die Straßenschilder an der nächstgelegenen Ecke teilten uns mit, dass wir die Kreuzung Lexington und Seventy-Fifth erreicht hatten.
Meg grinste. »Siehst du?«
»Was soll ich sehen?«, fragte ich. »Was willst du damit …«
Was sie meinte, traf mich wie ein Zugwaggon. »Oh nein«, sagte ich. »Nein, die haben genug für uns getan. Ich werde sie nicht wieder in Gefahr bringen, schon gar nicht, wenn Nero uns verfolgt …«
»Aber letztes Mal hattest du doch nichts dagegen, dass …«
»Meg, nein!«
Lu ließ ihren Blick zwischen uns hin und her wandern. »Worüber redet ihr hier?«
Ich hätte gern meinen Kopf in den Rucksack gesteckt und geschrien. Vor sechs Monaten hatte es mir keine Gewissensbisse bereitet, einen alten Freund aufzusuchen, der hier ein paar Straßen weiter wohnte. Aber jetzt … nach allen Anstrengungen und allem Kummer, den ich an jeden Ort gebracht hatte, an dem ich aufgenommen worden war … nein. Das konnte ich einfach nicht mehr tun.
»Anderer Vorschlag.« Ich zog den Pfeil von Dodona aus meinem Köcher. »Wir fragen meinen prophetischen Freund. Der hat sicher eine bessere Idee – vielleicht ein paar gute Sonderangebote von Hotels.«
Ich hob mit zitternden Fingern das Geschoss. »Oh großer Pfeil von Dodona …«
»Redet der mit dem Pfeil?«, fragte Lu an Meg gerichtet.
»Der redet gern mit leblosen Gegenständen«, erklärte Meg. »Tu ihm den Gefallen und spiel mit.«
»Wir brauchen deinen Rat«, sagte ich und unterdrückte den Drang, Meg gegen das Schienbein zu treten. »Wo sollten wir Zuflucht suchen?«
Die Stimme des Pfeils summte in meinem Gehirn: Hießest du mich justament deinen Freund? Das schien ihm gefallen zu haben.
»Äh, ja.« Ich hob für meine Begleiterinnen den Daumen. »Wir brauchen einen Ort, wo wir untertauchen und unser weiteres Vorgehen planen können – irgendwo hier in der Nähe, aber geschützt vor Neros Überwachungskameras und überhaupt.«
Des Kaisers Undüberhaupt ist fürwahr ein arges Hemmnis, sagte der Pfeil zustimmend. Indes ist dir die Antwort auf diese Frage bereits bekannt, oh Lester. Spornstreichs begib dich nunmehr zum Heim des Siebenschichten-Dips!
Und mit diesen Worten verstummte das Geschoss.
Ich stöhnte vor Verzweiflung. Die Botschaft des Pfeils ließ an Klarheit nicht zu wünschen übrig. Ach, wie köstlich war doch der Siebenschichten-Dip unserer Gastgeberin! Ach, wie behaglich war diese gastfreundliche Wohnung! Aber es wäre nicht richtig. Ich durfte nicht …
»Was hat er gesagt?«, fragte Meg.
Ich versuchte, mir eine Alternative zu überlegen, aber ich war so müde, dass ich nicht einmal eine Lüge zustande brachte.
»Schön«, sagte ich. »Dann gehen wir eben zu Percy Jackson.«
4
Dieses Kind ist süß.
Mein Herz ist schon gebrochen.
Werd nicht noch süßer!
»Hallo, Mrs Jackson. Ist Percy zu Hause?«
Ich zitterte und tropfte auf ihre Türmatte, und meine beiden ähnlich jämmerlich zugerichteten Begleiterinnen standen hinter mir.
Einen Herzschlag lang stand Sally Jackson wie erstarrt in ihrer Tür, ein Lächeln im Gesicht, als ob sie eine Lieferung von Blumen oder Keksen erwartet hätte. Was wir nicht waren.
Ihre treibholzbraunen Haare waren von etwas mehr Grau durchwirkt als noch vor sechs Monaten. Sie trug zerfetzte Jeans, eine weite grüne Bluse und einen Apfelkompottklecks auf ihrem bloßen linken Fuß. Sie war nicht mehr schwanger, was vermutlich das Babykichern in ihrer Wohnung erklärte.
Ihre Überraschung legte sich rasch. Da sie einen Halbgott aufgezogen hatte, verfügte sie zweifellos über eine Menge Erfahrung mit dem Unerwarteten. »Apollo! Meg! Und …« Sie starrte unsere riesige tätowierte Zugbegleiterin mit der Irokesenfrisur an. »Hallo. Ihr armen Würstchen. Kommt rein und trocknet euch erst mal ab.«
Das Wohnzimmer der Jacksons war noch immer so gemütlich wie in meiner Erinnerung. Der Geruch von mit Mozzarella überbackenen Tomaten kam aus der Küche herübergeschwebt. Auf einem altmodischen Plattenspieler lief eine Jazz-Scheibe – ach, Wynton Marsalis! Mehrere behagliche Sofas und Sessel standen bereit, um sich hineinfallen zu lassen. Ich hielt im Zimmer Ausschau nach Percy Jackson, aber ich sah nur einen Mann mittleren Alters mit grau melierten Haaren, einer zerknitterten Khakihose, Backhandschuhen und einem rosa Oberhemd unter einer knallgelben, mit Tomatensoße bespritzten Schürze. Er ließ ein Baby auf seiner Hüfte auf und ab hüpfen. Der gelbe Strampelanzug des Babys passte so perfekt zu der Schürze des Mannes, dass ich mich fragte, ob die als Kombi geliefert worden waren.
Eigentlich boten der Koch und das Baby einen hinreißenden, herzerwärmenden Anblick. Leider war ich mit Geschichten über Titanen und Götter aufgewachsen, die ihre Kinder kochten und/oder verzehrten, deshalb war ich vielleicht nicht ganz so bezaubert, wie es zu erwarten gewesen wäre.
»Da ist ein Mann in Ihrer Wohnung«, teilte ich Mrs Jackson mit.
Sally lachte. »Das ist mein Mann, Paul. Entschuldigt mich für einen Moment. Ich bin gleich wieder da.« Sie lief in Richtung Badezimmer davon.
»Hallo«, Paul lächelte uns an. »Das ist Estelle.«
Estelle kicherte und sabberte, als wäre ihr Name der allergrößte Witz im ganzen Universum. Sie hatte Percys meergrüne Augen und offenbar das herzliche Wesen ihrer Mutter. Sie hatte zudem einen schwarz-silbernen Haarflaum wie Paul, was ich bei einem Baby noch nie gesehen hatte. Sie würde das erste Kleinkind mit Silberschläfen sein! Insgesamt hatte Estelle offenbar eine gute Genmischung geerbt.
»Hallo.« Ich war nicht sicher, ob ich Paul, Estelle oder das, was in der Küche kochte, ansprechen sollte; das in der Küche roch jedenfalls köstlich. »Äh, ich will ja nicht unhöflich sein, aber wir hatten gehofft – oh danke, Mrs Jackson.«
Sally war aus dem Badezimmer zurückgekehrt und wickelte Meg, Lu und mich in flauschige türkise Badetücher.
»Wir hatten gehofft, Percy hier zu sehen«, vollendete ich meinen Satz.
Estelle quietschte vor Begeisterung. Der Name Percy schien ihr zu gefallen.
»Das würde ich auch gern«, sagte Sally. »Aber er ist unterwegs zur Westküste. Mit Annabeth. Sie sind vor ein paar Tagen losgefahren.«
Sie zeigte auf ein gerahmtes Bild, das in der Nähe auf einem Beistelltisch stand. Auf dem Foto saßen meine alten Freunde Percy und Annabeth im verbeulten Prius der Familie und schauten lächelnd aus dem Fenster auf der Fahrerseite. Auf dem Rücksitz schnitt unser gemeinsamer Freund, der Satyr Grover Underwood, für die Kamera Grimassen – er schielte, streckte die Zunge schief heraus und machte mit den Händen Peace-Zeichen. Annabeth lehnte sich an Percy und hatte ihm die Arme um den Hals geschlungen, als ob sie ihn küssen oder vielleicht auch erwürgen wollte. Percy saß hinter dem Lenkrad und hob die Daumen. Er schien mir damit zu sagen: Wir sind raus aus allem! Sieh zu, wie du mit deinen Einsätzen oder was auch immer fertigwirst!
»Er ist mit der Highschool fertig!«, sagte Meg, als hätte sie hier soeben ein Wunder miterlebt.
»Das ist er«, sagte Sally. »Es gab sogar einen Kuchen.« Sie zeigte auf ein Foto von Percy und ihr, auf dem sie strahlend einen babyblauen Kuchen mit einem Text aus dunkelblauem Zuckerguss hochhielt: GLÜCKWUNSCH, PERCY, ZUM EXMAEN! Ich fragte nicht, warum »Examen« falsch geschrieben war, denn Legasthenie war in Halbgottfamilien weit verbreitet.
»Dann«, ich schluckte, »ist er gar nicht hier.«
Das war eine blödsinnige Bemerkung, aber irgendein sturer Teil von mir bestand darauf, dass Percy Jackson hier irgendwo sein musste und nur darauf wartete, für mich gefährliche Aufgaben ausführen zu können. Dazu war er schließlich da!
Doch halt. So hätte der alte Apollo gedacht – der Apollo, der ich bei meinem letzten Besuch in dieser Wohnung hier gewesen war. Percy hatte ein Recht auf sein eigenes Leben. Und – ach, die bittere Wahrheit! – mit mir hatte das nichts zu tun.
»Das freut mich für ihn«, sagte ich. »Und für Annabeth …«
Dann fiel mir ein, dass sie vermutlich unerreichbar waren, seit sie New York verlassen hatten. Mobiltelefone zogen zu viel Monster-Aufmerksamkeit an, deshalb konnten Halbgötter keine benutzen, schon gar nicht, wenn sie mit dem Auto unterwegs waren. Die magischen Kommunikationsmittel wurden zwar nach und nach wieder aktiviert, seit wir Harpokrates befreit hatten, den Gott der Stille, aber sie waren noch immer unzuverlässig. Percy und Annabeth hatten vielleicht gar keine Ahnung von den Tragödien, die wir an der Westküste erlebt hatten – in Camp Jupiter und davor in Santa Barbara …
»Ach du meine Güte«, murmelte ich vor mich hin. »Das bedeutet ja, sie wissen noch gar nicht …«
Meg hustete lärmend und warf mir einen wütenden Halt-die-Klappe-Blick zu.
Natürlich. Es wäre grausam, Sally und Paul mit der Nachricht zu belasten, dass Jason Grace nicht mehr lebte, vor allem, wo Percy und Annabeth unterwegs nach Kalifornien waren und Sally sich sicher ohnehin schon genug Sorgen um sie machte.
»Was wissen sie noch nicht?«, fragte Sally.
Ich schluckte mühsam. »Dass wir nach New York kommen wollten. Egal. Wir wollten nur …«
»Genug geplaudert«, fiel mir Lu ins Wort. »Wir sind in großer Gefahr. Diese Sterblichen können uns nicht helfen. Wir müssen weiter.«
Lus Tonfall war nicht direkt verächtlich – nur gereizt, und vielleicht besorgt um unsere Gastgeber. Wenn Nero uns in dieser Wohnung ausfindig machte, würde er Percys Familie nicht verschonen, nur weil sie keine Halbgötter waren.
Andererseits hatte uns der Pfeil von Dodona schließlich hergeschickt. Das musste einen Grund haben. Ich hoffte, dass es etwas damit zu tun hatte, was Paul kochte.
Sally musterte unsere hochgewachsene tätowierte Freundin. Sie sah nicht beleidigt aus, sondern eher, als ob sie an Lu Maß nahm und überlegte, ob sie irgendwelche Kleider hatte, die ihr vielleicht passen könnten. »Na, ihr könnt hier nicht triefnass weggehen. Wartet wenigstens, bis ich ein paar trockene Sachen für euch gefunden habe, und esst noch was mit uns, falls ihr hungrig seid.«
»Ja, bitte«, sagte Meg. »Ich liebe dich.«
Estelle prustete wieder munter los. Sie hatte offenbar soeben entdeckt, dass ihr Vater mit den Fingern wackeln konnte, und nun wollte sie sich ausschütten vor Lachen.
Sally lächelte zuerst ihr Baby an und dann Meg. »Ich liebe dich auch, mein Schatz. Percys Freunde sind mir immer willkommen.«
»Ich hab keine Ahnung, wer dieser Percy ist«, sagte Lu verärgert.
»Alle, die Hilfe brauchen, sind hier willkommen«, korrigierte sich Sally. »Glaub mir, wir sind auch schon oft in Gefahr gewesen und haben es immer überstanden. Oder, Paul?«
»Klar«, stimmte er, ohne zu zögern, zu. »Zu essen haben wir auch genug. Und bestimmt hat Percy irgendwelche Kleider, die – äh, Apollo, ja? – passen würden.«
Ich nickte düster. Ich wusste nur zu gut, dass Percys Sachen mir passten, denn ich war vor sechs Monaten in seinen abgelegten Klamotten von hier aufgebrochen. »Danke, Paul.«
Lu grunzte. »Ist das Lasagne, was ich da rieche?«
Paul grinste. »Das Blofis-Familienrezept.«
»Hm. Ich glaube, ein bisschen können wir noch bleiben«, entschied Lu.
Wunder gibt es eben immer wieder. Die Gallierin und ich waren einer Meinung!