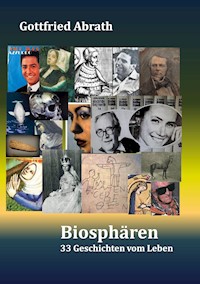Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Zeitreise
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Der Roman beschreibt die Begegnung zwischen einem holländischen Juden und einem deutschen Pfarrer in einem Zugabteil im März 1944. Der Zug wird bombardiert und führt die Reisenden in eine abenteuerliche Flucht. Äußerlich eine hochspannende Verfolgungsjagd zwischen Gestapo und den Reisenden, in den Zwischenräumen Gespräch und Annahme. Die Theologie des christlich-jüdischen Gesprächs kommt menschlich nah. Die Adoption ist der erste Roman einer Trilogie, von der 2015 der zweite Teil "Der AugenBlick" veröffentlicht wurde: ISBN 9 783734 746758
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 204
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dem Niklas, der Dies lesen möge
und
dem Bernhard, der mich Jenes lesen hieß
Wermingsen, 3., überarbeitete Auflage 2017
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Quellennachweis
Nachwort
1
17.März 1944, Abend
Die Stimme klang anders. Es war nur eine leicht veränderte Betonung gewesen, eine winzige Unruhe, die sich durch den Hörer hindurch bemerkbar gemacht hatte, doch Blum war vorgewarnt. Lange genug kannte er Konzelmann, solche Nuancen zu unterscheiden.
Es war nicht die späte Stunde, die ungewöhnlich für diesen Pedanten war. Aber die Anrufe sonst waren beiläufiger, so wie eine etwas unbestimmte Abmachung und in letzter Zeit eigentlich auch werbender, symbolisiert durch die kleinen Sahnetörtchen, die sie ihm jetzt gelegentlich servierten. Denn sie wussten genau, dass sie ohne ihn nicht weiter kamen. Er hatte mit seinem Plan eine Fährte gelegt, der sie folgten wie ausgehungerte Wölfe.
Blum trat ans Fenster und sah auf die dunkle Straße hinaus.
Nichts. Nur ein leiser Regen wehte gegen die Scheibe.
Hatte er den Bogen überspannt? Waren sie endlich darauf gekommen, dass sie durch ihn zum zweiten Mal hinters Licht geführt worden waren und zwar auf eine Weise, die in ihren Augen einer Majestätsbeleidigung gleichkam? Wenn sie nur eine Spur davon ahnten, wären sie nicht schon lange hier? Vielleicht warteten sie noch ab, um an die Hintermänner zu kommen. Ihn überkam Heiterkeit. Hintermänner, die es nicht gab, weil alles eine Phantasieleistung des Dr. Victor Blum war, die der Gestapo schlicht unvorstellbar bleiben musste.
Dann sah er sie. Sie standen an der Ecke zur Hertogenstraat, dicht an der Hauswand. Der eine hatte sich wohl eine Zigarette angezündet und verbreitete eine dünne Rauchfahne auf die leere, mondbeschienene Straße. Sah man genauer hin, nahm man die Bewegung eines Schattens wahr. Es wird nicht gemütlich sein, dort die ganze Nacht zu stehen!
Er musste weg. Das stand fest.
Wie lange schon hatte er diesen Tag herbeikommen sehen! Eigentlich war auch alles vorbereitet. Der falsche Pass lag längst bereit, sorgfältig verpackt und versteckt unter einer Platte im Garten: „Tristan Schaul“. Gewöhnungsbedürftig. Darauf musste er sich einstellen, den Namen sich einhämmern, damit er flüssig und ohne das geringste Zögern reagieren könnte. Eine Unzahl von Kontrollen war damit zu überstehen. Tristan – wer wohl sein Kind so nannte? Der Ausweis sei echt, hatte ihm sein Bekannter gesagt, ein Spezialist, der Originaldokumente so umzugestalten wusste, dass alles passte: Bild, Daten, Stempel.
„Mit dem Vornamen hast du keine Probleme“, hatte er ihm gesagt, auf die Wagner-Leidenschaft der Nazis anspielend.
Er riss sich zusammen. Die Zeit verstrich ungenutzt. Nur lähmte ihn eine unbekannte Kraft, die notwendigen Schritte zu tun. Jetzt konnte Blum es den Tausenden nachfühlen, die trotz all seiner Warnungen nicht geflohen waren, sondern einfach auf ihre Verhaftung gewartet hatten, bis sie abgeführt wurden zum Zug nach Westerbork.
Schwer, alles loszulassen! Lieber steckte man den Kopf in den Sand, ließ es einfach mit sich geschehen. Denn das Untertauchen in diesen Zeiten war ein Weg ins völlig Ungewisse, Gefährliche, eine einzige ungeheure Anspannung.
Dennoch war Blum entschlossen. Mit einem Ruck löste er sich vom Fenster. Dort drüben schien jetzt alles reglos und ruhig zu sein. Kein Mensch auf der nass glänzenden Straße.
Mechanisch packte er eine kleine Tasche zusammen. Nur keinen Koffer, viel zu auffällig. Es müsste aussehen wie ein später Pendler auf dem Weg nach Hause.
Noch einmal glitt sein Blick über die Bücherregale. Diese Vertrautheit ihres Nebeneinanders wie ein altes oft betrachtetes Gemälde: gerade das hatte ihm Heimat geschenkt in diesem umtriebigen Leben. Eigentlich undenkbar, diese wertvollen Werke zurückzulassen – wie eine Aufgabe der Identität. Was würde aus den Büchern werden? Zwar hatte er de Meng gesagt, dass er die alten, unersetzlichen Bibelkommentare im linken Regal unbedingt aufheben müsse, aber würde das gehen, nachdem die Gestapo seine Flucht festgestellt hatte?
Das Licht in der Küche würde er anlassen, um den Verdacht des Untertauchens zu dämpfen. Ein möglicherweise lebensrettender Vorsprung, wenn sie annähmen, er sei nur kurz weg.
Noch einmal ging er alles innerlich durch. Würde das Geld reichen? 300 Gulden waren nicht gerade wenig, aber auch schnell verbraucht. Eine größere Summe konnte verhängnisvoll sein im Falle, dass er durchsucht werden würde. Ein wenig Proviant, Brot, Käse. Es musste reichen. Irgendwie ging es immer weiter, wie nach einem undurchschaubaren Plan. Sein Blick blieb an der halbabgebrannten Kerze hängen. Eine Leuchte für nächtliche Stunden und wärmer, heimatlicher als alles Elektrische. Und Licht würde man brauchen in dem Dunkel, das vor ihm lag. Er steckte sie mit einer Schachtel Streichhölzer in die kleine Aktentasche.
Eine letzte Runde durch die zweieinhalb Zimmer.
Dann zog er behutsam die Tür ins Schloss und tastete im Dunkeln die Holztreppe hinunter. Ihr Knarren ließ ihn innerlich aufschreien. Er hielt inne. Doch blieb alles ruhig. Nur Musikgesäusel von irgendwo. Da saß wohl die alte Soestdijk eingenickt am Radio, ein beruhigendes Bild. Im Parterre alles still. Boswacht hatte Nachtschicht.
Vor der Eingangstür hielt er inne. Gleich käme es auf jede Bewegung an. Nur nicht zu nervös sein, das merkten Polizisten immer sofort. Abgerichtet wie Spürhunde, aber im Grunde ohne die Fähigkeit, die einfachsten Schlüsse zu ziehen. So normal wie möglich auftreten. Doch besser, diese Leute an der Straßenecke bemerkten ihn erst mal gar nicht.
Als er die Haustür öffnete, schlug ihm ein feuchter Windzug entgegen. Durch den halboffenen Spalt sah er in eine fast völlige Finsternis hinaus. Seit Kriegsbeginn lag das Land nachts in bedrückende Dunkelheit gehüllt, die aber auch Schutz bot. Mit geübtem Auge konnte man Schemen unterscheiden. Zudem erhellte der abnehmende Mond leicht die Szenerie. Er konnte Einzelheiten der Straße bis zur Kreuzung erkennen. Man müsste sich ganz links im Mondschatten halten und dann rasch hinter der Hausecke verschwinden.
Wieder das Zögern. Aber nur noch ein schwacher Impuls.
Wenige Sekunden später stand er am schmiedeeisernen Gartentor. Sein Quietschen war in der Straße unübertroffen. Nur jetzt keinen Lärm erzeugen in diese Stille hinein! Aber die beiden würden es nicht hören, wenn ein anderes Geräusch in der Nähe war.
Blum wartete angespannt in der Nische des Tores. Bis jetzt schienen sie noch nichts bemerkt zu haben.
Endlich polterte ein LKW durch die Straße.
Rasch öffnete Blum das Tor und schlüpfte in den Weg, der zum Garten hinter das Haus führte.
Er musste die Platten abzählen, um das Päckchen darunter wieder zu finden. Der Stein war unangenehm kalt und glitschig und er konnte ihn nur mit einiger Anstrengung vom Boden lösen. Darunter war alles unberührt. Blum entnahm der kleinen Teedose nur den Ausweis und das Geld und befestigte die Platte wieder neben den anderen.
Durch den Garten zu gehen war das Sicherste. Das gegenüberliegende Grundstück hatte einen gepflasterten Hinterhof mit einer kleinen Lagerhalle und war nur von einer brüchigen Backsteinmauer umgeben.
Im Garten erkannte Blum die vertrauten Umrisse des alten Apfelbaumes. Aus der Wohnung der Soestdijk fiel ein schwacher Lichtschein durch die offenbar beschädigte Verdunkelung. Sie konnte dafür Ärger bekommen.
Er tastete sich vorsichtig an die Mauer heran. Dicht daneben lag ein Stapel aus alten Latten, aufgeschichtetem Brennholz und einigem undefinierbaren Gerümpel. Er stieg behutsam auf den unsicheren Haufen und spähte über die Mauer. Alles ruhig.
Mühsam zog er sich hinüber. Blum bereute, dass er nicht trainierter war. An der anderen Seite hängend bedauerte er noch mehr, dass er sich nicht vergewissert hatte, was darunter lag. Es half nichts, er musste sich fallen lassen. Mit erheblichem Krach landete er auf einem kleinen Karren. Eine Schrecksekunde lang hielt er inne. Dann sprang er hinunter und lief über den kleinen Innenhof zu dem Bogen mit der Ausfahrt. Gut, dass er das Gelände kannte. Oft genug hatte er die Arbeiter von seinem Wohnzimmer aus beobachtet.
Aufatmend trat er auf den Aprikozenplein, als sei nichts geschehen. Eine winzige Spur sicherer.
2
18.März 1944, Morgen
Die zerknickten Ecken des Briefes standen in einem seltsamen Gegensatz zu dem feinen Büttenpapier, das inzwischen selten geworden war und Hesse sofort auffiel, als er den Briefkasten leerte. Flüchtig las er die schwungvolle Aufschrift mit seinem Namen, die ihn entfernt an längst vergangene Zeiten erinnerte. Er blätterte rasch die anderen Schreiben durch. Kein Brief von Franz. Einige offizielle Schreiben, eine Zeitschrift, sonst nichts. Enttäuscht nahm Hesse den kleinen Stapel mit in sein Arbeitszimmer und legte ihn auf dem Schreibtisch ab. Wenigstens wusste er den Jungen in einiger Sicherheit.
Seltsam, dieser Kerl beschäftigte seine Sinne viel mehr als der Ältere und das war von Jugend an so gewesen. Franz war im Sommer 1917 geboren, klein und schmal und hatte erst mit zwei Jahren laufen gelernt. Und dann die Lungenentzündung! All die Sorgen, die sie sich um ihn auch jetzt machten, mochten dort begründet sein. Und schließlich hatten sie ja auch allen Grund gehabt nach seiner Verwundung an der Ostfront. Eine Verwundung, die sich als phantastischer, wunderbarer Glücksfall entpuppte.
Hesse musste nun seine Gedanken auf das Krankenhaus in der Südstadt lenken, das heute seiner bedurfte. Wie viele hungrige Seelen mochten dort auf einen warten, der ihnen zuhörte, eine Weile dablieb, betete und sie segnete? Er machte sich zu Fuß auf den weiten Weg. Die Elektrische kam unregelmäßig und wenn, dann war sie meist überfüllt. Also los!
Ein scharfer Morgenwind wehte durch das weite Tal der Wupper. Von der Nordstraße bog er in die Markomannenstraße ein und wanderte dann über den Ölberg. Hier waren die Häuser stehen geblieben und fast war es wie früher, als die Bewohner ihre Stuben noch mit Petroleum beleuchteten.
Als Hesse 1920 nach Wuppertal gekommen war, begegnete ihm diese Stadt wie ein riesiger qualmender und verrußter Moloch voll gefährlicher Verkehrsverhältnisse. An die verrufenen Viertel, den Dreck, die bettelarmen Familien in den kleinen Stuben dachte er nur ungern zurück. Was für ein Gegensatz zu der ostfriesischen Idylle seiner Heimat! Aber auch was für eine großartige Kirchengemeinde! Mit ihren Dutzend Pastoren und über 60.000 Mitgliedern war die reformierte Gemeinde in Elberfeld die größte Kirchengemeinde in Deutschland. Ein Zentrum religiöser Kultur mit den verschiedensten Einrichtungen. Gemeinsam hatten sie ein Predigerseminar und eine Hochschule aufgebaut für die Ausbildung des Nachwuchses. Und er selbst mittendrin als Herausgeber der Wochenzeitung und Verwalter der Bibliothek! Ein heftiger Schmerz durchfuhr ihn bei diesen Gedanken. Seine geliebte Bibliothek! 18.000 Bände von einzigartigem Wert, Unikate, all das war den Flammen zum Opfer gefallen in einer einzigen, furchtbaren Nacht. Noch kein Jahr her.
Während er in Richtung Südstadt weiter zog, stiegen die Bilder der Katastrophe in ihm auf.
Es ist kurz nach Mitternacht, Sirene, Voralarm, dann Vollalarm, zum tausendsten Mal ein Gerenne, Hasten in den Keller. In der letzten Zeit angespannter, denn alles wartet nun, dass Elberfeld ´dran´ ist. Viele sind aufs Land verreist mit Sack und Pack. Kaum unten, hört man es nahen. Ein Brummen des Himmels – sie kommen! Man spürt an irgendetwas den Unterschied. Die Katastrophe. Überall leuchtende „Tannenbäume“. Die Helligkeit plötzlich, so ungewohnt. Namenlose Angst. Das Heulen herabstürzender Bomben. Jede wird töten und töten. Nicht hinhören, einfach nicht mehr denken! Ein Krachen. Überall. Berstende Einschläge, dröhnende Detonationen, ein ungeheures Hämmern. Das Abziehen der Flieger, man will aufatmen, denn lebt man nicht, steht nicht sogar das Haus!? Unheimliche Stille, in die langsam und da, da immer stärker ein heißer Wind hineingreift, es leuchtet wieder: Feuer! Haushoch wachsen die Brände, vom Wind vorangetrieben, eine Wand des Todes, bis sich schließlich der ganze Himmel glutrot einfärbt.
Sie sehen das alles durch das Kellerfenster. Zum Glück ist die eigene Straße noch verschont. Die ganze Zeit über hält er die Hand der zitternden Alten, die schon wenig zuvor in Barmen die Zerstörung erlebt hat. Sie haben sie als Ausgebombte aufgenommen.
Später machen sie sich auf, er und Tudi, durch die brennende Stadt, von einer Straße zur nächsten. Wo sind all die lieben Leuten aus der Gemeinde, die in den brennenden Häusern wohnten? Viele begegnen ihnen weinend, andere bleiben verschwunden. Verschwunden auch sein Kollege Bonn – dieser so schätzenswerte, demütige Mann – verschollen tagelang, schließlich wird er schwer verletzt unter den Trümmern geborgen. Wie furchtbar die Särge, die auf dem Marktplatz aufgestapelt stehen, und er soll noch tröstende Worte finden!
Er konnte es nicht abschütteln. Die Straße mit den hohen Häuserfluchten aus der Gründerzeit, die hier verschont geblieben waren, neigte sich deutlich dem Tal zu, schneller sein Gang, es zog ihn der Zerstörung entgegen.
An der Ecke hielt ihn eine alte Inschrift auf dem Sims für einen Moment fest: „Meine Hoffnung ist auf Gott gestellt, drum acht ich nicht die Ungunst dieser Welt.“
Das fromme Wuppertal lässt grüßen. Kann man heute noch so reden? Wie hatte er sich selbst nach dem Bombenangriff an einen ganz anderen Satz geklammert: „Zuflucht ist bei unsrem Gott“. Die letzte Zuflucht aus dem Schrecken. Rettung in der anderen Welt, die kein Krieg zerstören kann. So hatte er gepredigt am Sonntag danach in der großen Friedhofskirche. Sie steht noch. Aber ihre riesigen Rosetten sind sämtlich zerborsten. Zuflucht. – Gern will man sich verkriechen vor dem Inferno, das alles vernichtet, was gestanden hat, gestanden länger als man denken kann.
Inzwischen war er am Tippen-Tappen-Tönchen, einem dieser typischen Treppchen angekommen und überblickte nun die Innenstadt Elberfelds. Wehmütig schaute Hesse in die Richtung der alten reformierten Kirche. Das Mutterhaus aller anderen Kirchen Wuppertals, jetzt ein trauriger Trümmerhaufen einstiger Herrlichkeit. Seit über 250 Jahren hatte sie mitten in der Stadt gestanden und Menschen gesammelt. Was für frohe Zeiten, als sie die neuen Glocken wieder einweihen durften nach dem Weltkrieg und wohl über zweitausend Menschen in der Straße standen und sich mit ihm freuten über die neuen Klänge. Welch ein erhebendes Gefühl: auf ihrer Kanzel über der Menge zu predigen. Von da aus hatte schon der alte Krummacher die Gemeinde gemahnt.
All das war nun kaputt, zerschlagen, in Schutt und Asche versunken. Hier wie überall in Deutschland ging eine uralte Kultur zugrunde. Er spürte die Tränen aufsteigen und wandte sich ab.
Erst später, beim kargen Mittagessen kam die Rede wieder auf den Brief. Auch Tudi hatte nach Post von den Kindern Ausschau gehalten:
„Nichts von Carl Moritz?“
„Wo denkst Du hin? Der hat doch jetzt wohl keine Zeit, Briefe zu schreiben.“ Der ältere Sohn der Hesses war Major bei einer Wehrmachtsstelle in Berlin, die sich mit höchst geheimen Aufgaben beschäftigte. Seine Eltern ergingen sich öfter in den verrücktesten Vermutungen, was der etwas nüchterne, gerade 31jährige Sohn wohl für kriegswichtige Aufgaben zu bewältigen habe.
„Aber von Franz müsste jetzt bald mal was anlangen“, meinte Tudi in ihrem etwas steifen Lübecker Tonfall, indem sie die leere Suppenschüssel abtrug.
„Ach, du weißt doch, wie lahm die Zustellung geworden ist. Und auch Thüringen ist ja nicht um die Ecke. Aber warte, da war noch ein recht vornehmer Brief.“
Hesse ging ins Nebenzimmer und nahm das Kuvert mit der altmodischen Handschrift aus dem Stapel vom Schreibtisch. Nun sah er sofort die kleine holländische Marke, diesem so kleinen und doch wirksamen Emblem der Erinnerung an frühere Reisen. Und so öffnete sich ihm bei diesem Anblick die Erinnerung verbunden mit einer tief empfundenen Freude. Das konnte doch nur von Willem und Ida sein! Wann war die letzte Nachricht von dort gekommen? Irgendwann im Sommer 1940, nach dem Einmarsch der deutschen Truppen. Die Karte hatte er als Lesezeichen aufgehoben: „Wir leben noch, in dieser wahnsinnig gewordenen Welt“. So hatte der einzige Satz darauf gelautet.
Holland war für Klugkist Hesse wie eine besonders vertraute Kindheitsmelodie. Schon im vorigen Jahrhundert war der Onkel nach Den Haag gezogen und hatte bei der Regierung gearbeitet. In den Vorkriegsjahren waren von dort immer wieder kleine Päckchen gekommen mit Butter und Schokolade.
In plötzlicher Sorge öffnete Hesse das Schreiben. Ihnen wird doch nichts passiert sein!?
Erleichtert las er die etwas umständliche Einladung, bei der er amüsiert feststellte, dass sein Onkel Willem de Kooy den vornehm steifen Stil der Residenzstadt beibehalten hatte. Er erinnerte immer an die Nähe der Königsfamilie. Doch der Text war gedruckt und ohne persönliche Worte.
„Es ist eine Einladung von Willem und Ida. Sie feiern Goldene Hochzeit. Dass sie an uns gedacht haben! War aber lange unterwegs. Es soll schon am 23. sein.“
Den aufblitzenden Gedanken, die Einladung anzunehmen verwarf Hesse sogleich. Eine anstrengende Woche voller Termine erwartete ihn.
Später beim Tee, dieser so wertvoll gewordenen Kostbarkeit, auf die Hesse als Ostfriese kaum verzichten konnte, kam Tudi darauf zurück.
„Na ja, ich komme ja jetzt gar nicht weg, aber dir täten doch ein paar Tage woanders mal sehr gut. Du solltest überlegen, ob du nicht fährst, Klugkist“, meinte sie nachdenklich.
„Unmöglich, Tudi. Denk doch nur an die Reiseverhältnisse.“ Erst mit gewissem Abstand arbeitete die Frage noch einmal in ihm. Und diesmal tiefer: Wer weiß schon in solchen Zeiten, ob man sich noch einmal wiedersieht. Muss man da nicht gegenhalten, gegen all die menschliche Trennung, gegen den Wahnsinn, über die Grenzen hinweg? Eine tiefe Sehnsucht, spürbar aus dem Glanz vergangener Zeiten schöpfend, ergriff ihn noch tief in der Nacht. Einmal zurückkehren, nachgehen der Erinnerung, dem Frieden, die Lustigkeit und Jugend neu leben, wieder lachen, vielleicht auch weinen und derer gedenken, die nicht mehr da sind. Onkel Willem! Diese leise Ähnlichkeit an den früh verstorbenen Vater hatte Hesse immer angerührt. Und der Humor, die großzügige Freundlichkeit. Ach ja, aber das ist ja nun wohl vorbei.
Wenig später beim ersten Voralarm, auf dem Weg in den Keller, hielt Hesse Tudi für einen Moment am Arm fest. Mitten in das Geheul der Sirenen hinein sagte er: „Du hast recht, ich fahre hin.“
3
22.März 1944, Abend
Feuchtkalter Nebel lag über den Gleisen, der dem dunklen Abend eine zusätzlich abweisende Note verlieh. Eine Kulisse, die der Situation des Untertauchens ein so passendes Bild gab, dem Verschwinden und plötzlichen Wiederauftauchen. Blum stand im Schatten eines Pfeilers auf einem fast leeren Bahnsteig des kleinen Bahnhofs nördlich von Arnheim.
Bis jetzt war alles gut gegangen. Er hatte die letzten Tage in der Veluwe verbracht. Eine sichere Adresse. Jeden Schritt hatte er schon monatelang zuvor genau geplant. Die Gestapo würde annehmen, dass er mit dem Zug ins Ausland geflüchtet sei. Ihre ganze Phantasie kreiste ja um Diamanten und Geld. Dabei gab es nichts davon. Aber sie würden die Fernzüge besonders in den ersten Tagen seines Verschwindens verschärft kontrollieren. Auf dem Land konnte er sich sicher fühlen, auch wenn er seinen Verfolgern so nah blieb.
Wie mochten Konzelmann und Romberg wohl reagiert haben, als sie merkten, dass er verschwunden war! Trotz seiner ernsten Lage musste er schmunzeln. Sie waren sich ihrer Sache so sicher gewesen, weil sie immer nur auf das Geld gesetzt hatten, das ihn selbst aber nicht interessierte. Das begriffen sie nicht. Aus diesem Grund würden sie auch annehmen, dass er über Belgien und Frankreich in die Schweiz zu gelangen versuchte. Wie oft hatte besonders Romberg davon gesprochen, dass man dort für die Nachkriegszeit vorsorgen könne mit einem Nummernkonto. Konzelmann war eher der korrekte Typ des preußischen Polizeibeamten. Aber auch er war von dem Gedanken an den Devisenreichtum der höheren zionistischen Kreise wie berauscht gewesen, weil dies dem deutschen Sieg diene, wie er immer betonte. Es war schier unglaublich, welch eine verdrehte Vorstellung diese kleinen Beamten von dem Einfluss und dem Vermögen des Judentums in der Welt hatten. Aber wen wunderte das, wo doch selbst die britische Regierung sich immer wieder von den Zionisten hatte beeindrucken lassen. Dabei hielten diese sich in Palästina nur knapp über Wasser.
Bevor Blum untergetaucht war, hatte er sogar noch das Warnsystem in Gang gesetzt. Eine kurze, scheinbar belanglose Notiz in Mestendonks Briefkasten: „Termin verschiebt sich. PLS“. Henk würde sofort die anderen gewarnt haben. Hoffentlich waren sie auch wirklich untergetaucht. Es hatte sich wieder und wieder gezeigt, dass man nur so überleben konnte.
PLS, ihr Kürzel für das ganze Projekt. Henk wusste damit, dass es um alles ging. Palästina-Sperre.
Eigentlich war es unglaublich einfach gewesen. In Blums Kanzlei waren seit Mitte 1942 immer mehr jüdische Klienten gekommen, die ihn um irgendwelche Papiere baten, die sie brauchten, um sich vor der drohenden Deportation sperren zu lassen. Zunächst hatte er hilflos dagestanden. Denn wie sollten sich die Behörden täuschen lassen?
Für das, was dann folgte, war ein eigenartiger Zufall ausschlaggebend gewesen. Er war in den Besitz eines schweizerischen Stempels gekommen, der unter dem Signet des Internationalen Roten Kreuzes die deutsche Umschrift trug: „Vorgesehen für den Austausch nach Palästina“. Dieser Stempel entstammte dem Nachlass eines Zionistenführers, der von der Schweiz aus die Emigration nach Palästina im Auftrag der Hilfsorganisation durchgeführt hatte. Schon vor dem Krieg war dieser Mann nach Arnheim gekommen und hatte Blum mehrfach aufgesucht, bis er plötzlich an einem Herzanfall starb. Blum hatte in Vertretung eines Notars die Testamentsabwicklung übernommen. Und eines Abends hatte die Haushälterin des Mannes ihm eine Schachtel vorbeigebracht mit der Bemerkung, dass er doch diesen Schreibkram wohl noch würde verwenden können. Er hatte fast alles weggeworfen, nur eben diesen Stempel nicht, der ihm originell erschienen war, obwohl er selbst wenig für die Zionisten übrig hatte.
Viel später kam die Zeit, als besonders die arbeitsfähigen jüdischen Männer in so genannte Arbeitslager geschickt wurden. Sie erhielten zunächst einen Aufruf, sich zur Musterung zu melden.
Er erinnerte sich noch genau an jenen Abend, als Jossel Levisohn zu ihm gekommen war, schier verzweifelt von der Aussicht auf dieses Lager. Der Mann hatte ihn geradezu bestürmt, mit beiden Händen an seiner Jacke gerissen und war dann weinend zusammen gesunken. Wie konnte er ihn beruhigen? Da hatte er gesagt, und es war, als wären die Worte ohne sein Zutun aus seinem Mund gekommen:
„Nun hören Sie schon auf, ich habe noch eine Möglichkeit.“
Natürlich hatte er Levisohn nicht mehr enttäuschen dürfen. Er ließ ihn im Nebenzimmer warten. Rückblickend sah er sich selbst wieder am Schreibtisch sitzen, den Kopf schwer auf seine Hände gestützt, immer wieder in sich hineinfragend: Was soll ich nur tun, was, was was!? In der Verzweiflung gegen diese quälende Grübelei hatte er sich dann zum Schreibmaschinentisch umgewandt und nach einigem Zögern rasch ein angebliches Schreiben der britischen Gouverneursverwaltung in Jerusalem aufgesetzt – es würde schwer sein, dies mitten im Krieg auf seine Echtheit zu überprüfen – , in dem bestätigt wurde, dass Jossel Levisohn als Staatsbürger der britischen Krone angesehen werde und für einen Austausch gegen deutsche Kriegsgefangene vorgesehen sei, nebst einer Zahlung von 10.000 Pfund Sterling an das Deutsche Reich, zahlbar im Moment der Übergabe. Blum war des Englischen durch einen Studienaufenthalt in Cambridge kundig genug, und es gelang ihm, dem Schreiben das Flair britisch-hoheitlicher Bürokratie zu verleihen. Als Krönung prangte darunter der Schweizer Stempel in Grün – der üblichen Farbe für die vom Transport Zurückgestellten. Zusätzlich hatte er es mit einem Aufdruck und Unterschrift aus seiner Kanzlei versehen: „Geprüft, Büro Rechtsanwalt Dr. V. Blum“. Natürlich konnte er keinen wirklichen Austausch organisieren. Es kam nur darauf an, Levisohn solange für einen Transport zu sperren, bis er untertauchen konnte. Seinem Tun zum Trotz begleitete ihn die ganze Zeit über der Gedanke: was du hier tust, ist Wahnsinn, der reinste Selbstmord. Doch als wolle er sich selbst daran hindern, das Schreiben wieder zu vernichten, war er rasch aufgestanden und hatte dem verblüfften Mann die Bescheinigung mit einigen eindringlichen Bemerkungen überreicht.
Gleich am nächsten Tag war Levisohn zum holländischen Arbeitsamt gegangen, welches die Zusammenstellung der Transporte organisierte. Deutlich verunsichert hatte der Beamte das Schreiben in die Hand genommen, überrascht die Brille nach oben geschoben und dann auffallend schnell einen eigenen Stempel hervorgezogen „GESPERRT“ mit der handschriftlichen Ergänzung „Palästina“. Levisohn wurde damit von jeglichem Arbeitseinsatz zurückgestellt und brauchte nicht ins Lager umzuziehen.
Blum wusste, dass die Briten in jedem Jahr eine gewisse Quote von Juden nach Palästina einreisen ließen. Es hatte in den vergangenen Jahren besonders um diese Frage beträchtliche Unruhen gegeben. Die Briten wollten die Quote der Genehmigungen gering halten, um die Araber nicht zu Verbündeten der Deutschen zu machen. Wer aber konnte bei den Deutschen schon prüfen, wie viele auf den britischen Listen standen? Und die niederländischen Behörden sahen nur die Stempel und glaubten erst einmal alles.
Jubelnd war Levisohn damals gekommen und hatte mit der Bescheinigung gewedelt. Blum hatte selbst nicht recht glauben können, dass es so einfach war. Eindringlich mahnte er Levisohn, so rasch wie möglich unterzutauchen und nur ja keinem zu erzählen, dass er nun vom Arbeitseinsatz freigestellt und gesperrt sei. Das könne unabsehbare Folgen haben.