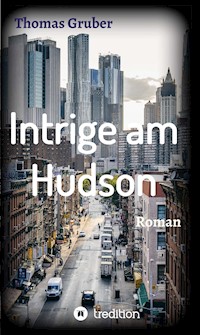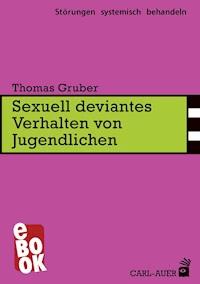6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Washington D.C., Zentrum der Macht. Hort für dubiose Geschäfte aller Art, verdeckte Einflussnahme und Treffpunkt macht- und geldgieriger Menschen. Manipulation ist alltäglich. Wer die Nase zu tief in die Angelegenheiten anderer steckt, lebt gefährlich. Was hat es mit der Akte Morgan auf sich und welche Rolle spielt John Chambers dabei? Verrat, Vertuschung, Mord und ruchlose Verbrechen führen von North Carolina über den Irak und Hawaii nach Washington D.C.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 681
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Die Akte Morgan
Thomas Gruber John-Chambers-Reihe
Buchbeschreibung:
Washington D.C., Zentrum der Macht. Hort für dubiose Geschäfte aller Art, verdeckte Einflussnahme und Treffpunkt macht- und geldgieriger Menschen. Manipulation ist alltäglich. Wer die Nase zu tief in die Angelegenheiten anderer steckt, lebt gefährlich. Was hat es mit der Akte Morgan auf sich und welche Rolle spielt John Chambers dabei? Verrat, Vertuschung, Mord und ruchlose Verbrechen führen uns von North Carolina über den Irak und Hawaii nach Washington D.C.
Über den Autor:
Thomas Gruber, Jahrgang 1968, lebt in der Region Basel und war über zwanzig Jahre in der Finanzbranche tätig. Seine Erfahrungen aus der Finanzwelt flossen in sein erstes Werk ("Intrige am Hudson", erschienen 2019) mit ein. In Teil 2 der John-Chambers-Reihe entdeckt er neue Seiten an sich: Verbrechen macht Spaß. Zumindest, wenn man darüber schreiben kann. Nach dem etwas ruhigeren Erstlingswerk geht es in "Die Akte Morgan" so richtig zur Sache.
Die Akte Morgan
Roman
Thomas Gruber
© 2025 Thomas Gruber
1. Auflage
Umschlaggestaltung: Zitronenzart Buchdesign (www.zitronenzart.com)
Unter Verwendung von: (c) khursheed/stock.adobe.com
Druck und Distribution im Auftrag des Autors:
tredition GmbH, Heinz-Beusen-Stieg 5, 22926 Ahrensburg, Deutschland
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist der Autor verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne seine Zustimmung unzulässig. Die Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag des Autors, zu erreichen unter: tredition GmbH, Abteilung »Impressumservice«, Heinz-Beusen-Stieg 5, 22926 Ahrensburg, Deutschland.
Kontaktadresse nach EU-Produktsicherheitsverordnung:
Wie alle meine Geschichten ist auch dieses Buch frei von KI und ohne Unterstützung von Ghostwritern entstanden.
ISBN Paperback
978-3-347-48586-0
E-Book
978-3-347-48588-4
Für die außergewöhnliche KB
Inhalt
Cover
Halbe Titelseite
Titelblatt
Urheberrechte
Widmung
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Epilog
Die Akte Morgan
Cover
Titelblatt
Urheberrechte
Widmung
Prolog
Epilog
Die Akte Morgan
Cover
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
Prolog
»Country Roads, Take me home, to the place, I belong…«1
Auf WTFX lief John Denvers berühmter Song, am Lenkrad seines Wagens sitzend sang Special Agent Adam Sato den Refrain laut mit. Seit Stunden saß er am Steuer, die Nacht war klar, der Interstate Highway nur wenig befahren. Die Scheinwerfer des Shelbys durchschnitten die Dunkelheit …
1 Songwriter(s): Denver John / Danoff Mary Catherine / Danoff William T
Kapitel 1
»Scheiße!«, fluchte John. Im wahrsten Sinne des Wortes. Beim Aussteigen hatte er eine Tretmine erwischt. Nichts Ungewöhnliches hier an der Upper East Side, wo sich die vermögenden Damen dekorative Vierbeiner hielten, mit denen sie jedoch nicht selbst ihre Runden drehten, sondern mäßig bezahltes Personal damit beauftragten. Und dessen Motivation, die Hinterlassenschaften der Hunde zu beseitigen, hielt sich in Grenzen. Ein stadtbekanntes Problem. Es gab zwar überall diese speziellen Mülleimer samt kostenlosen Plastiksäckchen für die fachgerechte Entsorgung des Hundedrecks, aber einmal mehr hatte jemand keinen Gebrauch dieses nicht bloß gut gemeinten Angebotes gemacht. Der Geruch, der John entgegenströmte, war äußerst penetrant und unangenehm. Und der Zeitpunkt für dieses Missgeschick suboptimal. Einen optimalen Moment für so ein Malheur gab es zwar nie, aber ausgerechnet jetzt war Hundekot an den Schuhen das Letzte, was er brauchte.
John schaute sich suchend um. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite entdeckte er ein Café. War das seine Rettung? Nachdem er mittels eines am Straßenrand gefundenen Ästchens die gröbsten Spuren des Malheurs beseitigt hatte, überquerte er die Fahrbahn und betrat die Lokalität. Nur wenige Tische waren besetzt, die Bedienung lehnte gelangweilt am Tresen. Er begab sich zu der jungen Dame und bestellte einen doppelten Espresso. Nicht etwa, weil er beabsichtigte, das aromatische Heißgetränk zu sich zu nehmen, sondern aus Höflichkeit und Respekt dem Personal gegenüber. Sein einziges Interesse galt dem Waschraum, dessen Zugang am hinteren Ende des schlauchförmigen Raumes lag und den er ohne Zeitverzug aufsuchte. Zu seiner Überraschung war dieser nicht nur äußerst sauber, sondern verfügte zum Glück über einen dieser nicht nur aus wirtschaftlichen Gründen etwas aus der Mode gekommenen Papierhandtuchspender. Und nicht etwa über eines dieser neumodischen Warmluftgebläse, dessen Luftstrom die Bakterien im Verlauf des Trocknungsprozesses nicht nur umgehend wieder auf die frisch gewaschenen Hände blies, sondern die Keime auch gleich durch den ganzen Raum wirbelte. Ohne Papiertücher wäre es ihm schwerer gefallen, die unangenehme Angelegenheit mit chirurgischer Präzision zu bereinigen.
Nach wenigen Minuten sahen seine braunen Budapester wieder akzeptabel aus. Bei seinem edlen Schuhwerk handelte es sich um an der Jermyn Street in London maßgefertigte Exemplare, das Paar hatte über 5‘000 britische Pfund gekostet. Beim Hinausgehen zahlte er und gab der Bedienung ein großzügiges Trinkgeld. Den Espresso trank er nicht, denn es war höchste Zeit, sich auf den Weg zu seinem Treffen zu begeben. Unterwegs fiel ihm Anika ein. Irgendwie vermisste er sie.
Lautes Gehupe und wütendes Gefluche holten ihn schlagartig in die Gegenwart zurück. Ohne die dezidierte Vollbremsung des Taxifahrers hätte es einen auf sein Smartphone fokussierten Jaywalker, der wenige Meter neben dem Zebrastreifen die Straße überquerte, erwischt. John schüttelte den Kopf: Schon wieder so ein Kamikaze-Fußgänger, dachte er. Von diesen gab es eine beachtliche Anzahl in New York, einer Stadt, in welcher viele Menschen das Rotlicht einer Ampel für eine gut gemeinte Empfehlung hielten und es deshalb nicht beachteten. In Manhattan war diese Art von Fußgänger für Autofahrer eine echte Plage.
Wie die meisten anderen Passanten wartete John geduldig, bis die Fußgängerampel die Straße zur Überquerung freigab. Auf der Höhe des Mount-Sinai-Spitals überquerte er die geschäftige Fifth Avenue und betrat die große Parkanlage. Die grüne Lunge der Stadt war zu dieser Tageszeit gut besucht. Zahlreiche Jogger drehten ihre Runden, Mütter verschafften ihrem im Kinderwagen sitzenden Nachwuchs frische Luft, auf den Wiesen wurde Frisbee und Football gespielt. Vereinzelt hatte man es sich auf Decken liegend auf dem gepflegten Rasen bequem gemacht. Die übliche Betriebsamkeit im Central Park bei sonnigem und trockenem Wetter.
Ein laut keuchender Läufer überholte John, der dabei unweigerlich an den in der Stadt am ersten Wochenende im November stattfindenden Marathonlauf erinnert wurde. Bereitete sich der eine oder andere hier auf diesen sportlichen Großanlass vor? Wie es schien, lockte kühleres Wetter vermehrt wieder Läufer und Spaziergänger in die bedeutendste Grünanlage der Stadt. Der Sommer verabschiedete sich gemächlich, was am Tag nach Labor Day keine große Überraschung für die Bewohner der Weltstadt war. Das lange Wochenende um den ersten Montag des Septembers bedeutete das inoffizielle Ende des Sommers und der Reisesaison. Die Menschen kehrten zurück nach Manhattan, die Kinder zur Schule, die Erwachsenen an ihre Arbeitsplätze und zu ihren Geschäften.
John hatte einen erfreulichen und angenehmen Sommer zugebracht. Nicht allein wegen des sonnigen und meist trockenen Wetters, sondern vor allem, weil er erstmals seit seiner Jugend wieder acht Wochen am Stück in den Hamptons verbracht hatte. Er verband den Landsitz auf Long Island mit prägenden Erinnerungen, da er in jungen Jahren viele unvergessliche Ferientage auf dem großzügigen Anwesen seiner Familie zugebracht hatte. Er liebte das weitläufige Haus, die entspannte Atmosphäre, die Nähe zum Strand und den Geruch des Meers. Diesen Sommer waren seine Eltern nicht wie üblich Mitte Mai, wie es Familientradition war, in die Hamptons gereist, sondern hatten ihre Pläne geändert und ihrem Sohn das Haus am Strand zur alleinigen Nutzung überlassen. Sein sich von einer Krebserkrankung erholender Vater zog den Aufenthalt im kühleren Lake Placid dem im Sommer rege besuchten und wärmeren Ostende von Long Island vor.
Acht lange Wochen hatten Anika und er das Landhaus genossen. Niemand hatte die Zweisamkeit getrübt. Das Leben an der dünn besiedelten Küste bot eine völlig andere Lebensqualität als der Alltag in der im Sommer überhitzten Metropole. Die Nächte in den Hamptons hatten es ihm besonders angetan. Nicht nur, weil er sie nicht allein verbracht hatte, sondern auch wegen der kühlenden Brise, die vom Meer zum Haus zog. Er liebte es, bei offenem Fenster zu schlafen, ein seltenes Vergnügen für jemanden, dessen Wohnung im lebhaften SoHo lag. Das entspannende Rauschen des Meeres hatte ihn jeden Abend in den Schlaf gewogen, das beruhigende und regelmäßige Geräusch klang wie Musik in seinen Ohren. Das monotone Brummen der Klimaanlage in seiner Stadtwohnung hatte er nicht vermisst. Für John bestand New York City im Wesentlichen aus Manhattan und dorthin war er nur gefahren, wenn es die Arbeit erfordert hatte. Was in zwei Monaten lediglich dreimal der Fall war. Wann immer möglich, führte er das Unternehmen per Videokonferenz. Aber nun war die erholsame Zeit zu Ende und er war nach Manhattan zurückgekehrt. Das entspannte Strandleben war Vergangenheit, die Hektik und das pulsierende Leben der Großstadt hatten ihn wieder.
Beim vereinbarten Treffpunkt unweit des North Meadow Softball Field Nummer 8 angelangt, blieb John stehen und betrachtete die schlichte Parkbank, der ein frischer Anstrich nicht geschadet hätte. Mit der linken Hand wischte er Blätter von der abgenutzten Sitzgelegenheit und nahm Platz. Weshalb hatte sein Kontakt genau diesen Treffpunkt vorgeschlagen? Was gab es zu bereden, was man nicht am Telefon besprechen konnte?
Derweil er da saß und wartete, beobachtete er die Umgebung. Wie es schien, hatten die Pflanzen die heißen Sommermonate im Park problemlos überstanden. Der Rasen sah gepflegt aus, die Bäume trugen noch immer ihre vollen Kronen. Die Menschen wirkten entspannt, schienen unbekümmert und stellten keine Bedrohung dar. Nach Einbruch der Dunkelheit würde er sich nicht allein und unbewaffnet hier hinwagen, aber zu dieser Tageszeit war es friedlich. John entspannte sich, seine Gedanken schweiften ab. Die Erinnerung an sein letztes Gespräch mit Anika flackerte auf.
Noch vor den Sommerferien hatte sie ihre Weiterbildung an der Columbia Law School abgeschlossen und somit die Chance, ihre neue Laufbahn in Angriff zu nehmen und sich zu beweisen. Trotz eines ansprechenden Starts bei Craine, Crawford & Lambert war sie kurz entschlossen zurück nach Großbritannien gereist, um dort ein Vorstellungsgespräch zu führen. Über ihre Beweggründe hatte sie nicht mit ihm gesprochen, weshalb John komplett im Trüben fischte. Sagte ihr der Job bei CCL auf einmal nicht mehr zu? Lag ihr etwa ein lukrativeres Angebot vor? Ihr Verhalten hatte ihn überrascht, immerhin handelte es sich bei CCL um eine große Kanzlei mit weltweiter Präsenz und tadellosem Ruf. John war im Londoner Büro zum Partner aufgestiegen, dort hatten Anika und er sich kennengelernt.
Ihre Abreise hatte ihn völlig überrumpelt. Keine 48 Stunden nachdem sie ihm ihren Entscheid mitgeteilt hatte, verabschiedeten sie sich am Flughafen voneinander. Er hatte sie selbst hingefahren, nicht, um sie umzustimmen, was er für aussichtslos gehalten hatte, sondern weil er es für angebracht hielt, sie dorthin zu begleiten. Womöglich waren es die letzten gemeinsamen Augenblicke. Ein merkwürdiges Bauchgefühl hatte ihn das annehmen lassen. Oder war es der Umfang ihres Reisegepäckes, der ihn vermuten ließ, dass sie nicht beabsichtigte, nur für einige Tage zu verreisen? Nahm man das Gewicht des aufgegebenen Gepäcks zum Indikator für ihre Absicht, so hatte alles darauf hingedeutet, dass sie ihn für immer verließ. Er rief sich den Abschied in Erinnerung, den flüchtigen Kuss und die Atmosphäre dieser Szene. Wenn es ihn denn tatsächlich gab, diesen schweren Duft von schlechtem Gewissen, dann hatte er in diesem Augenblick in der Luft gelegen. Auf dem Rückweg vom Terminal zum Parkhaus hatte er sich um ein Haar übergeben müssen.
Er realisierte, dass sein Glück zerplatzt war wie eine flüchtige Seifenblase. Gerade hatten sie unbeschwerte Tage am Meer verbracht, sie hatte glücklich und zufrieden gewirkt. Nichts hatte auf ihre Abreise hingedeutet. Hatte er sich getäuscht und Signale übersehen? Würde sie zurückkehren? Oder wenigstens den Mut haben, ihm reinen Wein einzuschenken? John war sich dessen nicht sicher.
Der geschäftsmäßig gekleidete Mann fiel ihm auf, er trug einen ungünstig sitzenden dunklen Anzug und eine schwarze Sonnenbrille. Er schaute sich immer wieder um, derweil er gemächlich in Johns Richtung spazierte. Nachdem er die Parkbank erreicht hatte, setzte er sich, ohne um Erlaubnis zu bitten.
»Mr Chambers.«
Das klang nicht wie eine Frage.
»Special Agent Doyle«, erwiderte John. Er legte eine kurze Pause ein, als wolle er seinen Worten mehr Wirkung verleihen, aber tatsächlich sammelte er bloß seine Gedanken. »Lange nicht gesehen. Wird das hier ein konspiratives Treffen, mitten am helllichten Tag im Central Park?«
John betrachtete den Ermittler des FBI und bemerkte, dass dieser seit ihrer letzten Begegnung merklich abgenommen hatte. Was den unzulänglich sitzenden Anzug erklärte. Aus Höflichkeit verkniff er sich eine entsprechende Bemerkung.
Doyle sah seinen Gesprächspartner nicht an, dieser bemerkte gleichwohl das verschmitzte Lächeln.
»Konspirativ ist das nicht, hier in aller Öffentlichkeit. Es gibt darüber hinaus keinen Grund, unsere Bekanntschaft zu verheimlichen. Zudem wird es dafür wohl auch zu spät sein.«
»Da ist was dran«, antwortete John.
Die Medien hatten ausführlich über den Fall berichtet. Tagelang. Ihre Namen waren immer wieder genannt worden. Ein gefundenes Fressen für die Presse, da der Erbe eines bedeutenden Vermögens, Träger eines stadtbekannten Familiennamens, in eine unschöne Angelegenheit involviert war. Da John die Ermittlungen ausgelöst und als Zeuge der Anklage aufgetreten war, hatte es dann doch nicht für die fettesten Schlagzeilen gereicht. Weshalb das Medieninteresse rasch wieder erloschen war. In der Haftanstalt landete nicht der Milliardär, sondern dessen gesetzesloser Mitarbeiter.
»Undercover könnten Sie nun nicht mehr arbeiten«, bemerkte John.
Doyle nickte. »Da haben Sie recht. Für den Job bin ich verbrannt.« Was ihn nicht weiter störte, denn verdeckte Ermittlungen waren nicht seine Sache: zu umständlich, zu gefährlich, zu lange Abwesenheiten von zu Hause. »Ich hielt es für angebracht, Sie persönlich zu informieren«, sagte er.
»Hier?«, fragte John.
»Wände haben manchmal Ohren«, erwiderte der Bundesagent.
»Ihre oder meine?«, erkundigte sich John.
»Meine.«
John nahm es schweigend zur Kenntnis.
Doyle drehte den Kopf und schaute seinen Gesprächspartner an. »Es gibt da einige Themen, die mich umtreiben.«
»Na dann lassen Sie mal hören, wo der Schuh drückt.« Johns Interesse war geweckt.
»Zuerst einmal möchte ich mich bei Ihnen bedanken.« Bevor John in der Lage war, darauf etwas zu entgegnen, erhob Doyle die Hand. »Vermutlich möchten Sie mir sagen, dass Sie nichts mit der Versetzung nach Washington D.C. zu tun haben.« Doyle lächelte. »Das würde ich Ihnen aber nicht abnehmen. Nachdem mir meine Vorgesetzte erzählte, dass sich Senator Nicholson, der Vorsitzende des Justizausschusses, für mich eingesetzt hat, war mir sofort klar, wem ich das zu verdanken habe. Es ist mir etwas unangenehm, denn es bringt mich in eine verzwickte Lage: Ich schulde niemandem gerne einen Gefallen. Sie wissen ja: Quid Pro Quo. Aber Sie haben etwas zugute bei mir. Weshalb haben Sie sich für mich eingesetzt?«
John sah seinen Gesprächspartner an und musterte ihn. Dann zuckte er mit den Schultern. »Ich könnte Ihnen eine nette Geschichte auftischen, aber es ist ganz einfach. Ich traf den Senator zum Lunch, wir unterhielten uns über Gott und die Welt und irgendwann erwähnte er, er sei auf der Suche nach einer geeigneten Person für einen gewissen Posten. Ob ich jemanden kenne, der Aufgabe gewachsen sei. Da fiel mir Ihr Name ein. Ich hoffe, Sie sind nicht enttäuscht über meine Ehrlichkeit. Und die Banalität.«
Doyle lächelte. »Ganz so dramatisch ist es ja nicht. Auf jeden Fall handelt es sich nicht um eine Strafversetzung. Zudem ist es doch erfreulich, dass Ihnen mein Name zum richtigen Zeitpunkt einfiel. Gleichsam eine glückliche Fügung. Meine Frau ist begeistert und freut sich auf den Umzug!«
»Tatsächlich?«, fragte John, der Mühe hatte, sich vorzustellen, dass jemand gerne nach Washington D.C. zog, selbst wenn es der Karriere förderlich war.
Doyle nickte und sah sein Gegenüber dabei an. »Sie stammt aus Maryland, der Job in D.C. bringt uns näher zur Verwandtschaft. Aber lassen Sie mich zum eigentlichen Grund unseres Treffens kommen.« Er setzte eine ernste Miene auf. »Es wird keinen Prozess geben.«
Der Ermittler des FBI ließ seine Worte wirken. Bevor John nachfragte, fuhr Doyle fort. »Die Staatsanwaltschaft hat einen Deal mit Ihrem ehemaligen Geschäftsführer gemacht. Steven Archer geht für sieben Jahre im Gefängnis, es besteht die Möglichkeit, dass er bei guter Führung nach der Hälfte der Strafe rauskommt.«
John nickte, was keinesfalls Zustimmung bedeutete. »Sieben Jahre für Betrug, Insiderhandel, Geldwäsche und die anderen Delikte sind keine übermäßig harte Strafe.« Dennoch war er nicht überrascht. Mit unvermuteten Wendungen war stets zu rechnen. Das Glück hatte den ehemaligen CEO der White Mountain Group nicht vollständig verlassen.
»Das sehe ich genauso«, sagte Doyle, »man hat Milde walten lassen. Er wird seine Strafe in einem Bundesgefängnis mit niedriger Sicherheitsstufe absitzen, vermutlich im sonnigen Arizona. Aber auf jeden Fall weit weg von zuhause. Ich kenne die Details der Vereinbarung nicht, aber es war eine ziemliche Überraschung für uns, dass der Staatsanwalt, der die ganze Zeit auf einen schnellen Prozess bestanden hatte, auf einmal auf einen Deal umgeschwenkt ist. Dabei hatte er uns gehörig Druck aufgesetzt, damit wir bei den Ermittlungen Gas geben. Denn ein Gerichtsverfahren vor den Wahlen versprach eine Menge Publicity. Und eine harte Strafe gegen einen hochangesehenen Manager hätte sich in der Außendarstellung gut gemacht.«
John nickte zustimmend. Er kannte die alte Masche. »Lässt sich das FBI denn von einem New Yorker Staatsanwalt unter Druck setzen?«, fragte er. Immerhin handelte es sich um eine übergeordnete Bundesbehörde.
»Das kommt manchmal vor. Leider spielt die Politik mittlerweile überall hinein.« Doyle kratzte sich am Hinterkopf. »Wissen Sie, was ich vermute?«
»Nein.« John schüttelte den Kopf. »Kaffeesatzlesen gehört nicht zu meinen Stärken.«
»Entweder irgendwer wollte um jeden Preis Aufmerksamkeit vermeiden und hat deshalb Druck ausgeübt. Ich meine jemanden, der in der Nahrungskette über dem Staatsanwalt steht.« Doyle räusperte sich. »Oder aber Archer hat dem Ankläger etwas gegeben, was diesem von Nutzen ist.«
»Klingt plausibel«, sagte John.
»Haben Sie eine Idee?«
John sah Doyle verwundert an. »Sie überschätzen meine Möglichkeiten! Genau genommen kenne ich Archer gar nicht so, wie mein Vater, der ihn eingestellt und lange Jahre mit ihm zusammengearbeitet hat. Ich habe keine Ahnung, weshalb sich die Staatsanwaltschaft auf einen Deal eingelassen hat. Dennoch ist es nachvollziehbar, denn in gewissen Situationen wird ein Vergleich durchaus als Erfolg betrachtet. Bedenken Sie nur, der Beschuldigte bekommt eine Strafe aufgebrummt – lassen wir einmal offen, ob sie gerecht ist oder nicht - aber der Staat spart sich einen langen und aufwendigen Prozess. Die Staatsanwaltschaft ist den Fall los und kann sich anderen Angelegenheiten zuwenden. Im Fall Archer war der Sieg dem Staatsanwalt sicher, im Baseball würde man das als ‚Home Run‘ bezeichnen. Und da demnächst gewählt wird: Es ist nicht auszuschließen, dass der Leiter der Strafverfolgungsbehörde vor den Wahlen noch etwas Spannenderes findet. Oder aber er hat schon einen knackigen und vielversprechenden Fall in der Pipeline.«
Doyle lächelte. Auf eine Art, die vermuten ließ, dass er dazu einen Grund hatte.
»Ach, deshalb sind Sie hier. Was hat er denn gefunden?«, fragte John nach.
»Ich bin mir nicht ganz im Klaren, was es bedeutet. Und gebe zu: Das ist nicht mein Spezialgebiet. Mein letzter Auftrag, bevor ich nach Washington versetzt werde, lautet, mit Ihnen zu sprechen. Der Generalstaatsanwalt hat mir gegenüber nicht alles offengelegt, sondern nur das, was ich brauche, um an Sie heranzutreten.«
Wenn sich der oberste Justizbeamte des Gliedstaates New York einschaltete, war davon auszugehen, dass es sich um etwas Bedeutendes handelte, dessen war sich John sicher. Er wartete geduldig, bis Doyle fortfuhr, was einen Augenblick dauerte.
»Haben Sie die Bezeichnung ‚Phantomgelder‘ schon einmal gehört?«
»Ist die Frage an den Anwalt oder an den gesetzestreuen Bürger gerichtet?«
»Macht das denn einen Unterschied?«, erkundigte sich der Ermittler.
»Aber sicher! Wenn Sie den Anwalt im Auftrag der Staatsanwaltschaft befragen, dann läuft ab jetzt die Uhr. Aus Verbundenheit berechne ich Ihnen lediglich 1’000 Dollar die Stunde.«
Doyle schluckte leer. Das überschritt sein Spesenbudget. Er rechnete nach. »Bei einem Arbeitstag von zehn Stunden und zwanzig Arbeitstagen pro Monat macht das 200‘000 Dollar! Verdienen Sie so viel?«
»Was meinen Sie, was Büroräumlichkeiten in dieser Stadt kosten? New York ist ein teures Pflaster! Außerdem ist das ein Freundschaftspreis. Eine Kollegin, Anwältin für Promischeidungen in Los Angeles, nimmt 1’500 Dollar die Stunde. Wenn es Ihnen lieber ist, können wir auch eine Tagespauschale vereinbaren.«
John fiel es schwer, ein Grinsen zu unterdrücken. Die hohen Stundenansätze wurden effektiv bezahlt, hatten aber gleichermaßen eine durchaus erwünschte abschreckende Wirkung auf weniger solvente Klienten.
»Sie nehmen mich auf den Arm, nicht wahr?« Doyle schaute seinen Gesprächspartner an und realisierte, dass dies nicht der Fall war. »Im Ernst: Ist irgendjemand bereit, so einen Stundenansatz zu bezahlen?«
»Klar doch! Mehr Leute, als man meinen würde. Es ist ja nicht so, dass ich mich mit Kleinkram beschäftige, sondern mit komplexen juristischen Fragestellungen. Bei denen meist hohe Summen auf dem Spiel stehen. Zudem ist Ihre Rechnung falsch. Denn ein Anwalt berät üblicherweise mehr als einen Mandanten, sonst wäre er von diesem einen Klienten wirtschaftlich abhängig und somit nicht mehr neutral. Denn letztlich muss Ihnen Ihr juristischer Berater ab und an mal Sachverhalte erläutern, die Ihnen unter Umständen nicht in den Kram passen. Hinzu kommt: Der übliche Arbeitstag eines Topanwalts dauert zwölf bis vierzehn Stunden, was beim FBI in Führungspositionen nicht anders sein wird. Und nur wenn ich persönlich für Sie tätig bin, kostet es Sie 1‘000 Dollar. Erledigen Mitarbeiter oder Assistenten etwas, gelangt ein tieferer Stundensatz zur Anwendung. Und zuallerletzt: Vergessen Sie nicht all die Kosten, die Kanzleien zu stemmen haben. Von der Miete für die repräsentativen und großzügigen Büroräumlichkeiten, über die Gehälter, Reinigung, Strom, Informatikaufwand et cetera. Bis hin zu den Steuern, die hier in New York City bekannterweise die höchsten in den gesamten USA sind. Diese Argumentation dürfte den Attorney General überzeugen.«
Doyle schien es kurz die Sprache verschlagen zu haben. Oder aber, er suchte schlicht nach den passenden Worten. »Arbeitstage von vierzehn Stunden sind bei Strafverfolgungsbehörden keine Seltenheit«, bestätigte er, um etwas Zeit zu gewinnen. »Nicht nur in Führungspositionen.« Er sprach aus eigener Erfahrung.
»Kein Wunder ist die Scheidungsquote so hoch«, erwiderte John trocken.
Doyle nickte. »Erstaunlich, dass es mich bis jetzt nicht erwischt hat. Aber bleiben wir doch beim Thema. De facto war die Frage an den Bürger gerichtet, oder, um es anders zu sagen, an den ehrenhaft aus dem Dienst entlassenen Lieutenant Commander.«
Das hatte John nicht kommen sehen. Er nickte anerkennend. »Ah, Sie appellieren an meine patriotischen Gefühle. Etwas peinlich, wenn der Staat, der einen beträchtlichen Teil meines Einkommens abzwackt, nicht einmal in der Lage ist, ein angemessenes Honorar für juristische Beratung zu bezahlen. Scheint übel um die Finanzen des Staates New York zu stehen. Oder hat man die Kosten Ihrer Behörde aufs Auge gedrückt?« John schmunzelte.
»Letzteres ist der Fall«, antwortete der Ermittler kleinlaut.
»Dann werde ich mal Ihre Frage betreffend der ‚Phantomgelder‘ beantworten. Ein mehrdeutiger Fachausdruck, es kommt folglich auf den Kontext an. Sogenannte Nichtregierungsorganisationen bezeichnen auf diese Art häufig Gelder, die über Zweckgesellschaften, SPV genannt, verbucht werden, um Umsätze in steuergünstigen Ländern anfallen zu lassen. Medien benutzen den Begriff oft im Zusammenhang mit staatlichen Hilfsgeldern, die an internationalen Geberkonferenzen großzügig und publikumswirksam gesprochen werden, z.B. Gelder für die ‚Opfer des Klimawandels‘ in der Dritten Welt. Da kommen schnell einmal einige Milliarden zusammen. In der Realität sieht das anders aus, in Wahrheit fließen dann merklich weniger Mittel an die betroffenen Länder. Aus PR-Gründen sprechen die Regierungen Unsummen, um gut dazustehen, zahlen später aber bloß einen Bruchteil davon. Deshalb nennt man das ebenfalls ‚Phantomgelder‘.«
Doyle kratzte sich am Hinterkopf. »Demnach sind diese Geberkonferenzen nur Show?«
Die Naivität der Frage überraschte John. »Mehrheitlich schon. In den meisten Fällen geht es einzig und allein um die mediengerechte Darbietung für das Publikum im eigenen Land. ‚Tue Gutes und rede darüber‘ lautet ein bekanntes Sprichwort. Vergessen Sie nicht: Politiker verteilen stets das Geld, das andere Leute mit harter Arbeit verdient haben. Betrachten Sie es doch mal so: Wer wahrhaftig helfen möchte, der stellt doch schlicht einen Scheck aus. Ohne großes Getöse, ohne internationale Geberkonferenz.«
»Und die Medien spielen mit?«, fragte Doyle.
»Aber klar doch! Das ist ein eingespieltes Team, ein riesiger Zirkus. Was heutzutage zählt, sind bewegende, bebilderte Geschichten. Knackige Storys generieren Aufmerksamkeit und Klicks. Und nebenbei öffnet wohlwollende Berichterstattung Türen. Der eine oder andere Journalist landet später auf einem großzügig bezahlten Pöstchen auf der anderen Seite des Tisches.«
»Und was sind diese SPV?«, hakte Doyle nach, dem die Kurzbezeichnung nicht geläufig war.
»Die Abkürzung steht für ‚Special Purpose Vehicle‘. Das sind Zweckgesellschaften, sprich separate Rechtseinheiten, die man nutzt, um Risiken auszulagern, zur Verbriefung, zum Asset Transfer oder um Liegenschaften oder Tochtergesellschaften zu halten.«
»Ist das legal?« Doyle kannte die Antwort, versuchte dennoch, seinem Gesprächspartner auf den Zahn zu fühlen.
John sah den Fallstrick, ihm war gleichgültig, was NGO oder linke Aktivisten über das Thema verbreiteten, denn da war stets politischer Schönsprech inkludiert.
»Das kommt immer darauf an, zu welchem Zweck man eine dieser Gesellschaften verwendet. Generell kann man sagen: Ist der Hintergrund legal, dann ist es die Verwendung ebenso.«
»Haben Sie solche Konstrukte schon eingesetzt?«
John war sich bewusst, dass ihn der Ermittler ausfragte, er spielte dennoch mit. »Sicher, sie gehören in den Werkzeugkasten einer jeden kompetenten Steuerkanzlei. Aber Sie sollten wissen: Ich bin kein Steueranwalt. Wenn Sie auf diesem Sachgebiet Hilfe benötigen, bin ich der falsche Ansprechpartner.«
Amerikanisches Steuerrecht war John eindeutig zu kompliziert. Und nicht nur das: Darauf hatte er schlicht keine Lust.
Doyle schienen die Fragen nicht auszugehen. »Und wann oder wo verwendet man solche Konstrukte? Haben Sie mir ein Beispiel?«
John überlegte. Es gab komplexe Fälle und leicht verständliche. Er entschied sich für Letzteres.
»Würde ich mir auf irgendeiner sonnigen Karibikinsel oder in Südamerika eine Immobilie kaufen, dann dürfte es unter Umständen durchaus angebracht sein, eine Zweckgesellschaft dazwischenzuschalten. Diese tritt dann als Eigentümerin der Liegenschaft auf. Dasselbe gilt beim Kauf einer Yacht. Das hat mehrere Vorteile. Einerseits taucht mein Name dann nicht im Grundbuch oder im Schiffsregister auf, was in gewissen Ländern aus Sicherheitsüberlegungen fraglos Sinn macht, denken Sie nur an die Kindesentführungen in Lateinamerika. Es gibt demnach plausible Gründe, öffentlich nicht als Käufer oder Eigentümer aufzutreten. Hinzu kommt ein weiterer Vorteil dieses Rechtskonstruktes: Verkaufe ich zu einem späteren Zeitpunkt meine Yacht oder mein Grundstück, veräußere ich schlicht die Zweckgesellschaft und übertrage diese auf den Käufer. Im Grundbuch bzw. Schiffsregister bleibt alles gleich.«
»Das ist aber nicht wirklich transparent«, warf Doyle ein und kratzte sich am Kinn.
»Da haben Sie recht, aber es gilt letztlich, eine Abwägung zu tätigen zwischen dem staatlichen Bedürfnis nach Transparenz – sei es, damit kein Steuersubstrat verloren geht oder aber, um eine wirkungsvolle Strafverfolgung zu ermöglichen – und dem menschlichen Bedürfnis nach Privatsphäre. Nur weil einige ihre Familienfotos auf Facebook posten, sollten doch nicht alle Erdbewohner dazu gezwungen werden, es ebenso zu tun. Ich zum Beispiel nutze keinerlei soziale Medien. Was sollte ich dort auch posten? Transparenz wird völlig überbewertet. Manchmal ist sie sogar schädlich. Exponierte Menschen schätzen ihre Privatsphäre und die Möglichkeit, unter dem Radar der Öffentlichkeit zu fliegen. Solange das im Rahmen der Gesetze geschieht, spricht nichts dagegen.«
»Danke für die Erläuterungen, Sie müssen mir das nicht im Detail erklären, ich hätte das lieber schriftlich.«
John schmunzelte. »Dazu gibt es die Internetrecherche. Die ist günstiger und gerade für Bundesbehörden mit schmalem Budget empfehlenswert.«
Doyle nahm es gelassen zur Kenntnis. Mittlerweile kannte er Johns Sinn für Humor. »Meine Vorgesetzte bat mich Ihnen auszurichten, dass wir Sie gerne in beratender Tätigkeit mit an Bord hätten.«
»Offiziell?«, fragte John.
Doyle nickte. »Offizieller geht es nicht.«
»Mit Ausweis und so?« John grinste und ließ seine eher scherzhaft gemeinte Frage wirken. »Aber im Ernst: Derzeit verspüre ich weder Langweile noch kann ich über mangelnde Arbeitsbelastung klagen.«
Doyle schmunzelte. »Mit dieser Antwort haben wir gerechnet. Das FBI meint es wahrhaftig ernst, diese Anfrage wurde durch das Büro in D.C. aufgegleist. Ich sagte bereits, ich bin nicht über alles informiert, ich wurde aber angewiesen, Sie erst zu kontaktieren, wenn das Ergebnis Ihrer Sicherheitsüberprüfung vorliegt. Die sind gründlich, wenn sie es ernst meinen.«
»Das kann ich mir vorstellen. Hätte mich überrascht, wenn Ihre Leute mich nicht überprüft hätten. Kam dabei was Spannendes heraus?«
»Das meiste ist für uns uninteressant. Dennoch gibt es einige Punkte, die unsere Aufmerksamkeit erregt haben. Ihre militärische Dienstakte zum Beispiel. Sie waren Anwalt bei der Navy, nicht wahr?«
John nickte. »Genau genommen war ich beim Judge Advocate General’s Corps (JAG) der Navy«.
»Eine faszinierende militärische Laufbahn haben Sie da absolviert«, sagte Doyle.
»Wie meinen Sie das?«, erwiderte John.
»Ein Jahr nach dem Abschluss Ihres Studiums der Rechtswissenschaften in Stanford stiegen Sie direkt im Rang eines Lieutenants Junior Grade ein. Keine üble Alma Mater, nebenbei erwähnt. Dann folgten fünf Wochen an der Officer Development School in Newport, Rhode Island. Am selben Ort besuchten sie zehn Wochen lang die Naval Justice School, bevor sie zu ihrem ersten Einsatz nach Norfolk abkommandiert wurden. Es folgt die Versetzung nach Honolulu. Ihre Personalakte weist keinerlei Auffälligkeiten auf, alles Routine, ausgezeichnete Bewertungen. Beeindruckende Erfolgsquote, kaum ein Angeklagter kam davon. Ein knallharter militärischer Staatsanwalt, detailversessen, verhandlungserprobt, erfolgreich. Turnusgemäß erfolgte dann die Versetzung nach Bahrain. Naher Osten.« Doyle schnippte mit den Fingern. »Ab dann wird es aufregend. Sie sind kaum drei Monate in Manama stationiert und schon werden Sie zum Lieutenant Commander befördert. Aus den Akten geht nicht hervor, was diesen raschen Aufstieg bewirkt hat. Ihr Aufenthalt am Golf wird besonders gewesen sein, nicht nur ein Karrierebeschleuniger, sondern gleichermaßen, was Ihre Tätigkeit anging. Denn auf einmal enthält Ihre Akte geschwärzte Passagen. Was nicht nur mich zu der Frage führt: Was hat sich dort ereignet?«
John hatte nur positive Erinnerungen an Bahrain, obwohl sich in Manama zur Zeit seiner Stationierung nichts Aufregendes zugetragen hatte. Die amerikanischen Truppen im Königreich verhielten sich mehrheitlich korrekt. Der Erwartung entsprechend kam es zu vereinzelten Grenzüberschreitungen, aber kaum gröberen, die ein Eingreifen des Anklägers erfordert hätten. Die meiste Zeit hatte er damit verbracht, militärische Befehlshaber in juristischen Fragen zu beraten.
»Respekt, Sie haben nicht nur akribisch recherchiert, Sie haben die Akte sogar gelesen.« Er warf Doyle einen vielsagenden Blick zu. Ihm war klar, dass es sein Gegenüber gründlich nahm.
»Was für uns von Interesse ist: Was wird da verheimlicht und weshalb?«, fragte der Bundesagent. Die Wahrscheinlichkeit, dass er eine Antwort auf seine Frage bekommen würde, war gering. Aber einen Versuch war es wert.
»Im Gegensatz zu Ihnen habe ich meine Akte nie zu Gesicht bekommen. Es entzieht sich somit meiner Kenntnis, was drinsteht. Wenn Sie mehr in Erfahrung bringen möchten, müssten Sie sich an meine damaligen Vorgesetzten oder deren Nachfolger wenden. Ich vermute mal, das hat auf dem Dienstweg zu geschehen.« Es war John unmöglich, ein Schmunzeln zu unterdrücken, denn er war sich sicher, was folgen würde.
»Das haben wir bereits getan. Und wissen Sie, was die uns geantwortet haben?«
»Es fällt mir nicht schwer, mir das vorzustellen.« Johns Schmunzeln verwandelte sich in ein breites Grinsen. »Ich kenne die Standardphrasen, wenn es um Geheimhaltung geht. So läuft das bei den Streitkräften. Ich sagte ja bereits: Transparenz wird völlig überbewertet.«
Doyle wirkte ernsthaft und konzentriert. »Sie waren kein gewöhnlicher Judge Advocate, nicht wahr?«
»Ich war nie in irgendetwas gewöhnlich, weder damals noch heute.«
»Das beantwortet meine Frage nicht.«
John lächelte erneut. »Dazu kann ich nichts sagen.«
Sie sahen sich an. Unausgesprochen war klar, dass Doyle zwar im Trüben fischte, dennoch nicht völlig falschlag.
»Sie möchten sich mir gegenüber dazu nicht äußern?«
John schüttelte den Kopf.
»Haben Sie eine Geheimhaltungserklärung unterzeichnet?« Doyle schaute seinen Gesprächspartner eindringlich an.
John ignorierte die Frage. Er kannte das Gesetz: Einen Bundesagenten zu belügen, war eine Straftat. »Was ist nun mit den Phantomgeldern?«, antwortete er stattdessen.
Er war sich sicher, dass Doyle nicht klein beigeben würde. Aber das war nicht sein Thema und schon gar keines, das hier, auf einer unbequemen Holzbank im Central Park, in aller Öffentlichkeit, geklärt werden würde.
Der Ermittler sah ein, dass es zwecklos war, John weiter dazu zu befragen und besann sich auf seinen Auftrag. »Werden Sie es sich betreffend der Beratertätigkeit überlegen?«
»Wenn Ihnen ernsthaft daran liegt, dann sagen Sie mir, in welchem Kontext Sie ermitteln.«
Die Forderung überraschte ihn nicht, Doyle beantworte die Frage, ohne zu zögern. »Bei unseren Ermittlungen gegen Ihren damaligen CEO stießen wir auf eine Bank in Moskau, bei der Konten geführt und über die Überweisungen getätigt wurden. Russische Geldinstitute sind stets sehr reizvoll für das FBI. Ich kann es nicht mit Sicherheit sagen, aber ich vermute, dass Archer dem Generalstaatsanwalt etwas im Zusammenhang mit der Germania Bank gesteckt hat. Das ist alles, worüber ich im Bilde bin.«
»Bemerkenswerter Name für ein russisches Finanzinstitut, finde ich. Geben Sie mir einige Tage Bedenkzeit, ich melde mich dann bei Ihnen. Ist sonst noch was?«
Bevor es Doyle möglich war, auf die ihm gestellte Frage einzugehen, klingelte Johns Smartphone. Er nahm das Gerät aus der linken Innentasche seines Jacketts und sah nach, wer anrief.
»Bitte entschuldigen Sie mich, diesen Anruf muss ich entgegennehmen.« John erhob sich und entfernte sich einige Meter. Dann nahm er das Gespräch an. »Hey Donnie, was gibt es?«, sagte er.
Doyle beobachtete John aufmerksam und registrierte, dass sich dessen Miene verfinsterte.
»Wenn ich etwas tun kann, lass es mich wissen«, hörte Doyle ihn sagen. Dann schien Chambers wieder zuzuhören. »Okay, ich werde da sein. Ich melde mich.«
John beendete das Gespräch. Doyle sah zu, wie er einen kurzen Augenblick auf das Gerät starrte, es dann in seiner Jackentasche verstaute, sich der Parkbank näherte und Platz nahm. Etwas schien sich verändert zu haben.
»Ist bei Ihnen alles okay?«, erkundigte sich Doyle.
John seufzte. »Nein, ich habe soeben erfahren, dass ein Freund gestorben ist.«
»Oh, das tut mir leid. Ein enger Freund?«
»Ja, wir standen uns sehr nah. Ein Freund jener Sorte, die einen aus dem Gröbsten rausholt, auch um vier Uhr nachts erreichbar ist und einem, falls notwendig, die Haut rettet.«
Sie verweilten einen Augenblick schweigend auf der Parkbank. In solchen Situationen zog es Doyle vor, keine Fragen zu stellen.
»Er ist gestern auf dem Weg zur Arbeit erschossen worden. Adam hatte bei einer Filiale von D’Oh!Nuts eine Pause eingelegt.«
Der Ermittler zögerte einen Moment. Dann traute er sich, die Frage zu stellen. »War Ihr Freund ein Cop?«
Es war nur eine Vermutung, aber sie stützte sich auf das bekannte Klischee: Wer holte Hefegebäck auf dem Weg zur Arbeit?
»Nein, er war Special Agent beim NCIS.«
Doyles berufliche Neugier war geweckt. Wer einen Bundesagenten ermordete, zog die Aufmerksamkeit sämtlicher Strafverfolgungsbehörden auf sich. »Am helllichten Tage? Wo ist das passiert?«, fragte er nach.
»Ich weiß es nicht, ich habe nicht danach gefragt. Ich nehme mal an in der Umgebung von Norfolk«, antwortete John.
»Arbeitete er dort?«
»Er hatte oft dort zu tun, in Norfolk befindet sich der größte Marinestützpunkt der Welt. Gearbeitet hat er in Quantico, aber ich nehme mal nicht an, dass das Verbrechen auf dem Stützpunkt der Marineinfanterie begangen wurde.«
Die Marine Corps Base Quantico war jedem Ermittler des FBI ein Begriff. In unmittelbarer Nähe zu dieser kleinen Ortschaft im Prince William County am Ufer des Potomac River in Virginia, war nicht nur der Hauptsitz des NCIS untergebracht, sondern ebenfalls die Ausbildungsakademie des FBI.
»Mein aufrichtiges Beileid. Wenn Sie etwas brauchen und ich etwas tun kann, lassen Sie mich es wissen.«
»Danke«, sagte John nur.
Doyle ließ ein klein wenig Zeit verstreichen, stand dann auf, verabschiedete sich und entfernte sich. Auf seinem Weg durch den Park in Richtung jenes Ausgangs, in dessen Nähe er seinen Dienstwagen abgestellt hatte, überlegte er. Irgendetwas passte nicht ins Bild, welches er sich von John Chambers gemacht hatte. Der Mann hatte im vergangenen Jahr im Alleingang die Ermittlungen gegen seinen CEO ins Rollen gebracht, ohne Rücksicht auf Ansehen und Verluste. Und dem FBI erstklassige Informationen geliefert. Chambers kannte die Anforderungen einer Strafermittlungsbehörde, was sich aufgrund seiner militärischen Laufbahn erklären ließ. Es war nicht nur das, was Doyle beschäftigte.
Es war eine Sache, zu wissen, was gebraucht wurde, um einen Gesetzesbrecher festzunageln. Etwas völlig anderes war es, dazu in der Lage zu sein, dem FBI gerichtsverwertbares Beweismaterial zu liefern. Das war Doyle schon damals aufgefallen und hatte ihn seinerzeit schwer beeindruckt. Er hatte es hier nicht mit einem Laien zu tun, dessen war er überzeugt. Seine Behörde war sich sicher, dass Chambers nicht nur auf ein leistungsfähiges Netzwerk zurückgreifen konnte, sondern ebenso über die Möglichkeit verfügte, sich Informationen zu beschaffen. Grenzüberschreitend. Wie genau er das anstellte, blieb rätselhaft. Bislang. Der Ermittler hatte den Eindruck, bei der Sicherheitsüberprüfung sei etwas übersehen worden. Seine Neugier war geweckt, er nahm sich vor, die Unterlagen nochmals gründlich durchzugehen. Und falls erforderlich, zusätzliche Nachforschungen in Auftrag geben.
Nachdem Doyle aus Johns Blickfeld verschwunden war, erhob sich dieser von der Parkbank und begab sich auf den Weg zu seinen auf ihn wartenden Wagen. Adam Sato war ermordet worden. Purer Zufall? Nicht auszuschließen, denn der berufliche Alltag eines Bundesagenten war nun mal nicht ungefährlich. In diesem Job begegnete man andauernd unberechenbaren und gewalttätigen Figuren. Dennoch wirkten Donovans Worte surreal. Erschossen auf dem Parkplatz einer ‚D’Oh! Nuts‘-Filiale? Das erschien John der unsinnigste Tatort überhaupt. Einen Bundesagenten dort abzuknallen, war vermutlich dasselbe, wie ihn vor einer Polizeidienststelle niederzustrecken: Das Risiko, dabei beobachtet zu werden, war enorm.
Kaffee und Backwaren. Es war Common Knowledge, dass Gesetzeshüter aufgrund ihrer langen Schichten und kurzen Pausen zum Konsum dieser Genussmittel neigten. Was auch immer der Grund für diese Vorliebe war, ob schneller Blutzuckeranstieg oder die aufputschende Wirkung von Koffein. Mehr als der ungewöhnliche Tatort beschäftige John jedoch ein Detail, welches Mike Donovan ihm bei ihrem kurzen Gespräch vermutlich unabsichtlich verraten hatte: Adam war mit drei Schüssen in den Rücken niedergestreckt worden. John wusste, wie er das zu interpretieren hatte. Beim JAG war er mit ähnlichen Gewalttaten in Berührung gekommen. Die drei Schussabgaben waren ein ausgeprägtes Indiz dafür, dass es sich um kein zufälliges Aufeinandertreffen von Täter und Opfer handelte.
In zügigem Tempo lief John zum Parkausgang und beobachtete genau, was um ihn herum geschah. Er war nicht mehr so entspannt wie auf dem Weg zu diesem Treffen. Jetzt betrachtete er sein Umfeld analytisch und systematisch. Er scannte seine Umgebung. Er war hellwach, voll konzentriert und äußerst aufmerksam. Alles schien normal und gewöhnlich, trotzdem war er sich nicht sicher, ob das nicht bloß Schein war.
»Verdammt noch mal! Fuck!«
Er bemerkte, dass er dies laut gesagt hatte, und schaute sich um. Keiner schien es gehört zu haben. Zum zweiten Mal am selben Tag beschlich ihn das ungute Gefühl, dass etwas nicht stimmte. Er lief zügig zur Ecke Fifth Avenue 102nd East, wo sein Fahrer am vereinbarten Treffpunkt auf ihn wartete.
»Wo soll es hingehen?«, erkundigte sich Lenny, der schon seit vielen Jahren für die Familie tätig war.
»Fahren Sie mich bitte ins Büro«, antwortete John, stieg ein und nahm auf dem mit weichem Nappaleder bezogenen Rücksitz des Wagens Platz.
Der weiße Range Rover setzte sich in Bewegung und fädelte in den zähflüssigen Verkehr ein. Auf der Fahrt in den Südteil Manhattans beschloss John, seine Reisepläne zu ändern. Es gab Fragen, die der Klärung bedurften.
Kapitel 2
»Hey, der Zwischenbericht der Forensik ist da«, sagte Special Agent Kimberly Van Pelt, nachdem sie das Großraumbüro betreten und die Akte schwungvoll auf den Schreibtisch ihres Kollegen befördert hatte. Das Dokument flog haarscharf an Tony Chans bis zum Rand mit Kaffee gefüllter Tasse vorbei.
»Das war aber knapp!«, zischte der Ermittler und schaute genervt auf. »Und, hast du was?«
»9 Millimeter Parabellum«, erhielt er zur Antwort.
»Alle 3?«
»Ja, alle drei gefundenen Projektile sind vom selben Kaliber.«
Chans Gesichtsausdruck veränderte sich schlagartig, seine Kollegin hatte sein Interesse geweckt. Er legte den kleinen hellgrünen, mit Noppen versehenen Gummiball, den er mit der rechten Hand bearbeitet hatte, auf den Schreibtisch. Zumindest mal etwas, selbst wenn es die Sache nicht wirklich eingrenzte.
Van Pelt deutete auf den Ball. »Nervös?«
Chan ignorierte die Frage. »Hülsen?«
»Auch drei«, antwortete Van Pelt. »Die Kriminaltechniker untersuchen sie derzeit auf Fingerabdrücke und DNA.«
»Vermutlich kein Profi«, meinte Chan.
»Du meinst, weil der Täter die Hülsen liegen ließ?«
»Du hast es erfasst.«
»Lass uns mal keine voreiligen Schlüsse ziehen«, entgegnete die Ermittlerin.
Diesen Ratschlag hatte Tony Chan schon oft gehört, selten beherzigt und trotzdem meist richtiggelegen.
»Unter Umständen wurde der Täter gestört, bevor er Zeit hatte, seine Spuren zu verwischen«, fuhr Van Pelt fort. »Dann hätten wir es mit einem Profi in Eile zu tun.«
Chan zog die Akte zu sich, schlug sie auf und überflog das Geschriebene. Daraufhin wandte er sich wieder an seine Kollegin, die mittlerweile am gegenüberliegenden Schreibtisch Platz genommen hatte. »Haben wir einen Treffer zur Tatwaffe?«
»Nein, bislang nicht. Das Profil läuft zurzeit durch die Datenbank. Weshalb dauert das bloß so lange, bis die Forensik uns Ergebnisse liefert? Weshalb schenken die dem Fall denn keine Aufmerksamkeit?« Van Pelt war ungehalten.
Chan kannte das Gefühl: Die Arbeit der Kriminaltechnik kam stets zu langsam voran. Zumindest erschien das den Ermittlern jeweils so. Selbst dann, wenn seit dem Verbrechen keine 48 Stunden vergangen waren, beschwerten sich sie sich und scharrten mit den Hufen. Sie hatten nur eines im Sinn: Gesetzesbrecher jagen.
»Auf den Beweismitteltüten steht ja nicht, dass das Opfer einer von uns war. Fallnummer und Name, das ist alles, was die Techniker sehen. Wer Adam nicht persönlich kannte und mitbekam, dass er erschossen wurde, stellt keine Verbindung zu den Beweismaterialien her. Jetzt heißt es warten, bis unser Fall an der Reihe ist. Erst dann erfahren wir, ob die Waffe bei einem anderen Verbrechen verwendet wurde.«
»Wovon kaum auszugehen ist«, warf Van Pelt ein. »So dämlich ist doch keiner, der sich an einen Bundesagenten heranwagt!«
Chan schloss die Akte, schob sie von sich weg und wandte sich seiner Kaffeetasse zu. Klar, die Warterei war unangenehm, es gab Tage, da bekam man davon einen dicken Hals, aber die Abläufe der Behörde waren nun mal so. Maßgeblich war der Eingangszeitpunkt der Beweismittel. Bearbeitet wurde stets der Reihe nach. Es war keinem Ermittler möglich, auf die Reihenfolge der Untersuchung Einfluss zu nehmen. Diese Kompetenz war einer einzigen Person vorbehalten. Und diese schien es bislang nicht für nötig gehalten zu haben, beschleunigend einzuwirken.
Tony Chan gönnte sich einen weiteren Schluck seines Lieblingsgetränks, welches mittlerweile erkaltet war, was ihn aber nicht störte. Dann stellte er die Tasse auf seinen Schreibtisch, richtete den Henkel im rechten Winkel aus und sah seine Kollegin an. Er hatte wieder den hellgrünen Gummiball in der Hand, diesmal in der linken, und knetete ihn.
»Sagtest du nicht, ich solle keine voreiligen Schlüsse ziehen?« Er sah sie fragend an, wartete jedoch nicht auf ihre Entgegnung. »Dummheit würde ich nicht ausschließen, die meisten Verbrecher sind nicht die Cleversten. Das liegt in der Natur der Sache.«
»Dennoch ist es merkwürdig und widersprüchlich. Das Trefferbild und die drei Schüsse deuten auf einen Profi hin. Das Liegenlassen der Hülsen nicht.« Van Pelt warf ihrem Kollegen einen vielsagenden Blick zu. »Wo ist eigentlich Murray? Er ist schon längst überfällig!«
Chan kam nicht dazu, ihre Frage zu beantworten, da sein Telefon klingelte. Er nahm den Anruf entgegen, hörte zu, sagte kaum etwas und beendete das Gespräch.
»Kim, der Boss wünscht uns zu sehen.«
»Wann?«
»Jetzt gleich.«
Van Pelt sah ihren Kollegen verwundert an, stieß einen Seufzer aus, erhob sich, zog ihre Jacke an und wartete, bis Tony ebenfalls bereit war. Dann begaben sich die Ermittler auf den Weg zu ihrem Vorgesetzten, dessen Büro auf dem gleichen Stockwerk, aber in einem anderen Gebäudeflügel lag. Der Assistent des Directors winkte sie durch. Keine zwei Minuten nach dem Anruf standen sie vor Owain Baker.
An seinem Schreibtisch sitzend sah dieser überrascht auf. »So rasch hatte ich nicht mit Ihnen gerechnet! Nehmen Sie Platz und lassen Sie uns keine Zeit verlieren: Was gibt es Neues im Fall Sato?«
Der walisischstämmige Leiter der Behörde war für seine direkte Art bekannt, er hielt sich nicht lange mit Höflichkeiten auf und kam geradeheraus und ohne Umwege auf den Punkt. Baker hatte seine beiden Mitarbeiter nicht für einen Kaffeeplausch mit unverfänglichem Small Talk zu sich kommen lassen.
»Agent Chan?«, sagte er, den älteren und erfahreneren Ermittler ansprechend.
Tony zeigte auf Kim. »Sir, sie kommt soeben aus der Forensik.«
»Nun, dann halt Agent Van Pelt. Was haben Sie?«
Van Pelt räusperte sich, zog den schwarzen Notizblock aus ihrer Jackentasche und klappte ihn auf. Sie musste die Seite nicht suchen, da sie diese mit einem kleinen selbsthaftenden gelben Notizzettelchen gekennzeichnet hatte.
»Special Agent Sato wurde am Montag gegen Nullsechshundert auf dem Parkplatz des ‚D’Oh! Nuts‘ in Jacksonville, North Carolina, mit drei Schüssen in den Rücken niedergestreckt.«
Montag. Da war Labor Day. Den freien Tag hatte der Behördenleiter mit seiner Familie bei Barbecue und Gesellschaftsspielen verbracht. Es war nichts Ungewöhnliches, dass Bundesagenten an einem Feiertag Dienst leisteten, schließlich nahm sich das Verbrechen auch keine Auszeit. Der Betrieb lief nonstop, 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr. Und dennoch wurde Baker nachdenklich. Es war sonderbar, dass einer seiner Ermittler aus heiterem Himmel erschossen wurde. Denn Sato hielt sich zum Tatzeitpunkt nicht etwa bei einem Einsatz auf, sondern in gewisser Art im ermittlungstechnischen Niemandsland.
»Drei Schüsse in den Rücken«, sagte er, mehr an sich als an seine Ermittler gewandt, »das war scheinbar keine Zufallsbegegnung. Weshalb kennen wir den Tatzeitpunkt denn so genau?«
Kimberly blätterte in ihren Notizen. Präzision war Baker wichtig, er achtete auf jedes Detail.
»Die Zentrale vermerkte den Notruf um 0608, um 0610 war eine Streife der örtlichen Polizei vor Ort.«
»Das ging aber schnell! Bemerkenswert. War das Zufall?«, fragte der Vorgesetzte.
»Es war die Frühschicht. Die beiden Polizisten waren auf dem Weg zum selben Geschäftslokal, um sich mit Kaffee und Hefegebäck zu versorgen.«
Baker schüttelte den Kopf. Einerseits bestätigte dies das Klischee: Bohnenkaffee und Donuts, Koffein und Kohlenhydrate. Typisch für Gesetzeshüter. Andererseits stellte er sich die Frage, was geschehen wäre, wenn die Ordnungshüter ihre Pause ein oder zwei Minuten früher angetreten hätten? Manchmal waren es Augenblicke, mitunter bloß Sekunden, die über Leben oder Tod entschieden.
»Wissen wir, was Agent Sato nach Jacksonville führte?«, fragte Baker.
Er war nicht durchgehend darüber informiert, wo sich seine Ermittler aufhielten. Er hatte nicht einmal den Überblick über jene, die ihren Arbeitsplatz hier, am Hauptsitz des NCIS in Quantico, auf dem Gelände der Marine Corps Base hatten. Es war schlicht unmöglich, den Gesamtüberblick zu behalten. Seine Behörde beschäftigte gegen 2‘500 Mitarbeiter, wovon etwa die Hälfte Special Agents waren. Überall, wo Schiffe der Navy oder Einheiten des US Marine Corps anzutreffen waren, war ein Vertreter seiner Behörde nicht fern. Die Männer und Frauen des NCIS waren auf der ganzen Welt im Einsatz.
»Gemäß Kollege Murray war Sato auf der Durchreise, auf dem Weg nach Camp Lejeune.«
»Was wollte er dort? Ein laufender Fall?«, erkundigte sich Baker.
»Er beabsichtigte, die Angehörige eines Mordopfers zu befragen«, antwortete Van Pelt.
»Ach deshalb Jacksonville«, murmelte der Director. Das ergab Sinn, es lag auf dem Weg. Er kratzte sich am Kinn. Hatte Agent Sato eine Kaffeepause eingelegt, die ihm dann zum Verhängnis wurde? Er überlegte, etwas störte ihn.
»Hatte er vor, die Befragung allein durchzuführen?«
»Ja, es scheint so. Agent Murray berichtete mir, dass sich Adam aufgrund einer vagen Vermutung auf den Weg gemacht habe, nichts Handfestes. Aber Sato meinte, dass er dort möglicherweise jemanden ausfindig gemacht habe, der ihnen weiterhelfen könne.«
»Merkwürdig.« Baker wirkte überrascht. Üblicherweise waren die Ermittler stets zu zweit unterwegs. »Weshalb war Agent Murray nicht dabei?«
»Er hatte am Montag einen freien Tag.«
Baker verschränkte die Arme und schüttelte den Kopf. Das erschien unkollegial, von außen betrachtet. Der alte Hase Murray zog einen freien Tag ein, derweil sein jüngerer Kollege eine mehrstündige Autofahrt auf sich nahm. Es wirkte so, als hätte dieses Duo aus zwei Einzelkämpfern bestanden, was ihn in Wirklichkeit nicht überraschte, denn Agent Sato war für seine Eigenwilligkeit bekannt. Der Director nahm sich vor, die Umstände der Zusammenarbeit dieses Teams prüfen zu lassen. Im Vordergrund stand im Augenblick aber diese laufende Mordermittlung.
»Er fuhr allein ohne seinen Partner los«, wiederholte Baker nachdenklich. Er sagte es auf eine Art, die Chan und Van Pelt vermuten ließ, was ihm dabei durch den Kopf ging. Es wurde still im Büro des Behördenleiters, jeder für sich kam zum Schluss, dass Agent Murray eine schwierige Zeit bevorstand.
Baker wandte sich an Tony Chan. »Haben Sie schon mal einen Partner verloren?«
Chan schüttelte den Kopf. »Zum Glück nicht.«
Baker schaute Van Pelt an: »Bei Ihnen erübrigt sich die Frage.«
So lange stand die junge Frau noch nicht in den Diensten des NCIS. Baker kannte ihre Akte, sie schien vielversprechend zu sein. Auf Anordnung des Marinestaatssekretärs war die Förderung von Frauen und anderen Minderheiten neuerdings Chefsache. Selbst ein höherer Beamter wie Baker konnte sich den Anweisungen der politischen Hierarchie nicht entziehen. Folglich behielt er Van Pelt im Auge.
Die Ermittler beobachteten schweigend ihren Vorgesetzten. Es brauchte keine immense Vorstellungskraft, um sich auszumalen, was folgen würde.
»Ich aber«, sagte Baker merklich leiser. »Ich kenne das aus eigener Erfahrung. Wer so etwas erlebt hat, weiß, dass man in den Tagen darauf weniger schlafen wird, wenn überhaupt. Man ist leicht reizbar und verrichtet seinen Dienst nicht mit überschwänglichem Elan. Murray wird sich Vorwürfe machen. Er wird sich fragen, ob er nicht … Wer kennt diese Gedanken nicht: Hätte, wäre, wenn. Sie wissen, was ich meine?«
Es war eine Frage, auf die er keine Antwort erwartete. Baker sah Van Pelt an, dann wandte er sich Chan zu und fuhr fort.
»Der Verlust eines Arbeitskollegen geht nie spurlos an einem vorüber. Handelt es sich dabei aber um den Partner, mit dem man viele Stunden verbracht hat, dem man vertraut und auf den man zählt, dann ist es doppelt schwer. Falls sich Murray in der nächsten Zeit einen Ausrutscher erlaubt, urteilen Sie ihm gegenüber nicht so streng. Und erinnern Sie sich an meine Worte.«
Baker ließ das Gesagte kurz wirken, dann ermunterte er die Ermittlerin mittels Handbewegung, mit ihrem Bericht fortzufahren.
Van Pelt räusperte sich erneut. »Das Opfer … Agent Sato, wurde von einer Passantin, genau genommen einer Kundin der gleichen Schnellverpflegungskette, gefunden. Die Frau hat die örtliche Polizei benachrichtigt. Nach Eintreffen der Kollegen am Tatort riefen diese umgehend einen Notarzt, gemäß Aussage der beiden Polizeibeamten war bei Agent Sato zu diesem Zeitpunkt kein Puls mehr feststellbar. Der Rettungsdienst traf um 0621 am Tatort ein und konnte nur das Ableben unseres Kollegen feststellen. Offizieller Todeszeitpunkt ist 0623. Aufgrund des Zeitablaufs müssen die Kollegen den Täter knapp verpasst haben.«
»Da blieb dem Verbrecher wenig Spielraum!« Baker kratzte sich am Hinterkopf. »Gab es Zeugen?«
»Der Tatort liegt in einem Vorort, bei der Auffahrt zur Interstate, keine Wohngegend, überall Gewerbeflächen. Zu dieser Tageszeit hat es kaum Publikumsverkehr in der Gegend. Es gab keine frühen Anlieferungen bei den Gewerbeunternehmen, da Montag ein Feiertag war. Niemand scheint die Schüsse gehört und die Straftat gesehen zu haben. Wir haben die Aufnahmen der Überwachungskameras des D’Oh! Nuts geprüft, unglücklicherweise hatte Agent Sato seinen Wagen etwas abseits in einem toten Winkel abgestellt. Zumindest auf diesen Aufnahmen ist nichts von dem Verbrechen zu sehen.«
Das war typisch für Sato: Er nahm nie den erstbesten Parkplatz, sondern einen, der weit weg vom Eingang lag. Antizyklisches Handeln hatte es Adam genannt.
»Wer von uns war vor Ort?«, hakte der Director nach.
»Murray, Chan und ich sind zum Tatort geflogen. Wir haben mögliche Zeugen befragt und die Besitzer der umliegenden Geschäfte und Lagerhäuser um die Aufnahmen ihrer Überwachungskameras gebeten. Bis jetzt haben wir nichts Brauchbares gefunden, aber die Auswertung läuft weiter.«
»Irgendeine Verbindung zu Satos aktuellem Fall?«
»Dafür ist es zu früh. Was dies betrifft, halte ich es für erforderlich, dass wir zuerst mit Supervisory Special Agent Donovan sprechen und Agent Murray ausführlicher befragen.«
Baker wirkte nachdenklich auf seine Ermittler.
»Agent Chan, haben Sie dazu etwas hinzuzufügen?«
Tony Chan verneinte. Seine Kollegin hatte alle vorliegenden Erkenntnisse erwähnt.
Baker sah Chan an. »Ich frage mich, was Adam Sato ausmachte, wer war er? Wissen Sie da mehr?«
»Ohne jemandem zu nahe treten zu wollen, aber mir gegenüber war Kollege Sato nie sehr gesprächig. Unsere Unterhaltungen drehten sich selten um Privates, so dass ich zu seiner Person wenig sagen kann. Du vielleicht, Kim?«
Van Pelt schüttelte den Kopf. »Ich denke mal, Murray und Donovan könnten Ihnen etwas dazu sagen. Sie verbrachten am meisten Zeit mit ihm.«
Baker schaute die Ermittler an. Was hatte sie denn überhaupt mit ihrem Kollegen verbunden? Offenkundig nur die Arbeit. Deshalb kannten sie den Verstorbenen nicht näher. Und da Adam Sato mit Murray ein fixes Team bildete, war es nicht erstaunlich, dass sie nur selten mit ihm zusammengearbeitet hatten. Abgesehen von den üblichen außerdienstlichen Tätigkeiten hatten sie vermutlich nichts miteinander unternommen. Der Job war hart, die Arbeitstage lang und manchmal gefährlich, da blieb wenig Zeit für ausführliche persönliche Gespräche. Auch ihm war bekannt, dass es sich bei Adam Sato um keinen ausgesprochen mitteilungsfreudigen Zeitgenossen gehandelt hatte, zumindest nicht, was sein Privatleben oder seine Vergangenheit anging. Was aber keinerlei negative Auswirkungen auf sein professionelles Verhalten gehabt hatte.
»Danke für die Offenheit, Agent Chan.« Baker nahm eine Akte von seinem Schreibtisch, öffnete sie und warf einen Blick hinein. »Es ist mir unmöglich, Ihnen etwas über Sato mitzuteilen. In seiner Personalakte steht nichts, was ich derzeit für erwähnenswert halte.« Er schloss das Dossier und übergab es Van Pelt. »Das ist eine bereinigte Kopie seiner Akte. Alles, was Sie nicht im Rahmen Ihrer Ermittlungen wissen müssen oder Ihre Gehaltsstufe übersteigt, wurde geschwärzt oder entfernt. Ihnen ist bekannt worum es bei Satos und Murrays laufenden Ermittlungen ging?«
»Sie meinen das Verbrechen in Norfolk?«, fragte Van Pelt nach.
»Genau«, antwortete der Behördenleiter.
Die beiden Ermittler nickten.
»Damit Sie zumindest über eine brauchbare Anfangshypothese verfügen, empfehle ich, dass Sie davon ausgehen, ihn habe diese Angelegenheit nach Camp Lejeune geführt. Sie sollten herausfinden, was er dort suchte, wen er befragen wollte und ob das mit seiner Ermordung zusammenhängen könnte.«
Chan und Van Pelt nickten erneut. Sie hatten die Anweisung verstanden.
»Sie konzentrieren sich gänzlich auf diesen Fall, alles andere, woran Sie arbeiten, übergeben Sie an eine andere Ermittlungsgruppe. Sprechen Sie mit Donovan, er wird das klären und koordinieren.«
Baker wandte sich der jungen Ermittlerin zu.
»Nun zu Ihnen, Agent Van Pelt. Ich bin mir bewusst, es ist eine heikle Angelegenheit, weil es sich beim Opfer um eine Person aus unseren Reihen handelt. Dennoch betraue ich Sie mit der Leitung der Ermittlungen im Fall Adam Sato. Ihr Kollege, Agent Chan, wird Sie dabei unterstützen und Ihre Stellvertretung übernehmen. Einwände?«
Es war ihr erstes Mal. Van Pelt behielt ihre Überraschung für sich. Beide Ermittler hatten keine Bedenken gegenüber der Aufgabenverteilung und schüttelten zeitgleich den Kopf.