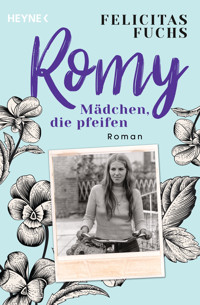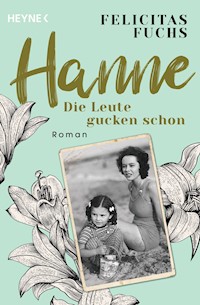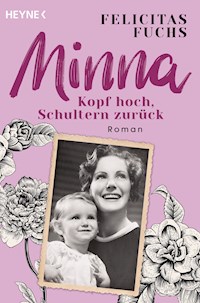9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Zwei Frauen, vier Jahrzehnte, und der Kampf für ihre Rechte
Bielefeld, 1963. Katja Schilling wächst im Wirtschaftswunder in einfachen Verhältnissen auf, in denen für ihren Traum, Ärztin zu werden, kein Platz ist. Nur ihr Großvater glaubt an sie – bis er eines Tages spurlos verschwindet. Sein Name wird in der Familie zum Tabu, und Katja bleibt mit ihren unbeantworteten Fragen allein. Jahre später stößt sie auf eine Wahrheit, die alles, was sie über ihre Familie zu wissen glaubte, erschüttert.
Bielefeld, 1936. Mathilde Schneeweiß beginnt ihre Arbeit als Sprechstundenhilfe bei Dr. Bönisch. Sie verliebt sich in den engagierten Arzt und wird in ein gefährliches Unterfangen hineingezogen. Gemeinsam helfen sie heimlich Frauen in Not, aber ihr Mut bleibt nicht unbemerkt. Als sie ins Visier der Gestapo geraten, muss Mathilde eine Entscheidung treffen, auch wenn diese sie das Leben kosten könnte. Der Kampf für die Rechte der Frauen muss schließlich weitergehen ...
Ein bewegender Roman über Mut und Verrat, Schuld und Gerechtigkeit – und die Spuren, die Geschichte in unseren Leben hinterlässt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 453
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Zum Buch
Bielefeld, 1963. Katja wächst im Wirtschaftswunder in einfachen Verhältnissen auf, in denen für ihren Traum, Ärztin zu werden, kein Platz ist. Nur ihr Großvater glaubt an sie – bis er eines Tages spurlos verschwindet. Sein Name wird in der Familie zum Tabu, und Katja bleibt mit ihren unbeantworteten Fragen allein. Jahre später stößt sie auf eine Wahrheit, die alles, was sie über ihre Familie zu wissen glaubte, erschüttert.
Bielefeld, 1936. Mathilde Schneeweiß beginnt ihre Arbeit als Sprechstundenhilfe bei Dr. Bönisch. Sie verliebt sich in den engagierten Arzt und wird in ein gefährliches Unterfangen hineingezogen. Gemeinsam helfen sie heimlich Frauen in Not, aber ihr Mut bleibt nicht unbemerkt. Als sie ins Visier der Gestapo geraten, muss Mathilde eine Entscheidung treffen, auch wenn diese sie das Leben kosten könnte. Der Kampf für die Rechte der Frauen muss schließlich weitergehen …
Zur Autorin
Felicitas Fuchs ist das Pseudonym der Erfolgsautorin Carla Berling, die sich mit Krimis, Komödien und temperamentvollen Lesungen ein großes Publikum erobert hat. Schon bevor sie sich ganz dem Schreiben widmete, war sie als Reporterin und Pressefotografin immer sehr nah an den Menschen und ihren Schicksalen. Für ihre historischen Familienromane lässt sie sich gern von Geschichten aus dem wahren Leben inspirieren. Mit ihrer Mütter-Trilogie gelang ihr auf Anhieb ein SPIEGEL-Bestsellererfolg.
Lieferbare Titel
Die Mütter-Trilogie:
Minna. Kopf hoch, Schultern zurück
Hanne. Die Leute gucken schon
Romy. Mädchen, die pfeifen
Die Akte Schneeweiß
FELICITAS FUCHS
DIE AKTESCHNEEWEIß
ROMAN
WILHELM HEYNE VERLAGMÜNCHEN
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.Trotz intensiver Recherche konnte der Verlag nicht alle Rechtegeber ermitteln. Bitte wenden Sie sich gegebenenfalls an den Wilhelm Heyne Verlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH.
Originalausgabe 05/2025
© 2025 by Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 Mü[email protected]
(Vorstehende Angaben sind zugleich
Pflichtinformationen nach GPSR)
Redaktion: Steffi Korda, Büro für Kinder- und Erwachsenenliteratur, Hamburg
Umschlaggestaltung: zero-media.net, München
unter Verwendung von © Shelley Richmond / Trevillion Images
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-31309-8V003
www.heyne.de
1. KAPITEL
Katja
AUGUST 1963
Was für ein Haus! Katja konnte sich bei der Besichtigung des Bungalows an all den schönen Dingen gar nicht sattsehen.
»Ihr habt euch ja nagelneu eingerichtet! Und alles ist so schick und modern«, flüsterte ihre Mutter und strich mit der Hand nahezu liebevoll über das Polster eines zierlichen Sofas.
»Die Couch kann man ausklappen, falls mal Besuch übernachten will«, erklärte die Nachbarin Tante Uschi.
Einen Fernseher mit Zimmerantenne gab es in diesem geräumigen Wohnzimmer, eine Musiktruhe und einen Tisch, den man mit einer Kurbel hoch- und runterdrehen konnte.
Dann betraten sie eine Anbauküche mit himmelblauen Fronten. Selten hatte Katja ihre Mutter so staunend gesehen. »Todschick«, sagte sie, »todschick. Und was das gekostet hat!«
Tante Uschi nickte. »Billig war das nicht. Aber wir mussten ja kein Grundstück kaufen, der Garten meiner Eltern war groß genug für ein zweites Haus. Aber du hast recht, das läppert sich.« Die Nachbarin zwinkerte ihr zu. »Sogar mein Mann war gleich begeistert, ich musste ihn nicht lange … überzeugen … wenn du verstehst, was ich meine.« Dabei grinste sie mit verschwörerischem Blick.
Katja hätte am liebsten eine Grimasse geschnitten. Dachten die Frauen, sie wüsste nicht, womit Männer sich am liebsten überzeugen ließen? Im März war sie vierzehn geworden, sie war doch nicht doof – und sie konnte lesen. Jeden Mittwoch ging sie in die Bücherei, um sich Lesefutter zu besorgen. Als sie neulich Das ärztliche Hausbuch zur Ausleihe auf den Tisch gelegt hatte, hatte Herr Frings sie über den Rand seiner Brille hinweg streng angesehen. »Hör mal, das ist aber noch nichts für dich, mein Frollein!«
Sie hatte behauptet, das Buch sei für die Mutter, die müsse etwas nachschlagen. Das stimmte nicht. Mutti hatte ihr Exemplar versteckt, weil sie, genau wie Herr Frings, der Meinung war, »so was« habe ein Mädchen nicht zu interessieren.
»So, für die Mutti«, hatte Herr Frings gemurmelt und den Stempel mit dem Datum, an dem das Buch spätestens zurückgegeben werden musste, auf den eingeklebten Zettel gedrückt.
Katja wusste weitgehend Bescheid. Über die Möglichkeiten der Frau, einen Mann zu überzeugen, hatte sie in Romanen gelesen. Manchmal versuchte sie, Antworten auf »körperliche« Fragen in medizinischen Büchern zu finden. Das ärztliche Hausbuch hatte sie mithilfe einer Taschenlampe unter der Bettdecke studiert, wenn Heidi im Etagenbett über ihr eingeschlafen war. Aber zu diesem Thema stand leider nicht viel drin. Katja hatte bei den Kühen von Bauer Wohlleben zufällig gesehen, wie das Ganze in der Praxis vonstattenging. Allerdings konnte sie sich nicht vorstellen, wie ein Mann und eine Frau das Gleiche taten wie Wohllebens Kühe. Es erschien ihr in jedem Fall recht unbequem, sich von einem Mann derartig bespringen zu lassen.
Sie hörte der Nachbarin wieder zu. »Ich hab meinem Mann den Prospekt gezeigt: Türen ohne Schloss und Schnäpper, die sich selbst schließen, individuelle Innenausstattung, Elektroleiste für Stromversorgung an jedem Arbeitsplatz. Da würde er direkt Lust bekommen, sich auch mal in die Küche zu stellen, hat er gesagt.« Tante Uschi lachte. »Um Himmels willen, das fehlte mir noch, ein Mann in der Küche, stell dir das mal vor!«
Katja stellte es sich vor und fand den Gedanken nicht schlimm. Der Fernsehkoch Clemens Wilmenrod stand auch in der Küche, seine Gattin Erika durfte nur assistieren. Dann hockten die Frauen der Nachbarschaft vor der Mattscheibe, machten sich Notizen und kochten seine Gerichte nach. Es hieß sogar, Wilmenrod habe Katjas Leibgericht, den Toast Hawaii, erfunden.
Ihre Mutter nickte zu Tante Uschis Worten die ganze Zeit wie der Wackeldackel auf der Hutablage eines Autos. Katja dachte daran, wie sie zu Hause lebten. Sie schlief mit Heidi in einem Zimmer ohne Ofen, es gab eine Wohnküche und das Schlafzimmer der Eltern. Das Klo auf halber Treppe teilten sie sich mit dem Hauswirt.
Sie gingen hinunter in die Waschküche. Mutti stieß einen hysterischen Laut aus. »Die Constructa 100!«
Katja hatte so ein Gerät im Schaufenster des Elektrohändlers gesehen und wusste, dass man dafür tausendvierhundert Mark hinblättern musste, ein unglaubliches Vermögen. Bei einem Streit hatte Mutti sich lautstark beschwert, weil Papa nicht mal sechshundert Mark im Monat in der Lohntüte hatte, und dass sie niemals auf einen grünen Zweig kommen würden, wenn sie nicht bald mitarbeiten würde.
»So weit kommt das noch«, hatte Papa geschimpft, »dass meine Frau arbeiten geht, und die Leute denken, ich könnte meine eigene Familie nicht ernähren. Wirtschafte halt vernünftiger!«
Katja wollte nicht heiraten. Sie würde ein Fräulein bleiben, dem niemand Vorschriften machte und das sich nicht von einem Mann bespringen ließe. Aber dieser Entschluss war ihr Geheimnis.
Neulich hatte Mutti ihr einen Vortrag gehalten: »Eine Hausfrau hält ihren Haushalt tadellos in Ordnung und teilt sich die Arbeit genau ein. Du kannst nicht erst um kurz vor eins mit dem Kochen anfangen und womöglich noch schnell zum Schlachter laufen, weil du die Bratwurst vergessen hast. Und mit dem Reinemachen musst du nicht anfangen, wenn dein Mann von der Arbeit kommt und sich erholen möchte.«
So ganz ließen sich Muttis Worte aber nicht mit dem vereinbaren, was sie zur Nachbarin gesagt hatte. Da beschwerte sie sich nämlich darüber, dass Papa ihr nicht erlauben wollte, wenigstens halbe Tage als Verkäuferin zu arbeiten.
Sie hörte Mutti fragen: »Sag mal, kann die Constructa wirklich mit sprudelnd kochender Lauge waschen? In der Reklame behaupten sie das ja!«
Tante Uschi kicherte. »Wird sie wohl. Ich gebe die Wäsche rein, nach ein paar Stunden ist sie sauber. Ich schaue der Maschine nicht bei der Arbeit zu, ich bevorzuge das Fernsehprogramm.«
Sie öffnete eine Tür neben der Waschküche und schaltete das Licht an.
»Hier sieht es aus wie in einem Laden!«, rief Katja. In Regalen, die vom Boden bis zur Decke reichten, standen Gläser mit eingewecktem Obst und Gemüse, es gab Marmeladen und Kompotte, Flaschen mit Most, Konserven und eine Kiste mit Kartoffeln. Auf dem Tisch in der Mitte türmten sich Schüsseln, sie waren mit flachen Tellern abgedeckt.
»Kartoffelsalat, Nudelsalat und Rohkostsalat hab ich gestern schon vorbereitet.« Tante Uschi zeigte auf die einzelnen Behältnisse. »Frikadellen sind im Kühlschrank, hundert Stück habe ich gebraten, und dreißig Schnitzel. Das hat man bestimmt bis zur Hauptstraße gerochen. In der Speisekammer liegen fünfzig hart gekochte Eier und große, feste Tomaten, Mayonnaise habe ich heute Morgen frisch gerührt, die müssen wir nur in den Spritzbeutel füllen, dann können wir Fliegenpilze machen. Ich hab außerdem Aal in Gelee vorbereitet und einen ordentlichen Kosakenkaffee angesetzt.« Sie strich Katja über den Kopf. »Du übernimmst die Käse-Igel. Wir halbieren eine Ananas und würfeln Käse, den steckst du abwechselnd mit den aufgespießten Weintrauben in die Ananas. Jetzt lasst uns die Schüsseln nach oben bringen. Im Garten sind Tapeziertische aufgestellt, wir richten das leckerste Büfett her, das es in der Straße je gegeben hat.« Sie wandte sich augenzwinkernd an Katjas Mutter. »Und dann kümmern wir uns um die Kullerpfirsiche!«
Heidi wurde zum Helfen hereingerufen. Sie setzte hart gekochte Eier und ausgehöhlte Tomatenhälften zu Fliegenpilzen zusammen und tupfte gewissenhaft Mayonnaise darauf. Während Katja sich um den Käseigel kümmerte, schaute sie nebenher aufmerksam zu, wie die Kullerpfirsiche zubereitet wurden. In die frischen, geschälten Pfirsiche stachen Mutti und Tante Uschi mit Gabeln rundherum Löcher, dann wurden sie in breite Gläser gelegt und mit Sekt aufgegossen. Heidi jauchzte vor Vergnügen, als die Früchte sich zu drehen begannen, erst schneller, dann wieder langsamer, ab und zu wechselten sie sogar die Richtung. »Wie geht das?«, fragte sie.
»Zauberei!«, behauptete Tante Uschi und trank einen großen Schluck.
Katja schüttelte den Kopf. »Das muss eine physikalische Ursache haben!«
Ihre Mutter bedachte sie mit einem tadelnden Blick. »Sei nicht so vorlaut und rede nicht wieder so geschwollen!«
Katja verkniff sich eine Antwort. Sie wollte nicht riskieren, heute Abend nicht mit zur Gartenparty zu dürfen. Aber sie ließ die Früchte nicht aus den Augen. Durch die Einstiche bildeten sich Bläschen, sie und die Kohlensäure des Sekts schienen die Ursache für die Rotation zu sein. Sie würde Opa Dom fragen. Er war der einzige Erwachsene, der ihre Fragen immer beantwortete.
Eine Stunde später kullerten vierzig Pfirsiche in vierzig perfekt polierten Gläsern. Für die Kinder gab es Zitronensprudel und Malzbier. Außerdem hatte Tante Uschi ihnen Himbeerbonbons und einen Karton Schokoladenzigaretten hingestellt. Sabine Seifert, Sabine Sandmann, Sabine Schmitz und Sabine Ehrenfeld liefen kichernd herum und imitierten die Erwachsenen: In einer Hand hielten sie die Malzbierflasche, mit der anderen führten sie graziös die Schokoladenzigarette zum Mund, deren dünnes Papier an den Lippen kleben blieb.
Katja stupste Heidi an. »Wir sind die einzigen Mädchen, die nicht Sabine heißen.«
»Außer Susanne, Gabi und Petra, die heißen auch nicht Sabine. Wir spielen auf der Straße Gummitwist, tschö mit ö!«, rief Heidi und verschwand im Getümmel.
Lachend schaute Katja ihrer Schwester hinterher. Obwohl sie erst acht war, konnte sie ziemlich lustig sein. Nun schlenderte Katja durch den Garten, belauschte Gespräche und beobachtete die Leute. Die Gäste hatten Likör oder Topfblumen zum Einzug geschenkt. Jemand brachte einen Gartenzwerg mit, bei dessen Anblick Tante Uschi in regelrechtes Entzücken ausbrach.
Diese Einweihungsparty wurde in der Straße unterschiedlich beurteilt. Einige Männer aus der Nachbarschaft hatten beim Ausschachten geholfen, auch während der Bauzeit hatten viele Nachbarn mit angepackt. Eine Frau sagte: »Vierzig Leute und die ganzen Blagen verköstigen, das muss man sich leisten können. Aber die ham’s ja. Der Deubel scheißt immer auf den dicksten Haufen.«
Mit einem Seitenblick erkannte Katja Frau Sandmann. Sie spielte mit ihrer Bemerkung auf den Lesezirkel von Tante Uschis Eltern an. In deren Schuppen stapelten sich Illustrierte, die in Papphüllen zu Lesemappen zusammengestellt und vermietet wurden. Überall, wo Leute warten mussten, lagen die braunen Mappen aus: Beim Arzt, beim Zahnarzt, beim Friseur, sogar in der Änderungsschneiderei. Die Kunden bekamen jede Woche neue Zeitschriften, dann wurden die der Vorwoche abgeholt und zu Lesern gebracht, die ältere und somit billigere Ausgaben bestellt hatten.
Jemand sagte: »Die Uschi, na, der fällt eben alles in den Schoß. Ist knapp dreißig und hat ein eigenes Haus. Der tut kein Zahn mehr weh.«
Katja schlenderte weiter. Das Fenster zum Wohnzimmer war geöffnet, drinnen hockte ein Bursche vor dem Zehnerwechsler und legte Platten auf. Wenigstens würde sich heute kein Nachbar über die laute Musik beschweren, sie waren ja alle hier.
Die Polstergarnitur war zur Seite geschoben und der Teppich zusammengerollt worden, schon schwofte das erste Paar. Nein, das war nicht Katjas Musik. »Da sprach der alte Häuptling der Indianer« gefiel ihr ebenso wenig wie Lieder von Freddy Quinn oder der »Der Babysitter-Boogie«. Vielleicht hatte sie Glück und jemand spielte später Elvis Presley oder Cliff Richard. Oder ein Lied der göttlichen Beatles. »Love Me Do«. Wenn ihr Vater nur das Wort »Beatles« hörte, wurde er sauer. »Das sind Irre, guck dir bloß an, wie die rumlaufen! Lange Haare, kurzer Verstand!«
Katja hatte keine Lust auf die Kinderspiele der anderen, viel lieber beobachtete sie die Erwachsenen. Frau Seifert war dünn wie eine Bohnenstange. Zur Feier des Tages trug sie das Haar wie Jackie Kennedy, aber sie sah damit kein bisschen glamourös aus. Nachdem der amerikanische Präsident den Satz »Ich bin ein Berliner« gesagt hatte, war er populärer als je zuvor, seither frisierten sich die Frauen in der Straße wie Jackie. Frau Seifert trug ein schwarzes Kleid, das eine Handbreit oberhalb ihrer knochigen Knie endete. Eine auffällige Brosche prangte über ihrer Brust, die Füße steckten in Schuhen mit Pfennigabsätzen, die sich in den kurz gemähten Rasen bohrten. Sie nahm sich mit affektierter Geste vom Rohkostsalat und legte ein Fliegenpilz-Ei daneben. Es muss zwischen der Menge des Essens und der Körperfülle einen Zusammenhang geben, dachte Katja.
Mutti kam mit Frau Schmitz von gegenüber auf das Büfett zu. Frau Schmitz hatte sich vor dem Ohr aus einer Haarsträhne eine Sechs gelegt. Katja wusste, dass man diese Frisur mit Zuckerwasser und Haarspray fixierte und dass kein Windstoß ihr etwas anhaben konnte. Frau Schmitz erblickte Frau Seifert, ihre Gesichtszüge veränderten sich abrupt zu einer Grimasse, sie schnappte nach Luft, schaute an sich herab. In diesem Moment drehte Frau Seifert sich um – und mit ihrem Gesicht geschah dasselbe. Erstaunen, Erschrecken, Erkennen. Und … Wut? Katjas Mutter riss die Augen auf und legte eine Hand vor ihren geöffneten Mund.
Jetzt sah Katja es auch. Die beiden Frauen trugen das gleiche Kleid. Ach, wie spannend, würden sie sich jetzt zanken? Es war den Damen anzusehen, dass sie nicht wussten, wie sie reagieren sollten, aber Katja spürte neben der Hilflosigkeit auch eine Art Abscheu, mit der die eine die andere musterte. Wenn sie sich recht erinnerte, gab es dieses Kleid im Neckermann-Katalog. Mutti gefiel es wohl auch, sie hatte es mit einem Bleistift angekreuzt. Aber knapp sechzig Mark … das war zu teuer. Nicht auszudenken, wenn sie es sich hätte kaufen können und heute drei Frauen im gleichen Modell auf derselben Party stünden.
Katja hörte plötzlich die Stimme von Opa Dom. »Das ist ja eine tolle Situation! Zwei schöne Frauen im gleichen Kleid! Ihr habt einen ausgezeichneten Geschmack, habt ihr euch abgesprochen und mit Absicht gleich angezogen?«
Katja drehte sich um und schaute ihrem Opa ins Gesicht. Niemand konnte so verschmitzt grinsen wie er. Tatsächlich hatte er es mit einem einzigen Satz geschafft, die Situation zu entschärfen: Die Frauen begannen zu lächeln, ihr Lächeln wurde breiter und endete schließlich in fröhlichem Gekicher.
Opa Dom tat, als wische er sich mit dem Handrücken den Schweiß von der Stirn. Er wandte sich an Katja und raunte: »Das war haarscharf.«
Katja liebte Opa Dom. Er wurde so genannt, weil er in monatelanger Fummelarbeit aus Millionen Streichhölzern beeindruckende Dinge baute. Ozeanriesen zum Beispiel oder Windmühlen, deren Flügel sich drehen konnten, einen berühmten englischen Bahnhof und den Pariser Eiffelturm. Als er den Kölner Dom aus Streichhölzern gebaut hatte, schrieb sogar die Zeitung darüber, seither hieß er bei den Leuten Opa Dom.
»Ich geh mir ein Bier holen. Warum bist du nicht bei den anderen Kindern?«
Katja zuckte mit den Achseln. »Gummitwist, Fangen, Verstecken, dazu habe ich keine Lust …«
Opa Dom zog sein krankes Bein heute besonders nach, das bedeutete, er hatte Schmerzen.
»Verrückt, dass mir der Fuß wehtut, obwohl ich da gar keinen mehr habe. Phantomschmerz, weißt du«, hatte er mal erklärt. Wie er seinen Unterschenkel verloren hatte, wusste Katja nicht. Als sie ihn gefragt hatte, hatte er gesagt »Den hab ich in meinem eigenen Krieg gelassen«, und dann hatte er das Thema gewechselt. Sie wusste, dass er eine Prothese hatte, die manchmal so drückte, dass er eine Menge Schnaps trinken musste, um die Schmerzen auszuhalten.
Schnaps wirkt wie Medizin, gegen Schmerzen, hatte Katja geschlussfolgert, Körperteile konnten wehtun, obwohl sie nicht mehr da waren. Sie nahm eine Handvoll Salzstangen aus einem Glas und aß sie im Gehen.
Je später es wurde und je mehr Bowle, Bier, Schnaps und Kosakenkaffee die Gäste tranken, desto lauter wurden die Gespräche. Die jüngeren Männer gruppierten sich in der Nähe des offenen Wohnzimmerfensters, aus dem die Musik schallte. Sie redeten über den sensationellen Postzugraub in England. Eine kriminelle Bande hatte den Nachtzug von Glasgow nach London überfallen und über zwei Millionen Pfund erbeutet. Kundig fachsimpelten sie, ob und wie man die Gangster fassen würde oder nicht.
Katja ging an der Terrasse vorbei, dort saßen die älteren Herren in den bunten Polstern moderner Gartenstühle und tranken Herrengedecke, bestehend aus Bier und »Schluck«. Hier ging es um die Transitstrecke der DDR. »Die haben das Grenzgebiet erweitert, jetzt gibt es innerhalb Berlins einen hundert Meter breiten Streifen, den niemand betreten darf, angeblich zum Schutz der Leute in der Ostzone. Außerdem haben sie die Kontrollen an den Transitstrecken verschärft … wohin soll das noch führen, armes Deutschland!«, lamentierte jemand.
Auch bei den Frauen hatten sich zwei Grüppchen gebildet, die älteren standen in der Nähe des Büfetts und redeten in diesem Moment über Gurken. Tante Uschi echauffierte sich: »Da haben die Minister in Bonn den Holländern verboten, ihre Gurken nach Deutschland einzuführen, und was passiert? Dreihunderttausend Gurken haben sie auf den Kompost geworfen! Weggeschmissen! Die waren alle noch gut! Die spinnen mit ihrer EWG, wenn ihr mich fragen würdet.«
»Dich fragt aber keiner!«, sagte Frau Seifert.
Die jungen Frauen hatten sich an der Hollywoodschaukel versammelt. Als die ersten Töne eines Twists von Caterina Valente erklangen, trippelten sie auf ihren Stöckelschuhen ins Haus, um zu tanzen.
Katja bemerkte die missbilligenden Blicke der Älteren. Frau Seifert aus Nummer zwölf schüttelte den Kopf. »Diese kurzen Röcke heutzutage, das ist eine Aufforderung zum … ihr wisst schon. Wenn sie sich so ordinär aufdonnern, müssen sie sich nicht wundern, wenn was passiert!«
Tante Uschi sagte: »Habt ihr das gehört, in Herford haben sie eine vergewaltigt, am helllichten Tag! Wenn die jungen Dinger so rumlaufen, wundert mich allerdings überhaupt nichts.«
Manchmal machten die Jungs in der Schule anzügliche Bemerkungen, in denen das Wort »vergewohltätigen« vorkam, dann klang es auf einmal harmlos. Während Katja so tat, als bände sie ihren Schuh zu, um unauffällig weiterlauschen zu können, bekam sie dieses Kribbeln im Bauch, das sich immer dann einstellte, wenn sie wütend wurde, sich aber nicht wehren konnte. Sie hätte sich am liebsten eingemischt, aber das gehörte sich nicht. Vergewaltigung war etwas Brutales, Schlimmes. War eine Frau selbst schuld, wenn sie vergewaltigt wurde? Wie konnte ein Opfer daran schuld sein, wenn an ihm ein Verbrechen verübt wurde? Oder konnte man es verhindern, indem man keine kurzen Röcke trug?
Die Frauen bemerkten sie und warfen ihr tadelnde Blicke zu. Katja verstand. Wenn Erwachsene sich unterhielten, hatten Kinder dabei nichts zu suchen. Obwohl, sie war vierzehn und kein Kind mehr, sie war ein Teenager. »Mein kleiner Backfisch«, nannte Opa Dom sie manchmal, aber das Wort war hoffnungslos altmodisch. Wo war er überhaupt?
Dort drüben stand er, mit ernstem Gesicht ins Gespräch vertieft mit einer Frau, die Katja nicht kannte. Als Oma am Gartentor auftauchte, verabschiedete er sich von der Fremden und humpelte auf seine Frau zu.
Ohne den weißen Kittel, den Oma tagsüber in ihrem Milchladen trug, sah sie ungewohnt aus. Sie hatte das gute Jackenkleid an, silbergrau, mit einem Muster aus Blättern. »Kinners, ich bin tatsächlich im Sitzen eingeschlafen, als ich mich umgezogen habe, langsam werde ich alt!«, sagte sie. Sie fasste an den Dutt in ihrem Nacken und prüfte den Sitz der Haarnadeln. »Katja, sitzt mein Haar? Ich glaube, ich hab mich in der Eile nicht gekämmt.«
»Du bist schön wie eh und je, und dass du alt wirst, hoffe ich!«, sagte Opa Dom. »Hundert Jahre sollst du werden!«
2. KAPITEL
Katja
SEPTEMBER 1963
An jenem Samstag, der alles veränderte, kam Katja nach der dritten Stunde aus der Schule. Sie freute sich, als sie Opa Dom auf der Eckbank sitzen sah, sein Bein mit dem fehlenden Fuß und dem klobigen Spezialschuh unterm Tisch ausgestreckt.
Heidi war unten im Hof. Sie hatte ausrangierte Schlüpfergummis zusammengeknotet, um zwei Aschetonnen gespannt und spielte Gummitwist.
Mutti stand am Herd und streute den Inhalt zweier kleiner Päckchen in einen Topf mit brodelndem Wasser. »Kannst Hände waschen«, sagte sie, »Essen ist gleich fertig.«
Katja trat zum Spülstein und wusch sich die Hände mit der Seife, die in der Mitte einen dunklen Riss hatte. Dann setzte sie sich neben Opa.
»Mein Mädchen, wie war’s in der Schule?«
»Wir haben ein Diktat geschrieben, hoffentlich habe ich nicht so viele Fehler …«
Er lachte, dabei leuchteten die Augen in seinem zerfurchten, braun gebrannten Gesicht besonders blau. »Keine Sorge, wirst schon ’ne gute Zensur haben. Haste doch immer.«
Plötzlich brach draußen gellendes Geschrei aus. Mutti rannte zum Fenster. »Heidi, was ist passiert?«
Katja drängelte sich neben Mutti und schaute hinunter. Ihre Schwester war weder gestürzt noch sah sie verletzt aus, sie stand bloß stocksteif da, mit ausgestreckten, leicht abgespreizten Armen und kreischte immer hysterischer. Rasch lief Katja hinunter. Heidi schrie ihr mit tränenüberströmtem Gesicht etwas entgegen und trampelte dabei hektisch auf der Stelle. Und dann erkannte Katja die Bescherung. Nein, Heidi hatte sich weder beim Hüpfen den Knöchel verstaucht, noch war sie umgeknickt oder gefallen. Auf ihrem Scheitel lag ein breiiger, grün-weißer Vogelschiss, der auf ihrer Bluse und ihrem Arm Spritzer hinterlassen hatte. Katja griff Heidis Hände, redete beruhigend auf sie ein und zog sie ins Haus.
Heidis Kreischen ging in Schluchzen mit einem heftigen Schluckauf über. Als Katja ihr in der Waschküche die Bluse und das Unterhemd auszog, sie sich hinknien ließ und begann, ihr die Vogelscheiße aus dem Haar zu waschen, wimmerte und hickste sie steinerweichend. Katja rubbelte das Haar halb trocken, kämmte sie, führte sie ins Kinderzimmer und reichte ihr eine saubere Bluse. Weil Heidi immer noch zitterte, knöpfte Katja ihr die Bluse zu. Dann nahm sie ihre Schwester in den Arm und strich ihr beruhigend über den Rücken. »Es ist alles wieder gut, nichts mehr zu sehen. Du musst dir die Nase putzen, soll ich dir ein Taschentuch holen?«
Schniefend schüttelte Heidi den Kopf. »Und … meine … schöne … Bluse …?«
»Das geht wieder raus. Ich weiche sie ein, wir nehmen Gallseife, keine Sorge!«
»Wirklich? Aber … und … wenn nicht?«
Katja konnte nicht nachvollziehen, warum Heidi so an ihren Klamotten hing, es gab doch wirklich Wichtigeres als Flecken auf einer Bluse. »Dann können wir uns immer noch was überlegen«, sagte sie.
Nachdem Heidi sich beruhigt hatte, gingen sie in die Küche.
»So ein Affentheater!«, brummte Mutti.
Heidi holte stockend Luft, es schien, als würde sie gleich wieder zu heulen anfangen, doch dann sagte Opa Dom: »Mensch, können wir froh sein, dass Kühe nicht fliegen können, oder?«
Einen Moment stutzten sie, dann brachen alle in befreiendes Gelächter aus.
Mutti nahm zwei Teller aus dem Schrank, gab in jeden eine Kelle mit dampfender Buchstabensuppe und stellte sie vor die Kinder. »Du auch?«, fragte sie ihren Vater.
»Ich esse keine Suppe, die als Pulver aus dem Päckchen kommt.«
»Ich muss mit dem, was Kalle mir an Haushaltsgeld gibt, auskommen. Arbeiten lässt er mich nicht.« Mutti ließ sich auf den Stuhl fallen und verschränkte die Arme.
Die Mädchen pusteten in die heiße Suppe auf ihren Löffeln.
Opa Dom seufzte. »Ich kann dir was geben. Hab heute einen Besuch. Bin mit’m Rad.«
Zwischen den Augen seiner Tochter erschien eine steile Falte.
Wenn Opa Dom mit dem Fahrrad kam, bedeutete es: Opa und Heidi fuhren »auf Besuch«. Er nahm sie auf den Gepäckträger. Hinten hatte er extra zwei klappbare Dinger angebracht, auf denen sie ihre Füße abstellen konnte, damit sie nicht in die Speichen gerieten. Früher war Katja mit ihm gefahren, aber das war lange her. Sie konnte sich kaum noch daran erinnern.
Mutti sagte: »Nee. Nicht das Geld. Damit ist Schluss. Sie ist zu groß und kriegt das mit. Mach deine Sache allein.«
»Na denn«, sagte Opa Dom und stand ächzend auf. »Wird schon gut gehen.« Er zupfte Katja und Heidi am Ohrläppchen und humpelte hinaus.
Nach diesem Tag verschwand er.
Zunächst sah Katja ihn eine Weile nicht. Aber das war erst mal nichts Besonderes. Opa Dom arbeitete bei der Bahn, hatte oft abends oder nachts Dienst, dann schlief er tagsüber. Er hatte ein winziges Postenhäuschen, in dem er manchmal übernachtete, neben den Schienen auf der Strecke des Haller Willem. Einmal hatte er Katja mitgenommen. Es war darin duster, überheizt und absolut langweilig gewesen. Früher, als Opa Dom noch beide Füße gehabt hatte, war er Streckenwärter gewesen, aber das war vor Katjas Geburt gewesen.
Einige Wochen später gingen die Mädchen nach dem Kindergottesdienst zu Oma. Der Mittagstisch war nur für drei gedeckt.
»Ist Opa im Keller?«, fragte Katja.
Oma antwortete nicht. Vielleicht hatte sie die Frage nicht verstanden, sie hörte manchmal schlecht.
Katja lief in den Bastelkeller. Ein angefangenes Schiff aus Streichhölzern stand dort, daneben lag Opas Werkzeug: ein Messer, um die Köpfe der Streichhölzer abzutrennen, ein Metallschaber zum Zerkleinern der Hölzchen, ein Winkel, Bleistifte, ein Anspitzer, Holzleim, ein Pinsel und ein Schneidebrett. Seit Katja vor ein paar Wochen zuletzt hier gewesen war, hatte er offenbar nicht weiter daran gearbeitet. Dabei saß er eigentlich jede freie Minute in seinem Keller. Bei genauem Hinsehen bemerkte sie, dass die Utensilien verstaubt waren, als seien sie seit Langem nicht benutzt worden. Komisch.
Oben rief Oma zum Essen. Es gab paniertes Kasslerkotelett, Salzkartoffeln und Bohnensalat. Oma sah müde und mürrisch aus.
»Kommt Opa nicht zum Essen?«, fragte Heidi.
»Nein«, antwortete Oma mit scharfem Unterton. Dabei stach sie heftig mit der Gabel in die Bohnen.
Sie aßen schweigend weiter. Eigentlich war Oma eine freundliche Person, so wie in letzter Zeit hatte Katja sie vorher nie erlebt. Irgendetwas war merkwürdig. Wo war Opa Dom? Warum kam er nicht zum Essen?
»Hat Opa Dienst?«, fragte sie.
»Nein.« Heftig traktierte Oma das Kotelett mit ihrem Messer. Die Kinder zuckten zusammen, als sie das Besteck mit einem klirrenden Geräusch auf den Teller warf und mit eisiger Stimme sagte: »Ich will seinen Namen in meinem Haus nie wieder hören, habt ihr das verstanden?«
»Nein«, antwortete Katja.
»Wie bitte?«
»Nein, ich hab das nicht verstanden.« Als Oma sie anstarrte, erklärte Katja: »Ich verstehe nicht, warum wir Opas Namen nicht sagen sollen, er ist unser Opa. Es ist doch euer Haus, nicht nur deins, und er …«
»Schluss jetzt!«, rief Oma. »Du kannst von mir aus alles essen, aber du musst nicht alles wissen. Ich will von Opa nie mehr hören, weder hier noch sonst wo. Und das ist mein letztes Wort.«
Sie verließ die Küche, kurz darauf knallte oben die Schlafzimmertür. Katja hielt den Atem an. Was war hier los? War Opa Dom was passiert? Aber das wäre ein Grund zu weinen und traurig zu sein, deswegen konnte Oma nicht so furchtbar wütend auf ihn sein. Und das war sie, wütend. Vielleicht hatte er sie verlassen? In der Schillerstraße wohnte eine Frau mit drei Kindern, deren Mann hatte die Familie verlassen, wegen einer anderen. Ob das der Grund für Omas Verhalten war?
Keines der Mädchen wagte zu reden. Schweigend aßen sie ihre Teller leer.
Zu Hause fragte Katja ihre Mutter, wo Opa Dom sei. Die zuckte die Schultern und machte genauso ein abweisendes Gesicht wie Oma.
»Oma hat gesagt, wir dürfen seinen Namen nicht sagen!«, platzte Heidi heraus.
»Dann haltet euch daran«, schnauzte Mutti.
Opa Dom kam nicht zurück.
Katja hatte schreckliche Angst, dass er gestorben sein könnte. Zwar gab es keine Anzeichen dafür, aber irgendeinen Grund musste sein Verschwinden haben. Zusammen mit Heidi suchte sie den Friedhof nach frischen Gräbern ab, aber es gab keins, das sie nicht zuordnen konnten. Sie hatte überlegt, den Schutzmann zu informieren, dass Opa nicht mehr da war, vielleicht hatte er eine Ahnung, was man davon halten sollte. Vielleicht hatte es ein Unglück gegeben, und Opa Dom lag im Krankenhaus. Aber auch das war nicht logisch, dann hätte Oma als Erste davon erfahren.
Katja und Heidi liefen zu seinem Postenhäuschen an den Eisenbahnschienen, darin saß ein Fremder.
Wie konnte es sein, dass Opa wie vom Erdboden verschluckt war, dass niemand ihn vermisste, keiner von ihm sprach, dass sich alle Erwachsenen verhielten, als habe es ihn nie gegeben?
Opas Fahrrad und das Motorrad verstaubten im Schuppen, der Bastelkeller blieb verwaist.
Opa Dom tauchte nicht wieder auf, und alle schienen ihn vergessen zu haben. Schlimmer noch, es war, als habe es ihn nie gegeben. Oma bediente im Milchladen ohne ein einziges Lächeln. Zu Hause war sie wortkarg und schlecht gelaunt.
Abends, wenn Heidi und Katja in ihren Betten lagen, überlegten sie flüsternd, was mit Opa Dom passiert war. Eines Tages wagte Katja es sogar noch einmal, Mutti danach zu fragen. Es war doch völlig verrückt, dass sie sich überhaupt keine Sorgen machte und den Namen ihres eigenen Vaters nicht mehr aussprach!
Aber Mutti sah sie nur streng an und sagte: »Ein für alle Mal, ich will nichts mehr davon hören und basta.«
3. KAPITEL
Mathilde
APRIL 1936
Um viertel vor fünf schlug Mathilde die Augen auf, und wie jeden Morgen war sie sofort munter. Sie setzte sich auf die Bettkante, griff den Wecker, den sie von der Herrschaft zum einundzwanzigsten Geburtstag bekommen hatte, und legte den kleinen Hebel um, bevor er losrasselte. Barfuß lief sie zum Dachfenster, stellte sich auf die Zehenspitzen und lugte hinaus. Hinter den Dächern der Bielefelder Altstadt ging die Sonne auf, begleitet vom ausgelassenen Gezwitscher der Vögel. Schwalben sausten pfeilschnell über die Dachfirste und verschwanden unter der Dachkante des Hauses gegenüber. Ob es immer dieselben waren, die in den letzten Jahren dort genistet hatten? Mathilde wusste, dass Schwalben den Winter in Afrika verbrachten und auf ihrer Reise Tausende von Kilometern zurücklegten. Und dass sie ihren Gefährten ein Leben lang treu blieben. Wie alt wurden Schwalben? Vielleicht wohnten sie schon genauso lange drüben wie Mathilde hier?
Die Glocke der Nicolaikirche schlug fünf Mal. Mathilde lief zur Kommode, um sich zu waschen. Der letzte Winter war lausig kalt gewesen, manchmal war das Wasser im Eimer halb gefroren, und sie hatte sich zähneklappernd mit eisiger Katzenwäsche begnügt. Heute genoss sie das erfrischende Morgenritual, ohne zu frieren. Danach befeuchtete sie die hölzerne Zahnbürste und stippte sie in das Schächtelchen mit dem Putzpulver. Seit ein paar Jahren durfte sie in der Drogerie mithelfen. Zuerst hatte sie stundenlang Zimmermanns Zahnpulver in die Pappschachteln füllen und danach die Banderolen aufkleben müssen. Aber rasch hatte sie das Mischverhältnis aus Borax, Kreide, Carbonat und Glycerin gekannt und das Pülverchen für die Kunden fortan bei Bedarf selbst angemischt. Inzwischen hatte Herr Zimmermann sie mehrmals in die Dunkelkammer mitgenommen und sie geduldig gelehrt, wie man Filme entwickelte.
Zurzeit konnte sie schon mittags in die Drogerie gehen. Im Haushalt gab es nicht viel zu tun, seit Frau Zimmermann und die Kinder am Gründonnerstag abgereist waren. Sie befanden sich in einem Kurheim an der Nordsee, um ihr Asthma auszukurieren. Das war jedenfalls die offizielle Version. Mathilde hatte sich ihrer Herrschaft gegenüber nicht anmerken lassen, dass sie den wahren Grund sehr wohl kannte. Wenn man zehn Jahre als Hausmädchen für eine Familie arbeitete, wusste man alles, wirklich alles über sie.
Mathilde zog sich an und ging in die Küche, um das Frühstück vorzubereiten.
Herr Zimmermann und Mathilde lebten jetzt allein in dem großen Haus am Bielefelder Alten Markt, es fiel im Haushalt wenig Arbeit an. Obwohl Mathilde sich wegen der allgemeinen Situation sorgte, gefiel es ihr, dass sie nun täglich in der Drogerie arbeiten durfte. Es hieß, sie müsse dort so lange aushelfen, bis neues Personal gefunden worden sei. Ein Grund mehr für Mathilde, alles zu lernen, was sich ihr bot. Ihre Ziehmutter hatte immer gesagt: »Stiehl, was du kriegen kannst, aber lass jedem das Seine!« Damit hatte sie gemeint, dass Mathilde mit den Augen »stehlen« und in ihrem Gedächtnis alles verwahren sollte, was ihr im Leben von Nutzen sein konnte. Die vielfältige Arbeit in der Drogerie gehörte gewiss dazu.
Kaum hatte sie im Esszimmer den Tisch gedeckt, die gestärkte Serviette gefaltet und die Kaffeekanne auf das Stövchen gestellt, hörte sie Herrn Zimmermann herunterkommen.
Er sah beängstigend schlecht aus, wirkte müde mit den dunklen Schatten unter den Augen. Tiefe Falten hatten sich neben seinem Mund eingegraben; dass er zuletzt gelacht hatte, war lange her. Kein Wunder, bei den Sorgen, die der Mann hatte.
»Guten Morgen, Mathilde«, sagt er matt. Anstatt etwas von dem frischen Brot und dem Westfälischen Schinken zu essen, zündete er sich eine Zigarette an. Mathilde schenkte Kaffee ein. Als er die Tasse hob, sah sie, dass seine Hand zitterte.
Ach, wie hatte Herr Zimmermann sich in den letzten Jahren verändert. Mathilde war noch keine fünfzehn gewesen, als sie im April 1926 in diesen Haushalt gekommen war. Damals war ihr Dienstherr kräftig und vital gewesen, immer zu Scherzen aufgelegt, und er hatte mit der gnädigen Frau eine Ehe geführt, die Mathilde sich zuvor nicht hatte vorstellen können. Wie auch. Ihre leibliche Mutter war früh gestorben, der Vater zwei Jahre später. Sie konnte sich kaum an die Eltern erinnern. Mathilde und ihr älterer Bruder Rudolf waren beim Bruder des Vaters und dessen Frau aufgewachsen. Sie waren einfache, anständige Leute, die ihr Lebtag geschuftet hatten und in deren Alltag es keinen Raum für Scherze oder gar liebevolle Blicke gegeben hatte.
Bei Zimmermanns war das anders gewesen. Hier hatte Mathilde zum ersten Mal gespürt, wie sich eine Verbindung anfühlen konnte, die aus Liebe eingegangen worden war.
Als sie ins Haus kam, war die Tochter drei Jahre alt und Frau Zimmermann wieder in anderen Umständen gewesen. Bei der Geburt des Sohnes war Mathilde sogar dabei gewesen und hatte der Hebamme assistiert. »Was würde ich nur ohne dich anfangen«, hatte Frau Zimmermann während des Wochenbettes oft gesagt.
Damals hatte Mathilde davon geträumt, auch einen Mann zu finden, der so humorvoll und liebevoll war wie Herr Zimmermann.
Es hatte sich nicht ergeben. Am ersten Mai würde sie fünfundzwanzig. Obwohl sie ganz passabel ausschaute mit dem glänzenden dunklen Haar und den blauen Augen, war kein Ehemann in Sicht. Sie würde wohl ein Fräulein bleiben. Aber sie hatte alles, was man zum Leben brauchte. Hier war ihr Zuhause, die Zimmermanns waren jetzt ihre Familie, ihr Wohlbefinden war stets Mathildes Lebensaufgabe gewesen. Aber seit 1933 hatte sich das Leben schleichend verändert. Ob Frau Zimmermann und die Kinder zurückkommen würden? Die Frage wich im Laufe der Wochen einer sicheren Gewissheit, dass dem nicht so war.
Herr Zimmermann holte sie aus ihren Gedanken zurück: »Mathilde … ich … ich möchte … ich muss …« Er schien um Worte zu ringen, bevor er schneller sprechend fortfuhr: »Ich weiß, dass du fleißig gelernt hast, deshalb wiederhole bitte: Wie entwickelst du einen Film?«
Es klang, als habe er eigentlich etwas anderes sagen wollen. Mathilde antwortete, ohne zu zögern: »Der belichtete Film wird in den Behälter mit Entwickler eingetaucht. Danach kommt er für dreißig Sekunden ins Stoppbad. Dann gebe ich den Film in die Wanne mit Fixierer und spüle ihn anschließend gründlich in Wasser ab. Zuletzt wird er zum Trocknen aufgehängt. Wenn der Film trocken ist, kann ein Abzug hergestellt werden.« Sie wollte noch sagen, dass der Film in den Vergrößerer eingesetzt und das Bild auf das Fotopapier projiziert werden musste, aber Herr Zimmermann unterbrach sie mit einer Handbewegung. Schade, sie hätte ihm sogar die Zusammensetzung der Chemikalien und ihr genaues Mischverhältnis nennen können, aber sie spürte, dass es ihm in Wahrheit um etwas anderes ging.
Er nickte anerkennend und lächelte für einen winzigen Moment, aber nur mit dem Mund, seine Augen blieben ernst. »Ach Mathilde, so fleißig und klug bist du, aus dir wäre eine gute Fotolaborantin geworden, wenn nicht …« Er verstummte und fuhr sich mit der Hand durch die blonden Haare. Mathilde sah ihm an, dass er wieder nach passenden Worten suchte. Er drückte die halb gerauchte Zigarette im Aschenbecher aus und zündete sich sofort eine neue an. Jetzt flüsterte er fast. »Ich habe inständig gehofft, niemals sagen zu müssen, was ich dir heute sagen muss, aber …«
Sie ahnte, was gleich geschehen würde. Seit Wochen hatte sie es befürchtet, und nachdem Frau Zimmermann mit den Kindern abgereist war, hatte sie es in ihrem Innersten sogar sicher gewusst. Als Herr Zimmermann sie aufforderte, sich zu ihm an den Tisch zu setzen, hatte sie keinerlei Zweifel mehr. Ihr Herz pochte wild, ihre Hände waren plötzlich eiskalt.
Er würde sie entlassen, das war ihr klar. Natürlich würde er seiner Familie folgen, solange es noch möglich war, er hatte doch gar keine andere Wahl.
Mathilde unterdrückte die aufsteigenden Tränen, versuchte, sich innerlich zu wappnen, irgendwie, um auszuhalten, was er sagen würde, stark wollte sie sein und es ihm nicht schwer machen. Sie selbst würde ja weiterleben können wie bisher, sie hatte keine jüdische Mutter wie Frau Zimmermann, ihr drohte keinerlei Gefahr.
»Mathilde, ich habe das Haus samt der Drogerie verkauft.« Herr Zimmermann senkte den Kopf. »Noch habe ich einen guten Preis bekommen … ich werde … auch … an … die … Nordsee ziehen.«
Mathilde versuchte, ruhig zu atmen, nicht zu weinen, nicht zu zittern, Haltung zu bewahren. Niemals würde sie zugeben, dass sie wusste, wohin er gehen würde, mitnichten an die Nordsee, sondern nach Amerika, zu seiner Frau und den Kindern, die mit dem Schiff längst dort angekommen waren. Und sie, Mathilde, würde alles verlieren, ihr Zuhause, ihre Arbeit, ihren Alltag und ihren Lebensinhalt.
Jetzt konnte sie ihre Tränen nicht länger zurückhalten.
»Mathilde, es tut mir aufrichtig leid.« Er klang bekümmert. »Aber wir lassen dich nach all den Jahren, in denen wir mit deinen Diensten mehr als zufrieden waren, nicht unversorgt zurück.« Er zog ein Kuvert aus dem Jackett und schob es ihr zu. »Hier ist dein Lohn für drei Monate und zusätzlich ein bisschen Geld. Du wirst es brauchen, wenn du dir ein Zimmer mietest.«
Mechanisch nickte Mathilde und presste ein leises »Danke« hervor.
»Darin ist auch die Adresse meines Freundes Bönisch. Er ist Frauenarzt, mit eigener Praxis. Er ist gewillt, dich als Sprechstundengehilfin anzulernen.«
Die Wörter prasselten auf Mathilde ein, nur mit Mühe gelang es ihr, einen klaren Kopf zu behalten. Frauenarzt? Sprechstundengehilfin? Praxis? Anlernen? Sie war ein Dienstmädchen! Was passierte denn hier gerade mit ihrem Leben?
»Hörst du, du musst deine Sachen packen und bei Dr. Bönisch vorstellig werden, am besten noch heute«, sagte Herr Zimmermann eindringlich.
Heute? Jetzt? Sie konnte nicht antworten, die Enge in ihrer Kehle ließ sie kaum atmen.
»Du kannst Dr. Bönisch vertrauen.« Herr Zimmermann zog einen zweiten Umschlag hervor. »Das ist dein Zeugnis. Auch im Namen meiner Frau danke ich dir.« Er erhob sich.
Sie nahm die Papiere, stand auf, reichte ihm die Hand und schaute ihm in die Augen. »Ja, dann … Vielen Dank für alles. Und … alles Gute an der Nordsee.«
Sie wussten beide, dass sie sich nie wiedersehen würden.
Mathilde verließ das Zimmer mit hastigen Schritten und eilte hinauf in ihre Kammer.
Sie weinte, während sie ihre Siebensachen packte. Das konnte nicht wahr sein. Sie kannte nichts anderes als das frühere Leben bei ihren Stiefeltern und die vielen Jahre hier im Haus, wie konnte das von jetzt auf gleich zu Ende sein? Gehilfin sollte sie sein? Bei einem Arzt? Mathilde war in ihrem ganzen Leben noch nie bei einem Arzt gewesen, was gab es denn da zu tun? Und wo sollte sie wohnen, wo heute Abend schlafen? Sie musste so schnell wie möglich mit Rudolf reden. Ihr blieb keine Wahl; wenn sie sich bei Dr. Bönisch vorgestellt hatte, würde sie sich auf den Weg nach Brackwede machen und ihren Bruder fragen müssen, ob er sie aufnehmen konnte.
Schon mittags um kurz nach zwölf verließ Mathilde das Haus am Alten Markt. In einer Hand trug sie einen Koffer, in der anderen eine Tasche. Ihr Lohn für drei Monate betrug hundertzwanzig Mark, dreißig Mark hatte Herr Zimmermann dazugegeben. Das Geld hatte sie in einem Brustbeutel versteckt, den sie unter ihrem Kleid trug. Sie ging los, ohne ein einziges Mal zurückzuschauen, und ließ fast ein Jahrzehnt ihres Lebens hinter sich.
Am früheren Schuh- und Sportgeschäft Hesse & Co. verharrte sie einen Moment. Im April 1933 hatte sie fassungslos an dieser Stelle gestanden und die Schmierereien an den Schaufenstern gelesen: Heil Hitler! Schuhe kauft man nur bei Wittler! Kauf sie bloß nicht bei Hesse, sonst bekommst du was in die Fresse! Und dann hatten die Leute hinter vorgehaltener Hand erzählt, das Ehepaar Hesse habe sich selbst töten wollen. Nicht mal das hätten die Juden gekonnt, hatte es hämisch geheißen. Als bekannt geworden war, dass die Familie ins Ausland fliehen wollte, war das Haus an den Prokuristen des Unternehmens veräußert worden. »Für’n Appel und ’n Ei«, sagten die Leute. Was wohl aus dem Ehepaar und den drei Töchtern geworden war? Mathilde wusste es nicht, und man fragte auch nicht. Nur gut, dass Herr Zimmermann rechtzeitig hatte verkaufen können. Wer wusste schon, wie das alles weitergehen würde. Hoffentlich war er bald in Amerika, in Sicherheit. Sie würde niemandem etwas verraten, niemals.
Aber was wurde aus ihr? Sie seufzte. Wenn Herr Zimmermann meinte, dass sie zu Dr. Bönisch gehen sollte, hatte das seine Richtigkeit.
Das Gepäck war schwer, Mathilde musste immer wieder rasten und es abstellen, und dann begann es auch noch heftig zu regnen.
Als sie die Adresse in der Hindenburgstraße, die vor einiger Zeit in Adolf-Hitler-Straße umbenannt worden war, erreicht hatte und klingelte, öffnete ein älterer Mann die Tür. Seine Statur unter dem dunkelgrauen Anzug war nahezu bullig. Er hatte dichtes, grau meliertes Haar und schaute sie aus blauen Augen durch die Gläser seiner runden Brille freundlich an. »Die Sprechzeit beginnt wieder um drei.«
»Ich möchte nicht in die Sprechstunde. Ich bin Mathilde Schneeweiß, Herr Zimmermann schickt mich.«
Dr. Bönisch nickte langsam. In dem Moment bemerkte er wohl, dass ihr das Wasser aus den Haaren lief, und öffnete die Tür ein Stück weiter. »Sie sehen aus wie ein nasser Pudel, kommen Sie mal besser ins Wartezimmer.« Er zeigte auf ihr Gepäck. »Wenn Sie sich was Trockenes anziehen wollen …?«
Mathilde stellte Koffer und Tasche ab und wischte sich mit dem Ärmel den Regen aus dem Gesicht.
Nachdem Dr. Wiegald Bönisch ihr ein Handtuch gebracht und sie in das leere Wartezimmer geführt hatte, öffnete sie dort ihren Koffer, zog ihr zweites Paar Schuhe und trockene Sachen an und hängte das nasse Zeug über eine Stuhllehne.
»Sie gelten als zuverlässig und fleißig«, begann Bönisch, als sie in trockner Kleidung in seinem Sprechzimmer Platz genommen hatte.
»Waren Sie schon mal in einer gynäkologischen Praxis?«
»Nein. Es gab keinen Anlass.«
»Nun, um hier zu arbeiten, ist eine Menge Fingerspitzengefühl erforderlich und eine gewisse Rigorosität. Zimmermann hätte Sie nicht zu mir geschickt, wenn er Ihnen derlei Eigenschaften absprechen müsste.« Er sah Mathilde in die Augen. »Sie wirken, als wollten Sie etwas fragen?«
Mathilde zögerte kurz. »Rigorosität? Wieso?«
»Sie müssen sich durchsetzen können. Keine Patientin lässt eine frauenärztliche Untersuchung entspannt über sich ergehen. Abgesehen von der naturgemäß unangenehmen Prozedur kann die Untersuchung schmerzhaft sein. Die Patientin verkrampft sich, wenn sie sich freimachen muss, was die Untersuchung schwierig machen kann.«
Mathilde schnappte nach Luft. Ach du liebe Güte, wohin war sie denn hier geraten! An so etwas hatte sie noch niemals gedacht.
»Zimmermann hat gesagt, dass Sie seiner Frau im Wochenbett eine große Hilfe waren.«
Mathilde nickte.
»Na sehen Sie, dann wissen Sie schon einiges, was den Alltag in meiner Praxis bestimmt.«
Er erklärte, dass sie von Montag bis Samstag zu arbeiten habe, von acht Uhr morgens bis achtzehn Uhr abends.
Mathilde schaute auf die Wanduhr hinter dem Schreibtisch. »Sie sagten, die Sprechstunde beginnt um drei?«
»Ja?«
»Was geschieht, wenn keine Sprechstunde ist? So wie jetzt?«
»Das ist wieder eine gute Frage.« Er schmunzelte. »Eigentlich hat sich meine Gehilfin mittags um administrative Dinge gekümmert. Aber«, er zuckte mit den Schultern, »sie hat gekündigt, nachdem ich mit dem Heimtückegesetz in Konflikt geraten bin.«
Mathilde sah ihn erschrocken an. »Was bedeutet das?«
»Das bedeutet, dass ich von der Gestapo verhört wurde, weil ich beim Großkampftag zum Weihefest für den Horst-Wessel-Stein nicht angemessen gejubelt habe.«
»Das klingt beängstigend.«
Bönisch winkte ab. »Es war ein Denunziant, und es hat nichts weiter nach sich gezogen. Außer der Kündigung meiner Gehilfin.«
»Wann war denn das?«, fragte Mathilde neugierig.
Er kniff die Augen hinter den Brillengläsern zusammen. »Dass ich nicht gejubelt habe? Na, im Oktober, als sie«, seine Stimme wurde nun spöttisch, »Bielefelds bestem Sohn den großen Aufmarsch beschert haben. Dass ich zum ersten Mal vorgeladen wurde, war nur wenige Tage später.«
»Zum ersten Mal?«, rutschte es Mathilde heraus. »Entschuldigung, es steht mir nicht zu, solche Fragen zu stellen.«
Dr. Bönisch sah sie wieder mit diesem offenen Blick an. »Fragen Sie, was Sie wissen wollen, Fräulein Schneeweiß, bitte. In diesen Zeiten ist es wichtig zu wissen, mit wem man es zu tun hat. Und anhand Ihrer Fragen weiß auch ich das dann.« Er bot ihr eine Zigarette an, die sie kopfschüttelnd ablehnte, und zündete sich eine an, bevor er weitersprach. »Das zweite Mal verdanke ich meinem jungen, eifrigen Kollegen Dr. Blomeyer. Er hat bei der Gestapo mein Berufsverbot gefordert, weil ich angeblich ein Luftmanöver nicht angemessen gewürdigt habe.« Bönisch lächelte, aber seine Augen blieben ernst. »Auch in diesem Fall entbehrte die Denunziation jeder Grundlage, sodass die Verhöre bei der Gestapo ergebnislos verliefen.«
Mathilde glaubte ihm. Und sie vertraute diesem Mann, ohne ihn zu kennen. Sie spürte, dass er eine ehrliche Haut war.
Er blies den Rauch seiner Zigarette an die Zimmerdecke. »Haben Sie weitere Fragen? Nur zu!«
»Mich würden die Aufgaben einer Gehilfin interessieren.«
Als er begann, aufzuzählen, hob sie die Hand. »Darf ich mir Notizen machen? Alles kommt so unverhofft auf mich zu, dass ich fürchte, vieles sofort wieder zu vergessen. Wissen Sie, als ich heute Morgen aufstand, war ich Hausmädchen in einem Drogistenhaushalt und wusste genau, was ich zu tun hatte. Und nun sitze ich hier und weiß nicht mehr, wer ich bin und was überhaupt aus mir werden soll …« Unvermittelt begann sie zu weinen.
Dr. Bönisch wartete, bis sie sich beruhigt und ihre Nase geputzt hatte. Er schaute sie mit unergründlichem Blick an, als er ihr Papier und Bleistift reichte. Dann zählte er langsam auf.
Die Gehilfin hatte die Patientinnen zu begrüßen, Akten über sie anzulegen und diese zu führen. Sie sollte die Frauen ins Untersuchungszimmer bringen und sie gegebenenfalls anweisen, sich auszuziehen. Sie war für die Sterilisation und Vorbereitung von Instrumenten und Geräten vor und nach den Untersuchungen zuständig. Außerdem müsse sie bei den Behandlungen assistieren, indem sie ihm unaufgefordert die richtigen Instrumente reiche. Für die Reinigung und Wartung der Praxisräume und aller Gerätschaften sei sie ebenfalls verantwortlich.
Mathilde hatte ein ganzes Blatt eng beschrieben.
Nachdem er geendet hatte, sah Bönisch sie mit einem prüfenden Blick an. »Sie wissen, dass Ärzte mehr Patienten betreuen müssen, seitdem jüdische Kollegen nicht mehr praktizieren dürfen?«
Als Mathilde ihn ratlos ansah, erklärte er, dass es jetzt ein Abkommen zwischen dem Hartmannbund und Krankenversicherern gäbe, das jüdische Ärzte auch aus diesem Versorgungsbereich ausschloss. Und mit der Reichsärzteordnung sei den Juden ab 1935 die Approbation komplett verwehrt oder entzogen worden. Natürlich, das wusste Mathilde, sie hatte die Schilder an Arztpraxen gesehen, die mit der Aufforderung Achtung, Jude! Besuch verboten! überklebt worden waren.
»Das Reichsarbeitsministerium führt ein Register und regelt die Kassenzulassungen, natürlich ist es auch möglich, politisch oppositionellen Kollegen die Zulassung zu entziehen.«
Mathilde versuchte, all diese Informationen zu verstehen. »Aber … warum gibt es so eine Bürokratie in einem Beruf, der Menschen helfen und sie heilen soll?«, fragte sie.
Bönisch schien sich jedes Wort sorgfältig zu überlegen. »Seit 1933 gibt es über jeden Patienten auszufüllende Formulare. Es hieß erst, sie würden streng vertraulich behandelt werden. Darin muss, unter anderem, die Rassenzugehörigkeit angegeben werden. Kurz darauf gab es ein neues Rundschreiben, in dem die Namen sämtlicher jüdischer Ärzte bekanntgegeben wurden.«
Mathilde fühlte sich durch seine Ehrlichkeit verunsichert. »Herr Doktor, ich würde nur eine angelernte Gehilfin sein, die von Politik und solchen Papieren nichts versteht.«
Er nickte bedächtig. »Ich habe nichts gesagt, das nicht öffentlich bekannt wäre, und ich habe die Erlasse der Regierung nicht kommentiert.«
Was wollte er ihr damit sagen? Als hätte er diesen Gedanken gehört, fuhr er fort: »Damit will ich Ihnen deutlich machen, dass wir einander vertrauen und uns einig sein müssen, dass die Gesundheit und die Heilung der Patienten immer im Vordergrund stehen.« Er fügte hinzu: »Ungeachtet ihrer Herkunft oder ihrer Religion.«
Jetzt hatte Mathilde verstanden. Aber wie sollte sie angemessen antworten? Sie dachte an das Schicksal der Familie Hesse, an Herrn Zimmermann, an die Geschichten, die nicht in der Zeitung standen und über die nur hinter vorgehaltener Hand geflüstert wurde. Nein, sie kannte Dr. Bönisch nicht und würde sich keinesfalls zu einer Äußerung hinreißen lassen, die ihr gefährlich werden konnte.
Der Arzt hatte ihr beim Denken zugeschaut. »Ich verstehe Ihre Lage und kann Ihre Unsicherheit nachvollziehen. Sie müssen die Stellung nicht annehmen, wenn sie Ihnen nicht liegt oder Sie etwas anderes in Aussicht haben.«
»Ich habe nichts in Aussicht. Bis heute früh habe ich nicht geahnt, dass ich jetzt hier sein würde und den Rest meines Lebens von einer Minute zur anderen neu planen muss. Wohin soll ich gehen? Ich bin eine alte Jungfer von fast fünfundzwanzig Jahren, nach der Schule bin ich sofort in den Haushalt zu Zimmermanns gekommen, ich kenne nichts anderes.«
Sie stutzte, weil er aufgelacht hatte. »Machen Sie sich keine Sorgen. Sie sind jung und hübsch und werden gewiss keine alte Jungfer werden.« Sein Gesicht wurde wieder ernst. »Sie haben die richtigen Verwandten, Ihre Referenzen sind exzellent. Ich hörte, dass Sie versiert in Laborarbeiten und sogar in der Lage sind, selbstständig Filme zu entwickeln und Fotografien zu erstellen, und dass Sie im Verkauf in der Drogerie eingesetzt wurden. Sie werden sich in meiner Praxis rasch einleben. Wenn Sie wollen, wie gesagt, Sie müssen nicht!«
Seine Worte klangen beruhigend, sein Blick wirkte klug und verständnisvoll. Mathilde konnte sich vorstellen, dass er ein guter Arzt war, einer, dem man vertrauen konnte. »Da ist noch etwas …«
Bönisch lächelte. »Sie wollen wissen, wie viel Sie verdienen. Dasselbe wie bei Zimmermann, zehn Mark in der Woche.«
»Nein, das meinte ich nicht.«
»Sondern?«
»Ich habe kein Zimmer. Vielleicht kann ich bei meinem Bruder in Brackwede unterkommen. Ich habe allerdings noch nicht mit ihm sprechen können. Er wohnt mit Frau und Kind in einem winzigen Bahnwärterhäuschen.«
Bönisch schaute nachdenklich drein. »Wie gesagt, die Arbeitszeit ist von morgens um acht bis sechs Uhr am Abend. Der Fußweg nach Brackwede dauert mindestens eine Stunde, im Winter ist es morgens und abends noch dunkel. Ich kann Ihnen in meinem Haus ein Zimmer anbieten.«
Mathilde zögerte. Lebte er allein? Wenn, dann war es unschicklich oder sogar leichtsinnig, das Angebot anzunehmen. Andererseits … er war ein Doktor und ein Freund von Herrn Zimmermann.
Trotzdem. Konnte sie ihn fragen, ob er Familie hatte? Sie entschloss sich zur Ehrlichkeit.
»Wenn ich ein wenig mehr von Ihnen wüsste, würde mich das vielleicht beruhigen.« Sie bemerkte seinen erstaunten Blick. »Bitte entschuldigen Sie, aber ich bin nicht sicher, ob es sich gehört, im Hause eines Mannes zu leben.«
Er schmunzelte. »Es ist gut, dass Sie fragen. Fragen Sie immer, wenn Sie etwas nicht verstehen, sich unsicher sind oder etwas wissen wollen. Es gibt keine dummen Fragen! Seien Sie unbesorgt. Ich bin verwitwet und kinderlos.« Er machte eine Pause, in der er verschmitzt dreinschaute. »Ich lebe aber mit drei Damen unter einem Dach, das müssten Sie akzeptieren.« Er lachte wieder, als er ihr entsetztes Gesicht sah. Dann erklärte er: »Frau Nolting ist meine Haushälterin, ohne sie würde ich glatt verhungern. Erika geht ihr zur Hand und kümmert sich um die Wäsche. Und Mizzi ist eine streunende Katze, die uns die Mäuse vom Leib hält und ab und zu im Haus übernachtet.«
»Oh, meine Zieheltern hatten auch eine Katze, ich habe sie mit dem Fläschchen aufgezogen, ihre Mutter war von einem Zug erwischt worden.«
»Sie sind bei Zieheltern aufgewachsen?« Mit wenigen Worten erzählte Mathilde vom Tod der Eltern und dass sie und Rudolf bei einem Onkel und seiner Frau aufgewachsen waren.
»Rudolf ist der Bruder in Brackwede?«
»Ja. Er ist zwölf Jahre älter als ich und arbeitet bei der Eisenbahn, wie früher unser Ziehvater. Er lebt in dem Häuschen, in dem wir aufgewachsen sind.«
Mehr wollte sie nicht preisgeben. Es interessierte Bönisch gewiss nicht, dass ihre Kindheit von Armut, dem Kohlrübenwinter und dem Großen Krieg überschattet gewesen war.
Damit war es ausgemacht. Mathilde zog in das Mansardenzimmer, lernte die »Damen« des Haushaltes kennen und begann am nächsten Morgen mit ihrer Arbeit in der Praxis.
4. KAPITEL
Katja
JUNI 1965
Es war schon in der großen Pause über dreißig Grad heiß, deswegen gab es nach der dritten Stunde hitzefrei. Beim letzten Ton des Klingelns hatte Katja ihre Siebensachen im Tornister verstaut und lief hinunter zum Klassenraum der Fünftklässler. Heidi stand schwatzend mit einigen Mitschülerinnen zusammen, wahrscheinlich ging es darum, wer wem welchen Spruch ins Poesiealbum geschrieben und welche Rosenbilder es dazu gegeben hatte. Katja musste lächeln. Die Interessen zehnjähriger Mädchen schienen sich nie zu ändern, jedes Kichern und jede Streiterei der »Kleinen« kannte sie zu gut. Ihre Tage an der Realschule waren indes gezählt: Am ersten Juli fingen die Sommerferien an, dann würde Katja die Mittlere Reife in der Tasche haben. Und wenn für Heidi nach den Ferien die sechste Klasse begann, würde sie die Hauswirtschaftsschule besuchen, bevor sie ihre Lehre als Krankenschwester antreten konnte. Im Grunde hielt Katja dieses Jahr für verschwendet, aber sie musste mindestens siebzehn sein, um als Schwesternschülerin anfangen zu können. Wenn es nach ihr gegangen wäre, hätte sie Abitur gemacht und später studiert.