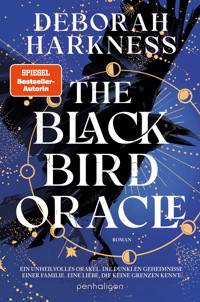Die All-Souls-Trilogie: Die Seelen der Nacht / Wo die Nacht beginnt / Das Buch der Nacht (3in1-Bundle) E-Book
Deborah Harkness
24,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 24,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 24,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die All-Souls-Trilogie - jetzt in einer Ausgabe.
Band 1: Die Seelen der Nacht
Diana Bishop ist Historikerin mit Leib und Seele. Dass in ihr zudem das Blut eines uralten Hexengeschlechts fließt, versucht sie im Alltag möglichst zu ignorieren. Doch dann fällt Diana in einer Bibliothek in Oxford ein magisches Manuskript in die Hände, und plötzlich wird sie von Hexen, Dämonen und Vampiren verfolgt, die ihr das geheime Wissen entlocken wollen. Hilfe erfährt Diana ausgerechnet von Matthew Clairmont, Naturwissenschaftler, 1500 Jahre alter Vampir – und der Mann, der Diana bald schon mehr bedeuten wird als ihr Leben …
Band 2: Wo die Nacht beginnt
Diana Bishop, Historikerin und Hexe, und Matthew Clairmont, Wissenschaftler und Vampir, haben es geschafft: Die Zeitreise in das historische London Elisabeths I. ist dank Dianas immer weiter erwachender Macht erfolgreich verlaufen. Doch kaum angekommen, wird die Liebe der beiden auf eine harte Probe gestellt, denn sie sind mitten in einer Welt der Intrigen, Spione und Geheimnisse gelandet. Geheimnisse, die auch Matthew betreffen und mit denen Diana lernen muss umzugehen. Ist ihre Verbindung stark genug, um dem standzuhalten? Und werden die beiden das Rätsel um das Manuskript Ashmole 782 nun endlich lösen?
Band 3: Das Buch der Nacht
Nach ihrer Zeitreise in das London Elisabeths der Ersten kehren Diana Bishop und Matthew Clairmont zurück in die Gegenwart, wo sie neue Herausforderungen, vor allem aber alte Feinde erwarten. In Sept-Tour, der Heimat von Matthews Ahnen, treffen sie aber auch endlich ihre Freunde und ihre Familien wieder. Außerdem werden sie mit einem tragischen Verlust konfrontiert, der besonders Diana sehr trifft. Die wahre Bedrohung für die Zukunft aber muss noch aufgedeckt werden, und dafür ist es von höchster Wichtigkeit, das Geheimnis um das verschollene Manuskript Ashmole 782 zu entschlüsseln und die fehlenden Seiten zu finden …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 3320
Veröffentlichungsjahr: 2019
Sammlungen
Ähnliche
Buch
Deborah Harkness ist Professorin für europäische Geschichte an der University of Southern California in Los Angeles. Für ihre wissenschaftlichen Arbeiten erhielt sie bereits mehrfach Stipendien und Auszeichnungen. Sie schreibt außerdem ein preisgekröntes Wein-Blog.
Ihre »All Souls«-Trilogie mit den Romanen »Die Seelen der Nacht«, »Wo die Nacht beginnt« und »Das Buch der Nacht« werden von Sky verfilmt, der erste Teil (»A Discovery of Witches«/»Die Seelen der Nacht«) wird in Deutschland im Frühjahr 2019 ausgestrahlt werden.
Die Seelen der Nacht
Diana Bishop ist Historikerin mit Leib und Seele. Dass in ihr zudem das Blut eines uralten Hexengeschlechts fließt, versucht sie im Alltag möglichst zu ignorieren. Doch dann fällt Diana in einer Bibliothek in Oxford ein magisches Manuskript in die Hände, und plötzlich wird sie von Hexen, Dämonen und Vampiren verfolgt, die ihr das geheime Wissen entlocken wollen. Hilfe erfährt Diana ausgerechnet von Matthew Clairmont, Naturwissenschaftler, 1500 Jahre alter Vampir – und der Mann, der Diana bald schon mehr bedeuten wird als ihr Leben …
Wo die Nacht beginnt
Diana Bishop, Historikerin und Hexe, und Matthew Clairmont, Wissenschaftler und Vampir, haben es geschafft: Die Zeitreise in das historische London Elisabeths I. ist dank Dianas immer weiter erwachender Macht erfolgreich verlaufen. Doch kaum angekommen, wird die Liebe der beiden auf eine harte Probe gestellt, denn sie sind mitten in einer Welt der Intrigen, Spione und Geheimnisse gelandet. Geheimnisse, die auch Matthew betreffen und mit denen Diana lernen muss umzugehen. Ist ihre Verbindung stark genug, um dem standzuhalten? Und werden die beiden das Rätsel um das Manuskript Ashmole 782 nun endlich lösen?
Das Buch der Nacht
Nach ihrer Zeitreise in das London Elisabeths der Ersten kehren Diana Bishop und Matthew Clairmont zurück in die Gegenwart, wo sie neue Herausforderungen, vor allem aber alte Feinde erwarten. In Sept-Tour, der Heimat von Matthews Ahnen, treffen sie aber auch endlich ihre Freunde und ihre Familien wieder. Außerdem werden sie mit einem tragischen Verlust konfrontiert, der besonders Diana sehr trifft. Die wahre Bedrohung für die Zukunft aber muss noch aufgedeckt werden, und dafür ist es von höchster Wichtigkeit, das Geheimnis um das verschollene Manuskript Ashmole 782 zu entschlüsseln und die fehlenden Seiten zu finden …
Deborah Harkness
Die »All-Souls«-Trilogie
Die Seelen der NachtWo die Nacht beginntDas Buch der Nacht
Deutsch von Christoph Göhler
Die Originalausgaben erschienen unter den Titeln »A Discovery of Witches« (2011), »Shadow of Night« (2012) und »The Book of Life« (2014) bei Vikinig, published by The Penguin Group, New York.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherheitsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright der Originalausgaben © 2011, 2012, 2014 by Deborah Harkness
All rights reserved including the right of reproduction in whole or in part in any form.
This edition published by arrangement with Viking, a member of Penguin Group (USA) Inc.
Copyright © der deutschsprachigen Ausgaben
»Die Seelen der Nacht« 2012,
»Wo die Nacht beginnt« 2013 und »Das Buch der Nacht« 2015
by Blanvalet Verlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Susann Rehlein
Umschlaggestaltung: www.buerosued.de
Umschlagmotive: »Seelen der Nacht« (li.): Fine Art Photographic/Corbis Historical/Getty Images; »Wo die Nacht beginnt« (m.): Historical Picture Archive/Corbis Historical/Getty Images; »Das Buch der Nacht« (re.): Corbis/Christie‘s Images
ISBN: 978-3-641-25393-6V005
www.blanvalet.de
Deborah Harkness
Die Seelen der Nacht
Roman
Deutsch von Christoph Göhler
Für Leslie und Jake und ihre strahlende Zukunft
Es beginnt mit Mangel und Verlangen.
Es beginnt mit Blut und Angst.
Es beginnt mit einem Hexenfund.
1
Das in Leder gebundene Manuskript schien nicht weiter bemerkenswert zu sein. Für einen gewöhnlichen Historiker hätte es sich nicht von unzähligen anderen, ebenso alten und zerlesenen Handschriften in der Bodleian Library in Oxford unterschieden. Aber als ich es in Händen hielt, war mir sofort klar, dass es damit irgendetwas auf sich hatte.
An diesem Nachmittag Ende September war so gut wie niemand im Duke-Humfrey-Lesesaal, und da der sommerliche Ansturm der Gelehrten auf Studienreise inzwischen abgeebbt war und der Tumult zu Anfang des Herbstsemesters noch nicht eingesetzt hatte, wurden die angeforderten Schriften prompt geliefert. »Dr. Bishop, die angeforderten Handschriften liegen jetzt vor«, flüsterte Sean mit leiser Ironie, als ich an die Ausleihtheke trat. Die alten Ledereinbände hatten auf dem Rautenmuster seines Pullovers rostfarbene Streifen hinterlassen, die er verlegen wegzuwischen versuchte. Dabei sprang eine sandfarbene Locke in seine Stirn.
»Danke.« Ich schenkte ihm ein ergebenes Lächeln. Schließlich missachtete ich ungeniert alle Ausleihbeschränkungen, und Sean, der während unserer gemeinsamen Studienzeit viele, viele Stunden mit mir unter der rosa Stuckdecke in dem Pub auf der anderen Straßenseite verbracht hatte, hatte meine Anforderungen seit über einer Woche klaglos erfüllt. »Und hör auf, mich Dr. Bishop zu nennen. Ich habe immer das Gefühl, du meinst jemand anderen.«
Grinsend schob er die Manuskripte aus dem Magazin der Bodleian – jedes einzelne enthielt einzigartige alchemistische Illustrationen und steckte in einem grauen Schutzkarton – über die abgewetzte Ausleihtheke. »Ach, da liegt noch eines.« Sean verschwand kurz in dem Gitterverschlag und kehrte mit einem dicken, in schlichtes fleckiges Kalbsleder gebundenen Manuskript im Quartformat zurück. Er legte es oben auf den Stapel und beugte sich vor, um es in Augenschein zu nehmen. Der dünne Goldrand seiner Brille funkelte im matten Schein der alten bronzenen Leselampe, die an einem Regal klemmte. »Das hier wurde schon länger nicht mehr verlangt. Ich mache mir einen Vermerk, dass es in einen Schutzkarton gesteckt wird, wenn du es zurückgegeben hast.«
»Soll ich dich daran erinnern?«
»Nein. Es ist schon fest vermerkt.« Sean tippte sich an die Stirn.
»Offenbar ist dein Gedächtnis besser organisiert als meines.« Mein Lächeln wurde breiter.
Sean sah mich schüchtern an und zupfte an dem Ausleihzettel, der aber fest zwischen dem Umschlag und den ersten Seiten klemmte. »Das hier will einfach nicht loslassen«, kommentierte er.
Plötzlich redeten gedämpfte Stimmen aufeinander ein und durchdrangen die vertraute Stille des Lesesaales.
»Hast du das gehört?« Verwirrt drehte ich mich nach den merkwürdigen Geräuschen um.
»Was denn?«, fragte Sean und sah von dem Manuskript auf.
Mir fiel auf, dass an den Manuskriptkanten die Überreste eines Goldschnittes glänzten. Aber diese verblassten Goldreste konnten unmöglich der Grund für das schwache Schillern sein, das zwischen den Seiten hervorzudringen schien. Ich blinzelte.
»Ach nichts.« Hastig legte ich die Hand auf das Manuskript; meine Haut begann zu prickeln, sobald ich das Leder berührte. Seans Finger hielten immer noch den Ausleihzettel, der sich jetzt widerstandslos aus der Bindung löste. Als ich den Bücherstapel hochwuchtete und mit dem Kinn festklemmte, stieg mir ein beklemmender Geruch in die Nase, der die vertrauten Bibliotheksgerüche nach gespitzten Bleistiften und Bohnerwachs überlagerte.
»Diana? Ist alles okay?«, fragte Sean besorgt.
»Es geht mir gut. Ich bin nur ein bisschen müde«, erwiderte ich und reckte die Nase höher über die Bücher.
Eilig marschierte ich durch den ältesten, aus dem sechzehnten Jahrhundert stammenden Teil der Bibliothek, vorbei an den Reihen von abgewetzten elisabethanischen Lesetischen mit den drei ansteigenden Bücherregalen, zwischen denen die gotischen Fenster die Aufmerksamkeit des Lesers auf die Kassettendecke lenkten, an der strahlend bunt und vergoldet das Universitätswappen mit den drei Kronen und dem offenen Buch prangte und wo aus der Höhe wiederholt das Motto »Deus illuminatio mea – Gott ist mein Licht« verkündet wurde.
An diesem Freitagabend hielt sich außer mir nur eine weitere amerikanische Wissenschaftlerin in der Bibliothek auf. Gillian Chamberlain war Altphilologin, lehrte in Bryn Mawr und brachte ihre Zeit damit zu, über in Glas eingefassten Papyrusfetzen zu brüten. Ich versuchte, jeden Blickkontakt zu vermeiden, als ich an ihr vorbeihuschte, doch das Quietschen der alten Dielen verriet mich.
Meine Haut kribbelte, so wie immer, wenn mich eine andere Hexe ansah.
»Diana?«, rief sie aus dem Halbdunkel. Ich erstickte ein Seufzen und blieb stehen.
»Hi, Gillian.« Ich wusste selbst nicht, warum ich so eifersüchtig über meinen Handschriftenstapel wachte, aber ich blieb so weit wie möglich von der Hexe entfernt stehen und drehte den Oberkörper weg, damit sie meine Schätze nicht zu sehen bekam.
»Was machst du an Mabon?« Gillian kam bei jeder Gelegenheit an meinen Lesetisch und forderte mich auf, Zeit mit meinen »Schwestern« zu verbringen, solange ich in der Stadt war. Nachdem es nur noch ein paar Tage bis zur Wicca-Feier, der herbstlichen Tagundnachtgleiche, waren, verdoppelte sie zurzeit ihre Bemühungen, mich in den hiesigen Hexenkonvent zu locken.
»Arbeiten«, erwiderte ich.
»Es gibt hier ein paar ausgesprochen nette Hexen, weißt du?«, sagte Gillian tadelnd. »Du solltest am Montag wirklich vorbeikommen.«
»Danke. Ich werde es mir überlegen«, sagte ich und war schon wieder auf dem Weg zum Selden End, einem luftigen Anbau aus dem siebzehnten Jahrhundert, der quer zur Hauptachse des Duke-Humfrey-Lesesaales verlief. »Allerdings muss ich noch einen Vortrag für eine Konferenz fertigstellen, also zähl lieber nicht auf mich.« Meine Tante Sarah hatte mich oft gewarnt, dass Hexen einander nicht belügen können, aber das hatte mich nicht davon abgehalten, es immer wieder zu versuchen.
Gillian gab ein mitfühlendes Brummen von sich, aber ich spürte ihren Blick im Rücken.
An meinem angestammten Arbeitsplatz, gegenüber den Bleiglasfenstern, konnte ich nur mit Mühe der Versuchung widerstehen, die Handschriften auf den Tisch fallen zu lassen und mir sofort die Hände abzuwischen. Stattdessen setzte ich den Stapel so behutsam ab, wie es seinem Alter gebührte.
Das Manuskript, das den Ausleihzettel so widerwillig herausgerückt hatte, lag obenauf. Auf dem Buchrücken war das goldene Wappen Elias Ashmoles eingeprägt, eines Schriftensammlers und Alchemisten aus dem siebzehnten Jahrhundert, dessen Bücher und Papiere, darunter auch die Nummer 782, im neunzehnten Jahrhundert vom Ashmolean Museum in die Bodleian Library überführt worden waren. Argwöhnisch berührte ich das braune Leder.
Ein leichter Schlag ließ mich zurückzucken, allerdings nicht schnell genug. Das Kribbeln kroch an meinen Armen aufwärts und richtete dabei sämtliche Härchen auf, dann breitete es sich über meine Schultern aus und verhärtete meine Hals- und Rückenmuskeln. Das Kribbeln legte sich bald wieder, aber zurück blieb ein Gefühl wie dumpfe unerwiderte Begierde. Erschrocken über meine Reaktion trat ich einen Schritt zurück.
Selbst aus dieser Entfernung provozierte mich das Manuskript – als stellte es einen Angriff auf den Schutzwall dar, den ich zwischen meine wissenschaftlichen Leistungen als Historikerin und mein Geburtsrecht als letzte Hexe aus dem Geschlecht der Bishops errichtet hatte. Nachdem ich mir mühsam einen Doktortitel und eine Festanstellung mitsamt Lehrauftrag erarbeitet hatte und meine Karriere jetzt allmählich in Schwung kam, hatte ich dem Erbe meiner Familie abgeschworen und mir ein Leben geschaffen, in dem allein Vernunft und wissenschaftliche Fakten zählten, nicht mysteriöse Ahnungen oder Zauberei. Ich war in Oxford, um ein Forschungsprojekt zu Ende zu bringen. Sobald ich es abgeschlossen hatte, würden meine Befunde veröffentlicht und anschließend meinen menschlichen Kollegen präsentiert werden, wobei keinerlei Raum für Mysterien oder andere Dinge bleiben würde, die man nur mit dem sechsten Sinn einer Hexe erfassen kann.
Nun jedoch hatte ich – wenn auch ungewollt – eine alchemistische Handschrift aus dem Archiv angefordert, die ich für meine Recherchen brauchte und die gleichzeitig eine übernatürliche Macht zu besitzen schien, die ich nicht ignorieren konnte. Es juckte mich in den Fingern, das Manuskript aufzuschlagen und mehr zu erfahren. Doch ein noch stärkerer Impuls hielt mich zurück: War meine Neugier allein intellektuell und durch wissenschaftlichen Forscherdrang begründet?
Ich atmete tief die Bibliotheksluft ein, schloss die Augen und hoffte, dass ich dadurch klarer sehen würde. Die Bodleian Library war mir immer ein Zufluchtsort gewesen, ein Platz, der nicht das Geringste mit den Bishops zu tun hatte. Die zitternden Hände unter die Achseln geklemmt, starrte ich im trüber werdenden Abendlicht auf Ashmole 782 und überlegte, was ich jetzt tun sollte.
Meine Mutter hätte instinktiv gewusst, was zu tun war. Die meisten Bishops waren talentierte Hexen und Hexer, aber meine Mutter Rebecca war etwas ganz Besonderes gewesen. Das sagten alle. Ihre übernatürlichen Fähigkeiten hatten sich früh gezeigt, und schon in der Grundschule hatte sie mit ihrem intuitiven Verständnis für alle Hexensprüche, ihren verblüffenden Vorahnungen und ihrer unheimlichen Begabung, Menschen und Ereignisse zu durchschauen, die meisten älteren Hexen im örtlichen Hexenkonvent ausgestochen. Meine Tante Sarah, die jüngere Schwester meiner Mutter, war ebenfalls eine begabte Hexe, aber ihre Talente waren nichts Ungewöhnliches: Geschick beim Mischen der verschiedenen Zaubermittel und die perfekte Beherrschung der überlieferten Sprüche und Beschwörungen.
Natürlich wussten meine Historikerkollegen nichts von meiner Familie, aber in Madison, der abgelegenen Kleinstadt im Staat New York, wo ich seit meinem siebten Geburtstag bei meiner Tante Sarah gelebt hatte, kannte wirklich jeder die Bishops. Nach dem Revolutionskrieg waren meine Vorfahren von Massachusetts dorthin gezogen. Damals waren schon über hundert Jahre vergangen, seit man Bridget Bishop in Salem hingerichtet hatte. Trotzdem war meinen Vorfahren das Gemunkel und Getuschel in die neue Heimat nachgefolgt, woraufhin sie sich nach Kräften bemüht hatten, allen zu demonstrieren, wie praktisch es sein konnte, in der Nachbarschaft Hexen zu haben, die Kranke heilen und das Wetter vorhersagen konnten. Im Lauf der Zeit hatten die Bishops so tiefe Wurzeln in der Gemeinschaft geschlagen, dass sie all die unausweichlichen Ausbrüche von Hysterie und menschlichem Aberglauben überstanden hatten.
Doch meine Mutter war von einer unstillbaren Neugier auf die Welt getrieben, die sie aus dem sicheren Madison herausgeführt hatte. Erst ging sie nach Harvard, wo sie einen jungen Hexer namens Stephen Proctor kennenlernte, der sich genau wie sie danach sehnte, dem Dunstkreis seiner Familie zu entkommen, die auf eine lange Geschichte in Neuengland zurückblicken konnte. Rebecca Bishop und Stephen Proctor waren ein charmantes Paar, auch weil die typisch amerikanische Offenheit meiner Mutter die eher altmodische Förmlichkeit meines Vaters kontrastierte. Beide studierten Anthropologie, tauchten in fremde Kulturen und Religionen ein und waren nicht nur durch ihre innige Liebe verbunden, sondern auch durch ihre intellektuelle Leidenschaft. Nachdem beide an einer Universität in der Gegend eine Anstellung gefunden hatten – meine Mutter an ihrer Alma Mater, mein Vater in Wellesley –, unternahmen sie gemeinsam Forschungsreisen ins Ausland und schufen in Cambridge ein Heim für ihre neue Familie.
Ich habe nur wenige Erinnerungen an meine Kindheit, aber jede einzelne davon ist mir lebendig und überraschend deutlich im Gedächtnis. Alle drehen sich um meine Eltern: Wie sich der Cord am Ellbogen meines Vaters anfühlte, wie das Maiglöckchenparfüm meiner Mutter duftete, wie ihre Weingläser klirrten, wenn die beiden anstießen, nachdem sie mich zu Bett gebracht hatten, um danach bei Kerzenlicht zu Abend zu essen. Meine Mutter erzählte mir Gutenachtgeschichten, und die braune Aktentasche meines Vaters klapperte, wenn er sie an der Haustür fallen ließ. Mit diesen Erinnerungen könnten sich die meisten Menschen identifizieren.
Mit anderen Erinnerungen an meine Eltern eher nicht. Zum Beispiel kann ich mich nicht entsinnen, dass meine Mutter je Wäsche gewaschen hätte, trotzdem waren meine Anziehsachen immer sauber und ordentlich zusammengelegt. Der vergessene Erlaubniszettel für den Zoobesuch lag auf wundersame Weise unter meinem Schultisch, wenn die Lehrerin ihn einsammeln kam. Und ganz gleich, wie es im Arbeitszimmer meines Vaters aussah, wenn ich hineinging, um ihm einen Gutenachtkuss zu geben (und es sah fast immer aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen), am nächsten Morgen war alles makellos aufgeräumt. Im Kindergarten hatte ich einmal die Mutter meiner Freundin Amanda gefragt, warum sie sich die Mühe machte, die Teller mit Spülmittel und heißem Wasser zu waschen, wenn man sie doch nur in der Spüle aufzustapeln, mit den Fingern zu schnippen und ein paar Worte zu murmeln brauchte. Mrs Schmidt lachte über meine merkwürdigen Vorstellungen von Hausarbeit, aber sie hatte mich dabei leicht verwirrt gemustert.
An jenem Abend erklärten mir meine Eltern, dass wir darauf achten müssten, wie wir über Magie redeten und mit wem. Die Menschen waren uns zahlenmäßig weit überlegen und ängstigten sich vor unserer Macht, erklärte mir meine Mutter, und Angst war die stärkste Kraft auf Erden. Ich hatte ihr damals nicht gestanden, dass auch mir die Magie Angst machte – vor allem die meiner Mutter.
Tagsüber sah meine Mutter aus wie fast alle jungen Mütter in Cambridge: leicht unfrisiert, leicht unorganisiert und ständig gehetzt, um der Doppelbelastung von Heim und Büro gerecht zu werden. Ihre blonden Haare wirkten modisch zerzaust, auch wenn die Sachen, die sie trug, allesamt aus dem Jahr 1977 zu stammen schienen – lange, glockige Röcke, übergroße Hosen und Hemden, dazu Männerwesten und Blazer, die sie wie eine zweite Annie Hall in Secondhandläden überall in Boston zusammensammelte. Nichts, was einen hätte stutzig werden lassen, wenn man ihr auf der Straße begegnet wäre oder hinter ihr im Supermarkt angestanden hätte.
Doch zu Hause, wenn die Türen verschlossen und die Vorhänge zugezogen waren, verwandelte sich meine Mutter. Dann wirkten ihre Bewegungen nicht mehr hastig und hektisch, sondern selbstbewusst und sicher. Manchmal schien sie geradezu zu schweben. Wenn sie singend durchs Haus spazierte und dabei Stofftiere und Bücher aufsammelte, verwandelte sich ihr Gesicht allmählich, bis es schließlich wunderschön wurde und wie nicht von dieser Welt aussah. Wenn die Magie aus meiner Mutter leuchtete, konnte man den Blick nicht von ihr losreißen.
»Mommy hat mal eine Feuerwerksrakete verschluckt«, meinte mein Vater mit seinem breiten, gutmütigen Lächeln dazu. Aber Feuerwerksraketen waren, wie ich erfahren sollte, nicht nur strahlend bunt und schön. Sie waren auch unberechenbar und konnten dich erschrecken und in Angst versetzen.
Eines Abends hielt mein Vater eine Vorlesung, als meine Mutter beschloss, das Silber zu putzen, und dabei in den Bann einer Wasserschüssel gezogen wurde, die sie auf den Tisch im Esszimmer gestellt hatte. Sie starrte auf die spiegelglatte Oberfläche, bis sich das Wasser mit einem leichten Nebel überzog, der sich wiederum zu winzigen Geisterschemen formte. Ich hielt begeistert den Atem an, während die Gestalten immer größer wurden. Bald kletterten die fantastischen Figuren an den Vorhängen hoch und baumelten von der Decke. Ängstlich rief ich nach meiner Mutter, aber die war vollkommen in den Anblick des Wassers versunken. Ihre Konzentration blieb ungebrochen, bis ein Wesen, halb Mensch, halb Tier, auf mich zugekrochen kam und mich in den Arm kniff. Das schreckte sie aus ihrer Trance, und sie explodierte in einen Schauer von zornig rotem Licht, der die Schattenwesen zurücktrieb und das Haus mit dem Gestank von verbrannten Federn erfüllte. Mein Vater, über den Geruch sichtbar erschrocken, fand uns zusammengekuschelt im Ehebett. Als meine Mutter ihn sah, brach sie in Tränen der Reue aus. Danach fühlte ich mich in unserem Esszimmer nie wieder wirklich wohl.
Was mir an Geborgenheit geblieben war, verpuffte schließlich kurz nach meinem siebenten Geburtstag, als meine Mutter und mein Vater nach Afrika reisten und nicht mehr zurückkehrten.
Ich rief mich zur Ordnung und konzentrierte mich wieder auf das Dilemma, vor dem ich stand. Das Manuskript lag in dem hellen Lichtkreis unter der Leselampe. Seine Magie zerrte an einem dunklen Knoten in meinem Inneren. Wieder landeten meine Finger auf dem glatten Leder. Diesmal kam mir das Kribbeln vertraut vor. Ich entsann mich vage, dass ich schon einmal etwas Ähnliches empfunden hatte, als ich im Arbeitszimmer meines Vaters in ein paar Papieren geblättert hatte.
Energisch wandte ich mich von der ledergebundenen Handschrift ab und beschäftigte mich mit etwas ganz Rationalem: der Suche nach der Liste von alchemistischen Texten, die ich erstellt hatte, bevor ich aus New Haven abgereist war. Sie lag irgendwo auf dem Lesetisch, tief vergraben unter all den unsortierten Papieren, Ausleihzetteln, Quittungen, Stiften, Bleistiften und Bibliotheksplänen, und war akribisch geordnet nach den verschiedenen Sammlungen und dann nach der Bibliotheksnummer, die jedem Text zugeordnet worden war, sobald man ihn in die Bodleian Library aufgenommen hatte. Seit ich vor ein paar Wochen eingetroffen war, hatte ich methodisch meine Liste abgearbeitet. Die kopierte Katalogbeschreibung für Ashmole 782 lautete: Anthropologia oder ein Traktatum über den Menschen in zwei Teilen: zum Ersten anatomischer Natur, zum Zweiten psychologischer Natur. Wie bei den meisten Schriften, die ich hier durcharbeitete, konnte man vom Titel kaum auf den Inhalt schließen.
Meine Finger würden mir möglicherweise mehr über das Buch verraten können, ohne dass ich es aufzuschlagen brauchte. Tante Sarah hatte die Post immer erst mit den Fingern geprüft, bevor sie einen Umschlag geöffnet hatte, nur für den Fall, dass er eine Rechnung enthielt, die sie nicht bezahlen wollte. Auf diese Weise konnte sie sich guten Gewissens ahnungslos stellen, wenn sich herausstellte, dass sie der Stromgesellschaft Geld schuldete.
Die vergoldeten Ziffern auf dem Buchrücken zwinkerten mir zu. Ich setzte mich und erwog die verschiedenen Alternativen.
Die Magie ignorieren, das Buch aufschlagen und es wie ein menschlicher Gelehrter zu lesen versuchen?
Das verhexte Manuskript ignorieren und ungeöffnet zurückgeben?
Sarah hätte sich halbtot gelacht, hätte sie von meiner Zwangslage gewusst. Sie hatte immer behauptet, dass ich ohnehin keine Chance hätte, meine magischen Fähigkeiten zu ignorieren. Trotzdem hatte ich genau das seit der Beisetzung meiner Eltern versucht. Damals hatten mich die Hexen unter den Trauergästen genauestens in Augenschein genommen, ob irgendwas darauf hindeutete, dass das Blut der Bishops und Proctors in meinen Adern floss, um mir schließlich aufmunternd auf den Rücken zu klopfen und zu prophezeien, dass es nur eine Frage der Zeit sei, bis ich den Platz meiner Mutter im örtlichen Konvent einnehmen würde. Einige hatten flüsternd Zweifel geäußert, ob es wirklich klug von meinen Eltern gewesen war zu heiraten.
»Zu große Macht«, murmelten sie, als sie glaubten, dass ich sie nicht hörte. »Damit mussten sie ja Aufmerksamkeit erregen – auch ohne dass sie alte religiöse Zeremonien studierten.«
Damit hatte für mich festgestanden, dass die übernatürlichen Kräfte meiner Eltern zu ihrem Tod geführt hatten und ich darum einen anderen Lebensweg einschlagen würde. Ich kehrte allem, was mit Magie zu tun hatte, den Rücken zu, beschäftigte mich mit Dingen, die typisch für eine menschliche Pubertät sind – Pferde und Jungs und Liebesromane –, und versuchte zwischen den gewöhnlichen Bewohnern unseres Ortes unterzutauchen. Während der Pubertät neigte ich zu Depressionen und Angstzuständen. Das sei ganz normal, versicherte der nette menschliche Arzt meiner Tante Sarah, dem sie natürlich weder von den Stimmen erzählt hatte, die ich hörte, noch von meiner Angewohnheit, zum Telefon zu gehen, bevor es läutete, und auch nicht, dass sie bei Vollmond alle Türen und Fenster mit einem magischen Bann verschließen musste, damit ich nicht durch den Wald schlafwandelte. Auch dass sich, wenn ich wütend wurde, die Stühle in unserem Haus selbständig zu einer halsbrecherischen Pyramide auftürmten, die laut krachend umstürzte, sobald sich meine Laune besserte, hatte sie ihm nicht gesagt.
Als ich dreizehn wurde, beschloss meine Tante, dass es Zeit für mich war, meine Energie wenigstens notdürftig zu kanalisieren und die Grundlagen der Hexerei zu erlernen. Unter ein paar geflüsterten Worten eine Kerze zu entzünden oder mit einem jahrhundertealten Mittel Pickel verschwinden zu lassen – das waren gewöhnlich die ersten Schritte einer jungen Hexe. Aber ich war unfähig, auch nur die einfachsten Sprüche anzuwenden, jeder einzelne Trank, den meine Tante mich anrühren ließ, brannte an, und ich weigerte mich störrisch, mich irgendwelchen Tests zu unterziehen, mittels derer sie feststellen wollte, ob ich das Zweite Gesicht meiner Mutter geerbt hatte.
Die Stimmen, die Brände und alle anderen Ausbrüche wurden seltener, als meine Hormone allmählich zur Ruhe kamen, trotzdem weigerte ich mich weiterhin, das Familiengeschäft zu erlernen. Es machte meine Tante nervös, eine untrainierte Hexe im Haus zu haben, und so war Sarah insgeheim erleichtert, als sie mich schließlich auf ein College in Maine schicken konnte.
Dass ich nicht in Madison blieb, hatte ich vor allem meinem Intellekt zu verdanken. Ich war schon immer frühreif gewesen und hatte schneller als andere Kinder reden und lesen gelernt. Dazu gesellte sich ein fantastisches, fast fotografisches Gedächtnis – wodurch es mir ein Leichtes war, den Inhalt unserer Lehrbücher abzurufen und bei allen Tests die gewünschten Informationen auszuspucken –, und so stand bald fest, dass die Schule für mich ein Ort war, an dem das magische Erbe meiner Familie keine Rolle spielte. Die letzten Jahre auf der Highschool übersprang ich und ging stattdessen schon mit sechzehn ans College.
Dort versuchte ich mir zuerst eine Nische in der Theaterklasse zu erobern, weil die Schauspielerei und die farbenprächtigen Kostüme meine Fantasie beflügelten – und ich fasziniert davon war, wie vollkommen die Worte eines Dramatikers eine andere Zeit und einen anderen Ort heraufbeschwören konnten. Nach meinen ersten Auftritten priesen mich meine Lehrer als Musterbeispiel dafür, wie sich eine ganz gewöhnliche Collegestudentin durch die Schauspielerei in jemand anderen verwandeln konnte. Dass diese Metamorphosen vielleicht nicht allein auf mein schauspielerisches Talent zurückzuführen waren, begann ich erst zu argwöhnen, als ich im Hamlet die Ophelia spielte. Sobald mir die Rolle zugesprochen worden war, begannen meine Haare so wild zu wachsen, dass sie mir schließlich bis zur Taille reichten. Stundenlang saß ich am Ufer des Teiches beim College, hypnotisch angezogen von der glänzenden Oberfläche, in der sich mein herabströmendes neues Haar spiegelte. Der Junge, der den Hamlet spielte, verfing sich gemeinsam mit mir in dieser Illusion, und es folgte eine leidenschaftliche, aber auch gefährlich explosive Affäre. Ganz allmählich verlor ich mich in Ophelias Wahnsinn und zog dabei das ganze Ensemble mit.
Infolgedessen gaben wir zwar mitreißende Aufführungen, doch jede neue Rolle brachte neue Gefahren mit sich. Die Situation wurde unhaltbar, als ich in meinem zweiten Jahr am College die Annabella in John Fords Schade, dass sie eine Hure war spielen sollte. Genau wie die Theaterfigur legte ich mir eine Eskorte aus ergebenen Verehrern zu – nicht ausschließlich menschlicher Natur –, die mir über den ganzen Campus folgten. Als sie sich weigerten, mich in Frieden zu lassen, als nach der letzten Vorstellung der Vorhang gefallen war, begriff ich, dass ich etwas ändern musste. Zwar verstand ich nicht so recht, wie sich die Magie in meine Schauspielerei eingeschlichen hatte, und wollte es auch gar nicht verstehen. Aber ich schnitt mir die Haare. Ich hörte auf, Blumenröcke und mehrlagige Tops zu tragen, und zog stattdessen die Rollkragenpullover, Khakihosen und Halbschuhe der ernsthaften, ehrgeizigen Jurastudenten an. Meine überschüssige Energie baute ich mit Sport ab.
Nachdem ich das Theaterspielen aufgegeben hatte, probierte ich mich in anderen Hauptfächern aus, immer auf der Suche nach einer Materie, die so rational war, dass sie der Magie keinen Fußbreit überlassen würde. Für die Mathematik fehlten mir die nötige Geduld und die Genauigkeit, und meine Bemühungen in Biologie endeten in einer Folge von fehlgeschlagenen Versuchen und abgebrochenen Laborexperimenten.
Am Ende des zweiten Jahres stellte mich der Studienberater vor die Wahl, mich endgültig für einen Studiengang zu entscheiden oder ein fünftes Jahr auf dem College zu verbringen. Ein Sommerstudienprogramm in England gab mir schließlich Gelegenheit, allem zu entfliehen, was mit irgendwelchen Bishops zu tun hatte. Ich verliebte mich in die Stadt Oxford, in den ruhigen Glanz der morgendlichen Straßen. In meinen Geschichtskursen wurden die Großtaten von Königen und Königinnen abgehandelt, und wenn ich in meinem Kopf Stimmen flüstern hörte, dann stammten sie ausschließlich aus Büchern des sechzehnten oder siebzehnten Jahrhunderts. Und dieses Flüstern war für solche Meisterwerke der Literatur keineswegs ungewöhnlich. Am allerbesten aber war, dass mich niemand in dieser Universitätsstadt kannte und dass alle Hexen, die den Sommer hier verbringen mochten, sich von mir fernhielten. Ich kehrte heim, wählte Geschichte als Hauptstudienfach, belegte in Rekordzeit alle erforderlichen Kurse und schloss noch vor meinem zwanzigsten Geburtstag cum laude ab.
Als ich beschloss, dem Studium eine Promotion folgen zu lassen, war Oxford die erste Wahl unter den verschiedenen Angeboten. Ich hatte mich mittlerweile auf Wissenschaftsgeschichte spezialisiert, und meine Forschungen konzentrierten sich auf jene Epoche, in der die Naturwissenschaften die Magie verdrängt hatten – jenes Zeitalter, in dem die Astrologie und die Hexenjagden Newton und seinen Naturgesetzen hatten weichen müssen. Die Suche nach einer rationalen Ordnung in der Natur, die das Übernatürliche ersetzen sollte, spiegelten meine eigenen Bemühungen wider, mich von allem Okkulten abzuwenden. Immer höher wuchs die Mauer, die ich zwischen dem, was sich in meinem Verstand abspielte, und dem, was ich in meinem Blut trug, errichtet hatte.
Meine Tante Sarah hatte nur geschnaubt, als ich ihr von meinem Entschluss erzählt hatte, mich auf die Chemie des siebzehnten Jahrhunderts zu spezialisieren. Ihr leuchtend rotes Haar verriet schon von weitem ihr leicht entflammbares Temperament und ihre scharfe Zunge. Sie war mit Leib und Seele Hexe, nahm grundsätzlich kein Blatt vor den Mund und dominierte jeden Raum, sobald sie ihn betreten hatte. Als Stützpfeiler der Ortsgemeinschaft von Madison wurde Sarah oft hinzugezogen, wenn es lokale Krisen, groß oder klein, zu bewältigen galt. Seit ich nicht mehr Tag für Tag ihren messerscharfen Bemerkungen über die menschliche Wankelmütigkeit und Inkonsequenz ausgesetzt war, verstanden wir uns viel besser.
Obwohl wir mehrere hundert Meilen voneinander getrennt waren, standen wir in engem Kontakt. Sarah machte kein Hehl daraus, dass sie auch meine jüngsten Versuche, mich der Magie zu entziehen, lachhaft fand: »Wir haben das früher Alchemie genannt«, sagte sie. »Und das ist im Grunde auch nur eine Form von Magie.«
»Ist es nicht«, protestierte ich hitzig. Mit meiner Arbeit wollte ich im Gegenteil beweisen, wie wissenschaftlich fundiert die damaligen Anstrengungen im Grunde gewesen waren. »Mir geht es um die zunehmende Bedeutung des wissenschaftlichen Experiments, anstelle der Suche nach einem magischen Elixier, mit dem man Blei in Gold verwandeln und Menschen unsterblich machen kann.«
»Wenn du meinst«, sagte Sarah zweifelnd. »Trotzdem ist das für jemanden, der als Mensch durchgehen möchte, ein eher befremdliches Fachgebiet.«
Nachdem man mir meinen Doktortitel verliehen hatte, kämpfte ich mit eisernem Willen um einen Job an der historischen Fakultät in Yale, dem einzigen Fleck auf Erden, der noch englischer ist als England. Meine Kollegen warnten mich, dass ich kaum Chancen auf eine Festanstellung hätte. Aber ich spuckte zwei Bücher aus, bekam eine Handvoll Preise verliehen und sackte mehrere Forschungsstipendien ein. Danach bekam ich meine Festanstellung und hatte alle Zweifler widerlegt.
Vor allem aber gehörte mein Leben endlich mir allein. Niemand in meiner Abteilung, nicht einmal jene Historiker, die sich mit der amerikanischen Frühzeit beschäftigten, brachten meinen Nachnamen mit jener Frau in Verbindung, die 1692 in Salem als Hexe verbrannt worden war. Um meine schwer erarbeitete Autonomie nicht zu gefährden, verbannte ich weiterhin alles aus meinem Leben, was nur entfernt nach Magie oder Zauberei roch. Natürlich wurde ich hin und wieder rückfällig, so wie damals, als ich auf einen von Sarahs Zaubersprüchen zurückgreifen musste, weil meine Waschmaschine mein kleines Apartment am Wooster Square zu überschwemmen drohte. Niemand ist vollkommen.
Ich vermerkte im Geist den Fehltritt, den ich mir eben geleistet hatte, holte tief Luft, ergriff das Manuskript mit beiden Händen und legte es in eine der keilförmigen Buchstützen, die die Bibliothek zur Verfügung stellt, um ihre seltenen Bücher bei der Lektüre zu schützen. Ich hatte mich entschieden: Ich würde mich wie eine ernsthafte Wissenschaftlerin verhalten und Ashmole 782 wie jede gewöhnliche Handschrift behandeln. Ich würde meine brennenden Fingerspitzen und den eigentümlichen Geruch des Buches ignorieren und ganz sachlich den Inhalt zusammenfassen. Danach würde ich – mit professioneller Distanz – entscheiden, ob sich ein längeres Studium lohnen könnte. Nichtsdestotrotz zitterten meine Finger, als ich die kleinen Messingklammern löste.
Das Manuskript stieß einen leisen Seufzer aus.
Ich vergewisserte mich mit einem kurzen Blick über die Schulter, dass ich allein im Raum war. Das einzige Geräusch war das laute Ticken der Uhr im Lesesaal.
Ich beschloss, auf den Vermerk »Buch seufzt« zu verzichten, beugte mich über meinen Laptop und öffnete eine neue Datei. Diese vertraute Übung – die ich schon Hunderte, wenn nicht Tausende Male absolviert hatte – wirkte ebenso beruhigend wie die immer gleiche Prüfliste. Ich tippte Namen und Nummer des Manuskriptes ein und kopierte den Titel aus der Katalogbeschreibung. Dann untersuchte ich Größe und Bindung und beschrieb beides minutiös.
Danach blieb nur noch eines zu tun: das Manuskript zu öffnen.
Obwohl ich die Klammern gelöst hatte, ließ sich der Einband kaum anheben, so als wäre er mit den Seiten darunter verklebt. Ich fluchte leise und legte kurz meine Hand flach auf das Leder, in der Hoffnung, dass Ashmole 782 nur fremdelte. Die Hand auf einen Bucheinband zu legen, zählte wohl kaum als Magie. Meine Handfläche kribbelte genauso, wie meine Haut immer kribbelte, wenn mich eine Hexe ansah, und im nächsten Moment wich die Spannung aus dem Manuskript. Danach ließ es sich problemlos aufschlagen.
Das erste Blatt war ein raues Vorsatzpapier. Auf dem zweiten Blatt, einem Pergament, standen in Ashmoles Handschrift die Worte »Anthropologia, oder ein Traktatum über den Menschen«. Die eleganten, runden Schwünge waren mir fast so vertraut wie meine eigene fließende Handschrift. Der zweite Teil des Titels – »in zwei Teilen: zum Ersten anatomischer Natur, zum Zweiten psychologischer Natur« – war später von anderer Hand mit Bleistift hinzugefügt worden. Auch diese Handschrift kam mir vertraut vor, wenngleich ich sie nicht einordnen konnte. Ich hätte vielleicht mehr erfahren können, wenn ich die Finger auf die Buchstaben gelegt hätte, aber das verstieß gegen die Bibliotheksvorschriften, außerdem hätte ich die Informationen, die meine Finger mir möglicherweise geliefert hätten, unmöglich dokumentieren können. Stattdessen vermerkte ich in meiner Datei die Verwendung von Tinte und Bleistift, die zwei verschiedenen Handschriften und die möglichen Datierungen der Inschriften.
Als ich die erste Seite umblätterte, erkannte ich, dass der befremdliche Geruch des Manuskriptes hauptsächlich dem abnorm schweren Pergament entstieg. Außerdem roch es eindeutig nicht nur alt. Es roch nach weit mehr – einer Kombination von Staub und Moschus. Und mir fiel sofort auf, dass drei Blätter säuberlich aus der Bindung herausgetrennt worden waren.
Endlich hatte ich etwas gefunden, das sich leicht beschreiben ließ. Meine Finger flogen über die Tastatur: »Mindestens drei Pergamentseiten entfernt, mittels Kantenlineal oder Rasiermesser.« Ich spähte in das Tal der Manuskriptbindung, konnte aber nicht feststellen, ob noch mehr Seiten fehlten. Je dichter meine Nase über dem Pergament schwebte, desto mehr lenkten mich die Kraft dieses Manuskriptes und sein eigenwilliger Geruch ab.
Ich richtete meine Aufmerksamkeit auf die Illustration gegenüber der Lücke, wo die Seiten entfernt worden waren. Sie zeigte ein winziges Baby, ein Mädchen, das in einem Glasgefäß schwebte. Das Baby hielt in der einen Hand eine silberne, in der anderen Hand eine goldene Rose. An seinen Füßen saßen winzige Schwingen, und von oben regneten rote Tropfen auf das lange, schwarze Haar des Babys herab. Unterhalb der Illustration war in dicker, schwarzer Tinte zu lesen, dass es sich hierbei um eine Darstellung des philosophischen Kindes handelte – um die allegorische Abbildung eines entscheidenden Schrittes bei der Herstellung des Steines der Weisen, jener Substanz, die ihrem Besitzer Gesundheit, Wohlstand und Weisheit versprach.
Die Farben leuchteten und waren verblüffend gut erhalten. Früher hatten die Künstler gemahlene Steine und Halbedelsteine in ihre Farbmischungen gerührt, um derart kraftvolle Farben zu erhalten. Gezeichnet hatte das Bild jemand mit wahrer künstlerischer Begabung. Ich musste mich auf die Hände setzen, so juckte es mich, durch ein, zwei flüchtige Berührungen Genaueres zu erfahren.
Andererseits hatte der Illustrator trotz seiner sichtbaren Begabung alle Details falsch wiedergegeben. Das Glasgefäß hätte nach oben offen sein müssen, nicht nach unten. Das Baby sollte eigentlich halb schwarz, halb weiß sein, um anzuzeigen, dass es ein Hermaphrodit war. Es hätte männliche Genitalien und weibliche Brüste haben sollen – oder zumindest zwei Köpfe.
Alchemistische Darstellungen waren immer allegorisch gemeint und äußerst vertrackt. Genau aus diesem Grund studierte ich sie: Ich suchte nach Mustern, die auf einen systematischen, logischen Denkansatz für chemische Transformationen hindeuteten, und zwar in der Zeit vor der Periodentafel der Elemente. Abbildungen des Mondes standen zum Beispiel fast immer für Silber, während die Sonne Gold darstellen sollte. Wenn beides chemisch kombiniert wurde, wurde der Prozess als Hochzeit wiedergegeben. Im Laufe der Zeit waren die Bilder durch Worte ersetzt worden. Und aus diesen Worten hatte sich wiederum die Grammatik der Chemie entwickelt.
Diese Handschrift jedoch stellte meinen Glauben an einen logischen Ansatz der Alchemisten auf die Probe. Jede Illustration wies mindestens einen fundamentalen Fehler auf, und es gab keinen Begleittext, der mir einen Schlüssel geliefert hätte.
Krampfhaft suchte ich nach etwas, das mit meinem Wissen über die Alchemie übereingestimmt hätte. Da tauchten im schwächer werdenden Licht auf einer Seite leichte, kaum noch erkennbare Spuren einer Handschrift auf. Ich drehte die Leselampe zur Seite, um die Stelle besser auszuleuchten.
Die Schrift war verschwunden.
Langsam blätterte ich die Seite um, als wäre sie ein zerbrechliches Laubblatt.
Über die Seite bewegten sich schimmernd Worte – Hunderte von Worten –, die sich aber nur bei einem ganz bestimmten Lichteinfall und Blickwinkel des Betrachters zeigten.
Ich verschluckte einen überraschten Aufschrei.
Ashmole 782 war ein Palimpsest – ein Manuskript innerhalb eines Manuskriptes. Weil Pergament damals Mangelware war, hatten die Schreiber bisweilen die Tinte aus alten Büchern gewaschen und die freien Seiten neu beschrieben. Im Lauf der Zeit konnte der ursprüngliche Text als geisterhafter Schatten wieder auftauchen und mit Hilfe von ultraviolettem Licht sichtbar gemacht und zu neuem Leben erweckt werden.
Allerdings war kein ultraviolettes Licht stark genug, um diese Spuren lesbar zu machen. Das hier war kein gewöhnliches Palimpsest. Die Schrift war nicht weggewaschen worden – sie lag unter einem Zauberspruch verborgen. Aber warum sollte sich jemand die Mühe machen, den Text in einem alchemistischen Buch zu verhexen? Hatten Experten doch so schon Mühe, die verworrenen Texte und die abstruse Bildersprache zu deuten, die damals verwendet wurde.
Ich riss mich von den fahlen Buchstaben los, die sich viel zu schnell bewegten, als dass ich sie hätte lesen können, und konzentrierte mich stattdessen darauf, den Inhalt des Manuskriptes in einer Synopsis zusammenzufassen. »Inkonsistent«, tippte ich. »Beschriftungen aus dem fünfzehnten bis siebzehnten Jahrhundert, Illustrationen vornehmlich aus dem fünfzehnten Jahrhundert. Bildquellen möglicherweise älter? Mischung von Papier und Pergament. Farbige und schwarze Tinten, Letztere von ungewöhnlich guter Qualität. Illustrationen gut ausgeführt, doch sind einige Details inkorrekt oder fehlen. Dargestellt werden die Herstellung des Steines der Weisen, alchemische Geburt/Schöpfung, Tod, Wiederauferstehung und Transformation. Fehlerhafte Kopie eines früheren Manuskriptes? Ein merkwürdiges Buch voller Anomalien.«
Meine Finger verharrten über den Tasten.
Wenn Wissenschaftler auf neue Fakten stoßen, die allem widersprechen, was sie zu wissen glauben, haben sie zwei Möglichkeiten. Entweder sie ignorieren die neuen Fakten, damit ihre hochgeschätzten Theorien nicht in Frage gestellt werden, oder sie konzentrieren sich mit lasergleicher Intensität darauf und versuchen zum Kern des Mysteriums vorzudringen. Hätte kein Zauber über diesem Buch gelegen, wäre ich versucht gewesen, Letzteres zu probieren. Weil es aber verhext war, neigte ich zu Ersterem.
Und wenn ein Wissenschaftler zweifelt, versucht er die Entscheidung zu verschieben.
Ich tippte eine ambivalente Schlusszeile: »Braucht mehr Zeit? Möglicherweise später erneute Vorlage?«
Ich hielt den Atem an und schloss mit sanftem Zupfen den Buchdeckel. Immer noch vibrierte das Manuskript unter Strömen von Magie, am stärksten rund um die Klammern.
Erleichtert, dass ich es wieder geschlossen hatte, starrte ich Ashmole 782 an. Es juckte mich in den Fingern, noch einmal die Hand auszustrecken und das braune Leder zu berühren. Aber diesmal widerstand ich, so wie ich zuvor der Versuchung widerstanden hatte, die Beschriftungen und Illustrationen zu berühren, um mehr zu erfahren, als ein menschlicher Historiker legitimerweise wissen konnte.
Tante Sarah hatte mir immer gepredigt, die Magie sei ein Geschenk. Falls sie tatsächlich ein Geschenk war, dann war es mit Haken und Ösen gespickt, die mich an alle Bishop-Hexen vor mir fesselten. Wer seine ererbte magische Macht einsetzte und die Zaubersprüche und Beschwörungen verwendete, die das sorgsam gehütete Geheimnis der Hexenzunft bildeten, musste irgendwann dafür bezahlen. Indem ich Ashmole 782 geöffnet hatte, hatte ich die Mauer durchbrochen, die ich zwischen meiner wissenschaftlichen Arbeit und meinem magischen Erbe errichtet hatte. Aber nachdem ich mich auf die richtige Seite zurückgezogen hatte, war ich fester entschlossen denn je, dort zu bleiben.
Ich packte meinen Computer und meine Notizen zusammen, dann griff ich nach dem Manuskriptstapel, wobei ich Ashmole 782 absichtlich zuunterst legte. Zum Glück saß Gillian nicht an ihrem Schreibtisch, obwohl ihre Papiere überall verstreut lagen. Offenbar hatte sie vor, bis tief in die Nacht zu arbeiten, und war jetzt unterwegs, um sich eine Tasse Kaffee zu besorgen.
»Fertig?«, fragte Sean, als ich vor der Ausleihtheke stand.
»Nicht ganz. Ich würde die obersten drei gern für Montag reservieren.«
»Und das Vierte?«
»Mit dem bin ich fertig«, blökte ich und schob ihm die Handschriften zu. »Das kann wieder ins Magazin.«
Sean legte es oben auf den Rückgabestapel. Er begleitete mich noch zur Treppe, verabschiedete sich dort von mir und verschwand dann hinter einer Schwingtür. Das Förderband, das Ashmole 782 in die Eingeweide der Bibliothek zurücktransportieren würde, lief rasselnd an.
Um ein Haar hätte ich kehrtgemacht und ihn aufgehalten, aber ich konnte mich beherrschen.
Ich hatte gerade die Hand erhoben, um die Tür im Erdgeschoss aufzustoßen, als sich die Atmosphäre um mich herum verdichtete, fast als würde die Bibliothek mich erdrücken wollen. Einen Sekundenbruchteil lang schimmerte die Luft, so wie die Seiten der Handschrift auf Seans Theke geschimmert hatten. Ich schauderte unwillkürlich und spürte, wie sich die Härchen an meinen Armen aufstellten.
Irgendetwas war passiert. Etwas Magisches.
Mein Gesicht wandte sich wie von selbst dem Lesesaal zu, und meine Füße drohten zu folgen.
Das bildest du dir nur ein, dachte ich und marschierte entschlossen durch die Tür.
Bist du sicher?, flüsterte eine seit Langem zum Schweigen verdammte Stimme.
2
Die Glocken von Oxford schlugen sieben Mal. Die Nacht folgte der Dämmerung nicht mehr so gemächlich wie noch vor ein paar Monaten, aber noch zog sich der Wechsel über eine ganze Weile hin. In der Bibliothek waren erst vor dreißig Minuten die Lampen eingeschaltet worden, die jetzt kleine goldene Teiche in das graue Halbdunkel zauberten.
Es war der einundzwanzigste September. Überall auf der Welt trafen sich an diesem Abend der herbstlichen Tagundnachtgleiche die Hexen zu einem Festmahl, um Mabon zu feiern und die hereinbrechende Dunkelheit des Winters zu begrüßen. Doch die Hexen von Oxford würden ohne mich auskommen müssen. Man hatte mich auserkoren, im nächsten Monat bei einer wichtigen Konferenz ein Grundsatzreferat zu halten. Meine Ideen waren noch unausgereift, und das machte mich zusehends nervös.
Schon bei dem Gedanken, was meine Mithexen jetzt wohl irgendwo in Oxford speisen würden, begann mein Magen zu knurren. Seit halb zehn saß ich jetzt in der Bibliothek und hatte mir nur eine kurze Mittagspause gegönnt.
Sean hatte heute frei, und die Vertretung an der Ausleihtheke war neu. Sie hatte sich gespreizt, als ich ein halb verfallenes Manuskript angefordert hatte, und mich zu überzeugen versucht, stattdessen die Mikrofilmausgabe zu verwenden. Zum Glück hatte der Leiter des Lesesaales, Mr Johnson, sie gehört und war sofort aus seinem Büro gekommen, um einzuschreiten.
»Bitte entschuldigen Sie, Dr. Bishop«, hatte er eilig beteuert und dabei die schwere, dunkel gerahmte Brille auf der Nase nach oben geschoben. »Wenn Sie dieses Manuskript für Ihre Forschungen brauchen, werden Sie es natürlich bekommen.« Er verschwand, um das gesperrte Stück zu holen, und überreichte es mir, wobei er sich wortreich für die Unannehmlichkeiten und die neue Mitarbeiterin entschuldigte. Damit hatte ich dank meines Rufes als Wissenschaftlerin meinen Willen durchgesetzt und daraufhin den ganzen Nachmittag beschwingt und gut gelaunt gelesen.
Zufrieden, dass ich so viel geschafft hatte, nahm ich die beiden aufgerollten Gewichte von den oberen Ecken des Manuskriptes und schloss es sorgsam. Nachdem ich am Freitag auf das verhexte Manuskript gestoßen war, hatte ich das Wochenende nicht mit Alchemie, sondern mit Routinearbeiten verbracht, um in die Normalität zurückzufinden. Ich hatte Finanzierungsanträge ausgefüllt, Rechnungen bezahlt, Empfehlungsschreiben verfasst und sogar eine Buchbesprechung fertiggestellt. Unterbrochen hatte ich diese Tätigkeiten mit häuslichen Ritualen wie Wäsche zu waschen, Unmengen von Tee zu trinken und mich an Rezepten aus ein paar Fernseh-Kochsendungen zu versuchen.
Heute hatte ich mich den ganzen Tag so gut wie möglich auf die vor mir liegende Arbeit konzentriert, statt im Nachhinein über den eigentümlichen Illustrationen und dem mysteriösen Palimpsest in Ashmole 782 zu brüten. Jetzt warf ich einen kurzen Blick auf meine Nachbereitungsliste. Von den vier Fragen, die sich heute im Laufe des Tages ergeben hatten, war die dritte am einfachsten zu beantworten. Die Antwort musste in einem obskuren Journal mit dem Titel Notes and Queries zu finden sein, und dieses Journal stand frei zugänglich in einem der Regale, die sich der hohen Decke im Raum entgegenreckten. Ich schob den Stuhl zurück und beschloss, wenigstens diesen Punkt auf meiner Liste abzuhaken, bevor ich für heute Schluss machte.
Die oberen Regale im Selden End waren über eine durchgetretene Treppe zu erreichen, die auf eine Galerie mit Blick auf die Lesetische führte. Ich erklomm die krummen Stufen und stand bald vor den Regalfächern, in denen streng chronologisch geordnet die alten, mit Buchleinen bezogenen Bände standen. Niemand außer mir und einem betagten Professor der Alten Literatur aus dem Magdalen College schien sie je zu konsultieren. Ich entdeckte den gesuchten Band und fluchte leise. Er stand im obersten Fach, knapp außerhalb meiner Reichweite.
Ein leises Lachen ließ mich aufhorchen. Ich drehte mich um, weil ich sehen wollte, wer an dem Lesetisch am anderen Ende der Galerie saß, aber dort war niemand. Ich hörte schon wieder Gespenster. Oxford war immer noch mehr oder weniger verwaist, und alle Universitätsangestellten waren vor einer Stunde abgezogen, um sich vor dem Abendessen im Gemeinschaftsraum des Lehrpersonals ein Gratisglas Sherry zu genehmigen. Nachdem heute ein hoher Wicca-Feiertag war, war sogar Gillian am Spätnachmittag entschwunden, allerdings nicht, ohne mich ein letztes Mal zu ihrem Treffen einzuladen und dabei einen scheelen Blick auf meinen Stapel mit Lesematerial zu werfen.
Ich suchte nach der Trittleiter, die eigentlich auf der Galerie stehen sollte, aber die war nirgendwo zu sehen. In der Bodleian fehlte es immer an solchen Dingen, und es konnte leicht sein, dass ich fünfzehn Minuten brauchen würde, um in der Bibliothek eine Trittleiter aufzutreiben und sie nach oben zu schleppen, nur damit ich den Band aus dem Regalfach holen konnte. Ich zögerte. Am Freitag hatte ich ein verhextes Buch in der Hand gehalten und trotzdem der Versuchung widerstanden, Magie anzuwenden. Außerdem würde mich niemand sehen.
Trotz meiner Rechtfertigungsversuche spürte ich ein nervöses Kribbeln. Ich brach meine Regeln nur selten und vermerkte akribisch im Geiste sämtliche Situationen, in denen ich mich verleiten ließ, auf Magie zurückzugreifen. Dies wäre das fünfte Mal in diesem Jahr, den Reparaturzauber an der kaputten Waschmaschine und die Berührung von Ashmole 782 eingeschlossen. Nicht allzu schlecht für einen September, aber auch keine persönliche Bestleistung.
Ich holte tief Luft, hob die Hand und stellte mir das Buch darin vor.
Band 19 der Notes and Queries rutschte langsam aus dem Fach, kippte dann nach hinten, als würde er von unsichtbaren Fingern heruntergezogen, und fiel dumpf in meine offene Hand. Dort öffnete er sich von selbst auf der gesuchten Seite.
Der ganze Vorgang hatte knapp drei Sekunden gedauert. Ich atmete tief aus, um mein schlechtes Gewissen zu besänftigen. Im selben Moment erblühten zwei eisige Flecken zwischen meinen Schulterblättern.
Ich war beobachtet worden, und nicht von einem gewöhnlichen Menschen.
Wenn eine Hexe eine andere beobachtet, löst ihr Blick ein Kribbeln aus. Allerdings sind Hexen nicht die einzigen Geschöpfe, die neben den Menschen die Erde bevölkern. Es gibt auch Dämonen – kreative, künstlerische Kreaturen, die stets zwischen Genie und Wahnsinn balancieren. Als »Rockstars und Serienmörder« beschrieb meine Tante diese befremdlichen, faszinierenden Wesen. Und es gibt die Vampire, uralt und wunderschön, die sich von Blut ernähren und dich mit ihrem Charme betören, wenn sie dich nicht vorher töten.
Wenn ein Dämon mich anblickt, spüre ich einen dezenten, verunsichernden Druck wie von einem Kuss.
Doch wenn ein Vampir mich fixiert, fühlt sich das kalt, konzentriert und gefährlich an.
Ich ging im Geist alle Besucher im Duke-Humfrey-Lesesaal durch. An einen einzigen Vampir konnte ich mich erinnern, ein cherubinischer Mönch, der sich wie ein Liebhaber in mittelalterliche Mess- und Gebetsbücher versenkt hatte. Aber Vampire sind in Bibliothekssälen mit alten Büchern nur selten zu finden. Hin und wieder wurde einer von nostalgischer Eitelkeit befallen und kam hierher, um in Erinnerungen zu schwelgen, aber das waren Einzelfälle.
Hexen und Dämonen findet man viel öfter in Bibliotheken. Gillian Chamberlain war heute hier gewesen und hatte mit einer starken Lupe ihre Papyri studiert. Und in der Musikbibliothek hielten sich definitiv zwei Dämonen auf. Als ich an ihnen vorbeigegangen war, um mir in der Buchhandlung nebenan einen Tee zu holen, hatten beide wie benebelt aufgesehen. Einer hatte mir aufgetragen, ihm einen Caffè latte mitzubringen, was erkennen ließ, wie tief er in seine Wahnvorstellungen versunken war, wie die auch immer aussehen mochten.
Nein, in diesem Augenblick hatte mich ganz eindeutig ein Vampir ins Auge gefasst.
Ich war schon einigen Vampiren begegnet, schließlich arbeitete ich auf einem Gebiet, auf dem ich viel mit anderen Wissenschaftlern zu tun hatte, und in den Laboratorien in aller Welt wimmelt es von Vampiren. Die Wissenschaft honoriert lange Studien und unerschöpfliche Geduld. Und weil Wissenschaftler meist für sich allein arbeiten, ließ sich ein Leben, das sich nicht über Jahrzehnte, sondern Jahrhunderte erstreckte, viel leichter managen.
Heutzutage interessieren sich Vampire besonders für Teilchenbeschleuniger, Projekte zur Entzifferung des Genoms und für die Molekularbiologie. Früher hatten sie sich vorzugsweise in der Alchemie, Anatomie und Elektrophysik getummelt. Wenn es ordentlich knallte, wenn Blut im Spiel war oder versucht wurde, die Geheimnisse des Universums zu offenbaren, stieß man mit ziemlicher Sicherheit auf einen Vampir.
Ich drückte die mit unzulässigen Mitteln erlangte Ausgabe der Notes and Queries an meine Brust und drehte mich um. Er stand auf der anderen Seite des Raumes vor den paläografischen Nachschlagewerken und lehnte im Schatten an einem der eleganten Holzpfeiler, die die Galerie trugen. In seiner Hand lag eine aufgeschlagene Kopie von Janet Roberts Guide to Scripts Used in English Handwriting Up to 1500.
Ich hatte diesen Vampir noch nie gesehen – aber ich war ziemlich sicher, dass er keine Anleitung benötigte, um alte englische Handschriften zu entziffern.
Jeder, der schon mal einen Taschenbuch-Bestseller gelesen oder auch nur ferngesehen hat, weiß, dass Vampire atemberaubend aussehen, aber das kann einen nicht auf den Moment vorbereiten, in dem man tatsächlich einem von ihnen gegenübersteht. Sie sehen aus wie von einem genialen Bildhauer gemeißelt. Und wenn sie sich dann bewegen oder etwas sagen, kann dein Gehirn nicht einmal ansatzweise verarbeiten, was du siehst. Jede einzelne Bewegung ist voller Grazie; jedes Wort ist wie Musik. Ihre Augen fesseln dich, und genau so fangen sie ihre Beute. Ein langer Blick, ein paar ruhige Worte, eine Berührung: Hat dich ein Vampir erst eingesponnen, hast du keine Chance mehr.
Während ich diesen Vampir anstarrte, erkannte ich zunehmend verzagt, dass mein Wissen in diesem Bereich dummerweise hauptsächlich theoretischer Natur war. Und dass es mir jetzt, wo ich tatsächlich einem Vampir gegenüberstand, wenig nutzte.
Der einzige Vampir, mit dem ich mehr als flüchtig bekannt war, arbeitete im nuklearen Teilchenbeschleuniger in der Schweiz. Jeremy war dünn und sah fantastisch aus, hatte strahlend blondes Haar, blaue Augen und ein ansteckendes Lachen. Er hatte mit so gut wie allen Frauen im Kanton Genf geschlafen und arbeitete sich inzwischen durch die Stadt Lausanne vor. Was er anstellte, nachdem er die Frauen verführt hatte, hatte ich nie genauer wissen wollen, und hatte seine hartnäckigen Einladungen, mit ihm auszugehen, ebenso hartnäckig ausgeschlagen. Ich hatte immer angenommen, dass Jeremy ein typischer Vertreter seiner Gattung sei. Aber verglichen mit dem Vampir, der jetzt vor mir stand, kam er mir klobig, ungelenk und sehr, sehr jung vor.
Dieser hier war groß – mindestens einen Meter neunzig, selbst unter Berücksichtigung der perspektivischen Verzerrung, die sich dadurch ergab, dass ich von der Galerie auf ihn hinabsah. Und er war ganz bestimmt nicht dünn. Breite Schultern verengten sich zu schlanken Hüften, die in geschmeidige, muskulöse Beine übergingen. Seine Hände waren atemberaubend lang und gelenkig und wirkten dabei so grazil, dass mein Blick immer wieder davon angezogen wurde, fast als müsste ich ergründen, wie sie zu einem so mächtigen Mann gehören konnten.
Während meine Augen ihn von Kopf bis Fuß abtasteten, lagen seine fest auf mir. Aus dieser Entfernung wirkten sie nachtschwarz, und sie blickten unter ebenso schwarzen Brauen hervor, von denen eine wie ein Fragezeichen angehoben war. Sein Gesicht war wirklich atemberaubend – nichts als glatte Flächen und Kanten und dazu hoch angesetzte Wangenknochen. Oberhalb des Kinns war praktisch die einzige Stelle, an der Raum für etwas Weiches blieb – seinen breiten Mund, der genau wie seine langen Hände irgendwie nicht ins Bild passen wollte.
Aber nicht sein makelloser Körper machte mich so nervös. Sondern die raubtierhafte Kombination von Kraft, Behändigkeit und messerscharfer Intelligenz, die durch den ganzen Raum hindurch zu spüren war. In seiner schwarzen Hose und dem hellgrauen Pullover, mit den dichten, aus der Stirn gekämmten und im Nacken kurz geschnittenen Haaren sah er aus wie ein Panther, der jeden Moment zuschlagen kann, es damit aber nicht eilig hat.
Er lächelte. Es war ein dezentes, höfliches Lächeln, bei dem er nicht die Zähne zeigte. Ich ahnte sie trotzdem und sah sie in Gedanken in zwei perfekten, scharfen Reihen hinter seinen blassen Lippen stehen.
Bei dem bloßen Gedanken an seine Zähnejagte ein solcher Adrenalinstoß durch meinen Körper, dass meine Fingerspitzen kitzelten. Plötzlich konnte ich nur noch denken: Du musst von hier verschwinden. SOFORT.
Die Treppe erschien mir viel weiter weg als die vier Schritte, die ich bis dorthin brauchte. Ich rannte nach unten, kam auf der letzten Stufe ins Straucheln und flog direkt in die wartenden Arme des Vampirs.
Natürlich hatte er vor mir den Fuß der Treppe erreicht.
Seine Finger waren kühl, und seine Arme fühlten sich eher nach Stahl an als nach Fleisch und Knochen. Der Duft von Nelken, Zimt und etwas wie Weihrauch lag in der Luft. Er richtete mich wieder auf, hob die Notes and Queries vom Boden auf und überreichte sie mir mit einer kleinen Verbeugung. »Dr. Bishop, nehme ich an?«
Von Kopf bis Fuß zitternd nickte ich.
Die langen, blassen Finger seiner rechten Hand tauchten in die Jackentasche und zogen eine blau-weiße Visitenkarte heraus. Er hielt sie mir hin. »Matthew Clairmont.«
Ängstlich darauf bedacht, ihn nicht zu berühren, zupfte ich die Karte mit spitzen Fingern aus seinem Griff. Dem vertrauten Wappen der Universität Oxford mit den drei Kronen und dem offenen Buch folgte Clairmonts Name und danach eine Reihe von Abkürzungen, denen ich entnehmen konnte, dass er in die Royal Society aufgenommen worden war.
Nicht schlecht für jemanden, der aussah wie zwischen Mitte und Ende dreißig, auch wenn ich annahm, dass er in Wahrheit mindestens zehnmal so alt war.
Und was sein Forschungsgebiet anging: Es überraschte mich nicht, dass der Vampir Professor der Biochemie war und mit der Oxford Neuroscience im John Radcliffe Hospital zusammenarbeitete. Blut und Anatomie – zwei Lieblingsgebiete der Vampire. Auf der Karte waren drei verschiedene Labortelefonnummern, dazu eine Büronummer und eine E-Mail-Adresse abgedruckt. Ich hatte ihn vielleicht noch nie gesehen, aber er war jedenfalls nicht unerreichbar.
»Professor Clairmont«, piepste ich, bevor mir alle weiteren Worte in der Kehle steckenblieben. Mit aller Kraft widerstand ich dem Drang, schreiend zum Ausgang zu rennen.
»Wir sind uns noch nicht begegnet«, fuhr er mit einem eigentümlichen Akzent fort. Hauptsächlich klang er nach Oxford und Cambridge, andererseits hatte sein Tonfall etwas Weiches, das ich nicht einordnen konnte. Seine Augen, die mir unbeirrt ins Gesicht blickten, waren eigentlich gar nicht so dunkel, entdeckte ich, sie wurden nur von riesigen Pupillen beherrscht, die von einem dünnen, graugrünen Irisring eingefasst waren. Ihr Sog war unwiderstehlich, und ich merkte, dass ich mich einfach nicht abwenden konnte.
Wieder bewegte sich der Mund des Vampirs. »Ich bin ein großer Bewunderer Ihrer Arbeit.«
Es war nicht völlig undenkbar, dass sich ein Professor der Biochemie für die Alchemie des siebzehnten Jahrhunderts interessierte, aber es kam mir doch reichlich unwahrscheinlich vor. Ich zupfte am Kragen meiner weißen Bluse und suchte kurz den Raum ab. Außer uns war niemand zu sehen. Niemand saß an dem alten Eichentisch mit den Karteikästen, niemand an den Computern. Und wer auch immer an der Rückgabetheke saß, war zu weit entfernt, um mir helfen zu können.
»Ich fand Ihren Artikel über die Farbsymbolik der alchemischen Transformation sehr überzeugend und Ihre Arbeit über Robert Boyles Annäherung an die Probleme der Expansion und Kontraktion ausgesprochen einleuchtend«, fuhr Clairmont ungerührt fort, als wäre er es gewohnt, Gespräche quasi allein zu führen. »Ihr letztes Buch über die alchemistische Ausbildung und Lehre habe ich noch nicht fertig gelesen, aber ich genieße es sehr.«
»Danke«, hauchte ich. Sein Blick senkte sich von meinen Augen auf meinen Hals.
Ich hörte auf, an meinen Kragenknöpfen zu nesteln.
Seine unglaublichen Augen blickten wieder in meine. »Sie verstehen es meisterhaft, Ihren Lesern die Vergangenheit nahezubringen.« Ich nahm das als Kompliment, denn er als Vampir musste wissen, ob ich Unsinn erzählte. Clairmont blieb kurz still. »Dürfte ich Sie zum Abendessen einladen?«
Mir blieb der Mund offen stehen. Abendessen? Vielleicht konnte ich ihm in der Bibliothek nicht entkommen, aber es gab für mich keinen Grund, eine ganze Mahlzeit mit ihm zu verbringen – vor allem, da er mir nur beim Essen zusehen würde, wenn ich seine Vorlieben richtig einschätzte.
»Ich habe schon was vor«, sagte ich barsch, ohne eine glaubhafte Erklärung abgeben zu können, was das sein sollte. »Wirklich zu schade«, murmelte er, und der Hauch eines Lächelns spielte um seine Lippen. »Dann vielleicht ein andermal. Sie werden das ganze Jahr in Oxford verbringen, nicht wahr?«
Sich in der Nähe eines Vampirs aufzuhalten, hätte jeden nervös gemacht, außerdem rief Clairmonts Nelkenduft den eigenartigen Geruch von Ashmole 782 wieder wach. Ich war zu keinem klaren Gedanken mehr fähig und beschränkte mich darum auf ein Nicken. Das erschien mir sicherer.
»Dachte ich mir«, sagte Clairmont. »Unsere Wege werden sich bestimmt wieder kreuzen. Oxford ist so klein.«
»Wirklich klein«, pflichtete ich ihm bei und wünschte mir, ich hätte mich entschieden, mein Forschungssemester in London zu verbringen.
»Bis dann, Dr. Bishop. Es war mir ein Vergnügen.« Clairmont streckte mir die Hand entgegen. Abgesehen von dem kurzen Ausflug an meinen Kragen hatten seine Augen unausgesetzt meine fixiert. Ich hatte ihn auch nicht blinzeln sehen. Ich nahm meine ganze Kraft zusammen, weil ich nicht als Erste den Blick abwenden wollte.
Meine Hand schob sich vor, zögerte aber kurz, bevor sie seine ergriff. Ich spürte einen flüchtigen Druck, dann entzog er mir die Hand wieder. Er trat lächelnd zurück und verschwand in der Dunkelheit des ältesten Bibliotheksbereiches.
Ich blieb reglos stehen, bis ich meine vereisten Hände wieder bewegen konnte, dann ging ich an meinen Tisch zurück und fuhr den Computer herunter. Während ich meine Papiere zusammenpackte, fragten mich die Notes and Queries vorwurfsvoll, warum ich mir die Mühe gemacht hatte, sie aus dem Regal zu holen, wenn ich nicht einmal einen Blick hineinwerfen wollte. Meine Aufgabenliste sah ebenfalls tadelnd zu mir auf. Ich riss das Blatt vom Block ab, knüllte es zusammen und versenkte es in dem geflochtenen Papierkorb unter dem Schreibtisch.
»Es ist genug, dass ein jeder Tag seine eigene Plage hat«, murmelte ich vor mich hin.
Der Nachtaufseher im Leseraum sah auf die Armbanduhr, als ich meine Manuskripte zurückgab. »Sie gehen heute früher, Dr. Bishop?«
Ich nickte und biss mir auf die Lippe, um nicht herauszuplatzen, ob er nicht wisse, dass sich zwischen den paläografischen Nachschlagewerken ein Vampir herumtrieb.
Er griff nach dem Stapel grauer Kartons, in denen die Handschriften steckten. »Werden Sie die morgen wieder brauchen?«
»Ja«, flüsterte ich. »Morgen.«
Nachdem ich mit der Rückgabe der Manuskripte meine letzte Gelehrtenpflicht erfüllt hatte, war ich frei. Das Klackern meiner Absätze auf dem Linoleumboden hallte von den Wänden wider, als ich durch die Gittertür vor dem Lesesaal stürmte, an den mit Samtbändern vor neugierigen Fingern geschützten Büchern vorbei, und dann die abgewetzte Holztreppe hinab in den geschlossenen Hof im Erdgeschoss. Ich lehnte mich gegen das Eisengeländer rund um die Bronzestatue von William Herbert, sog gierig die frostige Luft ein und bemühte mich, das Nelken- und Zimtaroma aus meiner Nase zu vertreiben.
In Oxford war jede Nacht irgendwas los, ermahnte ich mich streng. Dann gab es eben einen Vampir mehr in der Stadt, na und?
Trotz meiner mutigen Selbstansprache im Hof ging ich schneller als sonst nach Hause. Durch die düstere New College Lane zu gehen war schon bei Tag irgendwie unheimlich. Ich zog meine Karte durch den Schlitz am hinteren Tor des New College und spürte, wie etwas von der Anspannung aus meinem Körper wich, sobald der Torflügel hinter mir ins Schloss fiel, gerade als würden jede Tür und jede Wand, die ich zwischen mich und die Bibliothek gebracht hatte, mich zusätzlich schützen. Ich huschte unter den Kapellenfenstern entlang und durch den schmalen Durchgang in den Kolleghof. Von hier aus konnte man auf den einzigen noch existierenden mittelalterlichen Garten in Oxford sehen, wo es sogar einen jener traditionellen Hügel gab, die den Studenten von einst beim Nachsinnen über die Mysterien Gottes und der Natur einen grünen Ausblick bieten sollten. Heute Abend kamen mir die spitzen Türme und Bogen des Colleges ganz besonders gotisch vor, und ich konnte es kaum erwarten, ins Gebäude zu kommen.