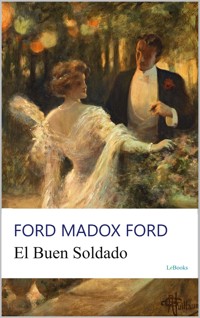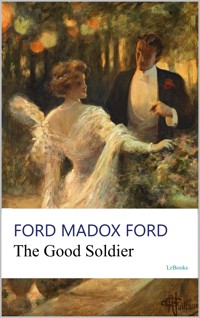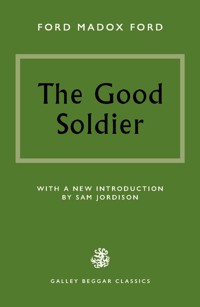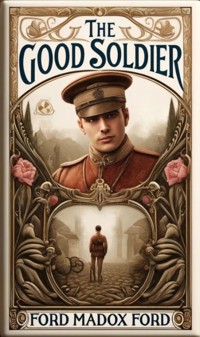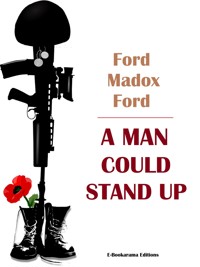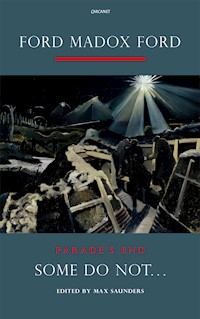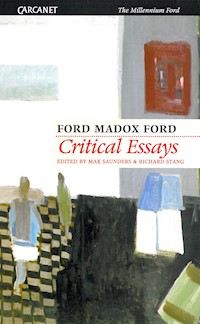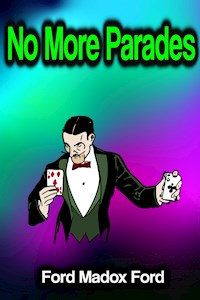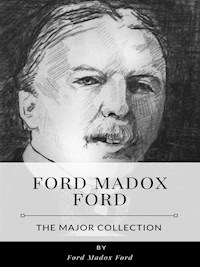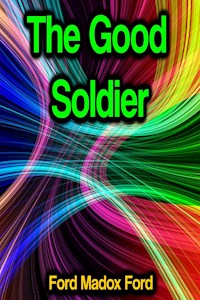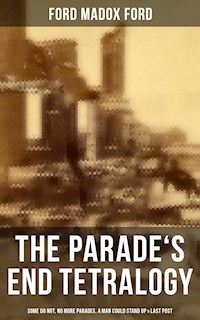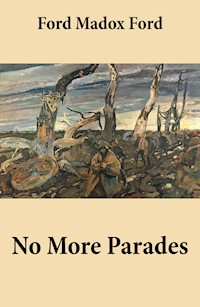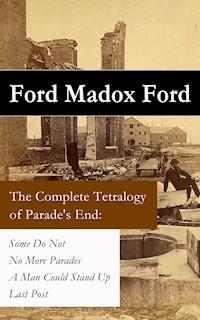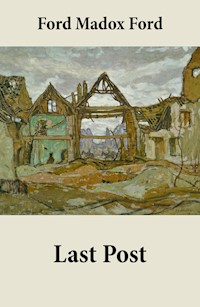25,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag AG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Am Vorabend des Ersten Weltkriegs verbringen die Ehepaare Ashburnham und Dowell alljährlich glückliche Tage in Bad Nauheim. Erst nach dem Tod seiner Frau entdeckt John Dowell, dass der Schein in all den Jahren getrogen hat, und er beginnt, den wahren Charakter seiner Freunde und seiner Frau zu erkennen. Ein bewegender Roman, der den Leser mit jedem seiner betörenden Sätze tiefer in das Labyrinth der menschlichen Seele lockt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 379
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Ford Madox Ford
Die allertraurigste Geschichte
Roman
Aus dem Englischen von Fritz Lorch und Helene Henze
Mit einem Nachwort von Julian Barnes
Diogenes
{7}An Stella Ford
Meine liebe Stella,
Ich habe dies immer als mein bestes Buch betrachtet – zumindest als mein bestes Buch aus der Vorkriegszeit, und zwischen seiner Niederschrift und dem Erscheinen meines folgenden Romans müssen fast zehn Jahre dahingegangen sein, so dass man alles, was ich seither geschrieben habe, als das Werk eines anderen Mannes – als das Werk ›Deines‹ Mannes – betrachten könnte. Denn es ist sicher, dass ich ohne den Anreiz zum Leben, den Du mir gabst, kaum die Kriegsepoche überstanden hätte, und noch sicherer ist, dass ich ohne Deinen Ansporn, wieder zu schreiben, nie wieder geschrieben hätte. Dank eines seltenen Zufalls ist The Good Soldier fast das einzige unter meinen Büchern, das niemandem gewidmet ist: Das Schicksal hatte offenbar beschlossen, das Buch die zehn Jahre lang warten zu lassen, die es nun gewartet hat – auf diese Widmung.
Was ich jetzt bin, verdanke ich Dir: Was ich damals war, als ich The Good Soldier schrieb, verdanke ich der Verkettung von Umständen eines ziemlich ziellosen und launenhaften Lebens.
Bis ich mich hinsetzte, um dieses Buch zu schreiben – es war am 17. Dezember 1913 –, hatte ich niemals {8}versucht, mich richtig ins Zeug zu legen (wie man von Rennpferden sagt); teils weil ich stets sehr fest davon überzeugt war, ich würde – wie immer es sich mit anderen Schriftstellern verhalten mochte – nicht einmal fähig sein, vor der Vollendung meines vierzigsten Jahres einen Roman zu schreiben, zu dem ich stehen könnte; teils auch, weil ich sehr entschieden nicht mit anderen Schriftstellern konkurrieren wollte, deren Anspruch auf Anerkennung oder dem Verlangen danach und nach dem, was Anerkennung bringt, größer waren als die meinen. Ich hatte niemals wirklich versucht, in einen Roman von mir alles hineinzulegen, was ich von der Kunst des Schreibens wusste. Ich hatte eher beiläufig eine Anzahl Bücher geschrieben – eine große Anzahl –, aber sie alle hatten vielmehr den Charakter einer pastiche, waren Stücke preziöser Schreiberei oder glichen einer tour de force. Aber ich war immer wie besessen vom Schreiben, davon, wie man schreiben sollte, und teils allein, teils zusammen mit Joseph Conrad hatte ich schon zu jener Zeit umfangreiche Studien zu der Frage unternommen, wie man mit Wörtern umgehen und wie man Romane entwerfen sollte.
An dem Tag, an dem ich vierzig Jahre alt wurde, setzte ich mich nun hin, um zu zeigen, was ich konnte – und The Good Soldier war das Resultat. Ich hatte die feste Absicht, dies sollte mein letztes Buch sein. Ich hatte immer gedacht – und ich weiß nicht, ob ich nicht heute noch ebenso denke –, ein Buch geschrieben zu haben sei für jeden Mann genug; und damals, als The Good Soldier beendet war, schien in London und {9}womöglich in der ganzen Welt die Herrschaft neuer und viel lebhafterer Schriftsteller anzubrechen. Das waren die erregenden Tage der literarischen Kubisten, Futuristen, Imaginisten und der übrigen tapageurs und aufrührerischen jeunes jenes jungen Jahrzehnts. So kam ich mir wie ein Aal vor, der, nachdem er die tiefe See erreicht hat, sein Junges auf die Welt bringt und stirbt – oder ich sagte mir, wie der große Alk, das mir beschiedene Los sei erfüllt, ich hätte mein eines Ei gelegt und dürfe sterben. Deshalb nahm ich in aller Form Abschied von der Literatur, in den Spalten einer Zeitschrift mit Namen Thrush – die ebenfalls, armer kleiner Alk, der sie war, nach dieser Anstrengung den Geist aufgab. Dann schickte ich mich an, beiseitezutreten, zugunsten unserer guten Freunde – Deiner und meiner Freunde – Ezra, Eliot, Wyndham Lewis, H.D. und der übrigen Schar stürmischer junger Schriftsteller, die damals an die Tür klopften.
Aber größere Stürme brachen über London und die Welt herein, die bis dahin zu den stolzen Füßen jener Eroberer zu liegen schienen; Kubismus, Futurismus, Imaginismus kamen unter dem Donner der Kanonen nie richtig zum Zuge, und so bin ich wieder aus meiner Höhle hervorgekrochen und habe mir ein Herz gefasst, neben Deine starken, zarten und schönen Werke einige meiner eigenen zu legen.
The Good Soldier bleibt für mich jedoch mein großes Alk-Ei, als der Abkömmling einer Rasse, die keine Nachfahren haben wird, und da das Buch schon vor so langer Zeit geschrieben wurde, werde ich wohl nicht {10}allzu eitel erscheinen, wenn ich mich einen Augenblick darüber auslasse. Kein Autor, glaube ich, verdient den Tadel der Eitelkeit, wenn er eines seiner zehn Jahre alten Bücher nimmt und ruft: »Gütiger Himmel, habe ich damals so gut geschrieben?« Denn das schließt stillschweigend mit ein, dass man inzwischen nicht mehr so gut schreibt. Und die wenigsten sind so neidisch, die Selbstgefälligkeit eines erloschenen Vulkans zu tadeln.
Wie dem auch sei – ich wurde kürzlich zu einer ziemlich eingehenden Prüfung des Buches veranlasst, denn ich musste es ins Französische übertragen, was mich zwang, dem Buch eine viel höhere Aufmerksamkeit zu widmen, als es noch bei der eindringlichsten Lektüre der Fall gewesen wäre. Und ich muss gestehen, ich war erstaunt über die Mühe, die ich auf die Struktur des Buches verwandt haben muss, über die verzwickte Verflechtung von kreuz und quer laufenden Beziehungen: Das ist zwar nicht verwunderlich, denn wenn ich das Buch auch in verhältnismäßig kurzer Zeit geschrieben habe, so hatte ich doch schon ein volles Jahrzehnt innerlich darüber gebrütet, weil die Geschichte eine wahre Geschichte ist, weil ich sie von Edward Ashburnham selbst hatte und sie erst niederschreiben konnte, als alle anderen tot waren. So trug ich sie all die Jahre mit mir herum und dachte immer wieder darüber nach.
Ich hatte zu jener Zeit einen Ehrgeiz: nämlich für den englischen Roman dasselbe zu leisten, was Maupassant mit Fort comme la mort für den französischen geleistet hatte. Eines Tages erhielt ich die Belohnung: Ich befand {11}mich zufällig in einer Gesellschaft, in der ein glühender junger Verehrer ausrief: »Bei Gott, The Good Soldier ist der schönste Roman in englischer Sprache!«, worauf mein Freund Mr. John Rodker, der meinem Werk stets eine angemessen zurückhaltende Bewunderung entgegenbrachte, mit seiner hellen, schleppenden Stimme bemerkte: »Ah ja, das ist er. Aber Sie haben ein Wort ausgelassen. Er ist der schönste französische Roman in englischer Sprache!«
Mit dieser Bemerkung – die mein Tribut an meine Meister in Frankreich ist – überlasse ich das Buch dem Leser. Aber ich möchte noch ein Wort zum Titel sagen. Ich habe dieses Buch ursprünglich The Saddest Story genannt; da es aber erst erscheinen konnte, als die dunkelsten Tage des Krieges über uns hereinbrachen, bestürmte mich mein Verleger Mr. Lane in Briefen und Telegrammen – ich war damals mit anderen Dingen beschäftigt! –, den Titel zu ändern, der, wie er sagte, das Buch zu jenem Zeitpunkt unverkäuflich gemacht hätte.
Eines Tages, als ich auf einer Parade war, erhielt ich von Mr. Lane ein letztes flehentliches Telegramm, und da die Rückantwort bezahlt war, nahm ich das Antwortformular und schrieb darauf mit hastiger Ironie: »Lieber Lane, warum nicht The Good Soldier?« … Zu meinem Schrecken erschien das Buch sechs Monate später unter diesem Titel.
Du, meine liebe Stella, wirst diese Geschichten oft von mir gehört haben. Aber jetzt trennt uns der Ozean, und ich stecke sie in diesen Brief, den Du lesen wirst, ehe {12}Du mich wiedersiehst, in der Hoffnung, sie mögen Dich erfreuen, und mit der Illusion, dass Du vertraute – und liebevolle – Stimmen hörst. Und so unterzeichne ich in aller Aufrichtigkeit und in der Hoffnung, Du mögest zugleich die besondere Zueignung dieses Buches und die allgemeine Zueignung dieser Ausgabe annehmen.
Dein F.M.F.
New York,
9. Januar 1927
{13}Erster Teil
I
Dies ist die traurigste Geschichte, die ich je gehört habe. Neun Jahre hindurch hatten wir während der Kursaison in Bad Nauheim mit den Ashburnhams in der größten Vertrautheit verkehrt – oder vielmehr in einem Verhältnis zu ihnen gestanden, das so lose und unbeschwert und doch so eng war wie das eines guten Handschuhs mit Ihrer Hand. Meine Frau und ich kannten Hauptmann und Mrs. Ashburnham so gut, wie man jemanden nur kennen kann, und doch wussten wir auch wieder gar nichts von ihnen. Das ist, glaube ich, ein Zustand, wie er nur bei Engländern möglich ist, die mir bis zum heutigen Tag, da ich mich hinsetze, um herauszufinden, was ich von dieser traurigen Affäre weiß, völlig fremd sind. Bis vor sechs Monaten war ich nie in England gewesen, und natürlich hatte ich nie die Tiefen eines englischen Herzens ausgelotet. Ich kannte nur seine Untiefen.
Ich will nicht sagen, wir hätten nicht mit vielen Engländern Bekanntschaft gemacht. Da wir nun einmal notgedrungen in Europa lebten und notgedrungen unbeschäftigte Amerikaner waren, was mit unamerikanisch gleichzusetzen ist, befanden wir uns sehr oft in Gesellschaft {14}feiner Engländer. Paris, sehen Sie, war unser Wohnsitz. Ein Ort irgendwo zwischen Nizza und Bordighera bot uns jährlich Winterquartier, und Nauheim sah uns immer von Juli bis September. Sie werden hieraus entnehmen, dass einer von uns, wie man so sagt, es am Herzen hatte, und aus der weiteren Angabe, dass meine Frau tot ist, schließen, dass sie die Leidende war.
Hauptmann Ashburnham hatte es ebenfalls am Herzen. Aber während ihn ungefähr ein Monat in Nauheim jeden Sommer für den Rest des Jahres auf genau die richtige Tonhöhe stimmte, reichten die zwei Monate, die wir dort verbrachten, gerade so aus, um die arme Florence von Jahr zu Jahr am Leben zu erhalten. Dass er sein Herz spürte, lag vermutlich am Polo oder an dem viel zu harten Sport in seiner Jugend. An den verwüsteten Jahren der armen Florence war ein Sturm auf unserer ersten Überfahrt nach Europa schuld, und die unmittelbaren Gründe für unsere Gefangenschaft auf diesem Kontinent waren die Anordnungen der Ärzte. Sie sagten, schon die kurze Fahrt über den Kanal könnte das arme Ding das Leben kosten.
Als wir uns zum ersten Mal begegneten, war Hauptmann Ashburnham, der auf Erholungsurlaub aus Indien gekommen war, wohin er nie wieder zurückkehren sollte, dreiunddreißig Jahre alt; Mrs. Ashburnham – Leonora – war einunddreißig. Ich war sechsunddreißig und die arme Florence dreißig. Heute wäre Florence also neununddreißig Jahre alt und Hauptmann Ashburnham zweiundvierzig; während ich fünfundvierzig bin und Leonora vierzig. Sie sehen also, unsere Freundschaft war eine Angelegenheit des jungen mittleren Alters, denn wir alle waren von recht beschaulicher {15}Gemütsart, insbesondere die Ashburnhams waren das, was man in England gewöhnlich ›ganz ordentliche Leute‹ nennt.
Sie stammten, wie Sie wahrscheinlich erwartet haben, von den Ashburnhams ab, die Karl I. auf das Schafott begleiteten, und wie Sie ebenfalls bei dieser Klasse Engländer erwarten müssen, hätten Sie ihnen das nie angemerkt. Mrs. Ashburnham war eine Powys; Florence war eine Hurlbird aus Stamford, Connecticut, wo man, wie Sie wissen, altmodischer ist, als selbst die Einwohner von Cranford in England es je sein könnten. Ich selbst bin ein Dowell aus Philadelphia, Pennsylvania, wo es, wie historisch verbürgt ist, mehr alte englische Familien gibt, als man in sechs englischen Grafschaften zusammengenommen finden würde. Tatsächlich trage ich – als wäre dies das einzige Ding, das mich unsichtbar an irgendeinen Punkt des Erdballs festkettet – die Besitzurkunden meiner Farm bei mir, die sich früher einmal über einige Blocks zwischen Chestnut Street und Walnut Street erstreckte. Diese Besitzurkunden sind aus Wampum und das Geschenk eines indianischen Häuptlings an den ersten Dowell, der von Farnham in Surrey als Begleiter William Penns aufbrach. Florences Familie, wie das so oft bei den Einwohnern von Connecticut der Fall ist, stammte aus der Nachbarschaft von Fordingbridge, wo auch der Besitz der Ashburnhams liegt. Und von hier aus schreibe ich gegenwärtig.
Sie mögen wohl fragen, warum ich schreibe. Und doch habe ich recht viele Gründe hierfür. Denn es ist nichts Ungewöhnliches, dass Menschen, die der Plünderung einer Stadt beiwohnten oder dem Verfall eines Volkes, das Bedürfnis haben, niederzuschreiben, was sie erlebten – zum {16}Nutzen unbekannter Erben und unendlich ferner Generationen; oder, wenn Sie wollen, einfach um das Bild im Kopf loszuwerden.
Irgendjemand hat gesagt, der Krebstod einer Maus sei ein Ereignis von der Größe der Plünderung Roms durch die Vandalen, und ich schwöre Ihnen, der Zusammenbruch unseres kleinen Viereckverhältnisses war ein ebenso unvorstellbares Ereignis. Angenommen, Sie wären uns begegnet, wie wir an einem der kleinen Tische vor dem Klubhaus, sagen wir in Bad Homburg, bei unserem Nachmittagstee saßen und dem Miniaturgolf zusahen, dann hätten Sie gesagt, nach allem menschlichen Dafürhalten wären wir eine außerordentlich feste Burg. Wir waren, wenn Sie so wollen, eines jener mächtigen Schiffe mit weißen Segeln auf blauer See, eines der Dinge, die uns als die stolzesten und sichersten all der schönen und sicheren Dinge erscheinen, die Gott den Menschenverstand ersinnen ließ. Wo hätte man eine bessere Zuflucht finden können? Wo?
Dauer? Beständigkeit? Ich kann nicht glauben, dass sie dahin ist. Ich kann nicht glauben, dass jenes lange, friedliche Leben, das sich wie die Figuren eines Menuetts bewegte, nach neun Jahren und sechs Wochen innerhalb von vier zerschmetternden Tagen verschwunden sein soll. Ja, mein Wort, unser vertrauter Umgang glich einem Menuett, einfach weil wir bei jeder Gelegenheit und unter allen Umständen wussten, wohin wir gehen, wo wir sitzen, welchen Tisch wir in Einmütigkeit wählen würden; und wir konnten uns alle vier erheben und weitergehen, ohne dass einer von uns ein Zeichen dazu gegeben hätte, immer nach der Musik des Kurorchesters, immer in dem milden Sonnenschein {17}oder, wenn es regnete, im Schutz der Wandelgänge. Nein, wahrlich, es kann nicht dahin sein. Man kann ein menuet de la cour nicht töten. Man kann das Notenbuch zuschlagen, das Cembalo schließen; in Kleiderschrank und Wäschebord mögen Ratten die weißen Atlasschleifen zerfressen. Der Pöbel mag Versailles plündern, das Trianon mag fallen, das Menuett aber – das Menuett tanzt von allein weiter, bis zu den fernsten Sternen, und so wird auch unser Menuett aus den hessischen Bädern seine Figuren immer noch weiterschreiten. Gibt es keinen Himmel, in dem alte schöne Tänze, die alte schöne Vertrautheit fortdauern? Gibt es nicht irgendein Nirwana, das erfüllt ist von dem leisen Rauschen der Instrumente, die in den Staub der Bitternis gesunken sind, aber doch von zarten, bebenden, unsterblichen Seelen bewohnt waren?
Nein, bei Gott, es ist falsch! Es war kein Menuett, das wir tanzten; es war ein Gefängnis – ein Gefängnis voll mit kreischenden Hysterikern, die geknebelt waren, damit sie das Rollen der Räder unserer Kutschen auf den schattigen Alleen des Taunus nicht übertönten.
Und doch schwöre ich beim heiligen Namen meines Schöpfers, es war die Wahrheit. Es war wahrer Sonnenschein, wahre Musik, und wahr war auch das Plätschern der Fontänen aus dem Mund der steinernen Delphine. Denn wenn wir in meinen Augen vier Leute mit demselben Geschmack, mit denselben Wünschen waren, Leute, die einmütig handelten – oder nein, nicht handelten –, die einmütig hier und dort beisammensaßen, so soll das nicht die Wahrheit sein? Wenn ich neun Jahre lang einen schönen Apfel habe, der im Innern faul ist, und seine Fäulnis erst {18}nach neun Jahren und sechs Monaten minus vier Tage entdecke, darf ich dann nicht sagen, ich hätte neun Jahre lang einen schönen Apfel gehabt? So mag es sich wohl auch mit Edward Ashburnham verhalten, mit Leonora, seiner Frau, und der armen lieben Florence. Und ist es nicht, wenn man darüber nachdenkt, ein wenig sonderbar, dass ich die physische Morschheit wenigstens zweier Säulen unseres viereckigen Hauses niemals als eine Bedrohung seiner Sicherheit empfand? Auch jetzt empfinde ich es nicht so, obwohl die beiden doch tot sind. Ich weiß nicht …
Ich weiß nichts – wahrhaftig nichts – von den Herzen der Menschen. Ich weiß nur, dass ich allein bin – furchtbar allein. Kein Kaminfeuer wird für mich je wieder Zeuge freundschaftlichen Umgangs sein. Nie mehr werde ich ein Rauchzimmer anders sehen als mit unberechenbaren, rauchumkränzten Schatten bevölkert. Aber, in Gottes Namen, was sollte ich anderes kennenlernen als das Leben am Kaminfeuer und im Rauchzimmer, da ich doch mein ganzes Leben an solchen Orten verbracht habe? Das warme Kaminfeuer! – Nun, da war Florence: Ich glaube, in den zwölf Jahren, die ihr Leben noch währte, nachdem der Sturm ihr Herz, wie es schien, unheilbar geschwächt hatte – ich glaube, ich habe sie während dieser Zeit nie länger als eine Minute aus den Augen gelassen, außer wenn sie sicher im Bett eingepackt war und ich mich vielleicht mit dem einen oder anderen guten Kerl unten im Gesellschaftsraum oder Rauchzimmer unterhielt oder mit einer Zigarre noch einen letzten Rundgang machte, ehe ich selbst zu Bett ging. Verstehen Sie mich recht, ich tadle Florence nicht. Aber woher kann sie gewusst haben, was sie wusste? Wie kam sie nur {19}dazu, es zu wissen? Es so umfassend zu wissen. Himmel! Mir scheint, sie hatte doch gar keine Zeit dazu. Es muss geschehen sein, während ich mein Bad nahm und meine schwedischen Übungen machte, während ich manikürt wurde. Bei dem Leben einer emsigen, überanstrengten Krankenschwester, das ich führte, musste ich etwas tun, um mich in Form zu halten. Es muss bei diesen Gelegenheiten geschehen sein! Aber auch sie können ihr nicht Zeit genug gelassen haben für die entsetzlich langen Gespräche voller Weltklugheit, von denen mir Leonora seit dem Tod der beiden berichtet hat. Und kann man sich vorstellen, dass sie während unserer vorgeschriebenen Spaziergänge in Bad Nauheim und Umgebung Zeit genug fand für die langwierigen Verhandlungen, die sie zwischen Edward Ashburnham und dessen Frau führte? Und ist es nicht unwahrscheinlich, dass Edward und Leonora diese ganze Zeit über nicht ein Wort im Vertrauen miteinander sprachen? Was soll man nur von der Menschheit halten?
Denn ich schwöre Ihnen, sie waren ein Musterpaar. Er war ihr so ergeben, wie man nur sein kann, ohne albern zu wirken. Ein so ausgeglichener Mensch mit ehrlichen blauen Augen und einem Anflug von Dummheit und so warmer Gutherzigkeit! Und sie – so groß, so herrlich im Sattel, so blond! Ja, Leonora war außerordentlich blond und die Vollendung in Person – fast zu schön, um wahr zu sein. Ich meine, man findet in der Regel nicht alles so superlativisch beisammen. Die erste Familie in der Grafschaft zu sein, wie die erste Familie der Grafschaft auszusehen und entsprechend reich zu sein, auch das in Vollendung; so vollendete Manieren – sogar bis hin zur befreienden Spur an {20}Anmaßung, die offenbar unerlässlich ist. All das zu haben und all das zu sein! Nein, es war zu schön, um wahr zu sein. Und doch sagte sie erst heute Nachmittag zu mir, als sie über die ganze Angelegenheit sprach: »Einmal versuchte ich es mit einem Liebhaber, aber mir war so elend ums Herz, ich war so erschöpft, dass ich ihn wegschicken musste.« Nie hatte ich etwas so Überraschendes gehört. Sie sagte: »Ich lag buchstäblich einem Mann in den Armen. So ein netter Kerl! So ein lieber Junge! Und ich sagte mir verbissen, ich zischte es durch die Zähne, wie sie es in den Romanen tun – ich biss sie wirklich zusammen –, ich sagte mir: ›Nun hat’s mich gepackt, und nun will ich auch einmal meine Freude haben – einmal im Leben!‹ Es war dunkel, in einer Kutsche auf dem Heimweg von einem Jagdfest. Wir mussten elf Meilen fahren! Und dann plötzlich die Bitterkeit der ewigen Armut, des ewigen Theaters – es fiel wie ein Fluch auf mich, es verdarb mir alles. Ja, ich musste einsehen, dass ich sogar für die Freude verdorben war, als sie wirklich kam. Und ich brach in Tränen aus und schluchzte und schluchzte die ganzen elf Meilen lang. Stellen Sie sich mich nur schluchzend vor! Und stellen Sie sich nur vor, wie ich diesen armen lieben Kerl zum Narren hielt. Es war natürlich gegen die Spielregel, nicht wahr?«
Ich weiß nicht; ich weiß nicht; war ihre letzte Bemerkung nicht die einer Dirne, oder ist es das, was jede anständige Frau – erste Familie der Grafschaft oder nicht – im Grunde ihres Herzens denkt? Oder, was das anbetrifft, immerzu denkt? Wer weiß?
Ja, wenn man das nicht weiß, zu dieser Stunde des Tages, auf dieser Höhe der Zivilisation, die wir erreicht haben, {21}nach all den Predigten sämtlicher Moralisten und nach all den Lehren, die Mütter ihren Töchtern erteilen, in saecula saeculorum … aber vielleicht ist es dies, was die Mütter ihre Töchter lehren, nicht mit den Lippen, sondern mit den Augen oder mit einem Flüstern von Herz zu Herz. Und wenn man nicht einmal so viel weiß vom Wichtigsten in der Welt, was weiß man dann überhaupt, und wozu ist man da?
Ich fragte Mrs. Ashburnham, ob sie das auch Florence erzählt und was Florence dazu gesagt habe, und sie antwortete: »Florence gab keinerlei Kommentar. Was hätte sie auch sagen sollen? Es gab nichts zu sagen. Bei der zermürbenden Armut, mit der wir zurechtkommen mussten, um den Schein zu wahren, und bei den Umständen, unter denen es zu dieser Armut kam – Sie wissen, was ich meine –, wäre jede Frau berechtigt gewesen, sich einen Liebhaber zu nehmen und Geschenke obendrein. Florence sagte einmal über eine sehr ähnliche Lage – sie war ein wenig zu gut erzogen, zu amerikanisch, um über meine Lage zu sprechen –, es sei ein vollkommen offenes Spiel gewesen und eine Frau dürfe sich wohl dem Augenblick hingeben. Sie sagte es natürlich auf Amerikanisch, aber das war der Sinn. Ich glaube, ihre Worte waren: ›Es stand ihr völlig frei, sich darauf einzulassen oder nicht …‹«
Sie dürfen nicht denken, ich wollte Teddy Ashburnham als ein Scheusal hinstellen. Ich glaube nicht, dass er eines war. Gott mag es wissen, vielleicht sind alle Menschen so. Denn, wie gesagt, was weiß ich schon, selbst wenn ich nur ans Rauchzimmer denke. Da kommen Burschen herein und erzählen höchst unflätige Geschichten – so unflätig, dass sie Ihnen geradezu weh tun. Und doch wären sie beleidigt, {22}wenn Sie durchblicken ließen, sie seien nicht die Sorte Mensch, denen Sie Ihre Frau anvertrauen würden. Und wahrscheinlich wären sie mit Recht beleidigt – das heißt, wenn man überhaupt irgendjemand irgendjemandem anvertrauen kann. Aber Burschen dieser Art macht es offensichtlich mehr Vergnügen, unflätige Geschichten anzuhören oder zu erzählen, als alles andere auf der Welt. Sie gehen gelangweilt zur Jagd und ziehen sich gelangweilt um und essen gelangweilt und arbeiten ohne Begeisterung und finden es lästig, sich drei Minuten lang über was immer Sie wollen zu unterhalten, und doch, wenn die andere Art der Unterhaltung beginnt, dann lachen sie und wachen auf und werfen sich in ihren Sesseln herum. Nun, wenn sie sich an derlei Erzählungen so ergötzen, wie ist es dann möglich, dass sie sich beleidigt fühlen – und zwar ehrlich beleidigt fühlen –, wenn Sie andeuten, Sie hielten sie für fähig, sich an der Ehre Ihrer Frau zu vergehen? Und Edward Ashburnham dagegen – niemand hätte einen anständigeren Eindruck machen können als er; ein ausgezeichneter Friedensrichter, ein hervorragender Soldat, einer der besten Gutsbesitzer in Hampshire, England, sagt man. Den Armen und den hoffnungslosen Trunkenbolden war er ein gewissenhafter Hüter. Und niemals in all den neun Jahren, die ich ihn kannte, erzählte er eine Geschichte, die nicht in den Spalten des Field hätte stehen können, mehr als ein- oder zweimal. Er hörte sie sich nicht einmal gerne an; er wurde unruhig, stand auf und ging hinaus, um eine Zigarre zu kaufen oder sonst etwas zu tun. Sie hätten gemeint, er sei ganz der Bursche, dem Sie Ihre Frau anvertrauen dürften. Und ich vertraute ihm meine an – und es war Wahnsinn.
{23}Und dann sehen Sie wieder mich an. Wenn der arme Edward wegen der Keuschheit im Reden gefährlich war – und sie soll immer ein Zeichen für Lüstlinge sein –, wie steht es dann mit mir? Denn ich schwöre feierlich, ich habe in meinem ganzen Leben in meiner Unterhaltung nie auch nur auf etwas Unanständiges angespielt; und mehr noch, auch für die Reinheit meiner Gedanken und die völlige Keuschheit meines Lebenswandels will ich einstehen. Und worauf läuft es dann hinaus? Ist das Ganze Narretei und loses Possenspiel? Bin ich nicht besser als ein Eunuch, oder ist ein richtiger Mann – der Mann mit Daseinsrecht – ein wütiger Hengst, der ewig nach den Frauen seines Nächsten wiehert?
Ich weiß es nicht. Und es gibt nichts, was uns hier leiten kann. Und wenn alles derart undurchsichtig ist in Bezug auf eine so grundlegende Sache wie die der Geschlechtsmoral, was soll uns dann in der höher entwickelten Moral all unserer persönlichen Kontakte, Beziehungen und Tätigkeiten leiten? Oder sind wir dazu ausersehen, allein dem Impuls zu gehorchen? Es ist alles ein einziges Dunkel.
II
Ich weiß nicht, wie ich die Sache am besten niederschreibe – ob es besser ist zu versuchen, die Geschichte von Anfang an zu erzählen, als wäre sie eine Geschichte; oder ob ich sie aus diesem zeitlichen Abstand erzählen soll, so wie ich sie von den Lippen Leonoras oder Edwards vernahm.
Ich stelle mir also vor, ich säße während der nächsten vierzehn Tage neben dem Kaminfeuer eines Landhauses und {24}hätte mir gegenüber eine mitfühlende Seele. Und ich werde mit leiser Stimme weitersprechen, während das Meer in der Ferne rauscht und über uns die große schwarze Flut des Sturms an den glänzenden Sternen vorbeistreicht. Von Zeit zu Zeit werden wir aufstehen und an die Tür treten und auf den großen Mond hinausblicken und sagen: »Nun, er ist beinahe so strahlend wie in der Provence!« Und dann werden wir ans Kaminfeuer zurückkehren, mit einem ganz leisen Seufzer, weil wir nicht in der Provence sind, in der noch die traurigsten Geschichten fröhlich sind. Denken Sie nur an die traurige Historie von Peire Vidal. Vor zwei Jahren fuhren Florence und ich mit dem Auto von Biarritz nach Las Tours, das in den Schwarzen Bergen liegt. Inmitten eines türkisfarbenen Tals erhebt sich eine riesige Bergspitze, und auf der Bergspitze sind vier Schlösser – Las Tours, die Türme. Und der mächtige Mistral blies ins Tal hinunter, das einst der Weg von Frankreich in die Provence gewesen war, blies, so dass die silbergrauen Blätter der Oliven wie Haar aussahen, das im Wind flog, und die Rosmarinbüschel sich an die eisernen Felsen duckten, um nicht mit den Wurzeln ausgerissen zu werden.
Es war natürlich die arme Florence gewesen, die nach Las Tours gehen wollte. Obwohl dieses strahlende Wesen aus Stamford, Connecticut, stammte, hatte sie doch in Vassar ihr Examen gemacht, stellen Sie sich das vor! Ich habe nie verstanden, wie sie das fertigbrachte – wunderliche, schwatzhafte Person, die sie war. Sie sprach mit einem schweifenden Blick in ihren Augen – der jedoch nicht im Geringsten romantisch war (ich meine, sie sah nicht aus, als hätte sie poetische Träume oder als schaute sie durch {25}einen hindurch, denn sie sah einen kaum je an!) – und ihre eine Hand emporhaltend, als wollte sie jeden Einwand zum Schweigen bringen – oder auch jede Stellungnahme. Sie sprach über Wilhelm den Schweigsamen oder Gustav den Redseligen, über Pariser Röcke, über die Art, wie sich die Armen im Jahre 1337 kleideten, über Fantin-Latour, über den train de luxe Paris–Lyon–Méditerranée, über die Frage, ob es sich lohne, in Tarascon auszusteigen, um von der im Wind schwingenden Hängebrücke über die Rhône noch einen Blick auf Beaucaire zu werfen.
Wir warfen natürlich nie wieder einen Blick auf Beaucaire – zauberhaftes Beaucaire, mit dem hohen dreieckigen weißen Turm, der so dünn wie eine Nadel und so hoch wie das Flatiron zwischen der Fifth Avenue und dem Broadway ist –, Beaucaire mit den grauen Mauern oben auf dem Gipfel, die unter den mächtigen Zirbelkiefern anderthalb Morgen blauen Iris umschließen. Wie schön so eine Zirbelkiefer ist! …
Nein, wir kehrten nie an irgendeinen Ort zurück. Nicht nach Heidelberg, nicht nach Hameln, nicht nach Verona, nicht nach Montmajour – nicht einmal nach Carcassonne. Natürlich hatten wir davon gesprochen, aber ich glaube, Florence holte sich alles, was sie wollte, mit einem Blick. Sie hatte das sehende Auge.
Ich habe es, unglücklicherweise, nicht, so dass die Erde für mich mit Orten übersät ist, an die ich zurückkehren möchte – Städte in blendend weißem Sonnenlicht; Zirbelkiefern vor dem Blau des Himmels; Giebelkanten, über und über geschnitzt und mit Hirschen und scharlachroten Blumen bemalt, und gestufte Giebel mit dem kleinen Heiligen {26}auf der Spitze; und graue und rosa Palazzi und von Mauern umgebene Städte am Mittelmeer, etwa eine Meile landeinwärts, zwischen Livorno und Neapel. Nicht eines davon sahen wir mehr als einmal, so dass für mich die Welt wie ein Gestöber von Farbflecken auf einer riesigen Leinwand ist. Wenn es nicht so wäre, dann hätte ich vielleicht jetzt etwas, woran ich mich halten könnte.
Ist das alles nun eine Abschweifung, oder ist es keine Abschweifung? Wieder einmal weiß ich es nicht. Sie, der Zuhörer, sitzen mir gegenüber. Aber Sie sind so still. Sie sagen nichts. Ich versuche jedenfalls, Ihnen klarzumachen, was für ein Leben das war, das ich mit Florence führte, und wie Florence war. Nun, sie war heiter, und sie tanzte. Sie schien über das Parkett von Schlössern und über Seen und immer wieder durch die Salons der Modistinnen und über die plages der Riviera dahinzutanzen wie ein lustiger, zitternder Strahl, der vom Wasser auf die Decke geworfen wird. Und meine Lebensaufgabe bestand darin, dieses glänzende Ding am Leben zu erhalten. Das war fast so schwierig, wie das tanzende Spiegelbild mit der Hand zu fangen. Und die Aufgabe währte Jahre.
Florences Tanten pflegten zu sagen, ich müsste der faulste Mann von Philadelphia sein. Sie waren nie in Philadelphia gewesen, und sie hatten das Neuengland-Gewissen. Wissen Sie, das Erste, was sie zu mir sagten, als ich Florence in dem kleinen alten Kolonistenholzhaus unter den hohen, zartblättrigen Ulmen besuchte – das Erste, was sie mich fragten, war nicht, wie es mir ginge, sondern was ich täte. Und ich tat nichts. Ich nehme an, ich hätte etwas tun sollen, aber ich sah keinerlei Veranlassung dazu. Warum tut man etwas? Ich {27}schneite einfach herein und wollte Florence. Zum ersten Mal war ich ihr auf einem Browning-Tee, oder dergleichen, in der 14th Street, die damals noch eine Wohngegend war, über den Weg gelaufen. Ich weiß nicht, warum ich nach New York gegangen war; ich weiß nicht, warum ich zum Tee gegangen war. Mir leuchtet nicht ein, weshalb Florence in ein solches Lesekränzchen ging. Es war schon damals nicht gerade der Ort, an dem man erwartete, einer Poughkeepsie-Graduierten zu begegnen. Ich nehme an, Florence wollte die Bildung der Stuyvesant-Clique heben, und sie tat es so, wie sie sich der Wohltätigkeit in den Elendsvierteln gewidmet hätte. Intellektueller Wohltätigkeitsdienst, das war es. Sie wollte immer die Welt ein wenig erhabener zurücklassen, als sie sie angetroffen hatte. Das arme Ding. Ich habe gehört, wie sie Teddy Ashburnham stundenlange Vorträge über den Unterschied zwischen einem Frans Hals und einem Wouwerman hielt und ihm erklärte, warum die prämykenischen Statuen kubisch waren und Knöpfe obendrauf hatten. Ich frage mich, was er sich dabei gedacht hat. Vielleicht war er ihr dankbar.
Ich weiß, ich war es. Denn Sie verstehen sicher, all meine Sorge, mein ganzes Streben war darauf bedacht, die arme liebe Florence bei Themen wie die Funde von Knossos und die mentale Spiritualität Walter Paters zu halten. Ich musste sie damit fesseln, verstehen Sie, es wäre sonst ihr Tod gewesen. Denn mir wurde feierlich erklärt, ihr kleines Herz könnte aufhören zu schlagen, wenn sie sich über irgendetwas aufregte oder ihre Gefühle richtig in Wallung gerieten. Zwölf Jahre lang musste ich jedes Wort jedes Menschen überwachen, das in einem Gespräch geäußert wurde, und es {28}von dem ablenken, was die Engländer things nennen – von Liebe, Armut, Verbrechen, Religion und was sonst noch alles. Ja, der erste Arzt, den wir aufsuchten, nachdem man sie in Le Havre vom Schiff getragen hatte, versicherte mir, dies müsse geschehen. Gütiger Gott, sind denn all diese Kerle ungeheuerliche Dummköpfe, oder besteht zwischen ihnen eine geheime Bruderschaft, von einem Ende der Welt zum anderen? … Das ist es, was mich an jenen Peire Vidal denken lässt.
Denn natürlich gehört seine Geschichte zur Kultur, und ich musste sie ja zur Kultur hinlenken; und dabei ist die Geschichte so komisch, und sie durfte doch nicht lachen, und so voller Liebe, und sie durfte doch nicht an Liebe denken. Kennen Sie die Geschichte? In Lastours mit den vier Burgen gab es die Burgherrin Blanche Soundso, die wie zur Empfehlung La Louve – die Wölfin – genannt wurde. Und Peire Vidal, der Troubadour, machte La Louve, der Wölfin, den Hof. Und sie wollte nichts von ihm wissen. So hüllte er sich ihr zuliebe – was Leute nicht alles tun, wenn sie verliebt sind! – in eine Wolfshaut und ging in die Schwarzen Berge hinauf. Die Hirten der Montagne Noire und ihre Hunde hielten ihn für einen Wolf, und er wurde von Zähnen zerfleischt und mit Knüppeln geschlagen. Dann trugen sie ihn nach Lastours zurück, und La Louve war nicht im Geringsten beeindruckt. Sie putzte ihn wieder heraus, und ihr Gemahl machte ihr ernstlich Vorwürfe. Vidal war, wissen Sie, ein großer Dichter, und es gehört sich nicht, einen großen Dichter mit Gleichgültigkeit zu behandeln.
So erklärte Peire Vidal, er sei Kaiser von Jerusalem oder sonst einem Ort, und der Gemahl musste niederknien und {29}ihm die Füße küssen, was ihm La Louve freilich nicht nachtat. Und Peire stach in einem Ruderboot mit vier Gefährten in See, um das Heilige Grab zu retten. Und sie fuhren irgendwo auf ein Riff, und der Gemahl musste eine kostspielige Expedition ausrüsten, um sie zu bergen. Und Peire Vidal fiel in ganzer Länge auf das Bett der Dame, während ihr Gemahl, der ein äußerst grimmiger Krieger war, sie abermals zur Höflichkeit ermahnte, die man großen Dichtern schuldig sei. Aber ich glaube, La Louve war die grimmigere von den beiden. Jedenfalls ist das alles, was daraus wurde. Und ist das etwa keine Geschichte?
Sie machen sich gar keinen Begriff von der wunderlich altmodischen Art von Florences Tanten – der Misses Hurlbird –, geschweige denn von ihrem Onkel. Ein außerordentlich liebenswerter Mann, dieser Onkel John. Er war dünn und zart, und da er es auch am Herzen hatte, lebte er ganz ähnlich wie später Florence. Er wohnte nicht in Stamford; sein Haus stand in Waterbury, woher die Uhren kommen. Er hatte dort eine Fabrik, die nach unserer sonderbaren amerikanischen Art fast alljährlich ihre Produktion wechselte. Neun Monate lang stellte sie zum Beispiel Knöpfe aus Knochen her. Dann produzierte sie plötzlich Messingknöpfe für Kutscher-Livreen. Dann befasste sie sich für kurze Zeit mit geprägten Blechdeckeln für Konfektdosen. Tatsache ist, dass der arme alte Herr mit seinem schwachen, flatternden Herzen seine Fabrik am liebsten hätte stillstehen lassen. Er wollte sich zurückziehen. Und er zog sich zurück, als er siebzig war. Aber er fürchtete so sehr, die Straßenjungen der Stadt könnten hinter ihm herrufen: »Seht, da geht der faulste Mann von Waterbury!«, dass er eine Reise um {30}die Welt unternahm. Und Florence, zusammen mit einem jungen Mann namens Jimmy, begleitete ihn. Nach dem, was Florence mir erzählte, war es Jimmys Aufgabe im Dienste Mr. Hurlbirds, alle aufregenden Themen zu umgehen. Er musste ihn zum Beispiel von allen politischen Diskussionen fernhalten. Denn der arme alte Mann war ein leidenschaftlicher Demokrat, und das zu Zeiten, da man die Welt absuchen konnte, ohne etwas anderes als Republikaner zu finden. Wie dem auch sei, sie fuhren um die Welt.
Ich denke, eine Anekdote ist am besten geeignet, Ihnen eine Vorstellung von dem alten Herrn zu geben. Denn vielleicht ist es wichtig, dass Sie erfahren, wie der alte Herr war; er hatte großen Einfluss auf die Entwicklung des Charakters meiner armen lieben kleinen Frau.
Kurz bevor sie von San Francisco aus Richtung Südsee aufbrachen, sagte Mr. Hurlbird, er müsse etwas mitnehmen, um den Leuten, die er auf der Reise träfe, kleine Geschenke machen zu können. Er kam auf den Gedanken, am besten geeignet für diesen Zweck seien Orangen – weil Kalifornien das Land der Orangen ist – und bequeme Liegestühle. So kaufte er ich weiß nicht wie viele Kisten Orangen – die großen, kühlen kalifornischen Orangen – und ein halbes Dutzend Liegestühle in einem besonderen Koffer, den er immer bei sich in der Kabine stehen hatte. Es muss eine halbe Schiffsladung Obst gewesen sein.
Denn jeder Person an Bord der verschiedenen Dampfer, die er benutzte, jedem, mit dem er auch nur ein Kopfnicken als Gruß tauschte, gab er jeden Morgen eine Orange. Und sie reichten ihm rund um den Gürtel unseres mächtigen Erdballs. Ja, noch als sie am Nordkap ankamen, sah er, der {31}arme liebe hagere Mann, einen Leuchtturm am Horizont. »Herrje«, sagte er sich, »die armen Kerle müssen sehr einsam sein. Wollen ihnen doch ein paar Orangen bringen.« So ließ er einige Kisten seiner Früchte ausladen und sich zum Leuchtturm am Horizont rudern. Die Liegestühle lieh er allen Damen, denen er auf dem Schiff begegnete und die ihm gefielen oder müde und kränklich wirkten. Und so fuhr er, wohl achtend auf sein Herz und mit seiner Nichte an der Seite, um die Erde …
Er machte nicht viel Aufhebens um sein Herz. Man hätte ihm nicht angemerkt, dass es ihm zu schaffen machte. Nur zum Nutzen der Wissenschaft hinterließ er es dem anatomischen Laboratorium von Waterbury, da er meinte, es müsse ein ganz außergewöhnliches Herz sein. Und der Witz dabei war, dass sich nicht der geringste Fehler an seinem Herzen feststellen ließ, als er im Alter von vierundachtzig Jahren, gerade fünf Tage vor der armen Florence, an einer Bronchitis starb. Gewiss hatte es gezuckt und geächzt oder sonst etwas getan, was ausreichte, um die Ärzte irrezuführen, aber anscheinend rührte das von einer seltsamen Gestaltung der Lunge her. Ich verstehe nicht viel von diesen Dingen.
Ich erbte sein Geld, weil Florence fünf Tage nach ihm starb. Ich wünschte, ich hätte es nicht geerbt. Es war eine große Plage. Gleich nach Florences Tod musste ich nach Waterbury fahren, weil der arme, liebe alte Kerl eine Menge wohltätiger Legate hinterlassen hatte, und ich musste Treuhänder ernennen. Der Gedanke, irgendetwas könnte nicht richtig ausgeführt werden, wäre mir unangenehm gewesen.
Ja, es war eine große Plage. Und gerade als ich die Dinge im Großen und Ganzen geregelt hatte, erhielt ich das {32}merkwürdige Telegramm von Ashburnham, der mich bat, zurückzukommen und mit ihm zu reden. Und unmittelbar darauf traf eines von Leonora ein, in dem es hieß: »Ja, kommen Sie bitte. Sie könnten von großer Hilfe sein.« Es war, als hätte er das Telegramm geschickt, ohne sie zu fragen, und ihr erst hinterher davon erzählt. So ungefähr hatte es sich auch zugetragen, nur dass er es dem Mädchen sagte und dieses es seiner Frau mitteilte. Ich kam jedoch zu spät, um noch von irgendwelchem Nutzen zu sein, wenn ich ihnen überhaupt hätte von Nutzen sein können. Und dabei bekam ich zum ersten Mal eine Ahnung von englischem Leben. Es war höchst erstaunlich. Es war überwältigend. Ich werde nie das glänzend gestriegelte Halbblut vergessen, das Edward neben mir lenkte, die Bewegungen des Tiers, den hochtrabenden Gang, das Fell, das wie Seide war. Und den Frieden! Und die roten Backen! Und das schöne, schöne alte Haus.
Wir waren in der Nähe von Branshaw Teleragh und fuhren von der hohen, klaren, sturmdurchbrausten Öde New Forests hinunter. Ich sage Ihnen, es war ungeheuerlich, von Waterbury dorthin zu kommen. Und es kam einem ganz unglaublich vor – denn Teddy Ashburnham hatte mir doch, wie Sie sich erinnern werden, telegraphiert, ›herüberzukommen und mit ihm zu reden‹ –, dass diesem Ort und diesen Menschen etwas wirklich Unheilvolles zustoßen könnte. Ich sage Ihnen, es war der Inbegriff des Friedens. Und Leonora stand, schön und lächelnd, mit ihren blonden Locken auf der obersten Stufe vor dem Haus, mit Butler und Lakai und Hausmädchen hinter sich. Und sie sagte nur: »Freut mich, dass Sie gekommen sind«, als wäre ich bloß von einer zehn Meilen entfernten Stadt zum Mittagessen {33}herübergekommen und nicht auf den Ruf zweier dringender Telegramme hin um die halbe Erde gereist.
Das junge Mädchen war mit den Hunden fort, glaube ich. Und der arme Teufel neben mir litt Qualen. Tiefste, hoffnungslose, stumme Qualen, wie kein Mensch sie sich vorstellen kann.
III
Es war sehr heiß damals im August 1904; und Florence hatte schon einen Monat lang ihre Bäder genommen. Ich weiß nicht, wie es ist, Patient an solch einem Ort zu sein. Ich bin nie irgendwo Patient gewesen. Vermutlich werden die Patienten an dem Ort rasch heimisch und finden dort eine Art Ankergrund. Sie scheinen die Badewärter mit ihren aufmunternden Gesichtern, ihrer Herrschermiene, ihrem weißen Leinen sehr gern zu haben. Aber was mich betrifft, gab mir Bad Nauheim ein Gefühl – wie soll ich sagen? –, fast ein Gefühl der Nacktheit – einer Nacktheit, wie man sie an einer Meeresküste oder in einem weiten, offenen Raum empfindet. Hier hatte ich zu nichts eine Beziehung, nichts hatte sich angesammelt. Zu Hause ist es, als ob angeborene kleine Sympathien einen zu besonderen Sesseln zögen, die einen wie in eine Umarmung aufnehmen; oder uns bestimmte Straßen hinunterführten, die uns freundlich erscheinen, während andere uns vielleicht feindselig anmuten. Und, glauben Sie mir: Dieses Gefühl spielt im Leben eine sehr wichtige Rolle. Ich weiß ein Lied davon zu singen, nachdem ich so lange durch öffentliche Kurorte gewandert {34}bin. Und man ist zu sehr herausgeputzt. Ich bin weiß Gott nie ein unordentlicher Mann gewesen. Aber was ich empfand, wenn ich morgens, während die arme Florence ihre Bäder nahm, auf den sorgfältig gefegten Stufen vor dem Englischen Hof stand und auf die sorgfältig angeordneten Bäume in Kübeln an den sorgfältig geharkten Kieswegen blickte, über die sorgfältig gekleidete Menschen in sorgfältig abgemessener Fröhlichkeit zu sorgfältig abgemessenen Zeiten dahinschritten, während die hohen Bäume des Kurparks zur Rechten aufragten … wenn ich den rötlichen Stein der Badehäuser sah – oder waren es weiße Fachwerkvillen? Auf mein Wort, ich habe es vergessen, ich, der so oft dort gewesen ist. Das wird Ihnen einen Begriff davon geben, wie gut ich mich in der Landschaft auskannte. Ich hätte blind meinen Weg zu den Ruhesälen, den Duschräumen, zu dem Sprudel mit dem rostigen Wasser in der Mitte des quadratischen Platzes gefunden. Ja, ich hätte blind meinen Weg gefunden. Ich kenne die Entfernungen noch genau. Vom Hotel Regina ging man hundertsiebenundachtzig Schritte, und dann brachten einen nach einer scharfen Linkswendung vierhundertundzwanzig Schritte direkt zum Sprudel. Vom Englischen Hof aus waren es, wenn man auf dem Bürgersteig begann, ebenfalls vierhundertundzwanzig Schritte, nur musste man sich diesmal rechts halten.
Und nun werden Sie verstehen, dass ich mir, da ich nichts auf der Welt zu tun hatte – rein gar nichts –, angewöhnte, meine Schritte zu zählen. Ich ging mit Florence zu den Badehäusern. Und natürlich ergötzte ich mich an ihrer Unterhaltung. Es war, wie ich schon sagte, erstaunlich, woraus sie eine Unterhaltung zu machen verstand. Sie schritt sehr {35}beschwingt dahin, und ihr Haar war sehr hübsch frisiert, und sie kleidete sich reizend und sehr teuer. Natürlich hatte sie eigenes Geld, aber ich hätte auch sonst nichts dagegen gehabt. Und doch, wissen Sie, kann ich mich an kein einziges ihrer Kleider erinnern. Oder nur an eines, ein sehr schlichtes, aus blaubedruckter Seide – ein chinesisches Muster – mit sehr weitem Rock und betonten Schultern. Und ihr Haar war kupferfarben, und die Absätze ihrer Schuhe waren außerordentlich hoch, so dass sie fast auf ihren Zehenspitzen trippelte. Und wenn sie an die Tür des Badehauses kam und diese sich öffnete, um sie einzulassen, dann pflegte sie mit einem leichten, koketten Lächeln zu mir zurückzublicken, so dass ihre Wange die Schulter zu streicheln schien.
Ich glaube mich zu erinnern, dass sie zu jenem Kleid einen ungeheuer großen Hut aus Livorno trug – wie der Chapeau de paille von Rubens, nur sehr weiß. Der Hut wurde mit einem locker geschlungenen Schal aus demselben Stoff wie ihr Kleid festgehalten. Und um ihren Nacken trug sie einfache hellrote Korallen. Und ihr Teint war von vollkommener Reinheit, vollkommener Glätte. Ja, so sehe ich sie am deutlichsten vor mir; in diesem Kleid, in diesem Hut, wie sie mich über die Schulter hinweg ansah, so dass ihre Augen sehr blau aufleuchteten – in dunklem Kieselblau.
Aber Teufel auch! Wem zuliebe tat sie das? Den Badewärtern zuliebe? Oder den Passanten? Ich weiß es nicht. Jedenfalls kann es nicht mir gegolten haben, denn niemals in all den Jahren, bei keiner Gelegenheit und an keinem anderen Ort lächelte sie mir so zu, so spöttisch, so lockend. Ah, sie war ein Rätsel; aber sind nicht alle Frauen Rätsel? Und mir fällt ein, dass ich irgendwo zuvor einen Satz begann, den {36}ich nicht zu Ende führte … Er berichtete von dem Gefühl, das ich jeden Morgen hatte, wenn ich auf den Stufen vor meinem Hotel stand, ehe ich aufbrach, um Florence vom Badehaus abzuholen. Schmuck, korrekt, sauber gebürstet und wohlwissend, dass ich ziemlich klein war unter den langen Engländern, den dürren Amerikanern, den rundlichen Deutschen und russischen Jüdinnen, stand ich da, klopfte eine Zigarette auf die Außenseite meines Etuis und ließ einen Augenblick lang meinen Blick über die Welt im Sonnenschein schweifen. Aber ein Tag sollte kommen, da ich das alles nie mehr allein zu tun brauchte. Sie können sich deshalb vorstellen, was die Ankunft der Ashburnhams für mich bedeutete.
Ich habe den Anblick vieler Dinge vergessen, aber ich werde nie den Anblick des Speisesaals im Hotel Excelsior an jenem Abend – und an so vielen anderen Abenden – vergessen. Ganze Schlösser sind meinem Gedächtnis entschwunden, ganze Städte, die ich nie wieder aufgesucht habe, aber jenen weißen Saal mit den Girlanden aus Papiermaché-Früchten und -Blumen; die hohen Fenster; die vielen Tische; den schwarzen Wandschirm vor der Tür mit den drei goldenen Kranichen, die auf jedem der Felder aufwärtsflogen; die Palme in der Mitte des Saales; die umherhuschenden Kellner; die kalte, teure Eleganz; die Mienen der Gäste, wenn sie abends hereinkamen – ihre ernsten Gesichter, als müssten sie eine Mahlzeit durchstehen, die ihnen von den Kurautoritäten persönlich vorgeschrieben worden war, und ihren Ausdruck strenger Enthaltsamkeit, als dürften sie unter keinen Umständen versuchen, ihr Mahl zu genießen – all diese Dinge werde ich nicht so schnell {37}