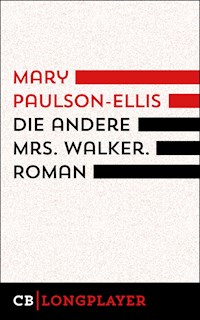
16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: CulturBooks Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
An einem kalten Wintertag in Edinburgh stirbt eine alte Frau. Sie hinterlässt ein verschüttetes Glas Whisky, ein smaragdgrünes Kleid, eine vergammelnde Mandarine und eine gravierte Paranuss. Aber keinen Hinweis darauf, wo sie herkam, wer sie war und was sie in Edinburgh gesucht hat. Margaret Penny, mit 47 gestrauchelt und ihrer Träume beraubt, soll nun im Auftrag des Amts für Verlorengegangene die Geschichte hinter diesem Leben zutage fördern. Und vielleicht fällt dabei auch für sie etwas ab … »Ein dunkler und betörender Roman, urkomisch und tragisch.« Sunday Times »Soghaft, genießerisch, ein famoses Geschick im Aufspüren der schrägsten Seiten des Lebens.« The Scotsman »Tief verwurzelt in den Geheimnissen von Edinburgh erkundet sie, was sie ›die mörderische Seite des Familienlebens‹ nennt – das Dunkle, das Skurrile und das Sonderbare.« Val McDermid
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 517
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Über das Buch
An einem kalten Wintertag in Edinburgh stirbt eine alte Frau. Sie hinterlässt ein verschüttetes Glas Whisky, ein smaragdgrünes Kleid, eine vergammelnde Mandarine und eine gravierte Paranuss. Aber keinen Hinweis darauf, wo sie herkam, wer sie war und was sie in Edinburgh gesucht hat. Margaret Penny, mit 47 gestrauchelt und ihrer Träume beraubt, soll nun im Auftrag des Amts für Verlorengegangene die Geschichte hinter diesem Leben zutage fördern. Und vielleicht fällt dabei auch für sie etwas ab …
»Ein dunkler und betörender Roman, urkomisch und tragisch.« Sunday Times
»Tief verwurzelt in den Geheimnissen von Edinburgh erkundet sie, was sie ›die mörderische Seite des Familienlebens‹ nennt – das Dunkle, das Skurrile und das Sonderbare.« Val McDermid
Über die Autorin
Mary Paulson-Ellis lebt in Edinburgh. Ihr Debüt Die andere Mrs. Walker wurde auf Anhieb ein Durchbruch, inzwischen schreibt sie am vierten Roman. Ihre sehr eigene Erzählweise verbindet Krimi mit Geschichtsepos, sie sondiert biografisch-historische Spuren und legt erzählerische Fährten hierhin und dorthin. Die frühere Drehbuchredakteurin, Kunstkuratorin und Reiseleiterin studierte Politik und Soziologie an der Universität Edinburgh. Paulson-Ellis ist regelmäßig bei BBC Radio Scotland zu hören und rezensiert, was Fernsehen, Film, Theater, Kunst und Bücher aktuell zu bieten haben.
Über die Übersetzerin
Mary Paulson-Ellis
Die andere Mrs. Walker
Roman
Impressum
eBook-Ausgabe: © CulturBooks Verlag 2022
Gärtnerstr. 122, 20253 Hamburg
Tel. +4940 31108081, [email protected]
www.culturbooks.de
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: Magdalena Gadaj
eBook-Herstellung: CulturBooks
Printausgabe: © Argument Verlag 2022
Titel der englischen Originalausgabe: The Other Mrs Walker
© Mary Paulson-Ellis 2016
Lektorat: Iris Konopik und Else Laudan
Erscheinungsdatum: April 2022
ISBN 978-3-95988-219-4
Für Audrey, in Liebe und für meine Mutter, in Dankbarkeit Oh, my darling Oh my darling Oh my darling, Clementine Thou art lost and gone forever
Vorbemerkung von Else Laudan
Ich liebe Bücher, die mich überraschen, bei denen ich nie weiß, was als Nächstes passiert. Die andere Mrs. Walker hat dieses Kriterium zu meiner Verblüffung in eine eigene Kunstform verwandelt. Ausgangspunkt ist eine gescheiterte Protagonistin mit sehr realen weltlichen Sorgen: Margaret Penny, 47. Sie begibt sich auf die Suche nach dem Ariadnefaden, der die Geheimnisse einer alleinstehenden Toten verbindet – und parallel dazu fächert Mary Paulson-Ellis höchst raffiniert eine von der Zeit überwucherte Familiengeschichte auf. Sie beginnt 1929 mit Alfred Walker, seiner gerade gebärenden Ehegattin Dorothea und ihrer Tochter Clementine. In filigranen Bildern werden sinnlich die 30er Jahre heraufbeschworen, der Weltkrieg und die britische Nachkriegszeit. Schillernd und geheimnisvoll webt sich der historische Faden in den dunklen Rahmen eines ganz heutigen, lakonischen Noir. Beiläufig tritt die Moderne mit ihren Frauenbildern zutage: Verbrechen, Künste, Körper, Einsamkeit, Wahnsinn, Krieg und Moral – jedes dieser Themen trennt die Geschlechter, weist Rollen zu, sieht Lebensweisen vor. Wer sich auflehnt, muss mit Gegenwind rechnen, eine Erfahrung, die alle Frauen der Erzählung auf je eigene Weise machen. Nach und nach entfaltet sich das Rätsel um die Mandarinenkerne, die Zwillinge, die verstorbene Mrs. Walker … Aber auch Margaret bleibt nicht unberührt von der Geschichte, die sie Stück für Stück den auffindbaren Indizien entlockt.
Was für eine Erzählung, und was für ein Krimi – denn es geht immer um Verbrechen, um Täuschung und Moral, und die Wahrheit liegt immer im Auge der Betrachterin. Bis zuletzt.
Else Laudan
PROLOG Weihnachten in Edinburgh 2010
So starb sie – in Schuhen und in Nylonstrümpfen, die um die Knie Falten warfen. Das Glas fiel aus ihrer Hand zu Boden, der Rest sickerte heraus, gemeinsam mit ihrem letzten Atemzug. Die Flüssigkeit glitzerte im Mondlicht, zwinkerte ihr ein letztes ›Gute Nacht‹ zu, bevor auch sie verschwand – in den Teppichfasern, in den rauen, staubigen Bodendielen und dann in der Decke der Wohnung darunter. Auf ihrem Weg verdunstete sie und hinterließ nichts als einen Fleck. Und diesen Geruch. Whisky. Das Wasser des Lebens. Doch nicht für sie. Nicht mehr.
In einer Schublade ließ sie eine Paranuss zurück, in deren Schale die Zehn Gebote geritzt waren. Auf dem Kaminsims einen Grat aus Staub, wo zuvor ein Foto gestanden hatte. Im Kleiderschrank ein smaragdgrünes Kleid mit versprengten Pailletten am Saum. Auf einem blauen Teller eine Mandarine, inzwischen voller Löcher wie ihre Knochen und ihr Hirn.
Alles war verblichen. Die Geschirrtücher in den Schubladen. Die Fliegengitter an den Fenstern. Die Zeitung, die unter der Kleidung um ihre Hüfte gewickelt war. Im Bad wuchsen Eisblumen auf der falschen Seite der Fensterscheibe. Im Schrank passte kein Teller zu irgendeiner Schale. Draußen war die Straße ebenfalls verblichen und die Gesichter der Passanten in der unerbittlichen Kälte zu Asche geworden. Drinnen, in ihrem Kühlschrank, stand eine einzelne Dose Erbsen.
So starb sie – mit einem Namen unter ihren Fingernägeln vom Kratzen über Gesicht und Arme in dem Versuch, sich zu erinnern. Mit ausgebreitetem Haar, rot an den Spitzen, weiß an den Wurzeln. Mit Bomben, die wie Klingeln in ihrem Kopf schrillten. Und diesem Schrei, Hilfe!, als Putz auf sie niederregnete, Splitter aus Holz, Metall und Glas durch die Stille flogen, als sie erneut schrie.
»Hilf mir!«
Sie fing den Gedanken ein, der durch ihr Hirn wuselte: Das könnte es gewesen sein. Doch das war es nicht. Denn jetzt war es so weit. Das Glas, das ihr aus den Fingern glitt. Das kleine bernsteinfarbene Rinnsal. Die Flüssigkeit, die durch den Teppich in die Decke der Wohnung darunter sickerte.
Und irgendwie hatte sie immer gewusst, dass sie so enden würde. In einem kleinen eckigen Raum, in einer kleinen eckigen Wohnung. Vielleicht in einer kleinen eckigen Kiste. Aus Pappe, mit einem Aufkleber darauf. Und einem Namen.
Wie lautete der Name? Verloren, mit allem anderen, was sie je besessen hatte.
Dann hoffte sie, während die Flüssigkeit versickerte, dass sie Gott nicht zu oft verflucht hatte. Denn jemand musste es doch sagen, oder? Asche zu Asche. Staub zu Staub. Denn wo sonst würde sie sein, wenn man sie tief in die Erde versenkte oder mit diesen blauen Gasflammen verbrannte? Sie wusste, das wäre ihr lieber, diese lodernde Hitze. Und doch fragte sie sich, als ihr Atem langsam entwich, ob sie nicht die feuchte Umarmung des schweren Edinburgher Lehms verdient hatte.
TEIL EINS
EDINBURGH NEWS vom 2. Januar 2011
Zweitkältester Winter seit Beginn der Wetteraufzeichnungen
Experten vom Meteorologischen Institut bestätigten heute, dass der Winter, der Edinburgh im Griff hat, der zweitkälteste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen ist. Sämtliche Straßen der Stadt sind mit einer heimtückischen Eisschicht überzogen.
Eis
»Wir bitten die Hausbewohner dringend um Mithilfe dabei, die Bürgersteige vor ihren Gebäuden von Eis und Schnee zu befreien«, sagte ein Sprecher der Edinburgher Stadtverwaltung. Es gab Vorwürfe an die Verwaltung, weil versäumt wurde, die Durchfahrtsstraßen zu räumen.
Nachbarn
Die nationale Wohlfahrtsorganisation Age Scotland bittet die Bürger der Stadt, sich in dieser Zeit um die Hilfsbedürftigsten zu kümmern. »Sehen Sie nach Ihren älteren Nachbarn, stellen Sie sicher, dass sie es warm haben.«
Das kalte Wetter soll noch mindestens bis zum Monatsende anhalten.
2011
Margaret Penny fuhr heim, weil die Münze so fiel. Kopf: ab nach Norden, Zahl: woandershin, vielleicht über alle Berge. Oder an einen noch ferneren Ort. Um sechs Uhr fünfundzwanzig am zweiten Tag des neuen Jahrs kam sie wieder im Athen des Nordens an, bei grauem Himmel, grauen Gebäuden, grauen Gehwegen, alles von Eis umschlossen. Genau wie die Leute.
Sie wachte auf, als der Motor des Nachtbusses ruckelnd zum Stillstand kam, die Haare dahin und dorthin, der Kopf verklebt von grellen, panischen Träumen. Sie klaubte alles zusammen, was sie noch besaß – eine kleine Reisetasche und einen roten gestohlenen Mantel –, und stolperte aus dem warmen Innenraum des Busses wie aus einem Mutterleib. Die Stufen waren schmal. Beim Ausstieg strauchelte sie, trat daneben, direkt in einen Rinnstein voll Matsch.
»Scheiße!«
Jedoch kalt und zähflüssig. Ruinierte sich das einzige Paar Schuhe, das ihr geblieben war.
Es war eine Art Wiedergeburt.
»Also dann, Täubchen!« Margaret Pennys Reisegefährte durch Nacht und Morgengrauen und den frühen, frühen Morgen, der schier nicht hatte enden wollen, stolperte hinter ihr die Stufen herab und öffnete knackend eine weitere Dose Special. »Frohes neues Jahr!« Er hatte sein Gelobtes Land erreicht. Edinburgh (und dem Rest Schottlands) blieb noch ein weiterer Tag zum Feiern, bevor die Arbeit wieder losging, und das Leben.
Gischt sprühte in einem Bogen Richtung Margaret, kleine Schaumflecken trafen ihren gestohlenen Mantel. Der Mann johlte und schwenkte seine Dose in einer Art Salut, wirres dunkles Haar und glitzernde Biertropfen stoben überallhin. Allen Grund zum Feiern. Kein Grund zur Reue. Nach dreißig Jahren war Margaret Penny zu Hause.
Ihre Mutter Barbara wohnte in einem beinahe modernen dreistöckigen Häuserblock im Nordteil der Stadt. Mit dem Taxi um diese Uhrzeit sieben oder acht Pfund. Um diese Jahreszeit das Doppelte. Verglichen mit Londoner Preisen war das nichts, jedoch die Hälfte dessen, was Margaret an Geld übrighatte. Edinburgh hatte sich noch nie gescheut, mehr zu nehmen, als man erwartete. Sie entschied, zu Fuß zu gehen.
Die grauen Straßen waren verlassen. Sechs Uhr fünfundvierzig am Morgen und es wirkte, als wäre ganz Edinburgh im Tiefschlaf oder tot. In keinem der hohen Fenster irgendwo Licht. Niemand führte seinen Hund aus. Nichts als Straßenlaternen mit Natrium-Heiligenschein in der trüben Morgenluft und Dampfschwaden, die den Zentralheizungs-Lüftungen entstiegen wie Geister.
Margaret mühte sich schlitternd und fluchend von der Bushaltestelle den Hügel hinunter. Sie griff nach allem, was sie finden konnte, um sich festzuhalten, Geländer und Ampelpfosten, Mülleimer mit den vereisten Überresten von Millionen bis zum letzten Zug gerauchten Zigaretten. Das Eis war hier wirklich heimtückisch, dick und klotzig, die Luft stach in ihre Lungen. Sie wünschte, sie hätte außer dem Mantel noch ein Paar Handschuhe geklaut oder wenigstens einen Schal; etwas, um die bloßen Stellen ihrer Haut zu bedecken – Hände und Hals, Ohren und Finger, die an den Spitzen vereist waren wie die Gipfel der Alpen. Margaret hatte vergessen, wie kalt Schottland sein konnte. Und wie gottverlassen.
Endlich am Fuß des langen Hügels angekommen, wankte sie auf den Parkplatz neben der Wohnanlage The Court und prallte beinahe gegen das Heck eines großen schwarzen Wagens, der mit durchdrehenden Reifen zur Ausfahrt schlitterte. Der Wagen wirbelte einen Sprühregen aus Splitt und Matsch auf, der auch über den Saum von Margarets Mantel spritzte. »Himmel noch mal!«, brüllte sie, doch das Fahrzeug flüchtete bereits, hinaus und ab auf die Hauptstraße, und verschwand in einer Wolke toxischer Abgase. Eine halbe Stunde in Edinburgh, und schon war Margaret von oben bis unten voll Dreck.
Sie stieg die Betonstufen zu Barbaras Haustür hoch wie ein heimgekehrtes Findelkind mit der Hoffnung, ihre Vergangenheit sei bloß ein Missverständnis. Doch als sich auf ihr drittes hartnäckiges Klingeln hin die Tür schließlich einen Spaltbreit öffnete, erkannte Margaret, dass der erhoffte Neubeginn hier kaum stattfinden würde. Ihre Mutter war alt geworden. Viel, viel älter, als Margaret sich vorgestellt hatte. Ihr Gesicht schon von Leichenblässe gezeichnet.
»Was machst du denn hier?« Nicht gerade die übliche Mutter-Tochter-Begrüßung.
»Ich dachte, ich helfe dir das neue Jahr feiern.«
»Das ist schon gelaufen.«
All das weiterhin mit der Kette vor der Tür.
»Ich habe Rum mitgebracht.« Margaret hielt die Literflasche hoch, die sie den ganzen Weg aus dem Süden mitgeschleppt hatte. Vielleicht ein Friedensangebot, ein Versprechen auf bessere Zeiten. Oder, was wahrscheinlicher war, weil Barbara ihrer Tochter immer eingebläut hatte: In Augenblicken wie diesem hieß es für alles gewappnet sein.
Die dunkle Flüssigkeit funkelte im Treppenhauslicht. Durch den schmalen Spalt in der Tür funkelten auch Barbaras Pupillen, als sie auf die Flasche linste, während Margaret wiederum ihre Mutter beäugte. Alt. Eindeutig alt. Und noch etwas anderes. Aber Margaret blieb keine Zeit, dahinterzukommen, denn die Tür schloss sich und öffnete sich dann wieder. Diesmal ohne die Kette.
Sieben Uhr morgens, und in Barbaras Miniatur-Hausflur gequetscht setzte Margaret zum Sturm an. »Das war ja eine nette Begrüßung in der Zeit des Jubels und der Freude.« Sie konnte es sich nicht verkneifen. Angriff, die beste Verteidigung. Widerspruchsgeist war tief in ihr verwurzelt, genau wie bei ihrer Mutter.
»Ich dachte, du wärst einer von den Gutmenschen.« Barbara trug einen wattierten Morgenmantel in einem Farbton von etwas, das mal rosa gewesen war.
»Eine Zeugin Jehovas?« Margaret hatte ihre Mutter nie für religiös gehalten. Mehr Interesse an Rum und Keksen als an der Chance, ihre Seele zu retten.
Mit der rechten Hand umklammerte Barbara einen grauen Krückstock vom NHS, dem nationalen Gesundheitsdienst. »Denen gehöre ich bereits an«, sagte sie.
Das war nicht die Art Heimkehr, die Margaret erwartet hatte. Eine plötzliche Hinwendung zu Gott in all seinen vielen Verkleidungen. »Ich dachte, du bist bei der Church of Scotland. Die gleich um die Ecke.«
Barbara schnaubte, ein leises Pfeifen entstieg ihrer Brust. »Und beim ganzen Rest.«
»Welchem Rest?«
»Anglikaner. Katholen. Protestanten. Freunde«, betete Barbara herunter, als wäre sie hier und jetzt in der Kirche.
»Freunde?«
Mit pfeifenden Lungen stützte Barbara sich auf ihren Stock. »Quäker, wie in dem Film mit dem Indiana-Kerl.«
»Ich dachte, das sind Amische.«
»Egal.«
Erst zwei Minuten in der Wohnung und schon lieferte Margaret nur ein Ungenügend. Sie hatte noch nicht mal den Mantel ausgezogen. »Dann bist du Mitglied in mehr als einer Gemeinde?«
»In mehr oder weniger allen.«
»Aber du glaubst doch gar nicht an Gott.«
»Woher willst du das wissen.«
Es war keine Frage und es gab nichts, was Margaret darauf antworten konnte. Zehn Jahre oder mehr. Wenige Telefonate. Keine Ahnung, wann sie das letzte Mal zu Weihnachten oder Neujahr zu Besuch gewesen war. Ihre Mutter war inzwischen alt, gut über siebzig. Vielleicht war es ein plötzlicher Sinneswandel. Eine Art Damaskuserlebnis, wie Margarets eigener Anfang vom Ende. Das wäre so typisch, mit einer Midlife-Krise heimkommen, nur um festzustellen, dass bei ihrer Mutter die Lebensendkrise in vollem Gange war. Margaret klammerte sich fester an den Hals ihrer Literflasche. Wer wagt, gewinnt. Oder so ähnlich. Aber natürlich war ihre Mutter schneller.
»Und, schenkst du mir nun ein Glas aus dieser Flasche ein? Oder muss ich das auch selber machen wie alles andere?«
Margaret Penny hatte so wenig geplant, nach Edinburgh zurückzukehren, wie Edinburgh ihre Rückkehr erwartet hatte.
Aber …
Zu Hause ist dort, wo dein Herz ist.
Sagte man nicht so?
Insbesondere ein Herz, das man gequält, verprügelt und in winzige Stücke zerschnitten hatte, bevor man es an einer Herz-Lungen-Maschine verwesen ließ.
Sie hatte ihr Leben in London aufgegeben, indem sie es irgendwann zwischen Weihnachten und Neujahr komplett entsorgte. All die Dinge, die für sie nicht mehr von Nutzen waren, wanderten stracks auf die Müllkippe – schwarze Kostüme und Blusen mit Häkeleinsatz, fleischfarbene Strumpfhosen, Zwiebelschneider und schicke Kleider, Ordner in lebhaften Farben. Sowie eine nagelneue Saftpresse, die sie sich einst gewünscht, aber nie gebraucht hatte.
Es geschah etwa zur selben Zeit, als das Leben, das Margaret zu führen meinte, auch sie abservierte. Ein Job, ohne Rückfrage dahin. Ein Bankkonto, geleert wie Badewasser durch den Abfluss. Kein Erspartes, um darauf zurückzugreifen. Auch keine echten Freunde, um darauf zurückzugreifen. Diverse Debit-, Kredit- und andere Karten, an die, wie jetzt herauskam, kein Geld (und keine Loyalität) gekoppelt war. Schlussendlich der Besuch eines Gerichtsvollziehers, der erklärte, dass die Wohnung, die sie all die Jahre gemietet hatte, ihr irgendwie entrissen worden war.
Dreißig Jahre in der Großen Metropole, dahin, wie Schnee von einer Herdplatte gleitet. Und alles wegen einer Begegnung mit einer mausgrauen Dame, die auf dem kleinen, fleckigen Tisch in Margarets Coffeeshop um die Ecke Fotos ausgebreitet hatte. Ein Mann, von dem Margaret damals annahm, dass es ihrer sei. Und neben ihm zwei Kinder mit silbernem Haar in knittrigem Technicolor. Das Leben, das Margaret sich immer gewünscht hatte.
Indes …
Wie sich zeigte, hatte es die ganze Zeit jemand anderem gehört.
Der Glücksbringer ihrer Mutter, ein Coronation-Penny, tauchte genau in dem Moment auf, als Margaret ihn am dringendsten brauchte. Ohne Grund zum Feiern, mit allem Grund zur Reue, saß sie auf den kalten Küchenfliesen einer Wohnung, die nicht länger ihre war, und trank mit einer billigen Flasche saurem Wein auf das Ende. Der Penny rollte zwischen zwei Küchengeräten hervor, kullerte ins Blickfeld wie eine kleine Botschaft aus der Vergangenheit. Margaret krabbelte hinterher. Die Fliesen waren hart und gnadenlos und zerschrammten ihr die Knie. Doch das war egal. Hier tat sich etwas Unerwartetes, gerade als sie aufs Schlimmste gefasst war.
Der Penny war antiquiert, roch nach Metall und Erde, und die Bronze schimmerte matt im trüben Winterlicht. Auf der einen Seite schwang Britannia ihren Dreizack. Auf der anderen blickte ein König ins Weite, der nie hatte König werden sollen. Kopf: ab nach Norden, Zahl: Richtung Süden. Oder an einen noch ferneren Ort. Margaret schnipste den Penny, ohne abzuwägen, was als Nächstes kommen mochte. Untergang oder das Aufschlagen eines neuen Kapitels. Sollte der König entscheiden.
Was er tat.
Sie ging mit nichts als einer kleinen blauen Reisetasche (vier Schlüpfer, ein Reserve-BH, zwei Strumpfhosen; dazu eine Zahnbürste und eine Tube getönte Tagescreme, leer bis auf einen kläglichen Rest). Zurück ließ sie einen Mann mit Haar in der Farbe nassen Schiefers, der mitten in einem Londoner Wohnzimmer stand, mit Wänden in der Farbe der Sonne. Und stahl einen Mantel, weil … nun … weil sie anscheinend gut darin war. Sowie ein Foto von zwei Kindern mit silbernem Haar, weil man nie wusste, wann es von Vorteil war, eine eigene Familie vorweisen zu können.
Es lag eine gewisse Befriedigung darin, nichts ihr Eigen zu nennen und niemandes Eigen zu sein. Doch damit blieben Margaret nicht viele Optionen. Nur ein Ticket für den ersten Bus nach Norden und eine Bude in einem ehemaligen Sozialwohnungsblock – Wohnzimmer, Küche, Schlafzimmer, Rumpelkammer und das winzige Quadrat in Beige, das ihre Mutter Flur nannte. Zu Hause. Nicht der Ort, wo Margarets Herz war. Aber immerhin eine Zuflucht.
Ein Liter Rum, ausgetrunken bis zum letzten Schleck. Der Fernsehton bis zum Anschlag aufgedreht. Fritten von den Knien gegessen. Es war nicht das beste Neujahrsfest, das Margaret Penny je gefeiert hatte. Aber gewiss nicht das schlechteste.
Binnen drei Minuten hakten sie und ihre Mutter alle üblichen Themen ab, mehr oder weniger.
Wetter.
»Manche Leute haben Söhne und Töchter, die für sie Schnee schippen.«
Gesundheit.
»Du hast ja den Stock gesehen.«
Freunde.
»Um diese Jahreszeit sind alle bei ihren Familien.«
Bevor sie zum eigentlichen Thema kamen.
»Ich wüsste gern, ob ich eine Weile bleiben kann.« Margaret zerknüllte den Rest des Frittenpapiers. Essig und schmieriges Fett unter den Fingernägeln machten ihr bewusst, wie wenig weiter sie in den vergangenen dreißig Jahre gekommen war.
»Dann machst du hier also Urlaub?« Barbara tröpfelte sich den Rest Rum auf die Zunge.
Margaret wusste nicht recht, ob ihre Mutter Urlaub für eine gute Idee hielt oder nicht. Entschied, sich bedeckt zu halten. »Ja. So in der Art.«
»Was soll das denn heißen?«
Ferien. Ein Besuch. Ein Wochenendtrip. Auf der Suche nach Liebe. Oder (da wahrscheinlich nicht verfügbar) nach Geld, um sich zu gegebener Zeit flugs abzusetzen. Doch Margaret konnte sich nicht entscheiden, welche Antwort die beste wäre, also wich sie aus. »Es wäre nur für ein, zwei Wochen«, sagte sie. »Vielleicht einen Monat.«
Schweigen.
Barbara, aus deren all-umspannendem Morgenmantel an Kragen und Bündchen Rüschen hervorlugten, starrte mit der gespannten Aufmerksamkeit eines Kleinkinds auf den Fernsehschirm. Margaret konnte nicht einschätzen, ob ihre Mutter über ihre Bitte, eine Weile hier Hausgast zu sein, nachdachte oder sie kurzerhand ignorierte. Oder ob sie (plausibler) ein Hörgerät brauchte. Es war wie verhört werden, nur dass die Gegenseite keinen Ton sagte. Doch gerade, als sie sich dreinfand, wieder in die eisige Edinburgher Nacht hinauszuziehen, schaltete Barbara mit einem kurzen Ruck ihres Handgelenks den Fernseher aus und sagte: »Du kannst die Rumpelkammer nehmen.«
»Wie bitte?«
»Sie gehört mal ausgemistet.«
Als Margaret später darüber nachdachte, war es eigentlich verblüffend leicht gegangen.
An diesem Abend lag Margaret in der Rumpelkammer ihrer Mutter auf einer Luftmatratze, wo sie sich drehte und wendete im vergeblichen Versuch, warm zu werden. Der gestohlene Mantel, rot wie ein Massaker, bedeckte ihren Leib. Die Außentemperatur lag weit unter dem Gefrierpunkt. Drinnen, in der Rumpelkammer, herrschte tiefsitzende Kälte. Egal, wie sie sich drehte, immer war ein Ellbogen, Fußknöchel, eine Hand oder Hüfte im Kalten. Margaret war sicher, sie konnte ihren eigenen Atem über sich hängen sehen wie ein pestilentes Leichentuch.
»Ich habe nicht oft Übernachtungsbesuch.«
So hatte Barbara es ausgedrückt, als sie ihr die einzige überzählige Decke gab, die sie zu besitzen schien. Klein und quadratisch, mit einem zerschlissenen Satinband gesäumt, passte die Decke eher zu einem Baby als zu einer erwachsenen Frau mittleren Alters. Margaret nahm sie trotzdem. Bettler durften nicht wählerisch sein. Im Übrigen war ihre Mutter wie ein Buch ohne Wörter. Unlesbar.
Nachdem Barbara zu Bett gegangen war, immer noch murrend, weil ihre Neujahrspläne durcheinandergeraten waren, brachte Margaret eine halbe Stunde damit zu, sich eine Stelle auf dem Boden der Rumpelkammer freizuräumen. Mit dem Kopf an der einen Wand berührten ihre Füße fast die andere. Es war eine Art Mini-Ground-Zero, was ihrer derzeitigen Lebensphase recht gut entsprach. Es dauerte eine Weile, bis sie die Luftmatratze (die einzige verfügbare Matratze) wiederbelebt hatte, bei der Mund-zu-Mund-Beatmung des blau-gelben Plastikteils hauchte sie beinahe selbst ihr Leben aus. Als sie sich im eiskalten Badezimmer die Zähne putzte und durch einen Fensterspalt auf den frostschimmernden Asphalt draußen blickte, wünschte sie, auch ihr würde jemand eine Mund-zu-Mund-Beatmung gönnen. In der Rumpelkammer gab es kein Fenster. Keinerlei Notausgang.
Ihre Mutter hatte recht. Die Kammer gehörte ausgemistet. Sie war voller Krempel. Vor Margaret lag ein ganzes Leben, diesmal nicht auf einem kleinen fleckigen Kaffeetisch, sondern in Stapeln von Wand zu Wand. Ein Heizlüfter mit kaputtem Regler, der einen verschmorten Geruch abgab, als Margaret ihn anzustellen versuchte. Ein Wäscheständer, der sämtliche Plastikummantelung eingebüßt hatte. Ein Bügeleisen mit ausgefranstem Stromkabel. Ein uralter Kleiderschrank voller uralter Kleider. Ein kleines braunes Gemälde, schmutzig auf mehr als eine Art. Und eine verdreckte Porzellanputte, angeknackst und rissig, deren einer Arm vor langer Zeit abgebrochen war.
Hier lag er also. All der Krempel, dem Margaret dreißig Jahre lang zu entkommen versucht hatte. Und doch war auch sie wieder hier gelandet. Siebenundvierzig, auf die fünfzig zu. Keine Kinder, die sie als Errungenschaft vorweisen konnte. Keine Großeltern oder Geschwister. Nicht mal irgendein Haustier. Und nun war sie wieder in Edinburgh. Land der grauen Bauten. Land der hohen Schornsteine. Land der Geheimnisse, die alle kannten, aber leugneten. So hatte sie das nicht geplant, diese Rückkehr mit siebenundvierzig, mit leeren Händen bis auf den gestohlenen Mantel und die Flasche Rum. Andererseits war Margaret nicht recht klar, was sie eigentlich geplant hatte. Bei näherer Betrachtung fiel ihr dazu gar nichts ein.
Indes …
Im Durcheinander der Rumpelkammer, tief in der Finsternis einer Edinburgher Nacht, spürte Margaret Penny etwas, das unter ihrer Hüfte klemmte. Eingequetscht. Deformiert. Im Grunde wie sie. Die letzte ihrer Weihnachtsclementinen, die sie von einem Londoner Marktstand hatte mitgehen lassen, eine abschließende Erinnerung an den Süden.
Margaret rollte herum und bekam die kleine Frucht zu fassen, die aus ihrer Manteltasche kullerte. Sie hob sie im Dunkeln an den Mund. Irgendwo draußen in der gefrorenen Einöde der Stadt tanzte ein betrunkener Mann, in dessen Haar Biertropfen glitzerten wie ein Sternbild. Doch hier, in der kalten und tintenschwarzen Rumpelkammer ihrer Mutter, kostete Margaret Penny die Sonne.
1929
Er kam nach Hause und sie kullerte aus seinem Jackenärmel – eine kleine orangene Sonne, die wie durch Zauberhand aus dem schmutzigen Tweed glitt.
»Daddy, Daddy, Daddy.« Das Kind, das im Flur des kalten Londoner Hauses auf ihn wartete, sprang von der untersten Treppenstufe auf und klatschte wieder und wieder in die Hände. »Gib sie mir. Gib sie mir.«
»Was kriege ich dafür, Mädel?« Alfred Walker hielt die Kostbarkeit außer Reichweite der Kleinen hoch in den Himmel des Flurs. Er lachte, wie er es immer tat, auf diese Art, dass man sofort einstimmen wollte.
Das Mädchen zog einen Schmollmund, die wilden Korkenzieherlocken klebten an ihren rosigen Bäckchen. »Daddy«, mahnte sie, als wäre sie vierzig, nicht vier, die Hände flach an ihr sauberes Weihnachtskleid gelegt. Sie blickte ihn mit diesen erstaunlichen Augen an: das eine so, das andere anders. Schwer zu widerstehen.
»Oh, du bringst mich um.« Alfred stöhnte und mimte einen Dolchstoß in die Brust, die geballte Faust an die Westenknöpfe gepresst.
»Dann gib sie mir«, wiederholte die Kleine.
Im oberen Stockwerk setzte ein lang gezogenes Stöhnen ein, streckte sich ihnen entgegen, stieg an, stieg an, fiel ab, fiel ab, stieg wieder an; riss alles im Haus mit sich, von den Deckeln der Weckgläser in der Speisekammer bis zu der Putte mit dem fehlenden Daumen, die den Kaminsims im Wohnzimmer zierte. Kind und Vater sahen sich an, seine Faust noch an seiner Brust, ihre Hände jetzt aneinandergepresst wie zum inständigen Gebet.
Dann senkte Alfred die Hand. »Jetzt dauert es nicht mehr lang«, sagte er und ließ die Mandarine zurück in seine Jackentasche gleiten, wo Dunkelheit die Kostbarkeit verschluckte.
Hinten in der Waschküche spritzte sich Alfred kaltes Wasser aus dem Hahn auf Unterarme und Handgelenke. »Hast du dir schon Namen überlegt?«, fragte er.
Die Kleine schüttelte den Kopf.
Er klatschte sich Wasser ins Gesicht und aufs Haar. »Warum, fällt dir keiner ein?«
Sie richtete ihre erstaunlichen Augen auf den Boden.
Alfred löste sich von dem dicken Steingutbecken, schüttelte den Kopf – wie das Schütteln eines wilden Hundes, bei dem es winzige Tropfen auf alle Oberflächen regnet. Als er aufsah, stand die Kleine vor ihm, ihr Kleid ganz gesprenkelt, und hielt ihm ein ebenfalls gesprenkeltes Handtuch hin.
»Danke, Darling.« Alfred trocknete sich rundherum ab, Gesicht, Ohren, Nacken. Als er das Handtuch beiseite warf, war das Gewebe gründlich verschmutzt. Er zog sich einen Stuhl heran und setzte sich. »Deinen Namen hatten wir aus einem Lied.«
Die Kleine krabbelte auf einen Stuhl neben ihm.
»Oh my darling.« Er streckte eine Hand aus, um ihr seidiges Haar zu berühren. »Aber wenn dir nichts einfällt, müssen wir sie einfach nach mir und deiner Mama nennen.« Alfred lachte. Dieses Lachen, bei dem jeder sofort einstimmen wollte. Das Mädchen hielt sich eine Hand vor den Mund. Doch diesmal runzelte sie die Stirn.
Oben begann ein weiteres Stöhnen seine lange Reise. Alfred hob den Blick zur Decke. »Keine Zeit zu verlieren«, sagte er und stand auf.
Auch die Kleine glitt von ihrem Stuhl.
Alfred ging zur Tür und blickte hinaus in den Flur: nichts als ein schmaler gelber Spalt am oberen Treppenabsatz. »Auf, auf und voran«, murmelte er, verschränkte seine Finger und knackte mit den Knöcheln.
»Daddy.«
Vier kleine Finger und ein Daumen berührten den Saum seiner Tweedjacke.
»Was ist?« Alfreds Hand lag bereits auf dem Holzgeländer.
»Fröhliche Weihnachten.«
»Oh, aye!« Alfred trat zurück in den Flur und klopfte auf seine beiden Taschen. »Wie konnte ich das vergessen?« Einen Moment tanzten seine Augen, dann verschwand eine Hand im Tweed und tauchte gleich wieder auf, mit einer kleinen Mandarine auf der Handfläche. »Fröhliche Weihnachten.«
Das Mädchen streckte die Hand danach aus.
Doch da hielt Alfred ihr mit der anderen Hand noch etwas hin. »Um die Babys zu feiern, wenn sie kommen«, sagte er. »Kopf: eins von jeder Sorte. Zahl für entweder oder.« Er lachte, schnipste den Penny in die Luft, und beide beobachteten, wie er eine langsame Drehung um die eigene Achse vollzog, bevor er rasch herabstürzte.
Die Münze fiel mit Klimpern und Scheppern, rollte davon und kullerte in die Dunkelheit. Die Kleine ging nicht im Staub auf die nackten Knie, um hinterherzukrabbeln. Stattdessen streckte sie erneut die Hand aus, schlang vier kleine Finger und einen Daumen um die Mandarine und hielt sie fest gepackt, bis Alfred die Hand wegnahm.
Das Mädchen sah zu, wie Alfred die Treppe hinaufeilte, immer zwei Stufen auf einmal, und wartete, bis er in der Dunkelheit verschwand. Dann aß sie das ganze Ding, bevor er wieder herunterkommen konnte. Wartete nicht darauf, dass jemand es ihr schälte oder zerteilte. Setzte sich damit nicht an den Tisch. Stattdessen fetzte sie mit scharfen kleinen Zähnen durch das orangene Fleisch, hockte auf den nackten Holzdielen, biss und nagte und saugte, so dass klebriger Saft ihr das Kinn hinunterlief.
Clementine. So hatten sie sie genannt.
Oben waren es ein Junge und ein Mädchen. Nach den Eltern benannt, beide jetzt das Lächeln in Person. Die Hebamme, Mrs. Sprat (wiewohl sie nicht verheiratet war und es auch nie sein würde), fuhrwerkte durchs Zimmer, von einem Baby zum anderen, räumte hier eine Waschschüssel weg, ordnete dort einen Stapel Tücher. »Was für ein Zirkus«, murmelte sie. Doch sie meinte nicht die Neugeborenen, die in ihren ersten Momenten so sonnig und heiter waren, wie sie es in ihren letzten sein würden. Sie wusch rings um den Stummel einer durchtrennten Nabelschnur und blickte missbilligend auf die vielfach am Boden verstreuten Kleider. Ein gründliches Reinemachen, das war es, was dieses Haus nötig hatte. Und Anstand einbläuen müsste man ihnen allen. Sie tupfte um einen kleinen Penis und zwei winzige Hoden herum, die hoch oben in ihrem Sack saßen. Und dieser Ehemann, guckte einfach zu! Wo sollte das bloß enden?
Das erste Baby krümmte und wand sich im Griff der Hebamme und drehte den Kopf, als suche er etwas, das er verloren hatte. Mrs. Sprat hielt ihn mit Händen wie zwei Schraubstockbacken und wickelte seine zappelnden Arme und Beine fest in ein Baumwolltuch. Und dann diese Frau, die wie eine Furie kreischte. Da wünschte man sich wirklich Stopfen für die Ohren. Die Hebamme legte den kleinen Jungen in einen bereitgestellten Korb und stopfte eine Decke um ihn fest, die mit einem glänzenden Satinband gesäumt war. Sie würde ein Wörtchen mit der Oberin reden müssen, dass man sie schon wieder in diesen Teil der Stadt geschickt hatte.
Im breiten Doppelbett zurückgelehnt lag Alfreds Frau Dorothea, die Haare dahin und dorthin. Alfred hockte daneben und strich ihr wieder und wieder über den Kopf. »Oh, my darling«, murmelte er.
»Sei so gut und gib mir meine Bürste.« Das Schönste an ihr war ihr Haar, fand Dorothea. Sie bürstete es jeden Morgen und jeden Abend. Und manchmal auch zwischendurch.
Alfred langte auf den Nachttisch und reichte Dorothea eine Bürste mit beinernem Griff. Dorothea begann sich zu bürsten, langsam, vom Scheitel bis hinunter zu den Spitzen. »Zwitschern sie?«, fragte sie.
Alfred stand vom Bett auf, ging hinüber und lehnte sich über den Korb. »Aye«, sagte er. »Zumindest eines.«
»Haben sie alles in notwendiger Anzahl?«
»Zehn Finger. Zehn Zehen. Jeweils.« Und er lachte.
»Haar?«
»Tja, der Junge schon, so viel ist sicher.« Alfred griff in den Korb und hielt ein winziges Bündel hoch, damit Dorothea es sehen konnte. Die Decke fiel ab. Das Baumwolltuch löste sich. Eine winzige rosa Ferse baumelte in der Luft. Alfred fing sie ein und verdrehte die Augen Richtung Hebamme, die in der Ecke stand und ihnen den breiten Rücken zukehrte. Dorothea kicherte. Mrs. Sprat beugte sich tiefer über ihre Arbeit.
»Und was ist mit Clemmie?« Dorothea wirbelte die Bürste einmal in der Hand herum und begann dann wieder oben am Scheitel.
»Sie nuckelt an ihrer Mandarine.«
»Hat sie einen Namen ausgesucht?«
»Nein.«
»Ich wusste es.«
»Wie kommt’s?« Alfred hob den Kopf und blickte von seinem neuen Sohn hinüber zu seiner Frau.
»Weil …« Dorothea widmete sich ganz den bleichen Enden ihrer Haarspitzen. »Sie will sie nicht.«
»Sei nicht albern«, Alfred wandte sich wieder dem Korb zu. »Sie wird sie lieben.«
»Oh nein«, sagte Dorothea. »Sie hat es mir gesagt.«
»Tja, wie auch immer, jetzt hat sie sie am Hals.«
Alfred und Dorothea schauten sich verblüfft an. »Sie spricht«, sagte Alfred.
Die Wangen der Hebamme röteten sich, als sie ein zweites Bündel in seine Richtung stieß. »Hier ist das andere.«
Dorothea hielt sich die Bürste an die Lippen, damit die Hebamme sie nicht lächeln sah. Dann streckte sie Alfred eine silberne Schere hin. »Sei so gut und schneide mir je eine Strähne ab, zur Erinnerung.«
Eine Stunde später stand Alfred in der Mitte des Schlafzimmers, ein kleines Baby in jedem Arm. »Wir nennen sie Klein Alfie und Klein Dottie.« Er sah aus wie ein Mann, der gerade ein sehr üppiges Abendessen zu sich genommen hat.
»Dotty, wie ich«, sagte Dorothea, der das Haar weich über die Schultern fiel wie ein Schal. Dann lachte sie. Die Art Lachen, bei der sich die Leute neugierig umdrehen und dann wegsehen. Die Hebamme, die eben zurück ins Schlafzimmer gekommen war, um ihre Tasche zu packen, tat genau das.
Auch Alfred lachte. »Aye«, sagte er. »Wie zwei winzige Splitter von zwei großen Blöcken.«
»Eher wie zwei Erbsen in der Schote.«
Beide sahen wieder die Hebamme an. Sie trug inzwischen ihre Haube und ein Cape, bereit zu gehen.
»Sie spricht wieder.«
»Alfred …« Dorothea wiegte ihr schimmerndes Haupt.
»Madam«, sagte Alfred zur Hebamme. »Gestatten Sie mir, Sie hinauszubegleiten.« Er legte die beiden Bündel in den Korb, Fuß an Kopf, und stopfte die Decke mit dem glänzenden Satinsaum wieder ringsherum fest. Dann schritt er zur Schlafzimmertür und streckte die Hand aus. Die Hebamme drückte ihre Tasche fester an die Brust. Es widerstrebte ihr, sie auszuhändigen, doch die Manieren behielten die Oberhand.
Unten keine Spur von Clementine. Nur sechs sauber abgelutschte Mandarinenkerne in einem Häufchen auf den nackten Dielen des Flurs. Alfred stieg über die Kerne hinweg, als gäbe es sie gar nicht. »Nun, dann auf Wiedersehen«, sagte er und hielt mit einer Hand die Haustür auf. »Und fröhliche Weihnachten.«
Die Hebamme war bereits draußen auf den Stufen. »Ach, ja.« Sie legte eine Hand an die Haube. Das hatte sie völlig vergessen.
»Ihre Tasche.«
»Oh.« Mrs. Sprat wandte sich um. Die hatte sie auch ganz vergessen. Was war das bloß mit dieser Familie, dass sie sie so durcheinanderbrachten? »Ihnen auch frohe Weihnachten.«
Doch die Tür schloss sich bereits. Eine Hebamme draußen in kalter Dezemberluft. Alle fünf der Familie Walker zusammen im Warmen.
»Oh«, sagte Mrs. Sprat wieder, obwohl niemand sie hörte. Dann stapfte sie los, die eisige Londoner Straße entlang, ein kleines Schlittern hier, ein kleiner Rutscher dort, beinahe ein Sturz. Die sind verrückt, dachte sie und drückte ihre Tasche an sich, die Finger schon taub vom langsam kriechenden Frost. Tastend suchte sie in den Taschen ihres Capes nach ihren dicken blauen Handschuhen. Doch sie waren verschwunden, ersetzt durch ein paar Stückchen klebriger Mandarinenschale.
2011
Insgesamt waren sie zu fünft. Ein Priester. Drei Trauernde. Ein toter Mensch in einer Holzkiste.
Gelobet seist du.
Ruhe in Frieden.
Und alles, was sonst noch angemessen war bei einer Beerdigung, wo niemand den Verstorbenen kannte. Margaret Penny war erst ein paar Tage in Edinburgh, und schon verkehrte sie mit den Toten. Das schien ihr eine passende Grabinschrift für das Scheitern ihres Lebens, über Wiege und Grab hinaus Bedeutung zu erlangen.
Der Anruf war tags zuvor gekommen und Margaret hatte ihn angenommen. Barbara schien seltsam abgeneigt, an ihr eigenes Telefon zu gehen.
»Hallo?«
»Hallo.« Eine helle Stimme. Männlich. Unerwartet. »Ist Mrs. Penny da?«
»Darf ich fragen, wer Sie sind?«
»Hier ist Mr. Wingrove. Hilfspfarrer der Gemeinde West Leith.«
»West Leith?« Anglikaner. Katholen. Protestanten. Freunde. Diese spezielle Gemeinde hatte Barbara in ihrer Litanei der aktuellen Kirchenbesuche nicht erwähnt.
Von ihrem Lehnsessel aus gestikulierte ihre Mutter wütend mit dem Krückstock, als wäre sie empört, dass Margaret überhaupt auf die Idee kam, den Hörer abzunehmen, geschweige denn mit der Person in der Leitung ein Gespräch anzufangen. Barbaras Haar war den ganzen Tag noch nicht gebürstet worden. An ihrem Kinn sammelten sich kleine Speicheltropfen. Und für einen flüchtigen Augenblick war da dieser Gesichtsausdruck. Der, den Margaret gesehen hatte, als Barbara das erste Mal an die Tür kam.
Margaret wandte sich leicht zur Seite, um dem hartnäckigen Starren ihrer Mutter zu entgehen. »Sie ist leider gerade nicht abkömmlich. Kann ich etwas ausrichten?«
»Ja, Sie könnten ihr sagen, dass sie beim Trauernetz als Nächste dran ist. Morgen Nachmittag.«
»Beim Trauernetz?«
So, wie ihre Mutter es später erklärte, war die Verpflichtung, amtliches Klageweib für die ›Bedürftigen‹ zu sein, beinahe ein Vollzeitjob.
Die Krematoriumskapelle war klein und leer, drei diagonale Stuhlreihen und ein breiter Vorhang vor der einen Wand. Vorn gab es einen in blauen Samt gehüllten Sockel und ein Rednerpult, für wen auch immer, aber von menschlichen Aktivitäten war nichts zu sehen. Auch nicht von dem Toten. Margaret linste vom Türrahmen aus ins Halbdunkel. Sehr hoch oben in der nackten Betonwand spendeten wenige schmale Fenster etwas Licht. So ähnlich wie in der Rumpelkammer ihrer Mutter. Keine Chance, beim Spenden der Sterbesakramente versonnen über grüne Augen zu blicken.
»Gehen wir hinein?« Ihr Atem erblühte in der eisigen Luft. Graupel fiel (schon wieder), so wie eigentlich immer, seit Margaret zurück in Edinburgh war, beiläufig stechende Tropfen, die sich als kleine Eisklumpen an ihren roten, gestohlenen Mantel hefteten. Inzwischen war es offiziell. Der zweitkälteste Winters seit Beginn der Wetteraufzeichnungen hatte Edinburgh im Griff. Sämtliche Oberflächen der Stadt verwandelten sich in tödliche Eisbahnen. Trotzdem sah Margaret nicht ein, warum sie draußen stehen und sich Frostbeulen holen mussten. Der Ehrengast war schließlich tot. Er würde es nicht merken, wenn jemand noch vor ihm auf seiner Party eintraf.
Barbara stach mit der Gummispitze ihres grauen NHS-Krückstocks auf den gefrorenen Untergrund ein. »Nein«, schnaufte sie. »Kommt nicht infrage.«
»Warum nicht?«, fragte Margaret.
»Darum.«
Und darauf gab es keine Antwort. Barbara hatte schon immer genau gewusst, wann das Richtige richtig und das Falsche (grundsätzlich) falsch war. Erst heute Morgen beim Frühstück, als sich kleine Weizenschrot-Fasern unbemerkt an die Vorderseite ihres wattierten Morgenmantels hefteten, hatte sie Margaret über die Regeln des Tages belehrt.
Nicht lächeln.
Nicht den Verstorbenen erwähnen.
Über nichts anderes reden als das Wetter.
Beerdigungen waren, als wäre man wieder klein, stellte Margaret fest. Das Edinburgh ihrer Kindheit kehrte zurück, um an ihren Knochen zu zehren. Sie hatte es sich verkniffen, hinüberzulangen und die Weizenfasern von der Brust ihrer Mutter zu klauben. Es war nicht ihre Aufgabe, dafür zu sorgen, dass Barbara gut aussah. Außerdem hatte sie ihre Mutter seit Jahren nicht mehr angefasst. Und schon gar nicht so.
Stattdessen klappte Margaret jetzt ihren Mantelkragen hoch und legte die Aufschläge übereinander, um das nackte Dreieck ihres Halses zu bedecken. Sie hatte immer noch keinen Schal aufgetrieben, trotz eines kurzen Stöberns im Schrank der Rumpelkammer. Nichts Brauchbares, nur ein Paar uralte marineblaue Wollhandschuhe mit Löchern an den Fingerspitzen und eine Bluse in einem scheußlichen Rehbraun. Als sie den Kleiderschrank zum ersten Mal öffnete, fragte sich Margaret: Was, wenn sie, statt etwas herauszuziehen, hineinstieg und für immer im Gedränge von Wäschestärke und Moder verschwand, in diesem Wald aus übergroßen Mänteln und plattgedrückten Kleidern unter dünnen Plastikfolien. Aber natürlich war ihre Mutter mal wieder schneller.
»Bist du noch nicht fertig?« Barbaras massige Gestalt tauchte im Türrahmen der Rumpelkammer auf und sperrte das wenige Licht aus.
»Doch«, erwiderte Margaret, »ich komme schon.« Und zog die ersten Sachen heraus, die sie zu fassen bekam. Ein wadenlanger Cordrock als Ergänzung zu den marineblauen Handschuhen und dieser scheußlichen rehbraunen Bluse.
Wie sich zeigte, trug Barbara einen Wollmantel in der Farbe nassen Sandes und einen zartlila Hut, der besser zu einer Sommerhochzeit gepasst hätte als zu einer Beerdigung an einem dunklen Januartag. Als sie in das wartende Taxi stiegen, wobei der Fahrer Barbara von hinten auf die Rückbank hebelte, erhaschte Margaret einen Blick auf noch etwas. Das Revers eines Sommerjacketts im Türkis der Hebridischen See. »Sollten wir nicht Schwarz tragen?«, fragte sie, als sie auf dem Rücksitz Platz genommen hatten.
»Tue ich«, sagte Barbara und zeigte mit ihrem Stock auf eine schwarze Tüllblume, die auf ihrem zartlila Hut vor sich hin welkte. Dann, als der Taximotor jaulend auf Touren kam, kramte sie in ihrer steifen Handtasche und zog zur Krönung des Ganzen eine Plastikregenhaube hervor. »Für alles gewappnet«, sagte sie.
Jetzt, beim Warten auf die Ankunft des Verstorbenen, beschwor Margaret eine Vision ihres eigenen Ablebens herauf, bei der Barbara in einem türkisfarbenen Kostüm feierte, während ein Glas Rum auf das andere folgte. Unbestreitbar wirkte ihre Mutter heiter. Aber was würde Margaret anziehen, wenn es umgekehrt wäre – Barbara tot aufgebahrt, mit herausquellendem Fleisch und schlecht aufgetragenem Make-up? Ihre derzeitige Garderobe, auf Reisetaschenformat geschrumpft (vier Schlüpfer, Reserve-BH, Zahnbürste, zwei Strumpfhosen etc.), gab nichts Passendes her. Womöglich müsste sie sich den zartlila Hut ausleihen. Wobei, wäre es noch leihen, wenn ihre Mutter tot war? Schließlich könnte, wenn Barbara eines Tages dem erlag, was immer sich in ihrer Brust eingenistet hatte, all ihre Habe Margaret gehören. Die verdreckte Porzellanputte anstelle einer glänzenden Saftpresse. Margaret musste lachen, ein hohles leises Geräusch.
»Was ist so witzig?« Neben ihr duckte sich Barbara unter ihrer Plastikkopfbedeckung, eine Frau, die stets mit dem Schlimmsten rechnete.
»Nichts.«
»Na dann.«
Mit Mühe unterdrückte Margaret ein Jaulen, als sich die Gummispitze von Barbaras grauem NHS-Krückstock in einen ihrer ungeeigneten Schuhe bohrte.
Fünf Minuten später, als Margaret schon eine Rebellion in Erwägung zog, erschien ein Priester mit wie zum Lobpreis erhobenen Händen. »Ah, Mrs. Penny.«
Doch es war nicht Margaret, die er in seiner Herde willkommen hieß.
Barbara, deren Augen im blassen Januarlicht plötzlich leuchteten, schlurfte vorwärts. Einen grässlichen Moment lang dachte Margaret, ihre Mutter würde den geweihten Mann umarmen und gleich dort auf den Stufen der Kapelle küssen. So weit war es mit der Church of Scotland in all den Jahren ihrer Abwesenheit doch bestimmt nicht gekommen, oder?
Aber der Priester verbeugte sich nur, als Barbara herankam, nahm ihre beiden Hände in seine, als wolle er einer Königin seine Ehrerbietung erweisen. »Welche Freude, Sie wiederzusehen«, sagte er. »So gütig von Ihnen, zu kommen.«
Weiß wohl nichts von den Katholen, dachte Margaret und klappte ihren Kragen wieder herunter, um repräsentabler zu wirken. Oder den Anglikanern. Oder den Freunden. Andererseits, vielleicht wusste er auch Bescheid und ignorierte es einfach. Das wäre ganz die Edinburgher Art.
Als sie ihren nackten Hals dem eisigen Wind aussetzte, bemerkte Margaret, wie ihre Mutter dem Priester eine Art Beschwörung ins Ohr zu flüstern schien. Er nickte, richtete sich aus seiner gebückten Haltung auf und wandte sich Margaret zu. »Und Margaret.« Auf einmal war der Priester groß und starrte ihr direkt in die Augen. »Die verlorene Tochter.«
Das war keine Frage.
»Ja«, sagte Margaret.
Barbara nickte Richtung Priester. »Reverend McKilty.«
Beinahe hätte Margaret gelacht. Dann besann sie sich auf die Anweisungen ihrer Mutter. »Schön, Sie kennenzulernen«, sagte sie. »Ein Jammer, das mit dem Wetter.« Sie sah die Augen des Priesters aufblitzen und kurz ihre eigenen widerspiegeln.
In der Kapelle setzten sie sich nicht in die erste Stuhlreihe. Stattdessen zeigte Barbara mit ihrem Stock an, dass sie hinten Platz nehmen sollten. »Die erste Reihe muss für die Familie frei bleiben«, keuchte sie.
»Welche Familie?«, flüsterte Margaret. »Ich dachte, es geht gerade darum, dass er keine hat.«
»Man weiß nie.«
Margaret quetschte sich neben Barbara hinter zwei leere Stuhlreihen (beide mit mehr Beinfreiheit) und fragte sich, wie viele andere Beerdigungen Barbara schon besucht hatte, ohne etwas über die Verstorbenen zu wissen. Wie üblich gab Barbara nichts preis. Stattdessen saß sie reglos da und starrte geradeaus auf den Sockel, während gedämpftes Keuchen und Schnaufen aus ihrer Brust drang.
Auch der Priester beachtete sie nicht weiter, lungerte an der Tür herum und wrang mehrfach die Hände, als wartete er darauf, dass noch jemand eintraf. Hielt vielleicht Ausschau nach dem Geist beim Bankett, irgendeinem entfernten Cousin. Oder einer lang vermissten Tochter, die plötzlich dem berühmten Edinburgher Nebel entstieg. Es war auch möglich, dass sie alle nur auf das Eintreffen des Toten warteten. Denn selbst bei Verstorbenen ohne Verwandte oder Kohle (»Es heißt bedürftig, Margaret. Bitte versuch dir das zu merken.«) war eine Leiche wohl Grundvoraussetzung für die Beerdigung. Zumindest nahm Margaret das an.
Tatsächlich erwies sich eine kleine Frau ohne Hut mit einem Strauß Schneeglöckchen als Grund für die Verzögerung.
»Mrs. Maclure«, murmelte der Priester, als die Verspätete durch die Kapellentür huschte.
»Tut mir leid, tut mir leid, tut mir leid«, murmelte die kleine Frau, nickte und verneigte sich Richtung Kapellenboden, während sie auf einen Stuhl am anderen Ende der Reihe rutschte.
»Wer ist das?«, flüsterte Margaret ihrer Mutter zu.
Barbara schaute stur geradeaus, ihre Lungen gaben ein leises Akkordeon-ähnliches Stöhnen von sich. »Sie ist die andere vom Trauernetz.«
»Schon klar, aber was …«
»Pscht!«
Alle in der Kapelle (alle drei) drehten die Köpfe in Margarets Richtung und erwarteten mit wortlosem Stirnrunzeln, dass sie den Mund hielt. Margaret versank in Schweigen. Verdruss. Das hatte ihre Mutter ihr immer vorgehalten. Von Anfang an nichts als Verdruss.
Ein Priester. Ein toter Mensch. Und drei amtliche Klageweiber, die am Tag der Einäscherung zufällig beim Trauernetz Dienst hatten. Es war keine überbordende Veranstaltung. Genau genommen dauerte das Ganze ungefähr fünfzehn Minuten, einschließlich Kommen und Gehen. Reverend McKilty psalmodierte. Mrs. Maclure schniefte. Barbara saß da wie ein Totempfahl, unverwandt auf ihren grauen NHS-Stock gestützt. Es gab keine Blumen. Keine Lieder. Keine Agende. Nur ein paar Worte, ein Stück aus der Bibel und einen Toten namens John. Nicht gerade ein aufwendiger Abschied für etwas, das mal ein Leben gewesen war.
Margaret saß alles aus und versuchte, dabei nicht mit dem Coronation-Penny herumzuspielen, der geborgen in der Tasche ihres gestohlenen Mantels steckte. Findst einen Penny, nimm ihn mit, dann folgt dir das Glück auf Schritt und Tritt. Das hatte ihre Mutter immer gesagt. Und wie jede andere hatte auch Margaret Penny immer angenommen, das Glück wäre auf ihrer Seite, bis sich zeigte, dass sie überhaupt kein Glück hatte. Die Münze war das erste Anzeichen, dass sich da etwas ändern könnte. Kopf: ab nach Norden, Zahl: woandershin, vielleicht über alle Berge. Oder an einen noch ferneren Ort. Aber was war Glück anderes, fragte sie sich jetzt, als eine zufällige Chance? Kopf oder Zahl. Hätte beides sein können. Sie drehte die Münze in ihrer Tasche, einmal, dann ein zweites Mal, als der Priester den Toten für tot erklärte. Margaret wusste, dass in ihrem Leben etwas fehlte. Wenn sie den Penny noch einmal drehte, fand sie vielleicht heraus was.
Als der Priester Asche zu Asche verkündete und der Sarg seinen endgültigen ruckeligen Abstieg ins glühende Vergessen antrat (oder in den Wartebereich des Krematoriums), versuchte Margaret, sich darin jemanden, den sie kannte, vorzustellen, um die erforderlichen Gefühle aufzubringen. Irgendwer musste doch weinen oder zumindest danach aussehen, damit es eine anständige Beerdigung war.
Da wäre natürlich ihre Mutter, die einzige von Margarets Verwandten, die sich bereits in Grabesnähe befand. Eigentlich die einzige Verwandte, die Margaret überhaupt kannte, Punkt. Dieser zartlila Hut. Diese Rum-feuchten Lippen. Und all der Krempel, der nur darauf wartete, weitergegeben zu werden. Doch trotz des Pfeifens, das jetzt aus Barbaras Brustkorb drang, war Margaret sicher, dass ihre Mutter noch eine Weile zugegen sein würde. Also dachte sie stattdessen an einen Mann mit Haar in der Farbe nassen Schiefers, der ihrer Lebensmitte den Anschein eines neuen Morgens gegeben hatte, bis herauskam, dass es eher der Anfang vom Ende war. Margaret wusste, seinetwegen könnte sie ein ganzes Meer voll Tränen weinen, oder auch zwei. Doch sie war entschlossen, das nicht zu tun.
Dann wäre da noch ihr künftiges Ich in dreißig Jahren, gestrandet in einer Rumpelkammer, wo der Teppich zu den Wänden passte. An der Matratze festgefroren wie in einem bösen Traum, drei Monate zu spät aufgefunden, keine Freunde, keine Ersparnisse, keine Perspektiven. Ohne Telefonbucheintrag, genau wie ihre Mutter. Nichts als ein schwacher Hauch von Rum, um ihr den Abgang zu versüßen.
Letztlich aber fiel ihre Wahl auf das Foto. Inzwischen verloren gegangen. Verschwunden. So wie Margarets bisheriges Leben: nichts als eine Erinnerung, eines Abends aus den Tiefen einer Schublade gefischt, als Margaret selbst noch ein Kind war. Zwei anonyme Zwillinge in Schwarzweiß, schlafend hinter einem kalten Rechteck aus Glas.
»Wer ist das?«, hatte sie ihre Mutter gefragt, obwohl sie damals schon wusste, dass sie auf verbotenem Terrain gestöbert hatte.
»Geht dich nichts an.« Barbara, die gerade bügelte, hatte sich vorgebeugt und ihr das Foto weggeschnappt. »Leg es zurück und rühr’s nicht an.« Barbara hatte nie viel von Familiengeschichte gehalten, weder ihrer eigenen noch der anderer Leute.
»Aber was machen die da?«, hatte Margaret beharrt.
»Sie sind tot, ist doch klar.«
Hinterher, als man sich draußen zu dem versammelte, was als Totenfeier durchging, erkundigte sich Mrs. Maclure nach Barbaras allgemeinem und seelischem Befinden. »Wir haben an Ihrem Geburtstag gar nichts von Ihnen gehört.« (Der kleine Anlass, der das Pech hatte, kurz vor Weihnachten zu liegen.) Den, merkte Margaret, hatte sie ganz vergessen. Seit Jahren hatte sie Barbaras Geburtstag nicht mehr gefeiert, und soweit sie wusste, auch ihre Mutter nicht.
»Und wir haben Sie beim Weihnachtsgottesdienst vermisst.«
Barbara pfiff, keuchte und lehnte sich schwer auf ihren Stock. »Ich war dieses Jahr nicht viel unterwegs«, sagte sie im voll aufgedrehten Trauertonfall. »Der Tod ist mir auf den Fersen.« Und da sah Margaret ihn wieder – diesen Blick in den Augen ihrer Mutter, wie beim ersten Mal, als sie durch den Türspalt spähte. Angst. Das war es, was Margaret gesehen hatte. Als könnte, wer auch immer dort wartete, nur eines bringen.
»Oh, ich weiß genau, wie Sie sich fühlen, meine Liebe.« Mrs. Maclure umklammerte noch immer die Schneeglöckchen, obwohl der Sarg längst abtransportiert war. »Das ist schon das dritte Mal in diesem Jahr, dass ich hier oben bin.«
Himmel, dachte Margaret. Wir haben doch erst die zweite Januarwoche.
Barbara stand jetzt ein wenig aufrechter. »Sind die anderen nicht verfügbar?«
»Oh nein, meine Liebe«, sagte Mrs. Maclure. »Es ist nur … es herrscht gerade großer Andrang. Das kalte Wetter. Rückstau im Leichenschauhaus.«
»Warum hat man mich nicht informiert?«
»Sie sind anscheinend nicht ans Telefon gegangen, meine Liebe. Ich habe es mehrfach versucht.« Mrs. Maclure wippte und verbeugte sich, als wäre sie es, die sich entschuldigen musste.
Das Crescendo pfeifender Atemzüge, das sich protestierend aus Barbaras Brust erhoben hatte, ließ etwas nach. »War beschäftigt«, knurrte sie und stach mit dem Stock in den Boden. Womit beschäftigt, war Margaret schleierhaft.
Mrs. Maclure aber wandte sich nun Margaret zu. »Und was ist mit Ihnen, Liebes? Treten Sie dem Trauernetz bei?«
»O nein, ich bin nicht …« Nach Edinburgh zu kommen war das eine. Regelmäßiger Umgang mit Toten als Pflichtprogramm stand auf einem anderen Blatt.
»Wir brauchen immer Unterstützung.« Im Schatten der Kapellentür schimmerten Mrs. Maclures Augen schwarz. »Um den Verlassenen beizustehen.«
»Na ja, vielleicht …« Der Kopf an der Matratze festgefroren. Der süße Kuss des Rums.
»Gut.« Mrs. Maclure lächelte und entblößte überraschend lange Eckzähne für eine ansonsten so zarte Frau. »Man weiß nie, wann es einen selbst trifft.«
Margaret bereute sofort, was sie sich da möglicherweise aufgehalst hatte. Ein Leben für die Bedürftigen Edinburghs entsprach nicht ganz ihrer Vorstellung von Zukunftsaussichten. »Aber vielleicht habe ich wenig Zeit«, sagte sie, nur um sich alle Optionen offen zu halten. »Ich muss mir einen Job suchen.«
»Was?« Barbaras Augen traten plötzlich hervor. »Ich dachte, du bleibst nicht.«
»Na ja, ich …«
»Wirklich?« Mrs. Maclure zögerte einen Moment mit schräg geneigtem Kopf, als sähe sie eine weitere Gelegenheit auf sich zukommen. »Da könnte ich vielleicht helfen«, sagte sie. Und sie strich flüchtig über Margarets roten Mantel, als hätten sie beide eine Übereinkunft getroffen.
Margaret nahm einen tiefen Zug frostige Januarluft und fragte sich, in was sie sich da verstrickte. Über die Jahre in London hatte sie das ganz vergessen. Die Edinburgher Art, Dinge anzupacken.
Margaret überließ Mrs. Maclure und ihre Mutter ihrem Gespräch über Einzelheiten des Trauernetzes für die Bedürftigen und machte sich auf die Suche nach dem Taxi, das sie für die Heimfahrt bestellt hatte. Sie sah, wie sich oben hinter der Krematoriumskapelle eine schwarze Limousine aus der Reihe der Leichenwagen löste und die lange Zufahrt zur Straße hinunter verschwand. Der Wagen sah genau aus wie der, der vor ein paar Tagen mit durchdrehenden Reifen vom Anliegerparkplatz am The Court geschlingert war. Sie hielt nach besonderen Merkmalen Ausschau.
Indes …
Sie befand sich beim Krematorium. Alle Wagen waren schwarz.
Als sie auf dem Nachhauseweg im Taxi durch die Stadt holperten und schlitterten, fragte Margaret ihre Mutter: »Wenn du nicht willst, dass der Tod dir auf den Fersen ist, warum machst du dann beim Trauernetz mit?«
»Jemand muss es tun.« Barbara fasste sich an den zartlila Hut, dessen schwarze Blüte von all der Aufregung leicht zerknautscht war.
»Ist das nicht ein bisschen wie ein Anwalt, der in der Notaufnahme auf Mandantenjagd geht?«
»Zumindest tun wir etwas Nützliches.«
Dazu sagte Margaret nichts. Sie fühlten sich beide nicht zu Bekenntnissen veranlasst, seit sie zurück war, trotz der Hinwendung ihrer Mutter zur Religion. Dennoch schien Barbara in Margaret lesen zu können wie in einem Buch.
»Aber du glaubst nicht an Geister, oder?«, bohrte Margaret.
»Natürlich nicht, sei nicht albern.«
Und doch war es da wieder – dieses winzige, kurze Verrutschen der Maske – wie als Barbara auf Margarets hartnäckiges Klingeln hin erstmals die Tür geöffnet hatte. Margaret wandte sich ab, blickte durch eine Atemwolke hinaus auf die gefrorene Stadt. Schwarz glitten Edinburghs Monolithen vorbei: die Burg (uralt), der Vulkan (erloschen), das Finanzviertel (angeschlagen). Eine ganze Welt war unter einer Eiskuppel zum Stillstand gekommen. Tote Eltern. Tote Großeltern. Zwei tote Kinder hinter kaltes Glas gepresst. Kein Wunder, dass ihre Mutter morbid war, wenn das ihr einziges Vermächtnis darstellte. Das Taxi bog in die grauen Straßen von New Town ein und hoppelte beim Beschleunigen über das vereiste Kopfsteinpflaster.
»Übrigens«, diesmal stach Barbara mit ihrem Krückstock in Margarets Wade, »ist sie nicht verheiratet. War es nie.«
»Wer?«
»Mrs. Maclure natürlich.«
»Warum ist sie dann eine ›Mrs.‹?«
»So ist das eben in Edinburgh.«
Man sagt das eine, meint das andere.
Beide klammerten sich an ihren Sitzen fest, als das Taxi um eine Ecke schlitterte und das Heck in einer großen, gleitenden Kurve ausscherte.
»Ist sie schon immer beim Trauernetz dabei?«, fragte Margaret.
»Sie weiß genau, wo die Leichen im Keller liegen.« Der Scherz entlockte Barbaras Brust ein kurzes Pfeifen. »Hat mal für die Verwaltung gearbeitet. Unter anderem.« Dann sagte sie: »Hast du die Nachricht gelesen, die sie dir gegeben hat?«
»Welche Nachricht?«
Doch, da war sie. In Margarets Manteltasche, zwischen dem Coronation-Penny und einem vertrockneten Stück Mandarinenschale. Papier, von einem kleinen Block abgerissen und zweimal gefaltet. Margaret entfaltete den Zettel, als das Taxi mit einem Ruck zum Stehen kam. Die Nachricht war neben eine Telefonnummer gekritzelt.
Verlorengegangen, stand da. KÖNNEN SIE HELFEN?
1935
Sechs Jahre vergangen und das Haus war noch dasselbe, der Flur derselbe, die Tweedjacke dieselbe, nur jetzt mit Flicken, Rissen und Löchern und an allerhand Stellen abgewetzt und blankgerieben. Keine orangene kleine Sonne kam aus dem Ärmel gekullert.
Alfred Walker stampfte in einer Wolke eisiger Luft zur Haustür herein, die nackten Dielen knarrten unter seinen schweren Stiefeln. »Ist es schon passiert?«
Clementine hockte an ihrem gewohnten Platz auf der untersten Stufe der langen steilen Treppe, die Knie hochgezogen bis zum Kinn. Sie war jetzt zehn, das Weihnachtskleid lange Vergangenheit. Sie machte sich nicht die Mühe aufzustehen, schüttelte nur den Kopf, damit ihr Vater wusste, wie die Dinge standen.
Alfred seufzte und rieb sich mit einem schmutzigen Daumen über die Stirn. »Dann gehe ich mal lieber hoch.« Er umrundete seine Tochter, unternahm keinen Versuch, sie zu berühren, und stieg Stufe um Stufe nach oben, noch immer in seiner schmutzigen Jacke, mit seinem schmutzigen Hals und den schmutzigen Händen.
Clementine sah Alfred nach, die Hände nicht länger rosig, das Haar nicht länger gelockt, das Kleid grau vom vielen Waschen, darüber eine von gestopften Stellen zusammengehaltene Strickjacke. Alfreds Tritte auf den rauen Holzstufen klangen bleiern, als er und mit ihm alles, was er in den Taschen haben mochte, hinauf ins Dunkel entschwand. Clementine wartete, bis die große, gebeugte Gestalt ihres Vaters mit der Finsternis oben verschmolz. Dann stand sie auf und ging durch den Flur in die Küche, wo sie sich ganz allein an den Tisch setzte. Wenn es noch so etwas wie Magie gab, hatte sie sich vor Jahren verflüchtigt. Davon abgesehen glaubte die zehnjährige Clementine nicht an solche Dinge. Nicht mehr.
Oben stand Alfred am Fuß des breiten Doppelbettes, knackte mit seinen schmutzigen Knöcheln und knibbelte mit den Zähnen an seinen schmutzigen Fingernägeln.
»Darf ich mal«, sagte Mrs. Sprat und schob sich mit Lappen und Schüssel an ihm vorbei.
»Entschuldigung«, sagte Alfred, in dessen Daumen sich dunkle Schmutzrillen gegraben hatten, und wich ein Stück zur Seite.
»Entschuldigung.« Wieder schob sich die Hebamme an ihm vorbei, und das Wasser in der Schüssel schwankte wie ein Betrunkener, rosa Schlieren setzten sich am Rand ab. Mrs. Sprat roch den Whisky, den Alfred ausdünstete. Wahrscheinlich konnten den selbst noch die Nachbarn riechen, dachte sie.
Dorothea lag im Bett, ihr Leib fleckig und feucht. Ihr Haar wirr und verfilzt. Ihr Atem rau. Aus ihrem Inneren sickerte der Geruch von Fleisch, das zu lange draußen gelegen hat. Alfred starrte auf den geschwollenen Bauch seiner Frau, der sich hoch über einem Meer aus schmutzigen Laken wölbte. Ihre Füße, an den Knöcheln aufgedunsen, pressten sich gegen die Holzstangen. Ihre Oberschenkel waren innen blutverschmiert. Und sie gab wieder diese Laute von sich. Ein kehliges, drängendes Ächzen.
Zwischen Dorotheas Beinen erschien kurz etwas glitschiges Schwarzes, verschwand dann wieder. Sie stöhnte, das lange, tiefe Stöhnen einer Frau, die seit zwei Tagen in den Wehen liegt. Die Hebamme schob Alfred mit einem scharfen Stoß ihres Ellbogens zur Seite. Er trat zurück. Mach, dass es ein Junge ist, dachte er. Alles käme in Ordnung, wenn es bloß ein Sohn wäre.
Unten trieb sich Clementine zwischen den Schachteln und Gläsern in der Speisekammer herum. Sie mochte die Kühle des langen schmalen Raums. Steinfliesen. Gestrichene Holzregale. Ein Fliegenschrank mit Drahtgewebe in der Tür. Sie hob den Deckel von einigen der großen Gläser an. Nahm sich einen zerbrochenen Kräcker vom Boden eines Fasses. Steckte die Fingerspitze in einen Krug Sahne.
Auf dem Regal stand eine Pastete mit gewelltem Rand. Außerdem eine Schüssel mit mehligen gekochten Kartoffeln und eine Flasche Stout. Clementine stieß ein oder zwei Kartoffeln an, deren Pelle bereits geplatzt war und sich abschälte. Dann zog sie das Stout zu sich heran, entfernte den Stopfen und atmete den starken, modrigen Duft ein. Der Geruch machte Clementine ganz schwindelig im Kopf. Sie schnüffelte nochmals. Dann beugte sie sich vor und legte beide Lippen über den dicken Glasrand. Ihr Speichel rann innen am Flaschenhals hinab und trieb kurz oben auf der dunklen Flüssigkeit, bevor er versank. Stout, das wusste Clementine, war Alfreds Lieblingsgetränk. Abgesehen von Whisky natürlich. Dem Wasser des Lebens.
In der guten Stube, die sie nicht betreten durfte, ließ Clementine einen Finger über alle Oberflächen gleiten. Der Tisch, der einst poliert war. Die groben grünen Vorhänge, ganz staubig am Saum. Weihnachten fiel dieses Jahr aus. Das Baby kam zu früh. Nichts war vorbereitet. Ihre Mutter lag schon seit Tagen oben im Bett und gab dieses schreckliche Ächzen von sich, die Hebamme kam und ging und kam wieder. Die Frauen aus der Straße kamen und gingen ebenfalls. Pasteten. Kalte Kartoffeln. Flaschen mit Stout. Und irgendwo eine Papiertüte voller Mandarinen, wenn Clementine nur wüsste, wo sie suchen musste. Sie hatten noch nicht mal den alten Kinderwagen aus dem Kohlenkeller geholt, wo er ausgemustert herumlag, völlig voller Ruß.
Natürlich war Dorothea schon viel länger als zwei Tage bettlägerig. Schon seit Monaten. Mehr als einem Jahr. Trug eine Kommodenschublade voller Nachthemden auf, Baumwolle und Flanell, Rüschen an Hals und Handgelenken. Morgens vor der Schule, wenn sie mit der Haarbürste in der Hand am Bett ihrer Mutter saß, zählte Clementine mit, bürstete und bürstete und bürstete. Die Strähnen von Dorotheas Haar erhoben sich wie Spinnweben, hafteten an Clementines Strickjacke oder an ihrer Haut. Doch das war Clementine egal. Sie wartete nur darauf, dass Dorothea noch einmal ihren Namen sagte.
Den Kaminsims in der guten Stube zierte noch immer die Putte, plump, pummelig und mit rosa Wangen. Clementine stand jetzt auf den Zehenspitzen und berührte mit ihrem Finger die kleine weiße Bruchstelle, wo einst der Daumen der Putte gewesen war. Wie es wohl wäre, einen Daumen zu verlieren? Sie versteckte ihren eigenen Daumen in der Handfläche und wackelte mit den restlichen vier Fingern. Ihre Hand sah merkwürdig aus, als sie sie umdrehte. Wie ein Fehler. Als sie kleiner war, hatte sie alte Männer mit Fehlern statt Händen gesehen. Fehlende Finger und Stummel statt Daumen, manchmal fehlten auch Arme oder Beine. Kriegsverletzungen hatte ihre Mutter das genannt. Doch die Männer waren zu alt gewesen, um im Krieg zu kämpfen. Wenn möglich wechselte Clementine die Straßenseite, um ihnen aus dem Weg zu gehen.





























