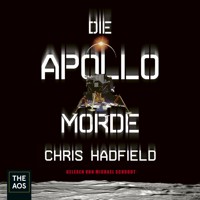
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: The AOS
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Kaz Zemeckis
- Sprache: Deutsch
»Houston, wir haben ein Problem!« Der Nr. 1 Bestseller aus Kanada von Astronaut Chris Hadfield Houston 1973. Apollo 18 startet – eine letzte, streng geheime Mission zum Mond. Auf der Mondoberfläche sollen Gesteinsproben gesammelt werden, die Unglaubliches versprechen. Doch nicht nur die US-amerikanische Crew, auch die Sowjetunion ist hinter den bislang verborgenen Schätzen des Mondes her. Der Flugleiter Kazimieras »Kaz« Zemeckis aus Houston muss alles tun, um die NASA-Crew zusammenzuhalten und gleichzeitig seinen sowjetischen Rivalen immer einen Schritt voraus zu sein. Aber nicht jeder an Bord von Apollo 18 ist ganz der, der er zu sein scheint. Es häufen sich die Anzeichen, dass einer von ihnen ein Mörder ist und Schreckliches im Sinn hat. Die Mission ist in höchster Gefahr, der Ausgang ungewiss. Voll faszinierender technischer Details – Chris Hadfield nimmt uns mit auf eine unvergessliche Reise zum Mond »Commander Hadfield nimmt uns mit auf eine spannende Reise in eine alternative Vergangenheit. Und wer könnte besser über Astronauten schreiben als ein Astronaut selbst!« Andy Weir, Autor von ›Der Marsianer‹ »Ich konnte dieses Buch nicht aus der Hand legen, bis zum fulminanten Schluss.« James Cameron
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Chris Hadfield
Die Apollo-Morde
Thriller
dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, München
Für Helene, die den farbenfrohen Tisch und wundervollen Arbeitsplatz erschaffen hat, an dem ich dieses Buch schreiben konnte. Alles für die Erfüllung unserer Träume – zusammen und in Liebe.
Viele der in diesem Buch auftretenden Personen
sind real existierende Persönlichkeiten.
Viele der in diesem Buch beschriebenen Geschehnisse
haben tatsächlich stattgefunden.
Prolog
Chesapeake Bay, 1968
Ich verlor mein linkes Auge an einem strahlenden Herbstmorgen, bei wolkenlosem Himmel.
Ich saß in einer F-4 Phantom, einem schweren, auch als die »Double Ugly« bekannten Kampfjet, dessen Bug mit Aufklärungskameras ausgerüstet worden war. Dadurch war ihre Nase nun runder, was das Verhalten der Luftströme beeinflusste. Bei einem Testflug über die Chesapeake Bay sollte ich die Geschwindigkeitssensoren neu kalibrieren.
Ich flog die Phantom wahnsinnig gerne. Sobald man den Gashebel nach vorne schob, wurde man mit enormer Kraft in den Sitz gedrückt, und ein gleichmäßiger Zug am Steuerknüppel ließ die Nase des Jets sanft in das endlose Blau hinaufsteigen. Mir kam es vor, als würde ich einen großen, geflügelten Dinosaurier steuern, und ich war immer wieder begeistert von der mühelosen Eleganz und der vollkommenen Freiheit in allen drei Dimensionen.
Heute allerdings hielt ich mich dicht über dem Wasser, um genau messen zu können, wie schnell ich flog. Indem wir die Angaben meiner Messinstrumente im Cockpit der Phantom mit den Werten der Techniker am Ufer verglichen, waren wir imstande, die Instrumente des Flugzeugs auf den neuesten Stand zu bringen und genau zu ermitteln, wie sich die neue Nasenform auswirkte.
Ich drückte den kleinen Knopf unter meinem linken Daumen und sprach direkt in meine Sauerstoffmaske: »Bereite letzten Vorbeiflug vor, 550 Knoten.«
Die Stimme des leitenden Ingenieurs drang knisternd aus dem integrierten Lautsprecher in meinem Helm: »Roger, Kaz, wir sind bereit.«
Ich drehte den Kopf, um die Markierungen zu finden, grellorange, dreieckige Fähnchen, die auf schwimmenden Pfosten im Wasser befestigt waren. Dann ließ ich die Phantom nach links rollen, wendete und brachte sie auf die richtige Bahn. Ich schob den Gashebel bis kurz vor den Nachbrenner, um die Geschwindigkeit wieder auf 550 Knoten zu bringen – neun Meilen pro Minute oder fast tausend Fuß bei jedem Ticken des Sekundenzeigers meiner Uhr.
Die Bäume am Ufer, das nun rechts von mir lag, verschwammen zu einem konturlosen Strom, als ich den Jet tief über die Bucht gleiten ließ. Ich musste in einer exakten Höhe von 50 Fuß vor den Messgeräten vorbeifliegen. Ein kurzer Blick zeigte mir eine Geschwindigkeit von 540 und eine Höhe von 75, also gab ich noch etwas mehr Gas und drückte den Steuerknüppel ein klein wenig nach vorne, bevor ich die Maschine wieder ausrichtete. Als die erste Markierung unter meiner Nase hindurchglitt, drückte ich den Knopf und sagte: »Bereit.«
»Roger.«
Gerade als ich die zweite Markierung ansteuerte, sah ich die Möwe.
Sie war nicht mehr als ein grau-weißer Fleck, befand sich aber direkt vor mir. Instinktiv wollte ich den Steuerknüppel nach vorne schieben, um ihr auszuweichen, aber bei einer Höhe von nur 50 Fuß war das keine gute Idee. Mit aller Kraft packte ich das Steuer, um es ruhig zu halten.
Die Möwe begriff, was passieren würde, und folgte dem über Jahrmillionen erworbenen Instinkt des Flugtieres: Sie ließ sich fallen, um der drohenden Gefahr zu entgehen, doch es war bereits zu spät. Ich schoss wesentlich schneller heran als jeder Vogel.
Wir kollidierten.
Die Techniker in der Messstation waren so auf ihre Anzeigen konzentriert, dass sie nichts davon mitbekamen. Vermutlich wunderten sie sich kurz, warum von mir kein zweites »Bereit« und kein »Zielpunkt« kam, als ich an der dritten Station vorbeiflog, doch dann lehnten sie sich entspannt zurück, und der leitende Ingenieur funkte mich gelassen an: »Das war der letzte Markierungspunkt, Kaz. Gut geflogen. Wir sehen uns bei der Nachbesprechung.«
Im Cockpit allerdings waren die Auswirkungen der Kollision gewaltig. Die Möwe hatte mich links oben getroffen und dabei die Acrylglaskuppel des Cockpits durchschlagen wie eine Granate. Der Wind traf mich mit einer Geschwindigkeit von 550 Meilen pro Stunde ungebremst ins Gesicht, ließ Möwengedärme und Plexiglasscherben gegen meine Brust prasseln. Erst wurde ich in den Sitz gedrückt, dann in meinen Gurten herumgeschleudert wie eine Puppe. Blind zog ich am Steuerknüppel, um an Höhe zu gewinnen und vom Wasser wegzukommen.
Mein Kopf dröhnte, es fühlte sich an, als hätte ich einen heftigen Schlag auf das linke Auge bekommen. Durch hektisches Blinzeln versuchte ich, wieder einen klaren Blick zu bekommen, konnte aber noch immer nichts sehen. Während das Flugzeug aufstieg, schob ich den Gashebel zurück und drosselte die Geschwindigkeit. Gleichzeitig lehnte ich mich vor, um dem peitschenden Wind zu entgehen, und wischte mir den Dreck aus dem Gesicht. Nachdem ich mehrmals von links nach rechts gerieben hatte, konnte ich mit dem rechten Auge zumindest den Horizont erfassen. Die Phantom rollte leicht nach rechts, noch immer steigend. Durch eine leichte Bewegung des Steuerknüppels brachte ich sie in eine stabile Lage, dann wischte ich mir noch einmal über die Augen und starrte prüfend auf meinen Handschuh. Das hellbraune Leder war mit frischem, hellrotem Blut verschmiert.
Ich wette, das ist nicht nur Möwenblut.
Schnell zerrte ich den Handschuh von meinen Fingern und tastete mein Gesicht ab. Noch immer peitschte der Wind auf mich ein. Mein rechtes Auge schien in Ordnung zu sein, aber meine linke Wange war taub und fühlte sich irgendwie zerfetzt an, außerdem konnte ich auf dem linken Auge überhaupt nichts sehen, es tat nur höllisch weh.
Die dicke, grüne Sauerstoffmaske saß noch fest über Nase und Mund, gut fixiert durch die schweren Schnallen am Unterkiefer. Doch das dunkelgrüne Visier war verschwunden, wohl abgerissen durch den Aufprall der Möwe und den Wind. Mühsam rückte ich den Helm auf meinem Kopf zurecht. Ich musste mich bemerkbar machen, und zwar schnell.
»Mayday, Mayday, Mayday!«, schrie ich und presste meinen blutigen Daumen auf den Funkknopf. »Hier spricht Phantom 665, hatte Kollision mit einem Vogel. Die Kuppel ist gebrochen.« Ich konnte nicht genug sehen, um auf eine andere Frequenz zu schalten, und hoffte einfach, dass die Techniker in ihrer Messstation mich noch hörten. Das Brüllen des Windes war so laut, dass ich keine Antwort hörte.
Indem ich abwechselnd das Blut von meinem rechten Auge wischte und den Handballen gegen das linke drückte, schaffte ich es, zumindest so viel zu sehen, dass ich weiterfliegen konnte. Durch einen Blick auf die Küstenlinie unter mir versuchte ich, mich zu orientieren. Die Mündung des Potomac zeichnete sich deutlich unter meinem linken Flügel ab, und mit diesem Orientierungspunkt nahm ich Kurs auf die Base an der Küste von Maryland, hin zur vertrauten Sicherheit der Landebahnen der Patuxent Naval Air Station.
Der Vogel hatte die Phantom an der linken Seite getroffen, ich wusste also, dass ein Teil der Trümmer in das Triebwerk an dieser Seite gesogen worden sein und es beschädigt haben könnte. Angestrengt starrte ich auf meine Instrumente – zumindest leuchteten keine gelben Warnlampen. Ein Triebwerk würde auch reichen, dachte ich mir und traf die ersten Vorbereitungen zur Landung.
Als ich mich nach links lehnte, traf der Luftstrom mit voller Wucht mein Gesicht und drückte das Blut von meinem gesunden Auge weg. Wieder schrie ich in meine Maske: »Mayday, Mayday, Mayday, Phantom 665 im Anflug für Notlandung, nehme Kurs auf Landebahn 31.« Hoffentlich hörte mich jemand und sorgte dafür, dass die anderen Jets die Bahn freimachten. Als Pax River in Sicht kam, nahm ich die Hand kurz von meinem linken Auge und drosselte die Geschwindigkeit, um das Fahrwerk ausfahren zu können. Die Fluggeschwindigkeitsanzeige war verschwommen, und so drückte ich auf gut Glück den roten Knopf, als ich der Meinung war, die Nadel sei unter 250 Knoten gefallen.
Mit dem üblichen Rattern und Zittern sanken die Räder der Phantom herab und rasteten ein. Ich streckte mich nach links und aktivierte Landeklappen und Vorflügel.
Der Wind im Cockpit hatte immer noch die Kraft eines Tornados. Ich blieb nach links gelehnt sitzen, wischte mir noch einmal das Blut aus dem rechten Auge und zog den Gashebel wieder um zwei Drittel zurück. Eine Hand weiter fest auf das blutende linke Auge gedrückt, brachte ich die Maschine in Position.
Die F-4 zeigt mit hellen, roten Lämpchen an, ob der richtige Winkel für eine Landung erreicht ist, außerdem verkündet ein beruhigendes Tonsignal, wenn die Geschwindigkeit stimmt. Während ich nun ungeschickt die letzten Handgriffe tätigte, dankte ich den Ingenieuren von McDonnell stumm für diese umsichtige Konstruktion. Da meine Tiefenwahrnehmung vollkommen hinüber war, peilte ich grob das Ende des ersten Drittels der Landebahn an und schätzte bestmöglich die Sinkgeschwindigkeit. Der Boden neben der Landebahn raste heran, und BUMM! Sobald ich unten war, schaltete ich in den Leerlauf und löste mit einem Hebel den Bremsschirm aus. Gleichzeitig versuchte ich blinzelnd, die Phantom einigermaßen mittig auf der Landebahn zu halten.
Ich zog den Steuerknüppel zwischen meine Beine, um dem Luftwiderstand dabei zu helfen, meinen siebzehn Tonnen schweren Jet abzubremsen, setzte die Radbremsen ein und versuchte, das Ende der Landebahn zu erkennen. Da es so aussah, als wäre ich viel zu schnell, bremste ich weiter ab und riss am Steuerknüppel.
Und dann war es plötzlich vorbei. Der Jet blieb mit einem Ruck stehen, Triebwerke im Leerlauf, und ich sah die gelben Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr, die mit Höchstgeschwindigkeit auf die Landebahn zusteuerten. Offenbar hatte irgendjemand meine Funksprüche gehört. Während sie kamen, wechselte ich die Hand an meinem verletzten Auge, schob den Gashebel zurück und drückte die nötigen Schalter, um die Triebwerke abzustellen.
Dann ließ ich mich in den Sitz zurückfallen und schloss mein gesundes Auge. Der Adrenalinschub ließ nach und wurde von grausamen Schmerzen abgelöst; in meiner linken Augenhöhle schien plötzlich ein Feuer zu brennen. Der Rest meines Körpers war taub, mir war übel, ich war nass geschwitzt und vollkommen erschöpft.
Die Leiter des Feuerwehrwagens schlug scheppernd gegen die Seitenwand der Phantom. Dann hörte ich die Stimme des Einsatzleiters neben mir.
»Heilige Scheiße«, sagte er nur.
Teil 1Auf zum Mond
1
Houston, Januar 1973
Flach.
So weit das Auge reichte, war alles flach.
Das Flugzeug war gerade durch die Wolken gestoßen, und die feuchte, trübe Luft von Südtexas schien die Entfernungen schrumpfen zu lassen. Kaz beugte sich vor, um einen genaueren Blick auf seinen neuen Einsatzort zu werfen. Er saß nun seit beinahe vier Stunden in der Boeing 727, und sein Nacken knackte hörbar, als er den Kopf reckte.
Unter ihm schlängelte sich eine Wasserstraße durch ein riesiges Labyrinth aus Erdölraffinerien. An ihren Ufern ragten zahllose Kräne auf. Er drückte die Stirn ans Fenster, um dem Wasser mit dem Blick zu folgen, bis es sich in der Galveston Bay verlor. Von dort aus strömte die ölig-braune Flut in den Golf von Mexiko, der durch den Smog nur verschwommen am Horizont zu erahnen war.
Nicht gerade hübsch hier.
Während sich die Maschine der Landebahn näherte, registrierte Kaz jede kleine Korrektur, die von den Piloten vorgenommen wurde. Als die Reifen dann quietschend auf dem Rollfeld des Houston Intercontinental Airport aufsetzten, fällte er ein stummes Urteil über ihre Landung: Nicht übel.
Beim Mietwagenunternehmen stand bereits sein Auto bereit. Er hievte seinen übervollen Koffer und sein Handgepäck in den Kofferraum und legte zum Schluss vorsichtig die Gitarre obenauf. »Ich habe einfach zu viel Kram«, brummte er. Da er aber nun für einige Monate hier in Houston sein würde, hatte er alles eingepackt, was er vielleicht brauchen könnte.
Kaz warf einen Blick auf seine Armbanduhr, die bereits auf die richtige Zeitzone umgestellt war: Sonntagmittag, da sollte nicht allzu viel Verkehr sein. Er stieg ein und startete den Wagen, wobei ihm der Modellname des Autos auf dem Schlüsselanhänger ins Auge sprang. Er schmunzelte. Sie hatten ihm einen silbernen Plymouth Satellite gegeben.
*
Der Unfall hatte Kaz mehr gekostet als nur ein Auge. Ohne binokulares Sichtfeld hatte er seine medizinische Freigabe als Testpilot verloren und seinen Platz unter den Astronauten, die zum MOL fliegen sollten – dem Manned Orbiting Laboratory –, einem bemannten Raumlabor im All, das laut Zielvorgabe des Militärs hauptsächlich zu Spionagezwecken dienen sollte. Seine harte Arbeit und seine Träume hatten sich in einem Haufen blutiger Federn in Luft ausgelöst.
Die Navy hatte ihm Weiterbildungsmaßnahmen ermöglicht, bis er wieder auf dem Damm war, und so hatte er ein Zusatzstudium in weltraumgestützter Elektrooptik absolviert und wurde anschließend als Analyst bei der National Security und der CIA eingesetzt. Das komplexe Aufgabengebiet hatte ihm gefallen, auch, dass er durch seine Kenntnisse die laufende Politik mitbestimmen konnte. Trotzdem hatte er mit leisem Neid beobachtet, wie ehemalige Militärpiloten mit den Apollo-Missionen ins All flogen und auf dem Mond spazieren gingen.
Und nun hatte es ihn durch das ewige Wechselspiel von Washington nach Houston verschlagen. Präsident Richard Nixon spürte den Druck des Wahljahres: Gewisse Fraktionen waren der Meinung, der Wettlauf ins All sei bereits gewonnen, und Inflation und Arbeitslosigkeit würden ansteigen. Das Verteidigungsministerium saß Nixon im Nacken, da sich der Vietnamkrieg seinem Ende näherte und keine konkrete Ausrichtung zu erkennen war, außerdem nahm man es ihm noch immer übel, dass er das MOL-Projekt gestoppt hatte. Von Seiten des militärischen Nachrichtendienstes NRO war Nixon versichert worden, die neuen Gambit-3-Keyhole-Satelliten könnten bessere Aufklärungsbilder machen als Astronauten in einer Raumstation, und das zudem billiger.
Doch Nixon war durch und durch Karrierist und fand mühelos einen vorteilhaften Mittelweg: Er schenkte der amerikanischen Öffentlichkeit eine weitere Mondmission, bezahlt aus dem enormen Budget des Verteidigungsministeriums.
Mit dem Geld des Ministeriums im Rücken wurde Apollo 18 zur ersten komplett militärischen Weltraummission erklärt, über den genaueren Zweck sollte die US Air Force entscheiden. Und da seine Erfahrungen als Testpilot, seine Ausbildung für das MOL-Programm und seine Geheimdienstarbeit in Washington ihn mit einer äußerst seltenen Kombination von Fähigkeiten ausstatteten, wurde Kaz von der Navy als Verbindungsmann zwischen Besatzung und Militär nach Texas geschickt.
Um ein Auge auf alles zu haben.
Während er nun auf der Interstate 45 Richtung Süden fuhr, war Kaz versucht, sich direkt auf den Weg zum Raumfahrtzentrum der NASA zu machen und sich dort umzusehen, doch stattdessen hielt er sich zunächst etwas weiter westlich. Bevor er Washington verlassen hatte, hatte er ein wenig herumtelefoniert und sich eine Unterkunft besorgt, die sehr vielversprechend klang, in der Nähe eines Städtchens namens Pearland. Also folgte er nun den Schildern Richtung Galveston und verließ den Highway an der Ausfahrt FM528.
Die Landschaft hier war genauso flach wie es von oben den Anschein gehabt hatte: An der zweispurigen Straße zogen sich endlose, schlammig grüne Kuhweiden entlang, nirgendwo Tankstellen, kaum Verkehr. Das Schild, an dem er abbiegen musste, war so klein, dass er es beinahe übersehen hätte: Willkommen auf der Polly Ranch.
Er fuhr die unbefestigte Straße entlang; knirschend rollten die Reifen über Kies und zerstoßene Muschelschalen. Leise rumpelnd überquerte der Plymouth ein in der Straße eingelassenes Viehgitter. Rechts und links zog sich ein rostiger Stacheldrahtzaun entlang. Weit vorne sah Kaz schließlich zwei einsame Häuser, jedes auf einer kleinen Anhöhe gelegen; vor dem näher an der Zufahrt errichteten Gebäude stand ein Pick-up. Kaz parkte in der Einfahrt des anderen Hauses, warf einen kurzen Blick in den Rückspiegel, um sicherzugehen, dass sein Glasauge richtig saß, und stieg aus. Dann streckte er sich, dehnte seinen steifen Rücken und zählte dabei bis drei. Zu viele Jahre auf schlecht gepolsterten Schleudersitzen hatten ihre Spuren hinterlassen.
Die beiden Häuser waren recht neu, im Ranchstil erbaute Bungalows mit merkwürdig hohen und breiten Garagen. Kaz ließ den Blick nach rechts und links schweifen – die Piste verlief bestimmt einen Kilometer lang vollkommen gerade. Perfekt.
Er ging auf das Haus mit dem Pick-up zu und stieg gerade die Stufen zur Veranda hinauf, als sich die Vordertür öffnete. Ein muskulöser, gedrungener Mann in einem blassgrünen Golfshirt, Bluejeans und spitzen braunen Stiefeln kam heraus. Die ersten Altersspuren im Gesicht und die grauen, militärisch kurz geschnittenen Haare verrieten, dass er wohl in seinen Fünfzigern angekommen war. Das musste sein Vermieter Frank Thompson sein, der ihm am Telefon bereits verraten hatte, dass er Avenger-Pilot im Pazifik gewesen war und jetzt für Continental Airlines flog.
»Sind Sie Kaz Zemeckis?«
Kaz nickte.
»Ich bin Frank«, stellte sich der Mann vor und streckte die Hand aus. »Willkommen auf der Polly Ranch! Hast du gut hergefunden?« Nachdem die Identität geklärt war, ging er quasi automatisch zum Du über.
Kaz schüttelte ihm die Hand. »Ja, danke. Deine Wegbeschreibung war prima.«
»Warte kurz.« Frank verschwand wieder im Haus und kam wenig später mit einem bronzefarbenen Schlüssel zurück. Dann verließ er die Veranda und ging über den Rasen zwischen den beiden Häusern, der noch ziemlich neu zu sein schien. Er schloss die Tür zu dem anderen Bungalow auf, trat einen Schritt zurück, überreichte Kaz den Schlüssel und ließ ihm den Vortritt. Wohnzimmer, Essbereich und Küche waren durch eine unverbaute Decke mit leichten Dachschrägen verbunden. Die Böden waren mit Terracotta gefliest, es gab vorne wie hinten viele Fenster, und die Wände waren mit dunklem Holz verkleidet. Links führte ein kleiner Flur zu den Schlafzimmern. Es hing noch der Geruch von Holzlack in der Luft. Das Haus war komplett eingerichtet und bot alles, was er brauchte. Es gefiel Kaz auf Anhieb, was er Frank auch sagte.
»Dann kommen wir nun zum besten Raum des Hauses«, beschloss Frank. Er ging ans andere Ende des Wohnzimmers, öffnete eine große Holztür und drückte auf einen Lichtschalter.
Die beiden Männer traten in einen voll ausgestatteten Hangar hinaus: fünfzehn Meter breit, achtzehn Meter lang, mit einer Deckenhöhe von über vier Metern. An Vorder- und Rückseite war er durch Rolltore verschlossen, Neonröhren leuchteten an der Decke, und der Boden bestand aus vollkommen ebenem Beton. In der Mitte der Halle stand eine makellose, orange-weiße Cessna 170B, perfekt ausbalanciert auf ihren beiden freistehenden Vorderrädern und dem Spornrad.
»Das ist eine wunderschöne Maschine, Frank. Und du bist dir sicher, dass du mich damit fliegen lassen willst?«
»Bei deinem Hintergrund? Absolut. Sollen wir sie uns einmal ansehen?«
Eine Frage, die man nur mit Ja beantworten konnte.
Nachdem Frank auf Knopfdruck die Rolltore geöffnet und Kaz seinen Mietwagen in den Hangar gefahren und an der Seite abgestellt hatte, schoben sie die Cessna auf die Straße hinaus.
Anschließend unternahmen die beiden einen schnellen Walk-around: Kaz überprüfte das Öl und ließ etwas Treibstoff durch einen transparenten Schlauch laufen, um ihn auf Wasser zu überprüfen. Dann entsorgte er das aufgefangene Benzin. Danach stiegen sie ins Cockpit, und Frank erklärte ihm die kurze Checkliste, wie man den Motor startete, Druck- und Temperaturanzeige und die übrigen Instrumente. Kaz ließ die Maschine bis zu der Baumgruppe am Ende der Straße rollen. Einmal die linke Bremse angetippt, ein wenig Schub, und schon wendete das Flugzeug und wandte sich der langen, schmalen Piste zu. Kaz überprüfte die Zündmagneten und zog fragend eine Augenbraue hoch. Frank nickte. Sanft schob Kaz den Gashebel bis zum Anschlag, wobei er die Anzeigen genau im Auge behielt. Seine Füße tanzten über die Pedale der Seitenruder, sodass er die Maschine genau in der Mitte des sechs Meter breiten Betonstreifens hielt. Dabei drehte er seinen Oberkörper immer wieder von rechts nach links, um mit seinem gesunden Auge beide Seiten der Startbahn im Blick zu behalten. Indem er das Steuerhorn nach vorne schob, hob er das Heck der Maschine an, dann zog er es sanft wieder zurück. Bei einer Geschwindigkeit von 55 Meilen pro Stunde hob die Cessna mühelos vom Boden ab. Sie flogen.
»Wohin?«, fragte er laut, um das Motorengeräusch zu übertönen. Frank zeigte nach rechts vorne, also flog Kaz eine Kurve in östlicher Richtung, weg von den beiden Häusern. Er folgte dem Zubringer zurück zur Interstate 45 und entdeckte schließlich zum zweiten Mal an diesem Tag den bräunlichen Schimmer der Galveston Bay am Horizont.
»Dort drüben liegt dein künftiger Arbeitsplatz!«, rief Frank und zeigte nach links. Kaz blickte durch das Seitenfenster und sah zum ersten Mal das Raumfahrtzentrum der NASA vor sich – Heimat des Apollo-Programms, Ausbildungsstätte der Astronauten und Missionskontrollzentrum. Es war wesentlich größer, als er gedacht hatte. Mehrere hundert Hektar freies Land erstreckten sich in westlicher Richtung, es gab Dutzende Gebäude, in Weiß und hellem Blau gehalten, umgeben von großzügigen Parkflächen, die jetzt am Wochenende beinahe leer waren. In der Mitte des Areals lag eine langgezogene, parkähnliche Grünfläche mit runden Brunnen und Fußwegen, die alle Gebäude miteinander verbanden.
»Sieht aus wie ein College-Campus«, rief er Frank zu.
»Sie haben es extra so entworfen, damit sie es der Rice University überlassen können, wenn sie mit den Mondmissionen durch sind«, erklärte Frank.
Immer schön langsam, dachte sich Kaz. Wenn er seinen Job ordentlich machte und Apollo 18 gut lief, schaffte es die Air Force vielleicht, Nixon auch noch zu Apollo 19 zu überreden.
*
Kaz schaltete in den Leerlauf und unterbrach die Treibstoffzufuhr, woraufhin der Motor der Cessna hustend erstarb. Der hölzerne Propeller wurde vorne plötzlich wieder sichtbar. Überlaut schien das Klicken der Schalter durch das Cockpit zu hallen, als Kaz die Elektronik abstellte.
»Hübsche Maschine, Frank«, sagte er.
»Du fliegst sie besser als ich. Die Piste ist ziemlich schmal, und bei dir sah das vollkommen mühelos aus, schon beim ersten Versuch. Ich bin froh, wenn sie öfter in die Luft kommt; ich selbst bin einfach viel zu selten da. Ist besser für den Motor.«
Frank zeigte Kaz den Treibstofftank an der Seite des Hangars, dann zogen sie gemeinsam den langen Schlauch in die Halle und füllten die Flügeltanks auf. Neben der Tür hing ein Klemmbrett, auf dem Kaz Datum, Flugzeit und Treibstoffverbrauch eintrug. Schließlich betrachteten die beiden Männer das reglose Flugzeug und gaben sich einem stillen Moment der Freude hin – der Freude am Fliegen. Seit er Pilot geworden war, hatte Kaz das Gefühl, einen Ort erst wirklich erfassen zu können, wenn er ihn aus der Luft gesehen hatte, quasi als lebendige Landkarte. Die dritte Dimension schien ein entscheidendes Puzzleteil hinzuzufügen, das ihm ein intuitives Gefühl für die Proportionen ermöglichte.
»Dann richte dich erst mal ein«, riet ihm Frank, bevor er zurück zu seinem Haus ging. Kaz ließ das Rolltor herunter und holte sein Gepäck aus dem Wagen.
Er schleifte den schweren Koffer den L-förmigen Flur entlang und stemmte ihn im Schlafzimmer auf das Bett. Kingsize, wie er zufrieden feststellte. Links davon war ein geräumiges Badezimmer angeschlossen.
Mit dem merkwürdigen Gefühl, in ein Hotel eingecheckt zu haben, öffnete er den überfüllten Koffer und verstaute seine Sachen. Seine beiden Anzüge – einer grau, einer schwarz – und das karierte Sportsakko hängte er in den Schrank. Es folgten sechs Anzughemden, alle weiß oder hellblau, Hosen und zwei Krawatten. Ein paar Lederschuhe, ein paar Turnschuhe. Freizeitkleidung und Sportsachen wanderten in die Kommode, genau wie Socken und Unterwäsche. Zwei Romane und sein Reisewecker fanden einen Platz auf dem Nachttisch. Rasierzeug und die Tasche mit den Pflegemitteln für sein Glasauge stellte er ins Bad.
Nun waren nur noch sein ausgebleichter orangefarbener Fliegeroverall von der Navy und ein Paar Lederstiefel im Koffer. Kurz berührte er den schwarz-weißen Aufnäher an der Schulter des Anzugs: ein grinsender Totenschädel mit gekreuzten Knochen. Es war das Zeichen der Jolly Rogers, der Jagdstaffel 84, der er angehört hatte, als er auf dem Flugzeugträger USS Independence F-4 geflogen war. Direkt darunter war das wesentlich formellere Wappen der U.S. Navy Test Pilot School aufgenäht, die er als Jahrgangsbester abgeschlossen hatte. Mit dem Daumen rieb er über seine goldene Pilotenschwinge, das Flugzeugführerabzeichen der Streitkräfte. Ein hart verdientes Rangabzeichen, an dem er sich stets aufs Neue maß. Dann nahm er den Anzug aus dem Koffer, hängte ihn auf einen Bügel und verstaute ihn im Schrank, gefolgt von den geschnürten Fliegerstiefeln, die er darunter auf den Boden stellte.
*
Er wurde vom Rasseln des Weckers aus dem Schlaf gerissen. Sein Glasauge fühlte sich rau an, als er in das Licht des frühen Morgens blinzelte. Sein erster Tag an der Golfküste von Texas.
Kaz stemmte sich hoch und tappte über die kühlen Fliesen ins Bad. Dort erleichterte er sich und warf anschließend einen prüfenden Blick in den Spiegel: 1,80 m groß, 78 kg schwer (muss eine Waage kaufen), dunkelbraunes Haar, helle Haut. Seine Eltern waren litauische Juden, die aufgrund der wachsenden Bedrohung durch die Nazis nach New York ausgewandert waren. Kaz war damals noch ein Kleinkind gewesen. Er hatte die hohe Stirn, die großen Ohren und den breiten Kiefer seines Vaters geerbt, sogar das kleine Grübchen am Kinn. Markante dunkle Brauen lenkten den Blick auf seine leuchtend blauen Augen – eines echt, das andere künstlich. Bei der Farbgebung hatte der Augenprothetiker einen wirklich guten Job gemacht. Kaz beugte sich vor und drückte an seiner linken Wange herum. Ja, die Narben waren noch da, aber bereits stark verblasst. Der plastische Chirurg hatte mehrere Eingriffe gebraucht (fünf? sechs?), doch es war ihm gelungen, Augenhöhle und Wangenknochen beinahe perfekt anzugleichen.
Gut genug für einen Job bei der Regierung.
Routiniert vollzog Kaz sein Morgenritual, das aus fünf Minuten Stretching, Sit-ups, Rückenstrecken und Push-ups bestand. Er forderte seine Muskeln, bis sie anfingen zu protestieren.
Gut gelockert ging er unter die Dusche, rasierte sich, putzte seine Zähne. Dann kramte er in seinem Augenpflegebeutel, holte ein kleines Fläschchen heraus und tropfte ein wenig künstliche Tränenflüssigkeit auf das Glasauge. Nach mehrfachem Blinzeln blickte ihn sein gesundes Auge mit einer weit überdurchschnittlichen Sehschärfe an.
Das hatte sie damals beim Auswahlverfahren für die Luftwaffe beeindruckt: Augen wie ein Falke.
2
NASA Raumfahrtzentrum
»Houston, wir haben ein Elektronikproblem im LM.« Apollo-Lunarmodulpilot Luke Hemming berichtete in ruhigem Tonfall von der gerade aufgetretenen Krise.
»Roger, Luke, wir sehen es uns an.« Die Stimme des Verbindungssprechers, der in Gebäude 30 des Raumfahrtzentrums bei der Flugkontrolle saß, war von ebenso viel leidenschaftsloser Dringlichkeit geprägt wie die des Piloten.
Die grellrote Warnleuchte auf Lukes Instrumententafel war direkt neben dem Fenster angebracht, wo er sie während der anstehenden Mondlandung keinesfalls übersehen konnte. Nun drückte er darauf, um den Alarm abzuschalten, und aktivierte ihn anschließend sofort wieder für den Fall weiterer Ausfälle. Mehrere andere bunte Lämpchen auf der Tafel leuchteten weiter.
»Was siehst du, Luke?« Kommandant Tom Hoffman beugte sich vor, um sich einen Überblick zu verschaffen. Das Cockpit war so eng, dass sich ihre Schultern berührten.
»Ich denke, einer der Spannungssensoren ist kaputt«, vermutete Luke. »Die Voltanzeige ist fast bei null, aber Ampere sehen gut aus.« Tom blickte an ihm vorbei auf die Anzeigen und nickte.
Ihre Mikrofone waren an, der Verbindungssprecher – Funkname CAPCOM – hatte also mitgehört. »Roger, Luke. Sehen wir auch so. Ihr könnt mit der Aktivierung fortfahren.«
Also erweckten Tom und Luke ihre Mondlandefähre nach und nach zum Leben, wobei ihnen die Tatsache zugutekam, dass während der 240.000 Meilen weiten und drei Tage langen Reise zwischen Erde und Mond relativ wenig zu tun war.
Luke zog einen Stift aus der Tasche an seiner Schulter und machte einen kurzen Vermerk auf dem Notizblock, den er vor sich an das Instrumentenbrett geklemmt hatte. Er hielt alle auftretenden Fehler fest; nur mithilfe einer solchen Liste konnte er den Überblick behalten, vor allem wenn gleich mehrere Systeme versagten. Die Explosion von Apollo 13 hatte wieder einmal gezeigt, wie komplex der Aufbau eines Raumschiffes war und wie leicht etwas schiefgehen konnte.
Tom checkte seine handgeschriebene Liste. »Also, ich habe hier ein verklebtes Kabinendruckventil, eine falsch konfigurierte Sicherung, einen Ausfall der Biotelemetrie und jetzt noch den kaputten Spannungssensor. Ich denke, wir können trotzdem mit dem vollständigen Flugplan weitermachen. Stimmt ihr zu, Houston?«
»Roger, Bulldog. Wir behalten die Spannungswerte im Auge und werden euch später vermutlich ein paar Anweisungen dazu geben. Ihr bereitet weiter TLI und Landung vor.« Es war Luke gewesen, ein Captain des Marine Corps, der das kompakte kleine Raumschiff auf den Namen »Bulldog« getauft hatte – nach dem langjährigen Maskottchen der Marines.
Tom und Luke gingen weiter die Checkliste für den Eintritt und die Landung durch, dann deaktivierten sie das LM, verließen es durch den Verbindungstunnel und schlossen die Luke hinter sich.
Michael Esdale begrüßte sie mit einem breiten Grinsen von seinem Pilotensitz im Kommandomodul aus. Er würde um den Mond kreisen, während Tom und Luke auf der Oberfläche landeten. »Ich hatte euch zwei schon fast aufgegeben«, meinte er. »Aber dann habe ich ein paar Snacks vorbereitet, falls ihr nach der anstrengenden Schalterdrückerei Hunger habt.« Tom schob sich an Michael vorbei auf seinen Sitz auf der linken Seite, während Luke rechts von Michael Platz nahm.
»Was macht Pursuit?«, wollte Tom wissen.
»Läuft wie ein Uhrwerk«, versicherte Michael. Der ausgebildete Testpilot der Navy hatte dem Kommandomodul seinen Namen gegeben. Als erster schwarzer Astronaut hatte er beschlossen, die schwarzen Kampfpiloten des Zweiten Weltkriegs zu ehren: die Tuskegee Airmen und ihre Einheit, die 99th Pursuit Squadron.
»Deine Snacks sind ziemlich … schlicht«, stellte Luke fest, bevor er sich einen Cracker mit einem Scheibchen Käse in den Mund schob.
»Das ist die NASA-Version von Toast Hawaii«, behauptete Michael. »Willst du es mit einem Schluck Tang runterspülen?« Auch wenn die Werbung etwas anderes behauptete: Die Limonade war seit dem Gemini-Programm Mitte der Sechzigerjahre nicht mehr im All getrunken worden. Damals hatte einer der Astronauten aufgrund von Raumkrankheit sein Tang wieder erbrochen und später berichtet, auf dem Weg raus schmecke es noch übler als auf dem Weg rein.
Tom drückte den Sendeknopf für den Funk. »Was kommt jetzt, Houston?«
»Ihr könnt eine Viertelstunde Pinkelpause machen, während wir den Simulator neu starten. Wir machen dann mit der Vorbereitungssequenz für den Eintritt in die Mondbahn weiter.«
»Klingt gut.« Tom drückte auf einen kleinen Knopf an seiner Armbanduhr, und die Crew von Apollo 18 kletterte aus dem Simulator.
*
Kaz, der sie über eines der vielen Kontrollpulte im Nebenraum beobachtet hatte, riss sich aus dem kurzen Tagtraum, in dem er sich vorgestellt hatte, er würde im Simulator sitzen und sich auf Apollo 18 vorbereiten. Er war schon früher mit Luke und Michael geflogen, da sie alle Testpiloten in Patuxent River gewesen waren. Bis zu seinem Unfall hatte er sie beinahe täglich gesehen und oft mit ihnen abends noch ein Bier getrunken. Und während er nun zusah, wie die Experten einen Störfall nach dem anderen erschufen – es war essenziell wichtig, dass die Crew vor dem Start lernte, was alles schiefgehen konnte und wie sie mit diesen Vorfällen umzugehen hatte –, packte ihn ein schlechtes Gewissen, da er ihnen gleich eine ziemlich unangenehme Überraschung bereiten musste.
Nach der Pause gingen Michael und Luke direkt zurück zum Simulator, Tom allerdings schaute noch kurz bei den Ausbildern im Nebenraum vorbei. Als er Kaz dort entdeckte, kam er mit einem breiten Grinsen auf ihn zu. »Sieh an, wen haben wir denn da? Kazamieras Zemeckis! Du bist ja noch hässlicher, als ich dich in Erinnerung hatte!«
Grinsend schüttelte Kaz den Kopf. Er kannte Tom zwar nicht so gut wie die beiden anderen, aber sie hatten gemeinsam die Ausbildung zum Testpiloten auf der Edwards Air Force Base in der kalifornischen Mojave-Wüste absolviert. »Schön, dich zu sehen, Tom. Ihr drei arbeitet wirklich gut zusammen.«
»Ja, langsam wird’s was. Dafür sorgen die Folterknechte hier schon.«
»Ich muss mit euch reden, wenn ihr im Simulator fertig seid.« Kaz unterbrach sich kurz, bevor er hinzufügte: »Neuigkeiten aus Washington.«
Tom runzelte irritiert die Stirn. Er mochte keine Überraschungen, vor allem nicht in seiner Funktion als Kommandant der Mission. Er sah kurz auf seine Uhr und nickte dann. »Okay. Aber jetzt muss ich wieder rein. Wir sehen uns bei der Nachbesprechung.«
*
Als Kaz den Simulator und Gebäude 5 verließ, brauchte er einen Moment, um sich zu orientieren. Vor ihm lag ein Parkplatz, rechts ein rechteckiges, neunstöckiges Gebäude. Er glich die Umgebung nun mit dem ab, was er bei dem Überflug in der Cessna gesehen hatte. Dann ging er nach rechts und überquerte den quadratischen Platz in der Mitte, um zum Missionskontrollzentrum zu gelangen.
Von außen sah das Kontrollzentrum nicht anders aus als viele andere mehrstöckige, mit Stuck verzierte Betonbauten. Die Fenster waren dunkel getönt, um die texanische Sonne abzuwehren. Er folgte dem Fußweg bis zum Eingang, wo der Architekt zumindest ansatzweise versucht hatte, die Erwartungen der Nation an ihr Raumfahrtprogramm zu erfüllen: eckige Betonklötze auf einigen postmodernen, brutalistischen Würfeln. Regierungsschick.
Kaz holte den NASA-Mitarbeiterausweis aus der Sakkotasche, den man ihm am Morgen ausgehändigt hatte. Der Portier vor den schweren silbernen Türen nahm ihn entgegen, prüfte die Gebäudezugangsberechtigung und gab ihm den Ausweis anschließend zurück.
»Willkommen bei Mission Control«, sagte er freundlich, während er auf einen Knopf drückte. Mit einem dumpfen Klappern wurde die Tür entriegelt. Wie bei einem Banktresor, dachte Kaz. Dann wollen wir doch mal sehen, welche Schätze sie hier drin verstecken.
Das Innere des Gebäudes war auf den ersten Blick ebenso enttäuschend wie das Äußere: graue Flure mit Neonbeleuchtung, praktischer Linoleumboden, an den Wänden verblasste Fotos von Erde und Mond in billigen schwarzen Rahmen. Kaz folgte den dezenten Wegweisern mit der Aufschrift MCC, um zum Kontrollraum zu gelangen. Es gab nur zwei Aufzüge, von denen einer defekt war, also nahm er die Treppe.
Oben zeigte er dem nächsten Wachmann seinen Ausweis, der nur nickte und mit dem Daumen auf die Tür hinter sich wies. Kaz drückte dagegen, musste aber mehr Kraft aufwenden als gedacht, weil die Tür unerwartet schwer war. Nachdem er hindurchgetreten war, versuchte er, sie möglichst leise zu schließen. Hier befand er sich im Herzstück der bemannten Raumfahrt, wo absolute Experten am Werk waren.
Der Raum war mit blassgrün eingefassten Arbeitsplätzen ausgefüllt, die wie in einem Theater in ansteigenden Reihen angeordnet waren. Sie alle waren auf drei große Bildschirme ausgerichtet, die sich vorne an der Wand befanden und auf denen in hellem Orange Zahlen, Akronyme und Tabellen leuchteten. Jeder der ebenfalls mit kleinen Monitoren ausgestatteten Plätze war besetzt; dichter Zigarettenrauch hing in der Luft. Die Spezialisten hier trugen Headsets mit einseitigem Kopfhörer, sodass sie gleichzeitig den Funk und die Gespräche im Raum verfolgen konnten. An den Wänden hingen die Embleme vergangener Raumfahrtprogramme, bis zurück zu Gemini 4.
Kaz sah eine Weile zu, wie das Flugüberwachungsteam mit der Apollo-18-Crew sprach, die nun wieder in Gebäude 5 an die Arbeit gegangen war. Dabei entdeckte er ein bekanntes Gesicht, wieder einen Kollegen aus seiner Zeit als Testpilot, der Kaz kurz darauf zu sich winkte. Vorsichtig schob sich Kaz durch die Reihen, um niemanden in seiner Konzentration zu stören.
Schließlich erreichte er den Arbeitsplatz des CAPCOM. Hier saß der Verbindungssprecher zwischen Astronauten und Kontrollzentrum, über den ein Großteil des Funkverkehrs lief. Er wurde von Chad Miller begrüßt, dem Reservekommandanten von Apollo 18.
»Willkommen in Houston. Warst du schon drüben bei der Crew?«, fragte er leise.
Kaz nickte. »Sie machen ihre Sache echt gut.«
Einen Moment lang sahen sie schweigend den Experten bei der Arbeit zu. Auf dem großen Bildschirm vorne in der Mitte war eine gezeichnete Grafik von Pursuit zu sehen. Das Schiff würde gleich hinter dem Mond verschwinden, weshalb Chad knapp fragte: »Tasse Kaffee?« Kaz nickte, und sie verließen so leise wie möglich den Raum.
*
Wie auch alle anderen Mannschaftsmitglieder von Apollo 18, ob nun aktiv oder in Reserve, war Chad Miller Testpilot beim Militär. Er hatte blaue Augen, hellbraunes Haar und breite Schultern, die das ordentlich in den Hosenbund geschobene himmelblaue Poloshirt problemlos ausfüllten. Der Rest seines durchtrainierten Körpers steckte in grauen Hosen mit braunem Gürtel, dazu trug er braune Slipper. Seine kräftigen Hände füllten nun den Kaffee in zwei weiße Porzellanbecher. An seinem linken Handgelenk trug er die übergroße Uhr der Air-Force-Piloten.
»Milch? Zucker?«
»Schwarz, danke.«
Chad reichte Kaz einen Becher und führte ihn dann in ein kleines Besprechungszimmer, wo sie sich entspannt an einen der Tische lehnten und sich gegenseitig auf den neuesten Stand brachten. Sie kannten sich zwar aus ihrer Zeit als Testpiloten, allerdings hatte Chad in Edwards gearbeitet und Kaz in Patuxent River, weshalb sie nie zusammen geflogen waren. Chad galt in ihrer kleinen Gemeinschaft als exzellenter Flieger, der perfekt mit Steuerknüppel und Ruder umgehen konnte, gnadenlos gegenüber jeder Form von Inkompetenz, bei sich selbst ebenso wie bei anderen. Diesen Wesenszug hatten viele Astronauten gemein, und Kaz hatte großen Respekt vor ihm – er war jemand, der die Dinge wirklich anpackte.
In einer Gesprächspause stellte Kaz ihm die Frage, die jedes Mitglied der Reservemannschaft irgendwann zu hören bekam: »Und, meinst du, du wirst fliegen?«
»Nö, Tom ist leider viel zu gesund.« Chad lachte. »Und so wie es aussieht, wird es nach der 18 keine Apollo-Missionen mehr geben. Das wäre also meine letzte Chance, einen Fuß auf den Mond zu setzen. Davon habe ich schon geträumt, als ich noch ein Kind war.«
Kaz nickte. »Ich kenne das Gefühl. Aber bei mir ist es mit sämtlichen High-Performance-Maschinen vorbei. Die Navy bevorzugt Piloten, die zwei Augen haben.«
»Klingt irgendwie logisch. Vielleicht lässt die NASA dich ja auf den Rücksitz einer T-38, während du hier bist.«
Kaz nickte zustimmend, dann blickte er kurz durch die offene Tür in den Flur hinaus, um sicherzugehen, dass sie niemand belauschte.
»Kommst du auch zur Nachbesprechung nach dem Simulatortraining?«
Chad nickte.
»Es gibt da etwas, das ich mit euch allen besprechen muss.« Kaz zögerte. »Die Russen sind fleißig gewesen.«
3
Berlin, 1957
In der Sakristei der russisch-orthodoxen Kathedrale war es kalt. Priestermönch Vater Ilarion rutschte auf seinem Sitz herum und zog die Robe an seinen Schultern hoch, um seinen Nacken zu wärmen. Jetzt war er dankbar dafür, am Morgen die lange Unterwäsche angezogen zu haben.
Er hatte sich auf einen hohen Hocker gesetzt, um die lückenhaften Unterlagen der US-Armee zu studieren – die Liste der sogenannten Wolfskinder: deutsche Waisen, die nach dem Krieg von amerikanischen Soldaten adoptiert worden waren.
Schon der Prozess, der nötig gewesen war, um an diese Kopie der Liste zu gelangen, hatte selbst die Geduld eines Priestermönchs auf eine harte Probe gestellt. Mehr als ein Jahr lang hatte er sich mit der Bürokratie des fremden Militärs und unzähligen Vertraulichkeitsklauseln herumschlagen müssen. Ilarion hatte insgesamt neun Briefe verfasst, die alle von einem des Englischen mächtigen Lektors der Kathedrale sorgfältig übersetzt worden waren. Zweimal war er persönlich bei dem ökumenischen Kleriker in der US-Botschaft in Berlin vorstellig geworden. Das Ganze wurde noch durch die Tatsache verkompliziert, dass es den Amerikanern offenbar ziemlich peinlich war, dass ihre Soldaten im Rahmen der Eroberung in Deutschland Tausende uneheliche Kinder gezeugt hatten. Und da die Spannungen zwischen Amerika und der Sowjetunion in Berlin stetig zunahmen, wurde alles immer schwieriger.
Nun war die Liste endlich in der Post gewesen. Doch als er mit wild klopfendem Herzen den Umschlag mit dem Wappen der amerikanischen Regierung geöffnet hatte, war er bitter enttäuscht gewesen. Die persönlichen Daten der Adoptivfamilien waren geschwärzt worden. Nun nahm er einen Schluck von seinem Tee, während er mit dem Daumen langsam von Zeile zu Zeile sprang, Seite um Seite. Sorgfältig prüfte er jeden Namen, versuchte eine Spur wiederaufzunehmen, die in den langen Jahren seit 1945 komplett erkaltet war.
Jeden Morgen dankte Ilarion in seinen Gebeten für sein neues Leben als Priestermönch. Es war ein einfaches, ruhiges, stets nach innen gerichtetes Dasein, ein wahres Bollwerk, das die harte Kindheit von ihm fernhielt, die er im vom Krieg zerstörten Berlin durchlebt hatte. Wo er Zeuge der schlimmsten Grausamkeiten geworden war, die Menschen einander antun konnten. Trotzdem wurde er von den Schuldgefühlen über den Verlust seines Bruders zerfressen. Er hatte seine toten Eltern enttäuscht, weil es ihm nicht gelungen war, auf den kleinen Jungen aufzupassen. Deshalb musste er ihn unbedingt finden, ihm jede Hilfe zukommen lassen, die er vielleicht brauchte.
Seine rudimentären Englischkenntnisse reichten zumindest aus, um den Sinn der einzelnen Spalten zu erfassen: Name, Geschlecht, Alter, Haar- und Augenfarbe, Geburtsdatum, falls bekannt, Datum und Ort der Adoption. Viele der Kinder waren noch so jung gewesen, dass nur ein Vorname vermerkt war, oder auch gar kein Name. Hier war für ihn besonders hilfreich, dass vor dem Krieg nur wenige Russen in Berlin gelebt hatten, hauptsächlich Menschen, die wie seine Eltern vor den Kommunisten geflohen waren. Im Stillen dankte er ihnen dafür, dass sie ihren Söhnen traditionelle russische Namen gegeben hatten. Auf einer Liste voller »Hans« und »Wilhelm« würde es leicht werden, einen Yuri zu finden, auch wenn die Namen nicht alphabetisch geordnet waren oder nach Geburts- der Adoptionsdatum. Fast schien es, als wäre die Zusammenstellung wahllos erfolgt, ein Konglomerat aus einem willkürlichen Stapel von Adoptionsunterlagen. Vater Ilarion erkannte plötzlich, dass er keinerlei Möglichkeit hatte, herauszufinden, ob vielleicht Seiten fehlten oder manche Adoptionen gar nicht erfasst worden waren. Seufzend machte er weiter.
Als sein Daumen in der nächsten Zeile plötzlich auf dem Namen Yuri landete, kam das so überraschend, dass er erschrocken keuchte. Ungläubig huschte sein Blick über die Angaben. Könnte er das sein?
Geburtsdatum unbekannt, stand dort, geschätztes Alter des Jungen: sieben. Er war 1947 adoptiert worden, allerdings wusste Ilarion nicht, ob sich dieses Datum auf den Zeitpunkt bezog, an dem der Junge aus Berlin fortgebracht worden war, oder auf den Abschluss des behördlichen Vorgangs. Sein Bruder war Jahrgang 1935, dieses Kind war also zu jung. Trotzdem schrieb er ein ordentliches Fragezeichen neben den Eintrag.
Er fand noch einen Yuri und markierte auch ihn. Als er die Liste komplett durchgegangen war, hatte er vier mögliche Spuren, wenn auch nicht alle vielversprechend. Dann fiel ihm auf, dass er all die Kinder ausgelassen hatte, bei denen kein Name vermerkt war. Leicht gereizt begann er noch einmal von vorne und sah sich die Beschreibung aller männlichen Waisenkinder an, die rund um das Jahr 1935 geboren waren. Es kostete mehr Zeit, doch nach einer halben Stunde war der zweite Durchgang beendet. Schnell blätterte er die Liste durch und zählte dreiundzwanzig Möglichkeiten. Mahnend schüttelte er den Kopf. Nein, nicht Möglichkeiten. Kinder.
Vater Ilarion gönnte sich eine Pause, um frischen Tee zu kochen. Während sich der Kessel erhitzte, dehnte er seinen Rücken und drehte die Hüfte, um den Schmerz in seinem kürzeren Bein zu bekämpfen. Dadurch hatte er Yuri verloren – ein schwerer Unfall auf der Baustelle, wo er als Maurer gearbeitet hatte. Das Handwerk hatte er von seinem Vater gelernt. Im Krankenhaus war es nicht möglich gewesen, seinen Bruder zu benachrichtigen, und als er schließlich wieder in den Kellerraum zurückkehrte, in dem die Brüder Unterschlupf gefunden hatten, war Yuri verschwunden. Er und das einzige Bild, das sie noch von ihrer Mutter hatten, ebenso das Medaillon, das sie so geliebt hatte. Im Chaos der zerbombten Stadt hatte er ihn nicht finden können. Und nachdem er jahrelang ergebnislos die Sterberegister durchforstet hatte, war ihm plötzlich der Gedanke gekommen, dass Yuri vielleicht adoptiert worden war, woraufhin eine neue Suche begann. Er hielt die Hände dicht an den Kessel und genoss die abstrahlende Wärme. Dann drückte er die warmen Handflächen gegen seinen Oberschenkel, der noch immer schmerzte, wenn es kalt war oder ein Wetterumschwung bevorstand. Als der Teekessel anfing zu pfeifen, holte er sich einen Keks aus der Dose im Regal, goss das dampfende Wasser auf den Teebeutel und kehrte an seinen Arbeitsplatz zurück.
Nun musste er Detektiv spielen. Sein Bruder war im Herzen Berlins verloren gegangen. Das Geburtsjahr 1935 stand fest, er war damals also neun gewesen, allerdings war Yuri recht klein gewesen für sein Alter, die Behörden könnten ihn also auch auf sieben oder acht geschätzt haben. Sicher waren außerdem Augen- und Haarfarbe: blau und hellbraun.
Ihm kam ein Gedanke. Die Amerikaner schrieben fremd klingende Namen vielleicht anders, er sollte also auch nach Yuriy, Juri oder Ähnlichem suchen. Beim Gedanken an diese zusätzliche Arbeit verzog er unwillig die Lippen, musste dann aber mit einem reumütigen Lächeln an ein Glaubenszitat denken, aus dem er immer wieder Trost schöpfte: Nur wer im Herzen Leid erfahren hat, kann wahre Demut erlangen.
Mit diesem neuen Fokus ging der Priestermönch die Liste noch einmal durch. Er fand zwei gute Treffer, beide Yuris mit braunem Haar und blauen Augen, sieben potenzielle und elf eher unwahrscheinliche Kandidaten. Die Seiten mit den beiden besten Treffern hielt er sich dicht vor die Augen, las jedes Detail sorgfältig durch und machte dabei eine Entdeckung. Der Armyvertreter, der für die Schwärzung der Familiennamen zuständig gewesen war, hatte nachlässig gearbeitet. Manchmal waren die schwarzen Linien so dünn oder wackelig, dass Teile der Buchstaben sichtbar geblieben waren. Ilarion ging zum Fenster, presste die bedruckten Seiten gegen das Glas und schrieb alles ab, was er entziffern konnte.
So gelangte er zwar an zusätzliche Informationen über die Adoptiveltern, doch ohne einen englischsprachigen Helfer und einen Atlas kam er nicht weiter. Zunächst ging er aber noch die sieben Kandidaten durch, die nach den beiden Favoriten kamen, und fügte die Details in seine persönliche Auflistung ein. Der nächste Schritt bestand nun darin, den Kathedralslektor mit den guten Englischkenntnissen zu bitten, für ihn einen Brief an die russisch-orthodoxe Kirche von Amerika zu schreiben. Darin würden sie darum bitten, die Gemeinden zu kontaktieren, die den möglichen Wohnorten der auf der mitgeschickten Liste vermerkten Jungen am nächsten waren. Es bestand zumindest die Chance, dass man in den lokalen Kirchen darüber informiert war, ob jemand in der Gegend ein russisch sprechendes Waisenkind aus Deutschland adoptiert hatte. Schließlich wäre das eine Gelegenheit, ein verlorenes Schäfchen in die Herde zurückzuholen, ihm die Möglichkeit zu geben, eine Verbindung zu seinem russischen Erbe und seinem Glauben herzustellen. Die Schrecken des Krieges wiedergutzumachen.
Und eine Möglichkeit, seinen Bruder zu finden.
4
Simferopol, Ukraine, Sowjetunion, 1973
Es war keine schöne Maschine.
Sie erinnerte an eine behäbige silberne Badewanne, die schwer auf acht Speichenrädern ruhte. An der Vorderseite waren zwei wissenschaftliche Instrumente angebracht, die aussahen wie eine Kreuzung aus Strahlenkanone und Weihnachtsdekoration. Die beiden Videokameras wirkten wie die Glubschaugen eines Krustentieres.
Selbst der Name war mehr praktisch als wohlklingend: Lunochod. Mondgang. Ein typisches Beispiel für russische Ingenieurskunst, bei der praktische Aspekte das Design bestimmten. Nicht hübsch, aber hübsch stabil.
Lunochod war gerade auf dem Mond gelandet.
Während er in Gedanken die Abläufe durchging, mit denen er die Maschine über die Rampe auf die Mondoberfläche befördern musste, wischte sich Gabdulkhai Latypov – von seinen Freunden einfach Gabdul genannt – die schweißnassen Hände an der Hose ab. Dann rückte er das Anweisungsbuch auf der Konsole zurecht und ließ seine kräftigen Finger knacken. Nachdem er zweimal überprüft hatte, ob alle Kontrollleuchten grün waren, umfasste er vorsichtig das Steuergerät. Er lehnte sich nach vorne, stützte für mehr Stabilität die Unterarme auf den Arbeitstisch, fixierte mit starrem Blick den Monitor und legte los.
Ganz kurz schob er den Controller nach vorne, drückte den Knopf und ließ los. Der Controller schickte nun einen elektrischen Impuls durch die Konsole an die riesige Satellitenschüssel draußen, die direkt auf den Mond ausgerichtet war. Dieses Signal würde innerhalb von 1,25 Sekunden über 380.000 Kilometer weit durch den leeren Raum reisen, um dann auf Lunochods kleine, spitze Antenne zu treffen. Dort würde der Impuls vom Prozessor des Rovers aufgegriffen und entschlüsselt werden, um dann alle acht Räder in Bewegung zu setzen.
Lunochod bewegte sich ruckartig vorwärts, um gleich wieder stehen zu bleiben. Ein perfekt abgerichteter Hund, der auch weit weg von zu Hause noch jeden Befehl seines Herrchens ausführte.
Die beiden Kameras des Mondmobils machten ein Bild von der kargen Landschaft und schickten es fast vierhunderttausend Kilometer weit zurück zu Gabduls Satellitenschüssel in Simferopol, wo es leicht verschwommen und in Schwarz-Weiß auf seinem Monitor erschien.
Zehn Sekunden nachdem er das Steuergerät losgelassen hatte, sah Gabdul, dass Lunochod sich bewegt hatte.
»Zhivoy!«, rief er triumphierend. Es lebt! Er hörte das erleichterte und gespannte Seufzen des restlichen Teams, das um ihn herum stand.
Wieder schob Gabdul den Controller vorsichtig nach vorne, diesmal ein wenig länger, und folgte dem oft geübten Protokoll, das die Maschine auf den Mond bringen würde, wo sie sich an die Arbeit machen sollte.
*
Gabdul war in der Nähe von Simferopol aufgewachsen, auf der Halbinsel Krim. Sein dichtes schwarzes Haar, die ausgeprägten Wangenknochen und sein silbenlastiger Name mit den vielen Glottallauten verrieten noch heute, dass seine Familie von den Tataren abstammte. Als Teenager hatte er in der Abenddämmerung auf der Krim gestanden und staunend in den Himmel geblickt, wo Sputnik durch die Dunkelheit gezogen war – der sichtbare Beweis für die Überlegenheit und Kraft russischer Technologie. Und als Gagarin vier Jahre später im Weltall um die Erde kreiste, beschloss Gabdul, dass er Kosmonaut werden wollte, genau wie eine Million andere junge Russen auch.
Sobald er mit der Schule fertig war, bewarb er sich bei der sowjetischen Luftwaffe, die ihn zunächst auf die technische Universität schickte, wo er zum Luftfahrtingenieur ausgebildet wurde. Anschließend hoffte er auf die Fliegerschule. Doch seine Herkunft stand ihm immer wieder im Weg. Eigentlich hatte Gabdul gedacht, dass die Deportation von 200.000Krim-Tartaren nach Usbekistan durch Stalin nach dem Großen Vaterländischen Krieg längst nur noch ein Eintrag im Geschichtsbuch sei, doch die Bigotterie war noch tief in den Reihen des Militärs verwurzelt. Und je näher er Moskau kam, desto stärker wurde sie. Als Angehöriger einer Minderheit aus den Randgebieten der Sowjetunion wurde er zu einem Bürger zweiter Klasse in einer klassenlosen Gesellschaft.
Obwohl er sein Studium mit Bestnoten abschloss, bekamen immer die Kommilitonen mit Namen wie Ivanov und Popov die besten Aufstiegschancen. Nachdem ihm mehrmals die Pilotenausbildung verwehrt worden war, war Gabdul im Alter von fünfundzwanzig noch immer ein einfacher Leutnant der Luftstreitkräfte und arbeitete als Techniker in einer Einrichtung für Weltraumkommunikation in der Nähe von Schtscholkowo, am äußersten Rand von Moskau.
Bis ihn sein Hauptmann eines Tages während einer Zigarettenpause auf dem Gang ansprach.
»Gabdulkhai Gimad’ovich«, hatte er steif begonnen, während sie nebeneinander am Fenster standen und durch die Doppelverglasung auf den Schnee hinausblickten, der vom Wind um die massigen Satellitenschüsseln herumgewirbelt wurde. »Es wird ein neues Programm ins Leben gerufen, und dafür suchen sie geschickte junge Elektroingenieure. Alles noch streng geheim, aber anscheinend geht die Sache mit einer speziellen Zusatzausbildung und diversen Reisen einher. Hätten Sie Interesse?«
Der Hauptmann wusste bereits, wie Gabduls Antwort lauten würde.
Wenige Wochen später wurde er in die Maschinenbaufabrik OBK-52 in Moskau abberufen, zu einem ersten Gespräch und einem Eignungstest. Dort saß er mit mehreren anderen jungen Ingenieuren in einem kargen Flur und wartete darauf, dass sein Name aufgerufen wurde, während er wie alle anderen seine Nervosität hinter einer ausdruckslosen Miene verbarg. Das Gespräch verlief unkompliziert, man fragte ihn nach seinem Werdegang, seinen Interessen, seiner Familie. Gabdul betonte vor allem, wie stolz er auf den Einsatz seines Vaters in der Armee war, und dass er schon sein Leben lang davon träumte, im sowjetischen Raumfahrtprogramm dienen zu dürfen.
Die praktischen Tests waren schwieriger und teilweise verwirrend. So musste er einen Gabelstapler durch einen vorgezeichneten Parcours steuern, wobei seine Zeit gestoppt wurde. Dann wurde ein Anhänger daran befestigt, und er musste das Gespann rückwärts um eine Ecke manövrieren. Gabdul schickte einen stillen Dank an seinen Vater, der ihm das gezeigt hatte, als er ihm damals in Simferopol das Autofahren beigebracht hatte.
Dann setzte sich einer der Prüfer ans Steuer, und Gabdul musste den Gabelstapler aus der Ferne über einen Monitor überwachen und dem Fahrer per Funk Anweisungen geben. Der Test wurde bei schlechter Beleuchtung wiederholt, und schließlich bekam Gabdul das Kamerabild nur noch alle fünf Sekunden zu sehen, da der Bildschirm immer wieder mit einem Klemmbrett abgedeckt wurde. Er war sich nicht ganz sicher, was durch diesen Test bezweckt werden sollte, doch er versetzte sich einfach in die Rolle des Fahrers und sagte dann das, was er an dessen Stelle gerne gehört hätte.
Er bekam keinerlei Erklärungen. Als er schließlich ging, wurde nur noch einmal betont, dass er mit niemandem über die Sache sprechen dürfe.
Es folgte eine Woche Ungewissheit, bis der Hauptmann schließlich während seiner Schicht den Kontrollraum betrat.
»Gabdulkhai Gimad’ovich!«
»Da?«
Die anderen Ingenieure blickten auf, als Gabdul sich von seinem Platz erhob.
»Sie werden uns verlassen. Die sowjetische Luftwaffe hat in ihrer unendlichen Weisheit beschlossen, dass Sie lange genug mit Satelliten kommuniziert haben. Sie werden sich in zwei Tagen bei NPO Lawotschkin in Reutow melden.« Er sah Gabdul durchdringend an. »Man hat mir nicht gesagt, was Sie dort tun werden, es muss also von hoher Wichtigkeit sein. Sogar so wichtig«, er wühlte in seiner Hosentasche und zog zwei dunkelblaue Epauletten mit hellblauen Streifen und drei Sternen hervor, »dass Sie zum Oberleutnant befördert wurden.«
Er entfernte Gabduls ausgebleichte Schulterklappen und ersetzte sie durch die steifen neuen. Dann trat er einen Schritt zurück und erwiderte Gabduls verblüfften Gruß.
Ein breites Lächeln erschien auf dem Gesicht des Hauptmanns. Er drehte sich zu den anderen um und sagte: »Rebyata! Sto gram!« Das verlangt nach Wodka!
*
Anfangs fühlte sich Gabdul auf seinem neuen Posten allerdings nicht besonders wichtig. Als er auf dem Gelände in Reutow ankam, wurde er zusammen mit achtzehn anderen Auszubildenden von einem Parteifunktionär in Empfang genommen, der sie über die strikten Geheimhaltungsvorschriften aufklärte. Dann schickte man sie in einen Reinraum der Fabrik, wo sie Laborkittel und Kappen überziehen mussten, um anschließend den Technikern dabei zuzusehen, wie sie eine Maschine zusammenbauten, die bald zum Mond fliegen sollte. Der Parteifunktionär zeigte auf das plumpe, silbrige Ding, das beinahe so groß war wie er selbst, und erklärte seinen Zweck, seinen komplexen Aufbau und die Rolle, die sie als handverlesenes Team bei seiner Steuerung spielen würden.
Gabdul wusste nicht, was er davon halten sollte. Sein Traum von einem Flug ins All löste sich damit endgültig in Luft auf. Aber vielleicht würde es ganz cool werden, dieses Monstrum über den Mond zu steuern.
In der ersten Zigarettenpause sprach einer der anderen das aus, was wohl die meisten Auszubildenden dachten: »Wir sollen ein Spielzeugauto lenken? So hatte ich mir das nicht vorgestellt. Ich dachte, sie würden uns zu Kosmonauten machen!«
Gabdul konnte es nachfühlen, doch er registrierte auch, dass es außer ihm keine anderen Tataren in der Gruppe gab, was sicher von Bedeutung war.
Schon wenig später gaben einige enttäuscht auf. Andere scheiterten an den überraschend komplexen und anspruchsvollen Aufgaben. Und in Gabdul regte sich langsam so etwas wie Stolz. Von über 240 Millionen Sowjetbürgern wurde einzig und allein ihm und dieser kleinen Eliteeinheit diese schwierige Arbeit übertragen. Nach den wiederholten Schwierigkeiten mit der N1-Schwerlastrakete gingen die Chancen, dass ein sowjetischer Kosmonaut den Mond betreten würde, inzwischen beinahe gegen null. Aber Lunochod existierte bereits und würde bald die Reise ins All antreten. Und was noch besser war: Das neue Mondsimulationsfeld und das Missionskontrollzentrum wurden in seiner Heimatstadt Simferopol auf der Krim eingerichtet.
Das war eine einzigartige Herausforderung und eine großartige Möglichkeit, seine Familie stolz zu machen: Ein Krim-Tatar, der in seiner Heimat dem Weltraumprogramm der Sowjetunion diente.
Vielleicht würden seine Füße niemals die Mondoberfläche berühren, aber er, Gabdulkhai Latypov, Sohn des Gimatudin, würde mit acht Speichenrädern eine Menge Mondstaub aufwirbeln.
Gabdul war nun ein Mondforscher.
5
Washington D.C., 1973
Jim Schlesinger stand wie üblich kurz vor einem Wutausbruch.
Vom Fenster seines im sechsten Stock gelegenen Büros aus starrte er grimmig über den George Washington Parkway hinweg zum Little Falls Dam am Potomac River hinüber. Als frisch ernannter Direktor der Central Intelligence Agency wollte er Veränderung, und es ging ihm alles nicht schnell genug.
»Richardson!«, brüllte er, ohne sich vom Fenster abzuwenden. Schon an seinem ersten Tag hier hatte er die Sekretärin seines unfähigen Vorgängers entlassen und wartete nun ungeduldig auf ihre Nachfolgerin. Die Tür öffnete sich, und eine große, gelassen wirkende Frau mit einem Notizblock in der Hand kam herein.
»Ja, Sir?« Während ihrer achtzehn Dienstjahre bei der Agency hatte Mona Richardson unter verschiedenen Vorgesetzten schrittweise die Karriereleiter erklommen, und nun fand sie im Schnelldurchlauf heraus, wie dieser hier am besten zu handhaben war.
Der DCI drehte sich nicht einmal um. »Sehen Sie sich das an«, bellte er und reckte wütend das Kinn.
Mona trat zu ihm ans Fenster.
»Dort sollte eigentlich das Schild der Agency aufgestellt werden«, sagte er, während er hinunter auf die Straße starrte. »Warum passiert da nichts?«
»Ich habe gestern mit den Behörden von Fairfax County gesprochen, Sir, und man hat mir versichert, dass das Schild genau nach Ihren Wünschen gedruckt wurde. Es soll heute noch installiert werden. Ich werde gleich noch mal nachfragen.«
Nun richtete sich sein finsterer Blick auf sie. Er schüttelte langsam den Kopf. Sie brauchten doch ein Schild, das den Leuten zeigte, wo der Nachrichtendienst ihres Landes seinen Sitz hatte! »Bitte bringen Sie mir noch einen Kaffee.«
Mona nickte und ging leise hinaus.
Schlesinger wandte sich wieder dem Fenster zu, holte seine Pfeife aus der Tasche seines Tweedjacketts und schob sie sich zwischen die Zähne. Dann fischte er ein Feuerzeug aus der anderen Tasche, entzündete den Tabak und paffte mehrmals, bevor er den Rauch langsam durch die Nase ausstieß. Nixon hatte wie üblich recht. Diese Prätorianergarde aus altmodischen, verschworenen, Lackschuh tragenden Spionen, die man ihm hier hinterlassen hatte, war blasiert und selbstherrlich. Hier musste mal kräftig aufgeräumt werden, und er war genau der richtige Mann dafür.
Entschlossen drehte er sich zu seinem Schreibtisch um, nahm sich eine dort bereitliegende Liste und studierte sie rauchend.
Bislang hatte er 837 Leute gefeuert, vor allem im sogenannten Directorate of Plans, einer geheimen Unterabteilung der CIA. Ein Dutzend Führungskräfte hatte er persönlich rausgeschmissen und die Abteilung anschließend umbenannt in Directorate of Operations. Totholz, das weggeschnitten werden musste. Diese Leute würden Nixon nicht in den Rücken fallen. Oder der Nation.
Seine Zeit bei der RAND Corporation und im Budget Office des Weißen Hauses hatte ihm gezeigt, wie neue Technologien die Welt verändern konnten. Die Vereinigten Staaten würden den Kalten Krieg nie gewinnen, wenn sie auf veraltete Methoden setzten. Während seiner zwei Jahre als Vorsitzender der Atomenergiekommission war mehr als deutlich geworden, wie viel Macht in dieser Technologie steckte. Ein Gleichgewicht des Schreckens? Wieder schüttelte er den Kopf. Amerika brauchte etwas Besseres. Es brauchte eine CIA, die sämtliche neue Technologien ausschöpfte, um an Informationen heranzukommen, die sich keine andere Nation beschaffen konnte. Und zwar bevor es zu spät war.
Er kehrte ans Fenster zurück und sah in den blauen Himmel hinauf. Unsere Kampfjets und Aufklärungsflugzeuge können auch nicht mehr mithalten. Wir machen einfach nur das, was wir immer schon gemacht haben. Irgendjemand muss hier mal für ein ordentliches Erdbeben sorgen. Wer sich dann nicht halten kann, muss eben auf der Strecke bleiben.
Der allgemeinen Anweisung folgend, klopfte Mona zweimal und wartete dann. Als von drinnen nichts kam, betrat sie das Büro und stellte das Tablett mit dem frischen Kaffee auf dem Schreibtisch ab. Dabei warf sie Schlesinger, der noch immer nach draußen starrte, einen kurzen Seitenblick zu. Er war hochgewachsen, hatte leicht ergrautes dickes Haar, eine breite Stirn und ein kantiges Kinn. Ein attraktiver Mann. Wenn er nur nicht so ein arroganter Arsch wäre.
Ohne sie anzusehen, befahl Schlesinger: »Holen Sie mir Sam Phillips ans Telefon.«
*
Dreiundzwanzig Meilen weiter nordöstlich, im achten Stock des grauenvoll hässlichen, in der Ford Meade Army Base ansässigen Sitzes der National Security Agency, musterte General Sam Phillips gerade ein Modellflugzeug im Bücherregal seines Büros. Es war eine Lockheed P-38 Lightning, der Abfangjäger, den er während des Krieges in Deutschland geflogen hatte.
Ihr Design verblüffte ihn auch heute noch. Die beiden großen V12-Motoren mit Turbolader brachten es auf 1.600PS, innendrehend, um das Drehmoment zu minimieren. Es war ein herrliches Gefühl gewesen, den Gashebel voll durchzudrücken und sich von den riesigen Motoren schneller und schneller vorantreiben zu lassen. Einmal hatte er es auf mehr als 400 Meilen pro Stunde gebracht, als ihm die Munition ausgegangen war und er einer Me 109 entkommen musste, um es sicher zurück nach England zu schaffen.
Nicht zum ersten Mal beugte er sich vor und starrte frontal auf das Modell. Mit niemals endendem Staunen stellte er fest, dass die Maschine von vorne beinahe unsichtbar war – aus dem Blickwinkel des Windes. Kein Wunder, dass sie schnell war. Ein herrliches, zielorientiertes Stück Ingenieurskunst. Die Skunk Works von Lockheed vertraten dieselbe Ansicht wie er: Nur das Ergebnis zählt.
Sein Blick streifte das gerahmte Bild der US-Flagge auf dem Mond, das die Crew von Apollo 11 für ihn signiert hatte. Neil Armstrong hatte eine Widmung hinzugefügt: »Für General Sam Phillips mit unserem aufrichtigen Dank – ohne Sie würde diese Flagge jetzt nicht dort stehen.« Doch nun musste er wieder an die Arbeit gehen.
»Ein Anruf für Sie, General«, rief seine Sekretärin aus dem Nebenzimmer. »CIA-Direktor James Schlesinger, auf der abhörsicheren Leitung 1.« Nach kurzem Zögern fügte sie hinzu: »Sind Sie zu sprechen?«
Der hat mir gerade noch gefehlt. Phillips seufzte.
»Ja, stellen Sie ihn bitte durch, Jan.« Das beigefarbene Telefon auf seinem Schreibtisch fing an zu klingeln, und ein hektisch blinkendes Lämpchen zeigte die wartende Leitung an. Er nahm den Hörer ab und drückte auf den Knopf.
»Direktor Phillips hier.«
»Sam, wir haben einiges zu besprechen.«
»Auch dir einen guten Morgen, Jim. Wie kann ich behilflich sein?«
»Behilflich sein? Ich brauche keine Hilfe. Es geht um dieses Fiasko, das sich in Russland zusammenbraut.«
In Gedanken ging Phillips seinen aktuellen Wissensstand durch. Welches Fiasko? Was genau hatte für den neuen CIA-Direktor einen solchen Stellenwert?
Er riet einfach mal ins Blaue hinein. »Du meinst den anstehenden Start der Proton-Rakete?«





























