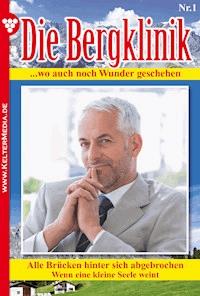
30,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blattwerk Handel GmbH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Bergklinik
- Sprache: Deutsch
Die Arztromane der Reihe Die Bergklinik schlagen eine Brücke vom gängigen Arzt- zum Heimatroman und bescheren dem Leser spannende, romantische, oft anrührende Lese-Erlebnisse. Die bestens ausgestattete Bergklinik im Werdenfelser Land ist so etwas wie ein Geheimtipp: sogar aus Garmisch und den Kliniken anderer großer Städte kommen Anfragen, ob dieser oder jener Patient überstellt werden dürfe. Keine Leseprobe vorhanden. E-Book 1: Alle Brücken hinter sich abgebrochen E-Book 2: Wenn eine kleine Seele weint
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 230
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Inhalt
Alle Brücken hinter sich abgebrochen
Wenn eine kleine Seele weint
Die Bergklinik – 1–
Die Bergklinik
Hans-Peter Lehnert
Alle Brücken hinter sich abgebrochen
Der Neubeginn des begnadeten Arztes stand unter einem schlechten Stern
Roman von Hans-Peter Lehnert
»Bitt’schön nehmen S’ Platz, gnä’ Frau!« Dr. Vinzenz Trautner wartete, bis seine Besucherin Platz genommen hatte, dann setzte er sich hinter seinen Schreibtisch. »Wer, sagten S’, hat uns empfohlen?«
Die Besucherin hieß Bettina Wagner und sie war auffallend nervös. Mit fahrigen Händen zündete sie sich zuerst eine Zigarette an, was Dr. Trautner mit einem Stirnrunzeln registrierte, dann nahm sie aus ihrer Handtasche ein Bündel Papiere und legte sie auf den Schreibtisch.
»Bitte fragen Sie mich nicht«, sagte sie, »da steht alles drinnen, was Sie wissen müssen, meine ganze Leidensgeschichte.«
»Auf wessen Empfehlung sind Sie zu uns gekommen?« Dr. Trautner zog eine schmalrandige Brille aus einem Etui, putzte ein wenig umständlich die Gläser und nahm dann die Papiere an sich.
»Ich hab’ irgendwo von der Klinik gelesen«, antwortete die elegant gekleidete und nervös den Rauch ihrer Zigarette in die Luft pustende Witwe Konsul Wagners.
»So so, irgendwo gelesen haben S’ von uns«, murmelte Dr. Trautner, dann blätterte er in der Krankengeschichte.
Dr. Trautner war nicht besonders groß, sehr schmal, wirkte fast ein wenig gebrechlich, was jedoch täuschte, denn er war ein außerordentlich vitaler Mann. Er hatte vor drei Wochen sehr zurückgezogen seinen siebzigsten Geburtstag gefeiert und er betrieb seit vielen Jahren die Bergklinik.
Die Klinik war Vinzenz Trautners Idee gewesen, ausschließlich sein Werk. Er hatte jeden Pfennig seines nicht unbeträchtlichen privaten Vermögens genommen und eine Gesellschaft gegründet, deren alleiniger Zweck das Betreiben der Klinik war. Die Klinik lag malerisch eingebettet zwischen Bergen unmittelbar an einem glasklaren Bergsee, der, wann immer es möglich war, in die verschiedenen Therapien einbezogen wurde und dessen Quellen jene heilende Wirkung hatten, die nicht zuletzt für den weit über den süddeutschen Raum hinausgehenden Ruf der Klinik sorgten.
»Sie sind aus München?« Dr. Trautner blätterte in den Krankenpapieren und sah dann Bettina Wagner fragend an. »Gibt es da keine Ärzte, die Ihnen haben weiterhelfen können?«
»Natürlich gibt es die dort«, antwortete Bettina Wagner ungehalten. Sie war noch genauso nervös wie vorher; als sie sich eine neue Zigarette anzünden wollte, schüttelte Dr. Trautner den Kopf.
»Das lassen S’ besser«, sagte er. »Bei uns in der Klinik werden keine Rauchopfer gebracht.«
»Sie wollen mir das Rauchen verbieten? Das ist noch niemand gelungen. Außerdem ist es meine Entscheidung und ich bin alt genug, um zu wissen, was ich tu.« Bettina Wagner war eine sehr elegante Erscheinung, sie hatte dunkelbraune Haare und ein sehr schön geschnittenes, sorgfältig geschminktes Gesicht. Sie hielt noch immer die Zigarette in ihren Händen, wollte sie nach wie vor anzünden und sah Dr. Trautner fragend an, als wartete sie lediglich auf seine Zustimmung.
Der stand auf, nahm das Bündel Papier und gab es Bettina Wagner. »Bitte sehr, gnädige Frau.«
»Aber Sie haben meine Krankengeschichte doch noch gar nicht gelesen.« Bettina Wagner wirkte verunsichert.
»Das wird nicht nötig sein.«
»Warum nicht?«
»Weil Sie uns wieder verlassen werden.«
»Bitte…?«
»Wenn Sie Patientin der Bergklinik sein wollen, gnädige Frau, dann werden Sie sich an ein paar Regeln halten müssen.« Dr. Trautner ging zur Tür und öffnete sie.
»Wie soll ich das verstehen?« Bettina Wagner war blaß geworden. »Von was für Regeln reden Sie?« Sie streckte die Hand mit der Zigarette aus und hielt sie Dr. Trautner entgegen. »Nur weil ich nicht aufs Rauchen verzichten möchte, lehnen Sie meinen Aufenthalt in Ihrer Klinik ab? Das darf doch nicht wahr sein.«
»Es ist ganz allein Ihre Entscheidung, gnädige Frau!« Dr. Trautner zuckte bedauernd mit den Schultern. »Sie müssen ja nicht zu uns kommen. Aber wenn Sie es wollen… wie gesagt, es gibt Regeln, die jeder hier zu beachten hat.«
»Das ist mir noch nicht passiert.« Empört nahm Bettina Wagner ihre Krankenpapiere, steckte sie in ihre Tasche, zögerte einen Augenblick, als wolle sie noch etwas sagen, dann drehte sie sich auf dem Absatz herum und verließ Dr. Trautner.
Der schloß einen Augenblick die Augen, schüttelte ganz kurz den Kopf, dann verließ auch er sein Zimmer, ging eine Treppe hinunter und betrat das Labor.
»Haben S’ die Werte von Herrn Lagemann schon?« fragte Trautner eine junge Laborassistentin.
Die ging zu einem Bildschirm, tippte ein paar Zahlen ein, und gleich darauf wurden die Laborbefunde ausgedruckt. Sie händigte sie Dr. Trautner aus, der sich bedankte und das Labor wieder verließ.
Er ging zurück in sein Zimmer, dort setzte er ein wenig umständlich wieder seine schmalrandige Brille auf, dann las er den Bericht sorgfältig durch. Zum Schluß nickte er, lächelte zufrieden, griff zum Telefon und wählte eine Nummer.
»Wissen S’, wo Herr Lagemann ist?« fragte er dann.
Als er die Auskunft bekommen hatte, steckte er die Laborbefunde in die Außentasche seines Ärztekittels, dann verließ er die Klinik und ging durch einen wunderschönen kleinen Park Richtung See, dessen Oberfläche verspielt das Sonnenlicht reflektierte.
»Sie kommen sicher, um mir mitzuteilen, daß endgültig keine Hoffnung mehr besteht.« Hans Lagemann war mittelalt, hatte jedoch bereits schütteres, dünnes Haar, war sehr blaß und wirkte äußerst bedrückt.
»Nach meinen Erkenntnissen sind Sie geheilt.« Dr. Trautner lächelte, zog den Laborbefund aus der Tasche seines Kittels und gab ihn dem Patienten. »Bitte, Sie kennen inzwischen selbst soviel davon, Ihnen muß ich die Werte nicht kommentieren.«
Lagemann nahm das Blatt Papier, seine Hände zitterten dabei ein wenig, dann kehrte er Dr. Trautner den Rücken zu und ging ein paar Schritte Richtung See.
Nach wenigen Minuten kam er zurück und sah Dr. Trautner mit einem Blick an, der seine Unsicherheit deutlich widerspiegelte.
»Das… das ist kaum zu glauben«, murmelte er.
»Ich hab’ es Ihnen aber schon angekündigt«, sagte Dr. Trautner.
»Das haben Sie allerdings.« Lagemanns Stimme klang plötzlich anders als vorher. »Und Sie meinen wirklich…?«
»Die Röntgendiagnostik, das heißt die Computertomographie hat im Grunde genommen doch gar keine andere Möglichkeit offen gelassen.« Dr. Trautner klopfte Hans Lagemann auf die Schulter. »Wenn Sie wollen, können Sie nach Hause. Sie sind geheilt. Aber Sie können gerne auch noch ein paar Tage bleiben. Sie wissen, daß wir keinen Patienten wegschicken, es sei denn, es ist dringend geboten, weil er unbedingt die Umgebung wechseln sollte. Also, es liegt bei Ihnen, ob Sie bei uns noch ein bisserl ausspannen.«
»Ich kann es noch gar nicht fassen.« Hans Lagemann schien unschlüssig zu sein. Doch dann huschte das erste Lächeln um seine Mundwinkel. Vielleicht war es sein erstes Lächeln seit Monaten, seit die Diagnose Bronchialkarzinom gestellt worden war.
»Fassen Sie es ruhig, lassen S’ sich aber Zeit dabei«, sagte Dr. Trautner. »Und heut’ abend, da lad’ ich Sie ein. Auf eine Flasche Wein. Wenn Sie wollen, dürfen S’ aber auch ein Bier trinken. Sie haben mir mal gesagt, daß Sie immer gerne ein Bier getrunken haben.«
Lagemann nickte. »Das hab’ ich allerdings gern getan. Seit sieben Monaten, seit der schrecklichen Gewißheit, hab’ ich drauf verzichtet, und jetzt sieht es so aus, als dürfte ich wieder ein wenig Hoffnung schöpfen.« Plötzlich rannen ihm ein paar Tränen übers Gesicht. »Entschuldigen Sie bitte, sonst bin ich nicht so sentimental.«
»Lassen S’ Ihren Gefühlen ruhig freien Lauf, Tränen reinigen die Seele, sagt man.« Dann klopfte Trautner seinem Patienten noch mal auf die Schulter. »Also, bis heut’ abend. Ich freu’ mich.«
*
Oberschwester Theresa hatte ihren strengen Blick aufgesetzt, und das bedeutete nichts Gutes. Sie kam aus einem der Schwesternzimmer, wo es kurz zuvor für wenige Augenblicke laut geworden war. Die Oberschwester war eine Anhängerin des klaren und, wenn es notwendig war, auch des lauten Wortes. Sie galt als streng; die Schwestern, aber auch die Patienten, fürchteten ihre kompromißlose Art, und wenn sie irgendwo im Haus auftauchte, dann verstummten sehr rasch alle Gespräche.
Als sie den Klinikgang Richtung Aufnahme ging, kam ihr ein junger Mann entgegen.
»Wo wollen Sie denn hin?« fragte sie. »Jetzt ist keine Besuchszeit. Wer hat Sie eigentlich hereingelassen?«
»Ich bin…« sagte der junge Mann.
Doch die Oberschwester schnitt ihm bereits das Wort ab. »Wer Sie sind, ist nicht wichtig. Wichtig ist, das der Tagesablauf der Klinik nicht in Unordnung gerät. Halten Sie sich also an die allgemeinen Bedingungen. Zu wem wollen Sie eigentlich?«
»Zu Herrn Trautner!«
»Wenn schon, dann zu Herrn Doktor Trautner«, sagte die Oberschwester, wobei sie das Wort Doktor über Gebühr betonte, »wir wollen doch nicht vergessen, wer wir sind.«
»Dann möchte ich also zu Herrn Doktor Trautner.«
»Ich weiß nicht, ob er in seinem Zimmer ist«, sagte die Oberschwester. »Wer sind Sie und was möchten Sie von Herrn Doktor Trautner? Falls Sie Pharmareferent sind, dann dürfen Sie gleich wieder gehen. Wir empfangen keine Vertreter, nur auf Bestellung. Sind Sie bestellt?«
»Bestellt nicht gerade«, antwortete der junge Mann, der einen sehr gepflegten Eindruck machte, einen sportlich geschnittenen Tweedanzug trug und die Oberschwester amüsiert anlächelte.
Wenn Oberschwester Theresa meinte, jemand begegne ihr nicht mit dem nötigen Respekt, dann konnte sie unangenehm werden.
»Was gibt es da zu lachen?« fragte sie. Ihre Stimme hatte an Volumen und Schärfe zugenommen. »Bitte verlassen Sie auf der Stelle die Klinik.« Dann schien sie den jungen Mann beim Arm nehmen zu wollen, um ihn zur Pforte zu dirigieren.
»Sehr verehrte gnädige Oberschwester«, sagte der junge Mann da, »bitte erlauben Sie mir, daß ich mich Ihnen vorstelle.«
»Wie kommen Sie dazu, mich mit verehrte gnädiger Oberschwester anzureden?« Theresa hatte die Augenbrauen ein wenig zusammengezogen, zum ersten Mal sah sie den jungen Mann intensiver an.
»Weil nur eine Oberschwester mit dieser Bestimmtheit vorgehen kann«, antwortete der.
»Und wer sind Sie?« fragte Theresa. »Sie wollten sich doch vorstellen?«
»Mein Name ist Stolzenbach, Clemens Stolzenbach!«
»Ja und? Sollte mich das beeindrucken…?«
»Ich glaube nicht, daß irgend etwas Sie beeindruckt, Oberschwester.«
»Da könnten Sie recht haben.« Ein ganz schmales Lächeln lag für Bruchteile von Sekunden um die Augen der Oberschwester. Ihre Stimme klang dann wesentlich freundlicher als vorher. »Also, was wollen Sie da bei uns in der Klinik, beziehungsweise von Doktor Trautner?«
»Er wartet auf mich.«
»Ich denk’, Sie sind nicht bestellt.«
»Das bin ich auch nicht, ich lasse mich nämlich nicht bestellen.«
Zum ersten Mal schien es, als falle der Oberschwester die passende Antwort nicht ein.
»Wie war noch mal ihr Name?« fragte sie schließlich.
»Clemens Stolzenbach, Professor Clemens Stolzenbach, ich bin der neue Chirurg der Bergklinik.«
Nicht viele konnten behaupten, Oberschwester Theresa einmal völlig perplex gesehen zu haben. Der junge Professor konnte es, denn die Oberschwester sah ihn in dem Moment an, als sei ihr gerade mitgeteilt worden, daß man ihre Position einer Lernschwester übertragen habe.
»Sie sind wer?« fragte sie mit ungläubig klingender Stimme. »Hab’ ich Ihren Namen richtig verstanden? Stolzenbach?«
»Professor Stolzenbach«, lautete die Antwort, »wir wollen doch nicht vergessen, wer wir sind!« Dann konnte er ein Lachen nur mühsam unterdrücken. »Wenn Sie also so freundlich sein wollen und mir zeigen würden, wo ich den Kollegen Trautner finde.«
»Selbstverständlich, Herr Professor, kommen Sie bitte.« Oberschwester Theresa zeigte den Klinikgang hinunter und blieb vor der Tür Dr. Trautners stehen. »Entschuldigen Sie bitte, daß ich Sie eben so…!«
»Danke sehr, Oberschwester«, antwortete Stolzenbach, dann klopfte er an die Tür von Dr. Trautners Zimmer.
*
Bettina Wagner hatte im Hotel Prinzregent eine Suite bekommen und ärgerte sich immer noch über die kompromißlose Art Dr. Trautners, der sie mehr oder weniger hinausgeworfen hatte. Derart brüsk war sie noch nie von jemand behandelt worden.
Bettina Wagner war sechsunddreißig Jahre alt und sie hatte vor sieben Jahren den über doppelt so alten Konsul Ludwig Wagner geheiratet. Ihre Bekannten hatten von einer Versorgungsehe gesprochen, doch Bettina Wagner hatte ihren Mann geliebt, auch wenn andere das nicht so gesehen hatten.
Konsul Wagner war vor anderthalb Jahren verstorben und hatte seiner Frau ein beträchtliches Vermögen hinterlassen. Seit dem Tod ihres Mannes kränkelte die Konsulin, wie man sie in München ein wenig spöttisch nannte, doch alle Ärzte, die sie konsultiert hatte, hatten ihr nicht helfen können.
In verschiedenen Münchener Kliniken hatte sie sich untersuchen lassen, aber Anhaltspunkte für eine ernsthafte organische Erkrankung wurden nicht gefunden.
Danach war sie in psychologischer Behandlung gewesen, doch auch der Psychologe hatte ihr nicht weiterhelfen können. Schließlich hatte man ihr die Bergklinik empfohlen. Sie hatte dann auch noch sehr Positives über die Klinik gelesen und sich vor einigen Wochen entschlossen, dort um einen Termin zu bitten.
Der Termin war ihr gewährt worden, doch das Gespräch mit diesem eingebildeten, alten Arzt war dann ganz und gar nicht nach ihrem Geschmack verlaufen. Was maßte der sich an? Wollte ihr tatsächlich das Rauchen verbieten! Das kam nicht in Frage. Sie allein entschied, was sie tat und was nicht. Es mußte noch eine Möglichkeit geben, mit einem anderen Arzt der Klinik zu sprechen, als mit diesem Doktor Trautner.
Dieser verschroben wirkende alte Mann konnte doch nicht die entscheidende Instanz sein, ob man sich in der Klinik mit ihrem Fall befaßte oder nicht.
Bettina Wagner nahm die Whiskyflasche und goß ein Glas halbvoll, schloß die Augen und trank es in einem Zug aus. Danach zündete sie sich eine Zigarette an, kramte in ihrer Handtasche und nahm dann schließlich das Schreiben der Bergklinik heraus.
Sie zog das Telefon heran, wählte die Nummer der Klinik, und als sich dort die Zentrale meldete, verlangte sie einen Arzt zu sprechen.
»Welchen Arzt möchten Sie sprechen?« wurde sie gefragt.
»Jeden, nur diesen alten Doktor Trautner nicht«, antwortete sie mit schwerer Stimme, denn es war bereits das vierte Glas Whisky gewesen, das sie an jenem Nachmittag getrunken hatte. »Welche Ärzte gibt es denn bei Ihnen?«
»Den Chef, Herrn Doktor Trautner…!«
»Den nicht!«
»Herrn Doktor Heiken«, begann die Dame an der Zentrale aufzuzählen, »Herrn Doktor Rosenberg, Herrn Professor Stolzenbach und…!«
»Moment, wie war der letzte Name…?« Bettina Wagner glaubte, sich verhört zu haben.
»Professor Stolzenbach!«
»Clemens Stolzenbach? Aus München?«
»Der Professor heißt mit Vornamen Clemens, das steht hier im Telefonverzeichnis, aber ob er aus München kommt, das weiß ich nicht.«
»Wie lange ist Professor Stolzenbach bei Ihnen in der Klinik?«
»Etwa zwei Wochen.«
»Dann möchte ich einen Termin bei ihm«, sagte Bettina Wagner. »Wann kann ich kommen?«
»Einen Moment bitte, da muß ich Sie weiterverbinden.«
Wenige Minuten später lehnte sich Bettina Wagner entspannt zurück.
Sie hatte einen Termin schon für den übernächsten Tag bekommen und sich unter dem Namen einer Freundin angemeldet. Die Sekretärin hatte ihr bestätigt, daß Professor Stolzenbach aus München sei und zuletzt im Klinikum gearbeitet habe.
»Das nenn’ ich Zufall«, murmelte Bettina Wagner, nahm abermals die Whiskyflasche, um sich erneut ein Glas einzugießen, stellte die Flasche jedoch wieder weg.
»Wenn ich mit dir rede, lieber Clemens«, murmelte sie vor sich hin, »muß ich einen klaren Kopf haben. In die Berge hast du dich also zurückgezogen. Da schau her!«
Dann begann sie, sich herzurichten, besuchte am Abend das Restaurant des Hotels, schlief den ganzen nächsten Tag, weil sie ausgeruht und gut aussehend in der Klinik erscheinen wollte, und als sie sich dann am nächsten Morgen sehr kritisch im Spiegel betrachtete, huschte ein zufriedenes Lächeln über ihr Gesicht. Wenn sie ausgeschlafen war, nahm sie es in punkto Aussehen noch mit jeder Frau ihres Alters auf, auch noch mit vielen, die wesentlich jünger waren als sie.
Später ließ sie sich ein Taxi kommen und zur Bergklinik fahren.
Der Taxifahrer war einer der Gesprächigen und plapperte drauflos. Unter anderem erzählte er, daß Dr. Trautner eine Kapazität sei, was sie kommentarlos hinnahm – was wußte schon ein Taxifahrer! Sie konzentrierte sich ganz auf die Begegnung mit Clemens Stolzenbach. Für ihn würde es sicher eine überraschende Begegnung werden, das stand fest. Wie er heute wohl aussah?
Etwas über sieben Jahre hatten sie sich nicht gesehen. Bei ihrer Hochzeitsfeier zum letzten Mal. Mit einem großen Strauß roter Rosen war er aufgetaucht und hatte ihn ihr vor allen Gästen überreicht. Ludwig hatte er keines Blickes gewürdigt. Dann war Clemens Stolzenbach aus ihrem Leben verschwunden.
Damals hatte seine Karriere gerade begonnen. Sie hatte sie verfolgt, soweit es ihr möglich war. Immer wieder berichteten die Zeitungen von seinen Erfolgen als Chirurg. Mehr als einmal war er als ganz begnadeter Chirurg bezeichnet worden.
Fünf Jahre waren sie miteinander befreundet gewesen, hatten eine sehr enge und intime Beziehung miteinander gehabt. Bis sie Ludwig Wagner begegnet war. Der hätte ihr Vater sein können, zumindest, was das Alter betraf.
Keiner hatte verstanden, daß sie sich von Clemens Stolzenbach getrennt und in Konsul Ludwig Wagner verliebt hatte. Auch nicht, daß sein Geld keinerlei Rolle bei ihrer Entscheidung gespielt haben sollte, als sie sein überraschendes Heiratsangebot ohne zu zögern annahm.
»Was willst du mit ihm?« hatte Clemens gefragt. Immer wieder hatte er wissen wollen, was Ludwig ihr geben konnte und er nicht.
Sie hatte versucht, es ihm zu erklären, doch die passenden Worte waren ihr nicht eingefallen. Dabei wäre es so einfach gewesen, das wußte sie heute. Liebe lautete das Zauberwort, es war Liebe gewesen, was sie mit Ludwig Wagner verbunden hatte, nicht mehr und nicht weniger.
Je näher das Taxi der Klinik kam, desto nervöser wurde sie. Sie wollte sich eine Zigarette anzünden, dachte an Dr. Trautner und steckte sie wieder weg.
Dann waren sie da. Sie nahm einen kleinen Kosmetikspiegel aus ihrer Handtasche, betrachtete sich kurz, steckte den Spiegel wieder ein, bezahlte den Chauffeur, stieg aus und betrat sehr selbstbewußt wirkend die Eingangshalle der Klinik.
»Ich habe einen Termin bei Professor Stolzenbach«, sagte sie zu der Dame am Empfang. Zum Glück erinnerte sie sich rechtzeitig genug daran, daß sie sich unter dem Namen Zanger angemeldet hatte, und Augenblicke später wurde sie in des Professors Ordination gebeten.
»Wenn Sie sich noch einen Augenblick gedulden wollen, gnädige Frau«, sagte die Sekretärin, »der Herr Professor ist sofort für Sie da.«
Es dauerte noch eine Viertelstunde, dann wurde die Tür geöffnet und Clemens betrat das Zimmer. Bettina Wagner meinte, ihr Herz bis zum Hals herauf schlagen zu hören, so aufgeregt war sie in dem Moment. Clemens sah sehr gut aus, besser als sie es in Erinnerung hatte. Er wirkte sportlich und äußerst kompetent.
Als er sie ansah, stutzte er einen winzigen Augenblick, dann kam er auf sie zu, küßte ihre Hand und tat so, als erkenne er sie nicht. Bettina Wagner war mehr als enttäuscht. Sie hatte seine Überraschung erleben wollen, und nun schien er sie nicht mal zu erkennen.
Doch dann wurde sie eines Besseren belehrt. Clemens bat sie, Platz zu nehmen, dann lächelte er sie an und fragte: »Seit wann heißt du Zanger? Hast du am Ende schon wieder geheiratet?«
Jetzt wußte sie nicht, ob sie sich freuen oder ärgern sollte. Immerhin, erkannt hatte er sie, aber seine abwartende, um nicht zu sagen kühle Reaktion konnte nichts anderes bedeuten, als daß er ihr nicht verziehen hatte.
»Ich… ich habe mich unter anderem Namen angemeldet«, sagte sie, »weil ich nicht sicher war, ob du mich empfangen hättest, wenn ich als Bettina Wagner gekommen wäre.«
Clemens Stolzenbach verzog keine Miene. Nach wenigen Momenten wollte er wissen, wie er ihr helfen könne. Dann fügte er hinzu: »Bist du meinetwegen hierher gekommen?«
Bettina schüttelte den Kopf. »Ich habe nicht gewußt, daß du hier bist.«
»Und dein falscher Name?«
»Erst bei der Anmeldung habe ich erfahren, daß es hier in der Klinik einen Professor Stolzenbach gibt. Ich war vor zwei Wochen schon mal hier.«
»Aha. Bei wem?«
»Doktor Trautner.«
»Und warum bist du nun bei mir?«
»Weil dieser Trautner mich nach Hause geschickt hat. Und zwar, weil ich nicht auf eine Zigarette habe verzichten wollen. Ich habe es als Unverschämtheit empfunden und bin gegangen.«
Clemens Stolzenbach schmunzelte.
»Was gibt es da zu lachen?« Bettina Wagner sah ihn fragend an.
»Kollege Trautner hat eine sehr eigene Art«, sagte Professor Stolzenbach. »Man kann damit schon mal seine Probleme haben.«
Bettina Wagner ging nicht weiter auf das Thema ein, sondern wollte wissen, warum er das Münchener Klinikum verlassen habe.
»Du hattest dort doch die allerbesten Aussichten«, sagte sie. »Die Münchener Zeitungen haben immer in den schillerndsten Farben von deiner Karriere berichtet.«
»Schillernde Farben rufen Neider auf den Plan…!«
»Und da hast du dich hierher zurückgezogen?« Bettina Wagner sah Clemens Stolzenbach ungläubig an. »Ich kann mir nicht vorstellen, daß du so einfach aufgibst. Früher hättest du es nicht getan.«
»Früher ist lange vorüber.«
Bettina Wagner lachte. »Du bist gerade mal vierzig.« Dann dachte sie nach. »Nicht mal vierzig bist du.«
»Es gab auch private Probleme«, sagte Stolzenbach daraufhin.
»Deines Chefs Töchterlein?« Bettina lächelte. »Auch das stand in der Zeitung.«
»Anscheinend hast du ja wohl die Regenbogenpresse gründlich studiert«, antwortete Clemens Stolzenbach.
»Ich habe seit meiner Heirat mit Ludwig nie mehr etwas von dir gehört.« Bettina Wagner war aufgestanden und ging zum Fenster. Dort blieb sie stehen und sah hinaus in die prachtvolle Bergkulisse. »Ich habe das sehr bedauert.«
»Ich habe bedauert, daß du mich verlassen hast«, entgegnete Stolzenbach. »Ich habe es nicht verstanden und ich bin anfangs auch nicht so ohne weiteres darüber hinweggekommen. Es hat lange gedauert, bevor ich eine neue Beziehung eingegangen bin.«
Bettina Wagner atmete tief durch. Sie ging zurück, nahm wieder Platz und sah ihren einstigen Geliebten an. »Ich… die Zeit mit dir war wunderschön. Aber als ich Ludwig kennenlernte, war sie vorüber. Ich habe Ludwig geliebt… wirklich geliebt…!«
»Du mußt dich nicht rechtfertigen«, fiel Stolzenbach ihr ins Wort. Dann räusperte er sich und zeigte auf das Bündel Papiere vor ihr auf dem Tisch. »Sind das deine Krankenpapiere? Weswegen bist du eigentlich hier?«
»Weil ich mich nicht wohl fühle«, antwortete Bettina Wagner. »Ich bin bei vielen Ärzten gewesen, auch bei einem Psychologen, weil einer deiner Kollegen die Vermutung äußerte, ich habe Ludwigs Tod nicht verkraftet, aber nach wie vor habe ich diese diffusen Schmerzen.«
»Wo…?«
»Hier!« Bettina Wagner legte die flache Hand auf die Magengegend. »Es kommt in Schüben. Manchmal bin ich tage-, ja wochenlang vollkommen schmerzfrei, dann ist es wochenlang wieder nicht zum Aushalten. Im Moment spüre ich nichts.«
»Wenn es dir recht ist«, sagte Clemens Stolzenbach, »werde ich mir deine Krankenpapiere ansehen, und dann werden wir uns weiter unterhalten. Wie kann ich dich erreichen?«
»Im Hotel Prinzregent in Mittenwald«, antwortete Bettina. »Wenn dieser Doktor Trautner nicht wäre, würde ich ja in die Klinik kommen. Aber ich habe das Gefühl, er mag mich nicht.«
»Wenn er dich erst mal näher kennt, wird er dich mögen«, sagte Stolzenbach. »Du siehst übrigens sehr gut aus, mein Kompliment. Du bist keinen Tag älter geworden.«
»Danke!« Bettina Wagner lächelte und stand auf. »Clemens…?«
»Ja?«
»Hast… hast du mir inzwischen verziehen? Ich meine, daß ich dich damals verlassen habe?«
Plötzlich sah Professor Stolzenbach ernster als vorher drein. »Ich hatte es zu akzeptieren, ob ich wollte oder nicht.«
»Das war nicht meine Frage«, sagte Bettina Wagner leise. Ihre bernsteinfarbenen Augen waren auf den jungen Chirurgieprofessor gerichtet. »Ob du mir heute verziehen hast, wollte ich wissen.«
Es dauerte eine Weile, bis Clemens Stolzenbach antwortete. »Es ist nie leicht, eine Frau, die man liebt, an einen anderen zu verlieren.«
»Was uns verband«, antwortete Bettina Wagner, »das war keine wirkliche Liebe, Clemens. Wir waren süchtig nacheinander, ja, aber wirklich geliebt haben wir uns nicht.«
»Ich kann natürlich nur für mich sprechen«, meinte Stolzenbach daraufhin. »Ich habe dich geliebt. Und du hast mich fallen gelassen. Beides sind Fakten.« Dann räusperte er sich. »Ich werde dich in deinem Hotel anrufen, wenn ich deine Unterlagen durchgearbeitet habe.«
*
»Doktor Trautner ist nicht da, Herr Professor.« Schwester Lissi zuckte bedauernd mit den Schultern. »Jeden Dienstag ist er vormittags droben am Berg bei dem Kräutersammler. Manchmal bleibt er auch den ganzen Tag bei ihm.«
»Wo ist er?« Professor Stolzenbach sah die junge, bildhübsche Schwester fragend an.
»Am Predigtstuhl«, antwortete diese, »da gibt’s einen alten Kräutersucher, den Gratlinger-Lois. Der Doktor und der Lois sind Freunde seid ihrer Kindheit, und die Freundschaft besteht noch heute.« Dann lächelte Lissi. »Der Doktor sagt oft, der Lois hätte mehr für die Gesundheit der Menschen in dieser Gegend getan als die meisten Ärzte.«
»Aha.« Professor Stolzenbach schien sich zu amüsieren. »Und wie sieht die Hilfe dieses Lois aus?«
»Ich habe es doch schon gesagt«, antwortete Schwester Lissi, »der Lois ist Kräutersammler. Daraus mischt er Tees, füllt Inhaliersäckchen ab und fertigt aus Wurzeln und Kräutern Salben, die er nach eigenen Rezepturen miteinander mischt.«
»Und Doktor Trautner?« wollte Stolzenbach wissen. »Was hat der damit zu tun?«
»Na, er holt immer was vom Lois«, antwortete die bildhübsche Schwester.
»Selbstgebraute Tees und Salben?« Clemens Stolzenbach sah die junge Schwester ungläubig an.
Die nickte. »Häufig sogar.«
»Und die wendet er dann hier in der Klinik an?«
»Sicher. Es hilft den Leuten ja.«
»Wendet Doktor Trautner sonst noch irgendwelche sogenannten Naturheilmittel an?« fragte Professor Stolzenbach.
»Ja, das Quellwasser.« Lissi Mitterer zuckte mit den Schultern. »Aber was es damit auf sich hat, das weiß ich nicht. Da müssen Sie den Doktor schon selbst fragen.«
Während Professor Stolzenbach sich bedankte und dann stirnrunzelnd davonging, stieg Dr. Trautner einen schmalen Pfad hinauf. Nach einer halben Stunde blieb er stehen und drehte sich um, um ein wenig zu verschnaufen. Dabei hatte er einen einmalig schönen Blick in die Werdenfelser Bergwelt. Im Westen ragten Waxenstein und Alpspitze in den wolkenlosen blauen Himmel, im Süden wuchs die Wettersteinwand aus dem felsigen Gestein, noch weiter südlich die schneebedeckten Spitzen der Tiroler Berge und im Osten zeichneten die Karwendelspitzen ihre steinernen Formationen gegen das Firmament.
Dr. Trautner setzte sich auf eine Felsplatte und genoß die Ruhe und die Einsamkeit. Er schätzte diese Minuten sehr und um nichts auf der Welt hätte er darauf verzichtet, einmal in der Woche auf den Predigtstuhl zu steigen, um seinen Jugendfreund Lois zu besuchen.
Alois Gratlinger war auf einem Bauernhof aufgewachsen, hatte mit Dr. Trautner die Schule besucht und Abitur gemacht, dann hatten sie sich vorübergehend aus den Augen verloren.
Als sie sich nach einigen Jahren wiedergesehen hatten, war Vinzenz Trautner Assistenzarzt in Garmisch, und der Gratlinger-Lois bewirtschaftete den Sterzenhof, den er von seinem Vater übernommen hatte.
Er war noch nicht mal fünfzig, als er den Hof seinem Sohn übergab und sich auf die Predigtstuhl-Alm zurückzog, wo er zu Beginn noch Almwirtschaft betrieb, doch im Laufe der Jahre widmete er sich immer mehr der Kräutersammelei.
Der Gratlinger-Lois mischte verschiedene Tees, deren Rezepturen er immer mehr verfeinert hatte; er stellte zuerst nur eine Salbe her, inzwischen waren es drei verschiedene, deren Mixtur er niemand verriet, die jedoch von vielen Ärzten der Gegend empfohlen wurden, und er gab Blumensamen und Kräuter in ein Sackerl, das man über heiße Dämpfe legte, um sie dann einzuatmen, denn sie halfen bei Schnupfen und Infektionen der oberen Luftwege.
Bei allem unterstützte ihn Dr. Trautner, der den Gratlinger seit Jahren auf seiner einmalig schön gelegenen Hütte auf der Predigtstuhl-Alm besuchte.
»Wo bleibst du denn heut’?« fragte der Lois, während er auf die hoch am Himmel stehende Sonne zeigte. »Ich hab’ mir schon Gedanken gemacht und gemeint, du wärst über den Ochsensteig gekommen. Das Brückerl über den Karbach drüben an der Klamm ist nämlich defekt. Einer der Bolzen hat sich gelockert, und wenn es ganz dumm geht, dann haut’s dich hinunter in die Schlucht.«
»Zuerst einmal Grüß Gott.« Dr. Trautner atmete ein paarmal tief durch, weil er ein wenig aus der Puste gekommen war, denn der letzte Teil des direkten Weges herauf auf die Alm war sehr steil und kräftezehrend.
»Grüß dich, Vinz!« Alois Gratlinger lächelte den Arzt der Bergklinik freundschaftlich an. »Bist froh, daß du dem Trubel wieder mal entkommen bist?«
»Hab’ ich dir schon gesagt, daß der neue Chirurg da ist?« Fragend sah Dr. Trautner seinen langjährigen Freund an.
Der nickte. »Ja, das hast mir gesagt. Und? Wie macht er sich? Rechtfertigt er den Ruf, der ihm vorauseilt?«
»Sein Können ist unbestritten.«
»Aber…? Das hat sich so angehört, als würdest dein Lob einschränken wollen.«
»Na ja, er ist ein junger Bursch, net einmal vierzig, und meint, er wüßt’ alles.«
»Dann bist also schon mit ihm zusammengeraten?« Alois Gratlinger verzog jetzt sein Gesicht. »Das wär’ wirklich kein gescheiter Anfang.«
»Zusammengeraten sind wir noch net«, antwortete Vinzenz Trautner, »aber er hat halt seine eigenen Vorstellungen.«
»Die hast du auch…!«





























