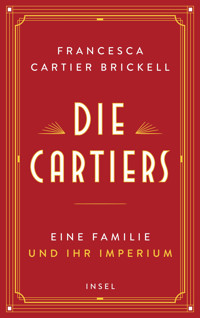
21,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 15,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Insel Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die fesselnde Geschichte von vier Generationen von Juwelieren, die hinter dem Cartier-Imperium stehen, und von drei Brüdern, die Anfang des 20. Jahrhunderts das bescheidene Juweliergeschäft ihres Großvaters in eine ikonische Luxusmarke verwandelten – erzählt von der Urgroßenkelin mit exklusivem Zugang zu einem lange verschollenen Familienarchiv.
Es begann mit einem kleinen, feinen Juwelierladen, den Louis-François Cartier 1847 in Paris gründete. Schon wenige Jahre später zählte die französische Kaiserin Eugénie zu seinen Kundinnen. Und als Prinzessin Mathilde, die Cousine von Napoleon I., 1856 bei einem ihrer Salons mit Cartier glänzte, öffnete dies dem Unternehmen das Tor zur Pariser Gesellschaft und zur internationalen Hautevolee. Anfang des 20. Jahrhunderts eröffneten die drei Enkel des Gründers Niederlassungen in London und New York. Sie machten aus Cartier eine ikonische Luxusmarke, belieferten weltweit die königlichen Höfe und versorgten die Schauspielerinnen und Mode-Diven des 20. Jahrhunderts – von Gracia Patricia, Wallis Simpson und Coco Chanel bis zu Elizabeth Taylor und Romy Schneider.
Aus vielen Mosaiksteinchen hat die Cartier-Urgroßenkelin die Geschichte ihrer Familie zusammengesetzt. Sie liest sich wie ein Gesellschaftsroman, in dem es nicht nur um sündhaft teure Schmuckstücke, sondern auch um arrangierte Ehen und heimliche Romanzen, um dynastische Intrigen und schändlichen Verrat geht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1129
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Cover
Titel
Francesca Cartier Brickell
DIE CARTIERS
Eine Familie und ihr Imperium
Aus dem Englischen von Frank Sievers
Insel Verlag
Impressum
Zur optimalen Darstellung dieses eBook wird empfohlen, in den Einstellungen Verlagsschrift auszuwählen.
Die Wiedergabe von Gestaltungselementen, Farbigkeit sowie von Trennungen und Seitenumbrüchen ist abhängig vom jeweiligen Lesegerät und kann vom Verlag nicht beeinflusst werden.
Um Fehlermeldungen auf den Lesegeräten zu vermeiden werden inaktive Hyperlinks deaktiviert.
eBook Insel Verlag Berlin 2023
Der vorliegende Text folgt der deutschsprachigen Erstausgabe, 2023
© der deutschen Ausgabe Insel Verlag Berlin 2023
Der Inhalt dieses eBooks ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Umschlaggestaltung von Rothfos & Gabler, Hamburg, unter Verwendung des Originalumschlags von Ballentine Books, Entwurf: Nick Misani
eISBN 978-3-458-77635-2
www.suhrkamp.de
Widmung
Für meinen Großvater und meine Kinder
Übersicht
Cover
Titel
Impressum
Widmung
Inhalt
Informationen zum Buch
Inhalt
Cover
Titel
Impressum
Widmung
Inhalt
Einleitung
Erster Teil Die Anfänge. (1819-1897)
1 Vater und Sohn: Louis-François und Alfred (1819-1897)
Zweiter Teil Teilen und herrschen. (1898-1919)
2 Louis (1898-1919)
Unter die Lupe genommen
3 Pierre (1902-1919)
4 Jacques (1906-1919)
Dritter Teil Wir imitieren nicht, wir kreieren. (1920-1939)
5 Steine – Paris: Anfang der 1920er Jahre
Unter die Lupe genommen
Unter die Lupe genommen
6 Moicartier – New York: Mitte der 1920er Jahre
Unter die Lupe genommen
7 Edel – London: Ende der 1920er Jahre
Unter die Lupe genommen
Unter die Lupe genommen
8 Diamanten und Depression: Die 1930er Jahre
Unter die Lupe genommen
Unter die Lupe genommen
Vierter Teil Der Zerfall. (1939-1974)
9 Die Welt im Krieg (1939-1944)
10 Cousins in entbehrungsreichen Zeiten (1945-1956)
Unter die Lupe genommen
Unter die Lupe genommen
11 Das Ende einer Ära (1957-1974)
Unter die Lupe genommen
Nachwort
Danksagung
Nachbemerkung der Autorin
Die Cartiers
Zeittafel
Anmerkungen
Bibliografie
Bildnachweis
Register
Bildteil 1
Der Cartier-Stil
Die Belle Époque
Das Jazz-Zeitalter
Bildteil 2
Jean-Jacques Cartier
Ausländische Einflüsse
Das Jahr 1930
Die Café-Gesellschaft
Welt der Veränderung
Informationen zum Buch
Die drei Cartier-Brüder mit ihrem Vater. Von links nach rechts: Pierre, Louis, Alfred und Jacques. [1]
Einleitung
Vor ein paar Jahren trafen sich vier Generationen meiner Familie im Haus meines Großvaters in Südfrankreich, um seinen 90. Geburtstag zu feiern. Während wir dort an diesem warmen Julimorgen auf der Terrasse saßen und unser übliches Urlaubsfrühstück einnahmen, frische Croissants mit Marmelade, musste ich plötzlich daran denken, was dieser wundervolle Mann am Kopfende des Tisches in seinem Leben alles durchgemacht hatte. Unvorstellbar, wie viele weltverändernde Ereignisse Jean-Jacques Cartier, Jahrgang 1919, aus nächster Nähe miterlebt hatte. Wie unzählige andere Menschen seiner Generation litt er unter der verheerenden Weltwirtschaftskrise und war als Soldat im Zweiten Weltkrieg. Er hatte mehr Jahre seines Lebens in den Goldenen Zwanzigern verbracht als im 21. Jahrhundert. Trotzdem war er an diesem Tag einfach nur mein Großvater, ein Mann mit ordentlich gekämmten weißen Haaren, Schnauzbart und lächelnden blauen Augen, der seine Geburtstagskarten las. Doch dieser Eindruck sollte sich bald ändern. Gleich würde ich eine Entdeckung machen, die mich tief in seine Vergangenheit und das Leben meiner Vorfahren führen sollte.
Nachdem wir unseren Kaffee getrunken hatten, überlegten wir in aller Ruhe, was wir heute unternehmen könnten. Wir wollten meinen Großvater an seinem Geburtstag verwöhnen, aber ihm behagte es nicht, im Mittelpunkt zu stehen. Er wollte wie immer, dass es um die anderen ging. Als wir klein waren, staunten meine Geschwister und ich immer, dass er an seinem eigenen Geburtstag lieber selbst etwas verschenkte, als Geschenke zu bekommen. Einmal stand plötzlich ein großer Sandkasten aus Holz auf seiner Terrasse, ein andermal mehrere Fahrräder, auf denen wir durch seinen Garten düsen durften. Diesmal verkündete er, er habe eine erlesene Flasche Champagner für diesen Tag aufbewahrt.
Ich bot ihm an, die Flasche zu holen, und ging nach unten in den Weinkeller. Im schummrigen Licht suchte ich die Regale ab, konnte die Flasche jedoch nicht finden, weshalb ich mich weiter im Keller umsah. Mein Großvater war bekannt dafür, niemals etwas wegzuwerfen, und so war der Raum mit den verschiedensten Dingen vollgestellt, Kartons mit Gebrauchsanweisungen für längst ausrangierte Elektrogeräte, Kisten mit alten Kleidern, die nach Mottenkugeln rochen, und unzähligen Ausgaben der Zeitschrift Horse & Hound. Nur der Champagner war nicht zu finden. Ich wollte schon aufgeben und mit leeren Händen zurückkehren, als mir ein großer Koffer auffiel, der in einer Ecke nahe der Tür stand. Darauf lagen diverse Gegenstände, bedeckt von einer dicken Staubschicht. Dass sich ausgerechnet darin der Champagner befinden sollte, war unwahrscheinlich, aber der Koffer hatte meine Neugierde geweckt.
Ich schob ein hohes, schmales Weinregal aus Metall, auf dem eine einsame Flasche Orangina vor sich hin gammelte, beiseite und bahnte mir einen Weg durch Stapel vergilbter Zeitungen aus den 1970er Jahren, bis sich mir der Reisekoffer in seiner vollen geschundenen Schönheit offenbarte. Er war schwarz mit braunen Lederriemen, trug keinerlei Beschriftung, aber an den Seiten Spuren vergangener Zeiten: verblichene Aufkleber von Pariser Bahnhöfen und exotischen Hotels aus Fernost. Ich kniete mich hin und schnallte vorsichtig die zerschlissenen Riemen auf, damit sie mir nicht gleich zwischen den Fingern zerbröselten. Und dann hob ich, ganz allein da unten im Dämmerlicht dieses Weinkellers, langsam den Deckel. In dem Koffer lagen Hunderte und Aberhunderte von Briefen. Fein säuberlich zu kleinen Bündeln geschnürt, mit verblichenen Fäden in Gelb, Rosa und Rot, auf jedem Stapel eine dicke weiße Karte mit einer Notiz in wunderschöner Handschrift.
Mein Großvater gehörte zur vierten Generation des berühmten Familienunternehmens Cartier und war der Letzte seiner Generation, der eine Filiale leitete, ehe das Unternehmen in den 1970er Jahren verkauft wurde. Der Koffer musste noch seinem Vater Jacques Cartier gehört haben. Hier, so dachte ich, während ich durch die Briefe blätterte, lag nun also die Geschichte eines Familienunternehmens verborgen, das einige der berühmtesten Juwelen der Welt für einige der berühmtesten Namen der Welt kreiert hat. Dieser Koffer würde mir ein Panorama eröffnen, das von den opulenten Bällen der Romanows über glanzvolle Krönungsfeiern bis hin zu extravaganten Festessen von Maharadschas reichen würde. Königshäuser, Designer, Künstlerinnen, Schriftsteller, Politiker, Filmstars und diverse andere Berühmtheiten würden wieder zum Leben erweckt. Ich würde König Eduard VII. von England, die russische Großfürstin Maria Pawlowna und Coco Chanel erleben ebenso wie die Herzogin von Windsor, Elizabeth Taylor, Grace Kelly und Queen Elizabeth II., die allesamt eine Rolle in der imposanten Geschichte der Familie Cartier spielten. Und was sie verband, waren die Juwelen meiner Vorfahren. Smaragde groß wie Vogeleier, unzählige Ketten aus perfekten Perlen, ein Feuerwerk an Diamanten in seltenen Farben, verwunschene Edelsteine, außergewöhnliche Saphir-Diademe und der leichteste und hellste diamantbesetzte Miederschmuck.
Aber die Briefe erzählten auch eine sehr menschliche Geschichte. Wie ich bald entdecken sollte, ging es hier nicht nur um Diamanten, Glanz und Glamour, sondern in den Bündeln waren auch Briefe heimwehkranker Kinder und besorgter Eltern. Freudige Telegramme verkündeten die Geburt eines Kindes, gramerfüllte brachten eine Todesnachricht. Ich fand Liebesbriefe, Wutschriebe und schillernde Berichte aus fremden Ländern. Aus manchen Seiten sprach die Hoffnung, aus anderen die Angst. Ein Vater bot seinem Spross Hilfe bei seinen neusten Unternehmungen an, Brüder erzählten einander per Luftpost von ihren Problemen und Erfolgen – Briefwechsel, die von unverbrüchlichen Freundschaften zeugten.
Mein Großvater hatte uns manchmal von alten Briefen erzählt, die seine Eltern ihm hinterlassen hatten, er aber nicht mehr wiederfinden konnte. Er hatte sich schon damit abgefunden, dass die Korrespondenz verloren gegangen war oder er sie bei seinem Umzug nach Frankreich versehentlich weggeschmissen hatte. Als ich ohne den versprochenen Champagner – den wir später in einem Schrank unter der Treppe entdeckten – auf die Terrasse zurückkam, konnte ich ihn mit einem Bündel ebenjener Briefe überraschen, die er für verloren hielt. Er war begeistert.
Ich liebte meinen Großvater heiß und innig. Er war großzügig wie niemand sonst, liebevoll und freundlich und brachte uns alle mit seinem unnachahmlichen Glucksen, das von seinem Bauch aus den ganzen Körper in Schwingung versetzte, zum Lachen. Hinter seiner zurückhaltenden Art hätte kaum jemand einen Mann vermutet, der jahrzehntelang ein weltberühmtes Schmuckunternehmen geleitet hatte. Am wohlsten fühlte sich dieser stille, introvertierte Mensch daheim, wo er nie von sich aus über das Geschäft sprach. Und selbst wenn wir ihn danach fragten, sang er meist nur ein Loblied auf seine Vorfahren oder die versierten Handwerker und Gestalter, die für ihn gearbeitet hatten, während er mit seinen eigenen Talenten hinterm Berg hielt. Für gewöhnlich hörte er lieber zu, statt selbst zu reden. Er wollte das Neuste über die Familie erfahren, wollte wissen, ob es allen gutging und wie er, falls dem nicht so war, helfen könnte. Jean-Jacques hatte sich kurz vor meiner Geburt nach Frankreich zurückgezogen. Jahr für Jahr stand er im Juli am Flughafen von Nizza, um uns in Empfang zu nehmen und zu seinem Haus zu fahren, wo er anfangs noch zusammen mit meiner Großmutter wohnte und später, nach ihrem Tod, allein. Jahr für Jahr stand er irgendwo unauffällig im Hintergrund, mit seiner Pfeife und Mütze als Markenzeichen, während wir schwer bepackt in die Ankunftshalle kamen. Sowie er uns sah, trat ein Lächeln auf sein Gesicht und er eilte herbei, um uns beim Tragen zu helfen und uns hinaus in die palmenbewehrte Hitze zu geleiten. Wie ich die Fahrt vom Flughafen zu seinem Haus genoss! Jetzt konnte der Sommer beginnen.
Auf der Promenade des Anglais schauten wir auf das glitzernde Meer und die fröhlichen Strandgänger zur Linken, und nach einigen Kilometern bogen wir ab, um hinauf in die Hügel zu fahren. Jean-Jacques’ schwacher Punkt war seine Lunge, genau wie bei seinem Vater, weshalb er sich einen Wohnsitz in den Bergen in frischerer Luft gesucht hatte. Nachdem wir die Küste und die Massen hinter uns gelassen hatten, wurde die Landschaft immer menschenleerer, bis wir schließlich in seinem kleinen Dorf ankamen. Wir fuhren an der Boulangerie vorbei, am Gemüseladen und dem Wagen, der Pizza aus dem Holzofen verkaufte, dann mussten wir nur noch eine scharfe Kurve nehmen und waren auf der Holperstraße, die hinauf zu seinem Haus führte, fernab der Welt. Zu beiden Seiten des Weges kauten Ziegen an langen, trockenen Grashalmen, und wie immer stand auch Thérèse Spalier, die ältere Ziegenbäuerin, die in einem wunderschönen großen Landhaus aus Naturstein wohnte, das nur winzige Fenster hatte, damit es drinnen immer kühl blieb. Noch ein paar weitere scharfe Kurven, dann standen wir vor dem weißen Tor zu unserer Sommerfrische.
Dahinter eröffnete sich uns eine wahre Oase. Als wir aus dem heißen Auto stiegen und über den hellgrauen Kies liefen, wurden wir vom Zirpen der Grillen begrüßt. Der Garten, in den Jean-Jacques seit seiner Rente viel Arbeit steckte, war im Gegensatz zur allgegenwärtigen Dürre von farbenfroher Üppigkeit. Der grüne Rasen erstreckte sich von der Terrasse in endlose Weiten, auf denen wir als Kinder unsere Rennen und später Badmintonspiele austrugen. Links davon, eine Ebene unterhalb der Terrasse, lag der Pool, gesäumt von Lavendel und Rosmarin. Und an der Böschung direkt unterhalb wuchsen Zitronen-, Clementinen- und Pampelmusenbäume. Hinter dem alten Poolhaus mit seinem von Jasmin überwucherten provenzalischen Dach führte der Blick bis hinab zur Küste. Bei klarem Wetter konnten wir die Boote auf dem Mittelmeer sehen. Am unteren Ende des Gartens standen Aprikosenbäume und Sträucher mit Johannisbeeren und Himbeeren. Und es gab auch wohlriechende, saftige Tomaten. Fürsorglich, wie er war, hatte Jean-Jacques sie für uns gepflanzt und wässerte sie bis zu unserer Ankunft jeden Abend, obwohl er selbst keine Tomaten mochte. Abends nahm der in der Mittagssonne in hellstem Blau erstrahlende Himmel ein sanftmildes Rosa an. Das war der Himmel von Matisse, Picasso und Cézanne. Meine Großeltern hatten ihre Flitterwochen in Saint-Paul-de-Vence verbracht, einem Bergstädtchen ganz in der Nähe, das lange Zeit Künstler angezogen hatte, bevor es bei den Touristen in Mode kam. Es war kein Zufall, dass sich mein Großvater diese Gegend für sein Altenteil ausgesucht hatte. Als Künstler zog es ihn zu seinesgleichen. In seinen letzten Lebensjahren, da sein Augenlicht schwächer wurde, schaute er oft zum Horizont über dem Meer. »Ich versuche, dieses Bild in meinem Kopf festzuhalten«, erklärte er mir einmal, als ich mich am Abend zu ihm auf die Terrasse setzte. »Wenn ich wirklich blind werden sollte, werde ich dieses Licht furchtbar vermissen – nicht das Licht bei Sonnenuntergang, sondern kurz davor, wenn es besonders subtil ist.« Oben im Garten hatte er sich ein Atelier eingerichtet, das für seine Zeit hochmodern war, mit Glasschiebetüren auf der einen Seite und einem großen rechteckigen Panoramafenster über seinem Pult, von dem aus er das Meer sehen konnte. Das Atelier, das voll war mit Skizzenbüchern, Zeichenpapier und dünnen schwarzen Stiften, diente ihm als kreativer Rückzugsort.
Was Jean-Jacques an seiner Arbeit bei Cartier begeistert hatte, waren nie die dicken Juwelen gewesen.1 Ihn interessierte viel mehr, originelle Entwürfe zu ersinnen und nach herausragender Handwerkskunst zu streben. Diese Philosophie bestimmte auch seinen Stil im Privaten. Er hatte jeden einzelnen Gegenstand im Haus – sei es eine kleine Bronzeskulptur, ein Ölgemälde oder ein spanischer Esstisch – seiner Schönheit halber erworben und ihm den idealen Platz zugewiesen. Überall sah man ausländische Einflüsse, von den indischen Teppichen über den chinesischen Couchtisch bis hin zu den persischen Miniaturen. In die Schmuckstücke des Familienunternehmens waren Inspirationen aus aller Welt eingeflossen und Jean-Jacques umgab sich wie sein Vater und seine Onkel gern mit eklektischer Kunst. Aber er war nicht in der Vergangenheit stecken geblieben. Der Bücherschrank aus Glas und Metall, den er für die hintere Wohnzimmerwand entworfen hatte, damit sein Vater seine Bücher unterbringen konnte, war Ausdruck seiner Philosophie des »weniger ist mehr«. Alles hatte seinen festen Platz. Trotzdem hörten wir nie auch nur die leiseste Beschwerde, wenn wir in sein Haus einfielen und alles ins Chaos stürzten. Im Gegenteil. Wenn uns aus Versehen etwas kaputt ging, fragte unser Großvater immer nur, ob uns nichts passiert sei. »Mach dir nichts draus, mein Schatz«, sagte er, wenn wir uns beschämt entschuldigten. »Hauptsache, euch geht es gut.«
Die Ferien bei Großvater waren himmlisch. Und wenn wir heimfuhren, weil die Schule wieder losging, blieben wir per Brief mit ihm in Kontakt. Überkam uns später auf dem Internat mal wieder das Heimweh, brachten uns seine Briefe mit seiner schönen Handschrift stets ein wenig Linderung. Er wusste nur zu gut, wie sich Heimweh anfühlte, und weil er so überaus einfühlsam war, konnte er es nicht ertragen, wenn andere Menschen unglücklich waren. Als Legastheniker bereitete ihm das Schreiben große Mühe, weshalb er lieber Bilder als Worte benutzte. So enthielten die schmalen Briefseiten meist Skizzen von Tieren mit lustigen Bildunterschriften, die uns zum Lachen bringen sollten.
Als wir älter waren und begriffen, dass dieser unser Großvater auch einmal ein eigenes Leben geführt hatte, fingen wir an, ihn nach seiner Vergangenheit zu fragen. Auch wenn er sonst nie von sich sprach, erzählte er uns dann manchmal ein paar Anekdoten: wie er im Buckingham-Palast eingeschlafen war, während er auf die Königsfamilie wartete, und wie ihn die Königinmutter wecken musste, was ihm zuhöchst peinlich war. Oder wie sein französisches Kavallerieregiment im Zweiten Weltkrieg mit Schwertern ausgerüstet wurde wie zu Napoleonischer Zeit, um gegen schwerbewaffnete Panzer zu kämpfen. Manchmal erwähnte er auch bestimmte Schmuckstücke, zum Beispiel einen Kosmetikkoffer, den für eine Fürstin herzustellen ihm Vergnügen bereitet hatte, oder ein Diamant-Collier, das sein Vater für einen Maharadscha angefertigt hatte. In vielen Geschichten ging es um frühere Generationen der Familie, vor allem um seinen Vater und seine zwei Onkel, jene drei Brüder, die aus Cartier das weltweit führende Schmuckunternehmen gemacht hatten.
Schon bevor ich den Stapel Briefe entdeckte, hatte ich einige Erinnerungen meines Großvaters niedergeschrieben, um sie vor dem Vergessen zu bewahren. Tatsächlich brachte mich dann jemand anderes auf die Idee, unsere Plaudereien am Mittagstisch, wenn uns unser Großvater, Baguette kauend, Einblick in die Vergangenheit gewährte, aufzuzeichnen. Als mein Mann, dessen Großeltern nicht mehr lebten, zum ersten Mal an einem unserer Familientreffen teilnahm, erkannte er, dass uns hier ein einzigartiges Fenster in eine andere Welt geöffnet wurde. Und er sorgte sich, dass diese Geschichten für immer verloren gehen würden, wenn niemand sie aufschrieb.
Durch meine Entdeckung im Weinkeller wurde aus einer zufälligen Ansammlung von Anekdoten etwas Größeres. Nachdem ich die Briefe geborgen hatte, verbrachte ich den Rest des Sommers damit, sie mit meinem Großvater durchzugehen. Meist setzten wir uns zur Teezeit in seinem Wohnzimmer zusammen. Seitdem er nach Frankreich gezogen war, vermisste er diese englische Tradition, weshalb ich mich mehr oder weniger erfolgreich daran versuchte, das Gebäck aus dem Kochbuch meiner Großmutter aus den 1970er Jahren nachzubacken. Während wir die Briefe lasen, stellte ich ihm Fragen, wenn ich etwas nicht verstand oder mehr über die Hintergründe erfahren wollte. Ich konnte sie gar nicht schnell genug verschlingen, diese Briefe, fasziniert von dieser weit ausufernden Geschichte, von der ich so wenig wusste. Er dagegen las langsamer und bedachte dankbar jedes einzelne Wort. Oft saß er einfach nur mit einem Brief in der Hand in seinem Lieblingsstuhl und sah in die Ferne.
Just am Tag vor meiner Entdeckung hatten wir wie des Öfteren zusammen einen Auktionskatalog mit Schmuckstücken durchgeblättert. Wenn mein Großvater ein interessantes altes Stück von Cartier sah, nahm er sich immer Zeit, mir zu erläutern, wie es hergestellt worden war, welche Inspirationen darin eingeflossen waren oder welche Schwierigkeiten die Kunsthandwerker bei der Fertigung gehabt hatten. An jenem Tag wies er mich auf einige Schmuckstücke mit ägyptischen Einflüssen aus den 1920er Jahren hin, die unter der Ägide seines Vaters hergestellt worden waren. Er erzählte mir, welchen Furor die Entdeckung des Grabs von Tutanchamun ausgelöst hatte und dass danach die Geschichte der Antike in Mode gekommen war. Nach meiner Entdeckung scherzten wir, die Ausgrabung des staubigen Briefstapels sei mein Tutanchamun-Moment gewesen. Er würde ein neues Licht auf die Vergangenheit werfen und die sepiafarbenen Figuren auf den Fotografien, mit denen ich groß geworden war, in farbenfrohe, lebhafte Menschen verwandeln. Und auch wenn ich es damals noch nicht wusste, sollten die Briefe meinem Leben eine neue Richtung geben. Je mehr ich las, umso weniger ertrug ich den Gedanken, dass sie einfach wieder in den Umschlag gesteckt und noch ein paar weitere Jahrzehnte an ihrer Ruhestätte verweilen sollten. Ich wollte mit meinem Großvater die komplexe Geschichte der Familie Cartier entfalten, solange er noch unter uns weilte. Denn die Briefe erzählten ja nur einen Teil davon.
Also fragte ich ihn eines Nachmittags, ob er mir erlauben würde, seine Erinnerungen aufzuzeichnen. Die gelegentlichen Erzählungen am Mittagstisch seien wunderbar, nur würde ich mir gern ein vollständigeres Bild von seinem Leben und dem Leben seiner Vorfahren machen, um womöglich eines Tages eine Geschichte der Familie Cartier schreiben zu können. Damit bat ich ihn um einen großen Gefallen. Mein Großvater war die diskreteste Person, die ich kannte, und hatte sich immer geweigert, mit Autoren oder Journalistinnen über seine Vergangenheit zu sprechen. Aber ihm war auch klar, dass seine Erinnerungen, wenn er sie als letzter Cartier seiner Generation und in seinem hohen Alter niemandem erzählte, für alle Zeit verloren wären.
Außerdem wollte er nicht, dass seine unbesungenen Helden der Vergessenheit anheimfielen. Es gab zwar zahlreiche Bücher mit prachtvollen Bildern über die Cartiers, von denen ihm einige sehr gefielen, aber sie erzählten nicht die ganze Geschichte. Manchmal ärgerte es ihn, wenn ich ihn darauf hinwies, dass seine Version der Ereignisse nicht ganz mit dem übereinstimmte, was ich irgendwo gelesen hatte. »Was in den Büchern steht, hat keinen Wert«, schnaubte er. »Ich erzähle dir, was wirklich passiert ist, denn ich war dabei!« Und weil er wollte, dass die Familiengeschichte über seinen Tod hinaus Bestand hatte, willigte er ein.
In den nächsten Monaten besuchte ich meinen Großvater regelmäßig. Meist kam ich spätabends an, da ich am Freitagabend den letzten Flug nach der Arbeit nahm. Er saß in seiner kleinen Küche an dem weißen Resopaltisch aus den 1950er Jahren und wartete schon darauf, mir all die Geschichten zu erzählen, die ihm seit meinem letzten Besuch wieder eingefallen waren. Fast kam es mir so vor, als hätte ihn mein Interesse dazu angeregt, noch einmal zurückzublicken und sich an fast vergessene Menschen und Ereignisse zu erinnern. Und um sie wieder zum Leben zu erwecken, musste er sie mir erzählen.
Das Schöne daran war, dass auch ich ihm etwas geben konnte. Er hatte keinen Computer und wusste nicht, wie er nach alten Zeitungsartikeln oder Menschen hätte suchen können, denen er vor zig Jahren begegnet war. Also kam ich mit allem, was ich gefunden hatte, zu ihm: Artikel über seinen Vater, Bücher über ehemalige Kunden, Erinnerungen von Personen, die im Familienunternehmen gearbeitet hatten. Sogar ein paar Angestellte aus der alten Londoner Filiale von Cartier machte ich ausfindig. Viele waren schon achtzig oder neunzig Jahre alt, hatten Mühe, am Telefon zu sprechen, und hätten nicht mehr damit gerechnet, noch einmal von ihrer alten Firma zu hören. Dass ich meinem Großvater erzählen würde, wie es ihnen ergangen war, und ihm ihre Wünsche überbrachte, war für alle eine große Freude.
Während er mich in die Geschichte unserer Familie einführte, konnte ich wiederum seine Erinnerungen anfachen und manchmal sogar bereichern. »Wie schön, dass wir eine Historikerin in der Familie haben«, sagte er nicht nur einmal, auch wenn ich mich selbst bis dahin nie so gesehen hatte. Nach meinem Literaturstudium in Oxford hatte ich als Finanzanalystin im Einzelhandel gearbeitet. Die langen Arbeitstage in der Londoner City waren schlecht für mein Privatleben, aber immerhin lernte ich, welche Faktoren zum Erfolg eines Unternehmens beitragen. Es ist eine Sache, Waren in herausragender Qualität herzustellen, etwas anderes aber ist es, eine internationale Marke aufzubauen, was Jahrzehnte dauern kann. Dieses Buch fand seinen Anfang in einem Bündel Briefe und in meiner Bewunderung für meinen Großvater. Doch je länger ich nach den Ursprüngen meiner Familie forschte, umso dringlicher wurde mein Wunsch, zu verstehen, wie meine Vorfahren aus einem kleinen Familienbetrieb einen der führenden Schmuckhersteller der Welt gemacht hatten. Und ich wollte wissen, warum sie ihr Unternehmen am Ende verkauften.
Während mein Großvater und ich in unseren Gesprächen immer tiefer ins Detail gingen, gewann ich allmählich ein Bild, wie das Unternehmen in den über einhundert Jahren in Familienbesitz funktioniert hatte. Er zeigte mir eine Zeitleiste, die sein Vater angefertigt hatte, als er noch ein kleiner Junge war, um ihm die Familiengeschichte näherzubringen. Er erzählte mir, wie sich sein Urgroßvater in Paris durch die Revolution gekämpft hatte, wie gewandt sein Großvater im Umgang mit Edelsteinen war und dass sein Vater und seine Onkel französische Luxusgüter lange vor dem Zeitalter der Globalisierung in alle Welt verschifften. Das Erfreulichste und Lohnendste an dieser Unternehmung jedoch war für mich, dass ich die Gelegenheit bekam, sein Leben nachzuvollziehen. An die Stelle des selbstlosen Großvaters, als den ich ihn kannte, trat ein kleiner Junge, der sich darauf freut, dass ihm seine Eltern zum Einschlafen eine Geschichte vorlesen, dann ein mutiger Soldat oder ein junger Mann, der den Tod seines geliebten Vaters betrauert, und schließlich ein aufgeregter Firmenchef, der ein Unternehmen übernimmt, ohne sich schon dafür bereit zu fühlen.
Durch den Fund der Briefe und die Tage mit meinem Großvater wurde ein neues Licht auf unsere Familie geworfen. Doch all das war in vieler Hinsicht erst der Anfang. Denn auch wenn ich seine Version der Geschichte nie in Zweifel zog, ist mir natürlich bewusst, dass sich niemand vollständig an die Vergangenheit erinnern kann. Selbst die Briefe aus dem Weinkeller erzählen nur einen Teil der Geschichte. Deshalb habe ich an allen Ecken und Enden der Welt nach Quellen gesucht, um eine möglichst umfängliche Darstellung der Geschehnisse geben zu können.
Während ich Stein um Stein umdrehte und dabei immer mehr unerwartete Fakten aufdeckte, änderte sich mein Verständnis von der Geschichte meiner Familie und ich ging Aspekten nach, denen ich nie zuvor Beachtung geschenkt hatte.
In den hintersten Winkeln der Welt, von St. Louis bis Tokio, spürte ich spannende Familienarchive auf. Ich fuhr nach London, Paris und New York, suchte Adressen auf, die ich irgendwelchen krakeligen Handschriften auf vergilbten Briefumschlägen entnommen hatte, und stellte mir vor, wie es damals, in einem anderen Zeitalter wohl gewesen sein mochte, in diesen herrschaftlichen Gebäuden zu wohnen. Ich folgte den Spuren meines Urgroßvaters durch fernöstliche Länder, besichtigte dieselben Saphirminen, schlief in denselben Gebäuden, lief barfuß durch dieselben Tempel und traf mich mit den Nachfahren der Menschen, die er gekannt hatte, von indischen Maharadschas über Perlenscheiche aus dem Persischen Golf bis hin zu srilankischen Edelsteinhändlern und amerikanischen Erbinnen. Ich verbrachte zig Stunden auf der Suche nach hundert Jahre alten Geburts-, Todes- und Heiratsurkunden, in denen ich nach Hinweisen auf das Leben längst verstorbener Menschen fahndete. Und ich hatte das Glück, einige bemerkenswerte Menschen kennenzulernen, von der neunzigjährigen Verkäuferin, die mich zum Mittagessen einlud und mir mit Freude erstaunliche Geschichten erzählte, bis hin zum Londoner Designer, der mich mit Victoria Sponge Cake und Berichten über exzentrische Kundenwünsche und legendäre Kronjuwelen verwöhnte.
Dieses Buch hat nicht den Anspruch, die offizielle oder endgültige Geschichte des Familienunternehmens Cartier zu erzählen. Mir ist bewusst, dass damit noch längst nicht alles ans Licht gebracht ist. Ich erzähle hier schlicht und einfach eine menschliche Geschichte, die auf persönlichen Erinnerungen, umfassenden Briefwechseln und Quellenmaterial basiert, das ich in mühevoller Arbeit zusammengetragen habe. Und als unabhängige Darstellung der Familie und ihres Unternehmens endet dieser Bericht im Jahr 1974, als Cartier die letzte Filiale verkaufte.
Leider ist mein Großvater vor einigen Jahren verstorben. Wir waren uns durch die Gespräche in seinen letzten Lebensjahren sehr nahegekommen, weshalb mich sein Tod erschütterte und ich mir lange Zeit die Aufnahmen unserer Unterhaltungen nicht anhören konnte. Ich dachte, es wäre komisch, seine Stimme auf Band zu hören, während er nicht mehr unter uns weilte. Doch dann stellte sich heraus, dass es mir ein ungeheurer Trost war und sich für mich anfühlte, als wäre er immer noch da. Ich muss noch oft an ihn denken: wenn auf einer Auktion ein Schmuckstück auftaucht, von dem er mir erzählt hat, wenn ich die Briefe lese, die er mir überlassen hat, oder den Stapel in meinem Haus sehe – und wenn das Licht am Himmel von Südfrankreich kurz vor Sonnenuntergang sein sanftmildes Rosa annimmt. Kurz vor seinem Tod, über hundert Jahre nachdem sich die drei Cartier-Brüder das Versprechen gegeben hatten, ein weltweit führendes Schmuckunternehmen aufzubauen, versprach ich meinem Großvater, die Geschichte der Familie Cartier so genau wie möglich nachzuerzählen. Dieses Buch ist der Versuch, mein Versprechen einzulösen.
Erster Teil
Die Anfänge
(1819-1897)
Ich muss dir nicht sagen, wie sehr ich mich danach sehne, dass du zurückkommst. Du und ich, wir sind unzertrennlich, und es schmerzt mich, dich für so lange Zeit wegschicken zu müssen, damit das Geschäft den größtmöglichen Erfolg hat. Ich hoffe auf gute Nachrichten von dir. Glaube mir, mein lieber Alfred, dein dich liebender Vater und Freund.
– Brief von Louis-François Cartier an Alfred Cartier, 1869
1
Vater und Sohn: Louis-François und Alfred (1819-1897)
Lebendige Geschichte
Im Auktionssaal herrschte reges Treiben. Aus allen fünf Kontinenten waren Sammler, Schmuckliebhaberinnen und Händler gekommen, um am »bedeutendsten Schmuckverkauf des Jahrhunderts« teilzunehmen, wie es in der Zeitschrift Town & Country hieß. An der hinteren Wand drängten sich die Fotografen, die Telefone des Hauses wurden von einer ganzen Armada an Mitarbeitern bedient, und um Punkt 10 Uhr betrat der erste von fünf Auktionatoren an diesem 19. Juni 2019 die Bühne von Christie’s: ein Podest im Rockefeller Center in New York. Was folgte, war ein monumentales, zwölf Stunden währendes Event. »Nicht jeden Tag«, schwärmte die Financial Times, »kommen derart viele museumsreife Schmuckstücke aus einer einzigen, weltberühmten Kollektion unter den Hammer.« 388 Lose aus fünf Jahrhunderten und von einigen der extravagantesten Herrscher aller Zeiten standen bei der Auktion »Maharajas & Mughal Magnificence« zum Verkauf. Sie gehörten allesamt dem Scheich Hamad Al Thani. »Aladins Schatztruhe« hatte das Magazin Forbes die Sammlung genannt, »nur bräuchte man eine Lampe mit einem Geist, der daraus entweicht, um auch nur ein Gebot zu finanzieren.«
Am Nachmittag standen zahlreiche Schmuckstücke von Cartier zum Verkauf. Das Los mit der Nummer 228, eine juwelenbesetzte Brosche für die Gürtelschnalle der Marquise von Cholmondeley aus den 1920er Jahren, würde gewiss einiges Interesse auf sich ziehen. Mit dem riesigen achteckigen Smaragd als Mittelstück, der von Diamanten, Saphiren und weiteren Smaragden umsäumt war, galt die Brosche als ein typisches Beispiel für eine aus Fernost inspirierte Art-déco-Kreation aus dem Hause Cartier. Das Mindestgebot lag bei 400000 Dollar. Bei einem anfänglichen Bietschritt von 20000 Dollar, der sich im weiteren Verlauf auf 50000 Dollar erhöhte, dauerte es nicht lange, bis die digitale Anzeige hinter dem Auktionator den Schätzpreis von 500000 bis 700000 Dollar überstieg. Als schließlich der Hammer fiel, ging bei der Bekanntgabe des Verkaufspreises – über anderthalb Millionen Dollar – ein Raunen durch den Saal und spontaner Applaus brandete auf.
Die Brosche war nicht das einzige Schmuckstück von Cartier, um das sich an diesem Tag die Bieter stritten. Von einem Miederornament aus Diamant und Platin aus der Belle Époque über eine Tutti-Frutti-Brosche aus den 1930er Jahren bis hin zum Halsreif eines Maharadschas aus Rubinen und Perlen standen einundzwanzig Schmuckstücke von Cartier zum Verkauf. Acht davon erzielten einen Preis von über einer Million Dollar, für eines wurden sogar mehr als zehn Millionen Dollar gezahlt. Insgesamt waren nur fünf Prozent aller Lose von Cartier, aber sie ergaben ein Viertel des Gesamterlöses der Auktion, der bei 109 Millionen Dollar lag. Ein atemberaubendes Ergebnis, wenngleich nicht ganz überraschend.
Noch im 21. Jahrhundert gehören alte Kreationen von Cartier zu den begehrtesten Schmuckstücken der Welt. »Wenn Sie ein altes Stück von Cartier sehen«, sagte ein Experte, »können Sie den Wert verdreifachen. Diese Juwelen spielen in einer anderen Liga.« 2010 erzielte die Panthère de Cartier aus Onyx und Diamant, die in den 1950er Jahren für die Herzogin von Windsor angefertigt wurde, bei Sotheby’s den höchsten Preis, der jemals für einen Armreif aufgerufen wurde. Das Jadehalsband von Cartier für Barbara Hutton aus dem Jahr 1933, das in Hongkong unter den Hammer kam, ging als teuerstes Jadeit-Juwel aller Zeiten in die Geschichte ein, während bei dem rekordträchtigen Verkauf des Schmucks von Elizabeth Taylor 2016 ein Halsband von Cartier den höchsten Preis erzielte. Angesichts dieser weltweiten Wertschätzung kann man sich kaum vorstellen, dass es jemals anders gewesen sein könnte. Doch der Wettstreit um die Juwelen mit der bekannten kursiven Signatur, bei dem sich Menschen freiwillig von Millionen trennten, ist in keiner Weise vergleichbar mit den Umständen, unter denen der Gründer des Hauses Cartier sein Metier begann. Genau zweihundert Jahre vor jener epochemachenden Auktion in New York betrat Louis-François Cartier eine gänzlich andere Welt.
Der Lehrling
Als Jugendlicher hätte Louis-François Cartier allzu gern eine umfassende Schulausbildung genossen. Er wollte die Klassiker lesen, in die Wissenschaften eintauchen, die großen Künstler kennenlernen. Aber er konnte sich sein Leben nicht aussuchen. Die Familie Cartier musste sieben hungrige Mäuler stopfen und er als ältester Sohn hatte schon früh Verantwortung zu tragen.1 Nachdem er die allergrundlegendste Bildung erhalten hatte, musste er gleich einen Beruf ergreifen. Sein Vater Pierre hatte ihm eine Lehre in einem Juweliergeschäft besorgt. Harte Arbeit für wenig Geld, aber die Juwelenhändler gehörten zu den sechs »Corps de Marchands de Paris«, besonders angesehene Gruppen von Händlern und Handwerkern, wodurch der junge Cartier deutlich bessere Zukunftsaussichten hatte, als wenn er seinem Vater ins metallverarbeitende Gewerbe gefolgt wäre.
Tag für Tag lief Louis-François den Weg vom winzigen Haus der Familie im Marais – zwanzig Minuten durch enge Gassen ohne Bürgersteige – zu Les Halles. Hier, gleich neben dem Gewimmel der Kornbörse und den Gerüchen der Austernstände, hatten die Juweliere der Stadt ihren Sitz. Sein neuer Chef war der Fabricant Bernard Picard, der eine Werkstatt auf zwei Etagen in einem sechsstöckigen Gebäude in der Rue Montorgueil Nº 31 hatte, gleich neben der Pfarrkirche Saint-Eustache.2
Das Leben als Lehrling war nicht leicht. Die Leiter der Werkstätten waren berüchtigt dafür, ihre Gehilfen »wie die Insassen eines Zwingers« zu behandeln. Die Jungen mussten fünfzehn zermürbende Stunden am Tag arbeiten, für wenig Lohn. »Uns blieb nichts erspart, es setzte Haue, Ohrfeigen und Fußtritte«, erinnerte sich der Juwelier Alphonse Fouquet, während ein Handwerker bei Fabergé sagte, das wichtigste Werkzeug seines Meisters sei die Peitsche gewesen: »Kein Schüler entkam ihr in seiner Lehre.«3 So mancher Lehrling gab auf, aber Louis-François, der miterlebt hatte, wie sich sein Vater aus dem Nichts etwas aufgebaut hatte, war wild entschlossen durchzuhalten.
Zehn Jahre vor der Geburt seines ältesten Sohnes war Pierre Cartier im Kampf für Frankreich während der Napoleonischen Kriege von Wellingtons Armee gefangen genommen worden.4 Jahrelang war er auf einem widerwärtigen, überfüllten, vor Krankheit strotzenden Gefängnisschiff im Hafen von Portsmouth eingesperrt, bis er sich irgendwann fragte, ob er noch jemals lebend wieder herauskäme. Als er nach Napoleons Niederlage 1815 freigelassen wurde, war er achtundzwanzig Jahre alt, hatte keinen Cent in der Tasche, keine Eltern mehr und keine Zukunft. Er kehrte nach Paris zurück, fand eine Anstellung als Metallarbeiter, heiratete die Waschfrau Élisabeth Gerardin und wurde Vater.5 Nun, da sein Sohn eine Lehre absolvierte, konnte Pierre endlich auf ein besseres Leben für die nächste Generation seiner Familie hoffen.
Louis-François trat seine Lehre zu einem günstigen Zeitpunkt an. Die französischen Adligen, die während der Revolution und unter der Herrschaft Napoleons aus der Hauptstadt geflohen waren, kehrten unter der neuen Bourbonen-Monarchie allmählich nach Paris zurück, wodurch die Nachfrage nach Luxusgütern wieder zunahm. Das Leben am Hof war zwar noch blass im Vergleich zur Ära einer Marie-Antoinette, aber immerhin zeigte sich nun ein Trend hin zu kleineren, diskreteren Schmuckstücken. Diesen Markt bediente Picard. Wenn Louis-François und seine Kollegen ein Stück fertiggestellt hatten, stempelten sie es mit dem Poinçon ihres Meisters, einem offiziellen Zeichen, das dessen Herkunft bekundete. Sollte indes ein Lehrling die Hoffnung hegen, bald seinen eigenen Stempel zu haben, so lag das in weiter Ferne. Denn die Aufstiegschancen in diesem Metier waren sehr begrenzt. Selbst wenn sich Picard eines Tages auf sein Altenteil zurückzog, würde sein ältester Sohn Adolphe an seine Stelle treten.
Ein paar Monate vor seinem einundzwanzigsten Geburtstag heiratete Louis-François trotz ungewisser Zukunft seine achtzehnjährige Freundin. Antoinette Guermonprez, die nur Adèle gerufen wurde, stammte nicht aus Paris. Ihr Vater war Tischmacher und von Roanne in die Hauptstadt gezogen, um sich dort Arbeit zu suchen. Anschließend hatte er die gesamte Sippe der Guermonprez nachgeholt, sodass nun mehrere Generationen in engsten Verhältnissen unter einem Dach lebten, unweit der Familie Cartier. Hier im Marais gab sich das junge Paar an einem kalten Februarmorgen des Jahres 1840 in der großen, im gotischen Stil erbauten katholischen Kirche Saint-Nicolas-des-Champs das Jawort. Nach der Hochzeit zogen die Trauleute bei Adèles Eltern ein, da sie sich kein eigenes Haus leisten konnten. Nun wollten sie gern eine Familie gründen. Nach einem Jahr kam ihr erster und einziger Sohn zur Welt, Louis-François Alfred, den alle nur Alfred nannten. Und als er fünf Jahre alt war, bekam er noch eine kleine Schwester, Camille.
In Paris Kinder großzuziehen war in den 1840er Jahren gerade für die Arbeiterklasse nicht leicht. Die Stadt platzte aus allen Nähten, weil so viele Menschen vom Land in die Stadt zogen und sich noch in der kleinsten Lücke, die sich auftat, niederließen, sodass kein Platz für Parks oder Erholungsgebiete blieb. Die überlaufenden Abflüsse und offenen Abwasserkanäle waren ein Nährboden für Krankheiten, die Sterblichkeitsrate bei Säuglingen hoch. Louis-François arbeitete hart für Picard. Er hoffte inständig, seinen Kindern einmal ein besseres Leben ermöglichen zu können – wie sein Vater ihm. Doch das sollte noch viele Jahre ungewiss bleiben.
Zwanzigtausend Francs
Im Jahre 1847 tat Monsieur Picard jedoch eine Neuigkeit kund, die sich nicht nur auf Louis-François’ Leben, sondern auch auf die zukünftigen Generationen der Familie Cartier und am Ende sogar auf die gesamte Juwelierbranche auswirken sollte. Picard wollte, wie er seinen Mitarbeitern erklärte, in das elegantere Viertel Palais-Royal umziehen. Zuvor musste er allerdings seine Werkstatt in der Rue Montorgueil verkaufen. Da sah Louis-François seine Chance gekommen. Und er ergriff sie. Dank der Unterstützung mehrerer Familienmitglieder gelang es ihm, zumindest einen Großteil der 20000 Francs zusammenzubekommen, die die Werkstatt kosten sollte – keine geringe Summe, wenn man bedenkt, dass der Durchschnittslohn damals weniger als zwei Francs am Tag betrug. Da er nicht den vollen Kaufpreis aufbringen konnte, zu schweigen von den 1600 Francs Monatsmiete, schlug er Picard vor, den Rest in Raten zu bezahlen. Gott sei’s gedankt: Picard, der Vertrauen in seinen fleißigen Mitarbeiter gefasst hatte, willigte ein.
Und so wurde Louis-François Cartier nach jahrelangem Ringen am Rande des Geschehens mit 27 Jahren stolzer Besitzer eines Juweliergeschäfts. Umgehend ließ er seine Handwerksmarke eintragen, sodass er schon im April offiziell unter seinem eigenen Namen Schmuck vertreiben konnte. Während Picards Poinçon aus einem durch seine Initialen fließenden Fluss bestand, entwarf Louis-François eine schlichte Raute – ein auf der Seite liegender Diamant – und setzte seine Initialen LC hinein, getrennt durch ein Herz-Ass – eine Anspielung darauf, dass das französische Wort »cartier« Kartenmacher bedeutet.6
Das erste Markenzeichen von Cartier, das Louis-François am 17. April 1847 amtlich eintragen ließ. [2]
Als im Januar 1848 das Jahrbuch der Pariser Händler gedruckt wurde, fand sich darin zum ersten Mal der Name Cartier. Louis-François’ neues Unternehmen trat, wie er selbst es formulierte, »die Nachfolge des Monsieur Picard an, Hersteller von joaillerie [mit Edelsteinen besetzter Schmuck] und bijouterie [Goldschmuck], Modeschmuck und Neuheiten«.7
Wie bei Picard stellte Louis-François eigenhändig Schmuck her, ließ sich aber auch Stücke von anderen Herstellern liefern. In den ersten Monaten hatte er kristallbesetzte Armreife, Blüten-Broschen, barocke Perlen-Accessoires und Diamant-Ohrringe in seinem Angebot, das er an andere Werkstätten und Juweliere verkaufte, darunter auch den königlichen Juwelier, zunächst ein Monsieur Fossin, später Monsieur Chaumet.8 Viele seiner Schmuckstücke hatte Louis-François für bekannte Namen ersonnen, von der Familie Rothschild bis hin zur belgischen Fürstin von Ligne, mit denen er liebend gern direkt Kontakt aufgenommen hätte. Doch dafür war es noch zu früh. Mochten seine Juwelen auch wahre Glanzstücke sein, in seiner bescheidenen Werkstatt konnte er kaum den glanzvollen Hochadel empfangen. Daher musste sich Cartier zumindest vorerst damit begnügen, sich in der Branche einen Namen zu machen. Und obwohl es anfangs durchaus gut für Louis-François lief, musste er leider bald feststellen, dass der Zeitpunkt dafür denkbar ungünstig war.
»Vive la réforme!«
Einige Monate lang drohte der in Frankreich brodelnde Unmut überzukochen. Schlechte Ernten, Kartoffelfäule und die Finanzkrise von 1846 hatten zu einer Rezession geführt. Ein Drittel aller Pariser waren arbeitslos und hatten kaum genug zu essen für ihre Kinder. Während die Wut der Bevölkerung auf den König und seine Regierung anschwoll, hielt das oppositionelle Bürgertum »politische Bankette« ab, um über seine eigenen Reformideen zu debattieren. Und als König Louis-Philippe 1848 beschloss, diese Bankette zu verbieten, brachte er damit bei vielen das Fass zum Überlaufen.
Das erzürnte Volk strömte in Massen auf die Pariser Straßen und machte seiner aufgestauten Wut mit dem Ruf »Vive la réforme!« Luft. Die Demonstranten errichteten Barrikaden und lieferten sich Gemetzel mit den Königsgarden. Soldaten feuerten in die Menge, die sich vor dem Außenministerium versammelt hatte, nur zehn Minuten von Louis-François’ Werkstatt entfernt, die er noch immer nicht ganz abbezahlt hatte. Fünfundfünfzig Bürger kamen im Kugelhagel ums Leben, was die Leute in eine solche Raserei versetzte, dass sie ihrerseits das Feuer eröffneten und auf den Palast zumarschierten. Zu Tode erschrocken, dankte der Premierminister Guizot unverzüglich ab, bald darauf auch König Louis-Philippe, der sein Zepter niederlegte und nach England floh.
Das Jahr 1848 sollte als das Jahr der europäischen Revolutionen in die Geschichte eingehen. Auf dem gesamten Kontinent brandeten Aufstände gegen die Monarchien auf. In Paris währten die Unruhen mehrere Monate, und Louis-François, der so lange darauf gewartet hatte, sein eigenes Geschäft zu eröffnen, blieb nichts anderes übrig, als seine Arbeit niederzulegen. Er fürchtete sogar, sie niemals wiederaufnehmen zu können, wie sich sein Enkel später erinnerte: »Mein Großvater hat mir erzählt, dass er während der Revolution dachte, er müsste sein Geschäft, das er ja gerade erst eröffnet hatte, für immer zumachen.«
Doch selbst unter der neuen provisorischen Regierung herrschte weiter unorganisiertes Chaos. Die Reichen flohen, Kredite wurden unbotmäßig teuer und die Zahl der Pariser Unternehmen schrumpfte auf die Hälfte. Louis-François machte versuchshalber sein Geschäft wieder auf, weil er endlich wieder Geld verdienen wollte, nur um festzustellen, dass die meisten Kunden ihr Geschäft aufgegeben oder sich nach anderen Geschäftspartnern umgesehen hatten.
Erst nach dem Staatsstreich von Louis-Napoléon drei Jahre später ging es in Paris wieder bergauf. Er, der bald Kaiser Napoleon III. heißen sollte, erwies sich als Modernisierer, was der Wirtschaft Aufschwung gab. Mithilfe seiner autoritären Pressezensur gelang es ihm schließlich auch, die Opposition zum Schweigen zu bringen. Louis-François erwog, nunmehr vorsichtig optimistisch, sein Geschäftsmodell zu ändern. Seine Schmuckwerkstatt befand sich zwar in günstiger Lage, um Händler und andere Werkstätten zu beliefern, er wollte aber gern exklusivere Kunden erreichen. Picard war in ein Viertel umgezogen, in dem er seinen Schmuck direkt an die Laufkundschaft verkaufen konnte. Und so folgte ihm Louis-François sechs Jahre nach der Gründung von Cartier nach.
»In der Kapelle, Sire«9
Für einen Händler von Luxusgütern war der Standort der entscheidende Faktor. Deshalb verließ der ambitionierte Louis-François das Gewimmel und den vertrauten Austernduft von Les Halles, um in das vornehme Viertel Palais-Royal überzusiedeln. Hierher kamen die schönsten Damen der Stadt in ihren Kutschen gefahren, um einzukaufen, zu speisen und gesehen zu werden. Cartier konnte sich zwar keinen Ausstellungsraum in den herrlichen Arkaden leisten, aber ab 1853 logierte er nur einen Steinwurf davon entfernt. In seinem neuen Ausstellungsraum im ersten Stock in der Rue Neuve-des-Petits-Champs N°5, über einem eleganten Restaurant und schräg gegenüber von den exquisiten Gärten gelegen, empfing der nunmehr 34-jährige Gründer des Hauses Cartier jene Kundinnen und Kunden, die seinen Namen in die Stadt hinaustragen sollten. Nicht alle kamen, um Juwelen zu kaufen. Sie wurden auch angelockt von den silbernen Teeservice, den kleinen Bronzestatuen, dem Zierrat aus Elfenbein und dem Sèvres-Porzellan, was neben Achat- und Obsidian-Steinen, Zierknöpfen, Taschenuhren und Amethyst-Armreifen ausgestellt war. Der rote Faden, der sie miteinander verband, waren Louis-François’ hohe Ansprüche, denen sie genügen mussten. Nachdem er über zehn Jahre lang als Handwerker tätig gewesen und eine Werkstatt geleitet hatte, wusste er die Kreationen anderer einzuordnen: Bei Cartier sollte ausschließlich qualitätvolle Ware angeboten werden.
Luxus war jetzt wieder gefragt. Frankreich profitierte von der Industrialisierung und der Reichtum der Ober- und Mittelklasse wuchs stetig. Auch die Qualität des Schmucks nahm im Zweiten Kaiserreich zu. Das Reformprogramm Napoleons III. war in Hinblick auf die Bezahlung von Handwerkern revolutionär. Fortan gab es keine strikt festgelegten Löhne mehr, sondern es konnten für besonders versierte Juweliere Anreize durch höhere Löhne gesetzt werden, sodass die Qualität der Juwelierarbeit zunahm. Noch dazu hatte eine galante neue Kaiserin das Parkett der Öffentlichkeit betreten, eine Dame, die im Land der Bewunderer eine Lanze für französischen Schmuck brach.
Von der Schönheit der spanischen Adligen Eugénie de Montijo betört, stellte ihr der Kaiser Napoleon III. die berühmte Frage: »Wie kann ich Sie erreichen?«, was sie mit »In der Kapelle, Sire« beantwortete – woraufhin er ihr umgehend einen Heiratsantrag machte. Als die künftige Kaiserin bei ihrer Hochzeit im Januar 1853 aus der vergoldeten Glaskutsche stieg, in der sie vom Élysée-Palast zur Kathedrale Notre-Dame gefahren worden war, entlockte sie der Menge entzückte Rufe. Ihr Kleid war aus weißem Samt, »die Brasselette leuchtete vor Diamanten der kostspieligsten Art und glänzte vor Saphiren«. Um die Taille trug sie einen diamantenen Gürtel, »auf ihrer Stirn den Diamant-Reif, den Marie-Louise [die erste Frau Napoleons I.] an ihrem Hochzeitstag getragen hatte«, und über ihre lange Schleppe zog sich ein Spitzenschleier, der durch ein Gebinde aus Orangenblüten gehalten wurde, »deren Liebreiz mit den Juwelen in Einklang ging«.10
Der Kaiser sollte noch etliche Kronjuwelen für seine Gattin umarbeiten lassen und von diesem Brauch des französischen Hofes einige ausgewählte Juweliere ihren Vorteil ziehen.11 Der noch kaum bekannte Cartier zählte nicht dazu, aber die Begeisterung der Kaiserin für große, glänzende Juwelen gab der Branche in ganz Frankreich einen enormen Aufschwung. Zudem wurde Paris unter der starken Führung Napoleons III. und seiner betörenden Frau wieder zu einer bedeutenden und attraktiven Stadt.
Sei stets ausgewählt höflich
Für eine Kundin, die im Viertel Palais-Royal nach einer Emailbrosche aus Limoges, einem Ring oder einem Anhänger mit Stein suchte, mussten die hier versammelten Juweliere wie Rivalen wirken. Tatsächlich aber belieferten sich die im Wettbewerb stehenden Händler – von Fossin über Falize bis hin zu Boucheron und Cartier – nicht selten gegenseitig mit Schmuck. Manchmal wurde eine Halskette oder eine Brosche auch in Gemeinschaftsarbeit gefertigt. Und da verschiedene Juweliere bei ein und denselben Juweliermachern einkauften, konnte sich Cartiers Sortiment nicht durch Einzigartigkeit auszeichnen. Wenn Louis-François unter der Konkurrenz hervorstechen wollte, musste er sich also auf andere Weise einen Ruf erwerben.
»Sei stets ausgewählt höflich«, bat Louis-François seinen Sohn Alfred um ein Auftreten, das für ihn ein wichtiger Kern seiner Lebensphilosophie war. »Es ist ein einfaches Mittel, um mit anderen Menschen gut Freund zu sein und zu bleiben, ganz gleich wie hoch oder niedrig ihr Rang ist.« Jeder Mensch, der das Haus Cartier betrat, sollte mit Respekt behandelt werden. Louis-François hatte vielleicht nicht die Möglichkeiten, sein Geschäft mit großen Diamant-Colliers oder Perlenketten zu bestücken, und auch einen Ausstellungsraum in den prestigeträchtigen Arkaden des Palais-Royal konnte er sich nicht leisten. Aber ihm war bewusst, dass er sich durch eine besondere persönliche Note hervorheben konnte. Wenn seine Kunden seinen Ausstellungsraum zufrieden verließen und sich über den angenehmen Umgang mit Monsieur Cartier freuten, standen die Chancen gut, dass sie wiederkamen und ihn womöglich sogar weiterempfahlen.
Im Gespräch mit Jean-Jacques Cartier
Jeder Kunde, der das Haus Cartier betrat, sollte seinen Besuch genießen. Wir hatten einen wunderbaren Empfangsportier, der ein bisschen aussah wie der Weihnachtsmann und jeden Kunden mit einem breiten Lächeln begrüßte, das über das ganze Gesicht ging. Man konnte eigentlich gar nicht anders, als ihn ebenfalls anzulächeln. Ein Geschäftsmann muss diskret und zuvorkommend sein, das versteht sich von selbst, aber niemand kauft Schmuck in einem Geschäft, in dem er sich nicht wohlfühlt. Das hat mir mein Vater beigebracht.
Zwei Jahre nachdem er sein Geschäft eröffnet hatte, sollte Louis-François – sei es durch Mundpropaganda oder aus reinem Zufall – seine bis dahin bedeutendste Kundin empfangen.12 Die 44-jährige Comtesse de Nieuwerkerke war die Frau des Pariser Superintendenten der Schönen Künste. 1855 kaufte sie ganz im Sinn der aktuellen Mode, die möglichst dezent zu sein hatte, einige Steine in Form eines Colliers und sechs Knöpfe. In den nächsten drei Jahren besuchte sie Cartiers Ausstellungsraum regelmäßig und erwarb über fünfzig Artikel. Louis-François wusste sehr zu schätzen, dass er die Comtesse als Stammkundin gewonnen hatte, und noch mehr, dass sein Name durch sie weiterverbreitet wurde. Als sie auf einem »überwältigenden Fest« ein Schmuckstück von Cartier trug, fand es die Bewunderung der Geliebten ihres Ehemanns, die zufällig eine Fürstin und eine der einflussreichsten Frauen der Stadt war.13
Das schönste Dekolleté Europas
»Ohne den großen Napoleon«, sagte Mathilde Bonaparte einmal über ihren Onkel, »würde ich wohl jetzt in Ajaccio auf der Straße stehen und Orangen verkaufen.«14 Tatsächlich aber gehörte sie Mitte des 19. Jahrhunderts zu den angesehensten Personen der elitären Zirkel. Nach einer kurzen, stürmischen Ehe mit dem schwerreichen russischen Prinzen Anatole Demidow war sie 1846 nach Paris geflüchtet, wo sie sich unermüdlich für die Belange ihres Cousins Napoleon III. einsetzte. Und als sein Platz auf dem Thron gefestigt war, war damit auch ihre Stellung in der Gesellschaft gesichert.
Die kultivierte Fürstin Mathilde, die auch Notre Dame des Arts genannt wurde, »unsere Dame der Künste«, hielt in ihrer Villa in der Rue de Courcelles N°10 einen der feinsten Salons des Zweiten Kaiserreichs ab. Ihre Nichte Fürstin Caroline Murat bezeichnete ihn als »einen wahrhaften Hof«, als »Mittelpunkt und Heimat der Pariser Intellektuellen«.15 Gefeierte Autoren wie Guy de Maupassant, Gustave Flaubert oder Alexandre Dumas der Jüngere debattierten hier über Politik und Kunst, und auch Journalisten wie Hippolyte de Villemessant, der Herausgeber des Figaro, Gelehrte und Wissenschaftler wie Louis Pasteur waren geladen. Das Diner am Freitagabend indes blieb Künstlern vorbehalten.
Aufgrund ihrer herausragenden Stellung in der Gesellschaft, ihres bemerkenswerten Geschmacks und der Tatsache, dass sie »le plus beau décolleté d’Europe« besaß, das schönste Dekolleté Europas, war Mathilde der Traum eines jeden Juweliers.161856 erteilte sie Louis-François einen verheißungsvollen Auftrag, als sie ihn bat, ein Collier für sie zu reparieren. Anschließend erwarb sie bei ihm auch noch mehrere Schmuckstücke, was seinen Namen in der Stadt weiter aufwertete. In den nächsten Jahren tätigte sie bei ihm großzügige Einkäufe, die von der Vielfalt des Cartier’schen Angebots zeugen: ein Collier mit Rubinen und Perlen, Steine mit Medusenhaupt, Broschen mit Amethyst, eine türkisfarbene Skarabäenbrosche, ein opalbesetzter Armreif, Ohrringe im ägyptischen Stil und auch einen Griff für einen Sonnenschirm erwarb sie bei ihm. Alles in allem sind in Cartiers Bestandsbüchern über zweihundert Artikel aufgeführt, die die Fürstin bei ihm kaufte.
Aber die Fürstin und Louis-François teilten noch mehr miteinander als ihre Leidenschaft für Schmuck. Als Kunstliebhaber, die ästhetische Gestaltung schätzten, hatten sie zufälligerweise auch denselben Kunstlehrer. Eugène Julienne hatte als Zeichner in der Porzellanfabrik in Sèvres angefangen, ehe er von dem Pariser Juwelier Jean-Paul Robin entdeckt wurde. Beeindruckt von »seiner Vorstellungskraft und der herausragenden Fähigkeit, die von ihm verlangten Zeichnungen in nur wenigen Minuten anzufertigen«, schlug Robin ihm vor, Schmuck zu entwerfen. Bald darauf arbeitete Julienne für viele führende Juweliere und Goldschmiede in der Hauptstadt und eröffnete 1856 seine eigene Kunstakademie. Zu den prominenten Privatschülern gehörten Damen des Hofes, aber er unterrichtete auch in größeren Gruppen Ornamentzeichnung. Louis-François war für einen Abendkurs bei ihm angemeldet. Einmal die Woche ging er die zwanzig Minuten von seinem Ausstellungsraum im Palais-Royal zu Juliennes Atelier auf dem Boulevard Saint-Martin, um von diesem brillanten Meister zu lernen. Er war dort in guter Gesellschaft. Unter seinen Mitschülern befanden sich noch andere Juweliere, und die Verbindungen, die Louis-François bei Julienne knüpfte, sollten ihm später noch nützlich sein.17
Louis-François Cartiers wichtigste Kundin zu Anfangszeiten, Fürstin Mathilde Bonaparte, die nicht nur häufig bei ihm einkaufte, sondern seinem Unternehmen auch das erste Brevet verlieh, ein königliches Patent, das Cartier auf seinen Rechnungen stolz neben seinen Namen setzte. [3]
In kaum mehr als zehn Jahren hatte sich Louis-François von einem schlecht bezahlten, überarbeiteten Handwerker zu einem Händler hochgearbeitet, der eine Fürstin zu seinen Kunden zählte. Allerdings sollte der nächste Rückschlag in seinem Leben nie lange auf sich warten lassen. Drei Jahre nach der Eröffnung seines Ausstellungsraums im Palais-Royal drohte ein katastrophaler Unfall allem ein Ende zu setzen. Als der Chefkoch des direkt unter Cartier gelegenen Restaurants eines Abends Anfang 1856 seinen Herd anstellte, gab es eine derart gewaltige Explosion, dass ein Teil der Decke einfiel und sich der Schutt über die Tische ergoss. Die kreischenden Gäste wurden, so schnell es ging, nach draußen gebracht. Grund für den Unfall war ein unentdecktes Leck in der Gasleitung. Die Flammen breiteten sich in Windeseile aus und hatten schon Cartiers Werkstatt in der zweiten Etage erreicht. Wie durch ein Wunder kam niemand zu Tode und die Feuerwehr, die schnell zur Stelle war, konnte das Gebäude retten. Nach den notwendigen Renovierungen sollte Cartier in alter Form wiedereröffnen. Aber das Erlebnis hatte nachhaltige Auswirkungen auf Louis-François. Er entwickelte nicht nur eine panische Angst vor Feuer, sondern lernte auch, jederzeit auf das Schlimmste gefasst zu sein.
Cartier Gillion
In den zwölf Jahren seit seiner Gründung hatte das Haus Cartier eine Revolution, eine Wirtschaftskrise, einen Staatsstreich und einen Brand überlebt. Doch die Widrigkeiten, denen sich Louis-François ausgesetzt sah, hatten nur dazu geführt, dass er noch entschlossener ans Werk ging. 1859, sechs Jahre nach seinem Umzug in das Viertel Palais-Royal, wagte er ein noch größeres Risiko. Als ihm zu Ohren kam, dass Monsieur Gillion, ein sehr bekannter Pariser Juwelier, in Rente ging, wandte sich der 44-jährige Louis-François an ihn, um ihm ein Angebot für sein Geschäft zu unterbreiten.
Gillions Räumlichkeiten waren bedeutend größer als Cartiers Werkstatt in Palais-Royal. Das Gebäude auf dem geschäftigen Boulevard des Italiens trug die N°9 und umfasste einen Laden im Erdgeschoss mit Eingang zur Straße, ein Geschäft im Hinterhof, mehrere Etagen, einen Keller und die Nutzung einer Wasserpumpe. Das Entscheidende dabei war, dass sich die Adresse ideal für Laufkundschaft eignete. Als einer der vier großen Pariser Boulevards war der Boulevard des Italiens bei der gutgekleideten Elite sehr beliebt. Das Café Anglais, nur zwei Häuser weiter in der N°13 gelegen, galt als das beste Restaurant der Stadt und wurde nachgerade zu einem Wahrzeichen der Kapitale, es fand in Romanen von Zola, Proust, Balzac, Flaubert und Maupassant Erwähnung.
Die Miete für Gillions Geschäft betrug 8500 Francs im Jahr (umgerechnet 43000 Euro).18 Louis-François willigte in einen über zehn Jahre laufenden Pachtvertrag ein, den er, wenn alles gut lief, verlängern konnte. Der größte finanzielle Posten aber war der Bestand, der zusammen mit der ersten Monatsmiete fällig war und sich auf 40000 Francs belief (umgerechnet über 200000 Euro).19 Der Preis war doppelt so hoch wie im Falle Picards, aber das Geschäft auch deutlich etablierter. Gillion war weithin bekannt für seine »Brillantringe, Perlencolliers, auf geschmackvollste Weise gefasste Juwelen aller Art«. Zu Cartiers vielfältigem Angebot passte ebenfalls, dass Gillion nicht ausschließlich Schmuck anbot. »Es gibt auch prachtvolle Schüsseln und Tafelservice, die jedes Festmahl allein durch den Glanz, den sie verströmen, schöner machen«, schwärmte ein Journalist. »Denn der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Der Gourmet isst nicht nur mit dem Mund, sondern genießt auch mit den Augen.«20 Besonders attraktiv schien Louis-François, dass Gillion der Ruf einer »unstrittigen Vormachtstellung« vorausging, weshalb er schon bald sein Unternehmen unter dem Namen Cartier Gillion führte und diesen sogar auf seine Schmuckschatullen drucken ließ.21
Der geschäftige Boulevard des Italiens, auf dem Cartier 1859 sein neues Geschäft bezog, sowie ein beispielhaftes Stück, das Louis-François dort verkaufte: eine Demi-Parüre mit emailliertem Goldschmuck. Anhänger, Ohrringe und Collier wurden 1869 von Fontenay gefertigt und unter dem Namen »Cartier Gillion« in einer speziell dafür hergestellten rotseidenen Schatulle verkauft. [4]
Zu der Zeit, als Louis-François in den geräumigen neuen Ausstellungsraum umzog, ging es jedoch nicht allen so gut wie ihm. Zehn Jahre lang hatte er sein Geschäft nach den Prinzipien aufgebaut, die er bei Picard gelernt hatte. Wie sein vormaliger Chef hatte er als Hersteller begonnen und war eines Tages umgezogen, um seine Waren direkt an das Großbürgertum zu verkaufen. Nun wollte er seinen Sohn Alfred ins Geschäft einführen. Picard dagegen hatte große Probleme. Der 59-Jährige war mit allen Unbilden konfrontiert, die ein Familienunternehmen mit sich bringen kann, und sah sich infolge der Machtkämpfe zwischen seinen beiden Söhnen aus zwei verschiedenen Ehen gezwungen, es aufzulösen. Mithin kann 1859 als das Jahr gelten, in dem Louis-François seinem alten Herrn und Meister endgültig den Rang ablief – und als das Jahr, in dem er seine bis dahin bedeutendste Kundin empfing.
Mit dem Schmuck, den Kaiserin Eugénie auf ihrer atemberaubenden Hochzeit trug und der »auf Augenhöhe mit den glanzvollsten Höfen war, die Frankreich jemals gekannt hat«, setzte sie einen neuen Modetrend.22 Dank ihres Einflusses wurde nunmehr bei Abendveranstaltungen wieder Perlenkette getragen, und im Gegensatz zum zurückhaltenderen Stil der postrevolutionären Zeit regte sie ihre Kreise an, sich mit allerlei prunkvollem Geschmeide herauszuputzen. »Die Kaiserin hatte einen wunderschönen, bis in den Garten hinausreichenden Ballsaal, dort gab sie dieses ganz und gar liebreizende Fest«, erinnerte sich ihre Freundin, die österreichische Salonnière Fürstin Pauline von Metternich, an einen rauschenden Ball. »Ich nahm an der Quadrille teil, die die vier Elemente darstellen sollte, und wurde der Gruppe der Luft zugeteilt. In jeder Gruppe gab es vier Frauen. Die Gruppe der Erde trug nichts als Smaragde und Diamanten, die des Feuers nichts als Rubine und Diamanten, die des Wassers nichts als Perlen und Diamanten und die der Luft nichts als Türkise und Diamanten.«23
Auch wenn Louis-François nicht selbst in den Genuss dieser majestätischen Feste kam, erfuhr er natürlich von der Leidenschaft der Kaiserin für Juwelen. Er hatte an ihrem Hochzeitstag in der beeindruckten Menge gestanden und auf der Weltausstellung 1855 ihre Krone aus Diamanten und Smaragden bewundert. Als die Kaiserin Eugénie 1859 in seinen Ausstellungsraum trat, war das für ihn somit die größtmögliche Anerkennung. Louis-François Cartier, der Sohn einer Wäscherin und eines Metallarbeiters, erhielt Besuch von der wichtigsten Frau Frankreichs und der vermutlich ausschweifendsten Schmuckkäuferin der Welt.
Hatte der hochstrebende Juweliermeister jedoch gehofft, dass die Kaiserin bei ihm teure Edelsteine kaufen würde, so sah er sich enttäuscht. Sie erwarb bei Cartier lediglich ein silbernes Teeservice. Trotzdem war ihr Besuch ein Moment der Wertschätzung, der weit über die Rechnungshöhe hinaus von Bedeutung war. Wo die Kaiserin einkaufte, dorthin kamen auch andere hochrangige Kunden, und zu Louis-François’ Entzücken sollten sich sogar bald Besucher aus dem Ausland bei ihm einfinden.
Im Jahr darauf betrat ein Angehöriger der russischen Königsfamilie, Fürst Saltykow, bei einem Besuch in Frankreich das Geschäft auf dem Boulevard des Italiens N°9 und erwarb einen Armreif mit Smaragden in einer schwarz emaillierten Goldfassung. Wieder ein eher bescheidener Kauf, aber einen Russen zu seiner Kundschaft zu zählen war für Cartier ein bedeutender Aufstieg. Nach dem Ersten Weltkrieg sollte Amerika mit seinen Industriellen zum finanzstärksten Land der Welt aufsteigen, aber im 19. Jahrhundert war das große Geld noch in Russland, und damit auch die beste Kundschaft für Luxusgüter. Dass Saltykow bei Cartier einen Armreif kaufte, war ein frühes Bekenntnis aus einem Land, das noch eine wichtige Rolle bei der Entwicklung des Unternehmens spielen sollte.
Pariser Ruhm
Jeden dritten Dienstag im Monat nahm Louis-François um 20 Uhr an den Treffen der Chambre Syndicale de la Bijouterie teil, des Juwelierverbands, wo er auf Kollegen wie Boucheron, Falize und Mellerio traf. Auch ein junger Mann war dort zugegen, Théodule Bourdier. Er sollte bald eine enge Verbindung zur Familie Cartier eingehen. Seitdem Louis-François den Abendkurs besuchte, wusste er um die Vorteile des Netzwerkens, und der Verband, als dessen Sekretär er eine Zeitlang fungierte, war eine eingeschworene Gemeinschaft. Die Mitglieder verband die Leidenschaft für ihren Beruf und die Überzeugung, dass sie mehr erreichen konnten, wenn sie sich zusammentaten und für ihre Branche einsetzten.
Im Gespräch mit Jean-Jacques Cartier
Die meisten glauben, dass die Juweliere Konkurrenten waren, aber dem war nicht so. Die Familie Cartier war immer darauf bedacht, mit den Kollegen auf gutem Fuß zu stehen. Wir saßen ja alle im selben Boot, vom Ladenbesitzer bis zum Großkunden. Natürlich erzählte man sich nicht alles – bei neuen Ideen ließ sich keiner in die Karten blicken –, aber man muss sich nur das Adressbuch und die Korrespondenz meines Vaters ansehen, er war mit vielen anderen Juwelieren befreundet. Die Fabergés stehen drin, Van Cleef, Arpel und Charles Moore von Tiffany.
Louis-François’ Engagement ging aber weit über die Pariser Juweliergilde hinaus. Ihm war bewusst, dass er auch aus eigener Initiative handeln musste. Als er zum Beispiel 1864 hörte, dass in Bayonne im Rahmen der Einweihung der Bahnstrecke Paris–Madrid durch Napoleon III. eine große Ausstellung geplant war, packte er mehrere Koffer mit Schmuckstücken voll und fuhr dorthin. Sein Ziel war, die Edelsteine einem neuen Publikum zu präsentieren, und zu seinem Glück befanden es seine Konkurrenten aus Paris der Mühe nicht wert, ebenfalls zu der Ausstellung zu reisen. Tausende Besucher kamen, darunter auch der Kaiser und Mitglieder des spanischen Königshauses. Am wichtigsten war Louis-François jedoch, dass auch die Presse zugegen war. In Paris hatte Cartier Schwierigkeiten, in die Zeitung zu kommen, während die Journalisten in der Provinz zu seiner Freude begierig darauf waren, über die prächtigen Juwelen aus der Hauptstadt zu berichten.
Ein Kritiker, der Louis-François als »Monsieur Cartier Gillion« bezeichnete, sprach von seinen »schönen Schmuckstücken, die einen persönlichen und ungewöhnlichen Stil« hätten, und fügte hinzu, »dass auch seine Diamanten sehr schön eingefasst sind«.24 Die Kunstzeitschrift L’Artiste zeigte sich besonders begeistert von der vielfachen Verwendbarkeit eines Miederornaments, das aus fünf in Silber gefassten Diamantblüten bestand: »Es ist ein doppeltes Glück, dieses luxuriöse Juwel zu besitzen, das sich unendlich oft verwandeln kann. Aus diesem reichen Blütenstrauß lassen sich fünf hübsche Broschen, ein umwerfend schöner Kamm, ein wunderbarer Stirnreif und ein herrlicher Armreif machen. Für alle diese Verwandlungen braucht es nur ein paar Minuten, ohne dass irgendein Edelstein dabei Schaden nähme.«25
Während sich der gute Ruf des Namens Cartier weiterverbreitete, sodass Louis-François bald als »einer unserer ruhmreichen Pariser« galt, stieg er auch in den gesellschaftlichen Kreisen auf. Er lieferte nicht nur silberne und goldene Knöpfe an Charvet, den besten Hemdmacher Frankreichs, sondern konnte es sich sogar leisten, dessen elegante maßgeschneiderte Hemden selbst zu tragen. Schuldenfrei und behaglich in der Mittelschicht eingerichtet, genoss er guten Wein, reiste häufig ins Ausland – ins langersehnte England, aber auch in die Schweiz und nach Deutschland – und investierte in Immobilien. Als seine 19-jährige Tochter Camille 1865 heiratete, konnte er ihr eine ansehnliche Mitgift von 40000 Francs schenken (umgerechnet über 200000





























