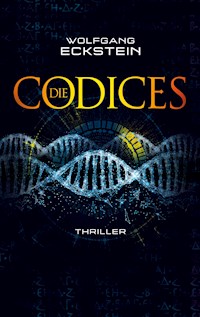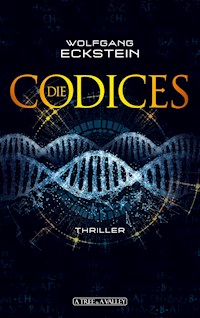
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: A TREE & VALLEY
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Ein römischer Senatorensohn reist für seine Ausbildung in das antike Alexandria, um dort die Wunder der Wissenschaft und das bemerkenswerte astronomische Wissen seiner Zeit zu lernen. Fast 2000 Jahre später steht der junge Forscher Lennard Sander vor der größten Entdeckung der Neuzeit: einem DNA-basierten Super Computer mit praktisch unbegrenzter Rechenleistung. Doch ein Mordanschlag zwingt ihn zur Flucht. Irgendjemand versucht an seine Erfindung zu gelangen, um mithilfe einer künstlichen Intelligenz das Leben aller Menschen zu kontrollieren. Zur selben Zeit findet ein italienischer Philologe einen Hinweis auf drei verschollene Codices aus dem Altertum. Tragen sie das Geheimnis in sich, um die entfesselte Technologie in die Schranken zu weisen? Die Zeit wird knapp, denn die totale Kontrolle hat bereits begonnen … Ecksteins meisterhaftes Debüt zeichnet ein fiktives Schreckensszenario absoluter Kontrolle, das schon in naher Zukunft Realität werden könnte. Ein packender Episoden-Thriller über die Möglichkeiten und Grenzen unseres Fortschritts. Eine Reise durch die Zeiten, Kulturen und das Wissen unserer Welt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 923
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
1. Auflage 2019
© 2019 by Verlag A TREE & A VALLEY
Inh. Stefan Funcke
Hannah-Arendt-Str. 3–7
35037 Marburg
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://d-nb.de abrufbar.
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.
Alle Rechte vorbehalten.
Umschlaggestaltung: Stefan Hilden, www.hildendesign.de
Motiv: © HildenDesign unter Verwendung mehrer Motive von Shutterstock.com | Anton Khrupin anttoniart, Ensuper, Zita
Redaktion: Stefan Funcke
ISBN EPub: 978-3-947357-16-1
ISBN Mobi: 978-3-947357-17-8
ISBN Print: 978-3-947357-15-4
www.verlag-atav.de
VORWORT
Ende der 80er Jahre, während meiner Forschungsarbeiten am Institut für Informatik der TU-München, las ich einen faszinierenden Artikel über die Möglichkeiten eines DNA-Computers – eines Rechners, der unvorstellbare Rechenleistung erzielen würde, indem er die gleichen Mechanismen nutzt, die auch in den Zellen unseres Körpers auf kleinstem Raum die komplexen Prozesse des Lebens steuern. Es war die Zeit, in der zum ersten Mal der Gedanke aufkam, jeder Mensch könnte einmal einen Rechner zu seiner persönlichen Nutzung haben. Langsam fand das Internet Einzug (damals erst an den Universitäten) und der seinerzeit schnellste Rechner, eine Cray-2, der mehrere Schränke füllte, hatte weniger Rechenleistung als heute eine Smart Watch.
Der DNA-Computer war damals eine Utopie. Doch eine Utopie, die eines Tages Wirklichkeit werden könnte. Es gab noch keine Ansätze, wie man ihn realisieren sollte, doch seine unglaubliche Rechenleistung war schon sehr früh offensichtlich, und selbst heute, wo in praktisch jedem technischen Gerät moderne Hochleistungs-CPUs verbaut sind, verblasst diese Rechenleistung im Vergleich zu dem unglaublichen Potenzial eines DNA-Computers. Bereits damals faszinierte die Frage, wie ein solcher Computer die Welt verändern würde. Ganz offensichtlich könnte man Lösungen für Aufgaben finden, die heute noch nicht einmal gestellt worden sind.
Doch wie würde die Welt aussehen, wenn man diese Schwelle überschritten hätte? Wäre sie unbegrenzt oder stünde man vielleicht schon bald, nach dem euphorischen Durchbruch, vor einer weiteren Hürde, dieses Mal vor einer unüberwindlichen?
Von der breiten Bevölkerung unbemerkt fanden die Pioniere der Logik und Informatik, Kurt Friedrich Gödel und Alan Mathison Turing, unerwartete Ergebnisse. Die Theorien, auf denen ihre Ergebnisse basierten, waren jedoch ungewohnt und komplex (und daher für das Vorabendprogramm ungeeignet) und darüber hinaus dem damaligen Zeitgeist so zuwider, dass sie lange Zeit, selbst in Teilen der Wissenschaft, abgelehnt wurden.
Mich fesselte der Gedanke, wie eine Welt mit einem ultra-schnellen DNA-Computer aussehen würde. Der menschliche Geist, zusammen mit einem solchen Werkzeug, müsste jedwede Begrenzung unseres Wissens überwinden können. Dieser Erwartung entgegen stehen die Ergebnisse von Gödel und Turing, die selbst dem schnellsten Rechner noch klare Grenzen aufgezeigt haben. Die neue Welt, eine Welt mit DNA-Computern, die nicht in allzu weiter Zukunft liegt, wäre somit ein Schmelztiegel, in dem nicht nur Gedankengebäude aufeinanderprallen, sondern in der ebenso die Frage nach dem freien Willen und den Grenzen unserer Wissenschaften in den Mittelpunkt rückt.
»Wir müssen wissen und wir werden wissen« (David Hilbert)
»Wir wissen es nicht und wir werden es niemals wissen« (Emil Du Bois-Reymond)
»Wenn jemand sich dünkt, er erkenne etwas, so hat er noch nicht erkannt, wie man erkennen soll« (Apostel Paulus)
PROLOG
Der Regen lief in Strömen über seine kurzen Haare, und was der scharfe Wind nicht von Nase und Kinn wehte, rann weiter den Hals hinunter, hinein in sein Gewand. Grelle Blitze erhellten den nächtlichen Wald und ließen bizarre Kreaturen vor seinen Füßen tanzen. Er wusste nicht, wie lange er unterwegs war. Er wusste nicht einmal, wo sein Weg begonnen hatte. Seine Sandalen waren nicht für einen solchen Weg gemacht, ebenso wenig wie der leichte Umhang, der regennass an seinem Körper klebte.
Schwer atmend stieg er den steilen, schlammigen Pfad nach oben. Kurz legte er den Kopf in den Nacken und blickte hinauf zu den mächtigen Baumwipfeln, die über ihm emporragten. Er stolperte über eine Wurzel, rutschte aus und fiel mit ausgestreckten Armen nach vorne. Tastend bewegten sich seine kleinen Hände am Boden entlang, bis sie schließlich einen flachen runden Stein fanden. Er griff nach ihm, stand auf und hielt ihn freudig vor sich. Erinnerungen an frisch gebackenes Brot wurden in ihm wach, und er meinte für einen Moment die Hitze der Mittagssonne auf seinem Gesicht zu spüren. Während seine Finger behutsam über den nassen Stein fuhren, verblasste das Bild wie ein schöner Traum, den der erste Blick in den grauen Morgen vertrieb.
43 Mal hatte es geblitzt, seit er in diesem Wald war, und 59 Mal hatte er es donnern gehört. 7177 Schritte war er gegangen, bis er zu der Gabelung kam. Diese Zahlen konnte man nur durch Eins teilen. Er war auf dem richtigen Weg.
Schritt Nummer 7993 führte ihn über eine hohe Schwelle und durch ein überdachtes Holztor. Auf einem mit groben Natursteinen gepflasterten Weg ging er durch einen Garten. An einer niedrigen Brücke kniete er sich hin und streckte den Arm hinunter ins Wasser. Farbige Fische näherten sich vorsichtig seiner Hand. Er strich ihnen sanft über den Rücken und kicherte leise.
Zufrieden stand er auf, betrachtete noch einmal die Fische, stieg am Ende des Gartens eine Holztreppe hinauf und klopfte an eine Holztür. Manchmal musste er blinzeln, wenn die Regentropfen sich in seinen Wimpern verfangen hatten.
Die Tür wurde zur Seite geschoben und ein freundlich aussehender, älterer Mann sah ihn an. Der Mann hatte weder einen Bart noch Haare auf dem Kopf. Er sagte etwas in einer fremden Sprache, doch seine Worte klangen warmherzig. Mit den langen Ärmeln seines dunklen Umhangs trocknete er ihm liebevoll das nasse Gesicht. Dann streckte er ihm den Arm entgegen, zog ihn in das ehrwürdige Haus, und der Regen verstummte, als die Tür sich hinter ihnen schloss.
TEIL 1
1
Flug Dallas – Chihuahua
Lennard Sander klammerte sich an seinem Sitz fest.
Kalter Schweiß stand ihm auf der Stirn, und sein Blick fixierte das Schild zum Notausgang einige Sitzreihen vor ihm. Er mochte das Fliegen nicht, schon gar nicht bei Gewitter. Dabei hätte es ein wirklich ruhiges Wochenende werden können. Bis der Anruf von Professor Foresight kam und seine Pläne durchkreuzte.
»Du musst heute noch fliegen und die Proben nehmen.«
Selten hatte Lennard seinen Professor so aufgeregt erlebt. Die Untersuchungen, die ursprünglich für übernächste Woche geplant gewesen waren, sollte er plötzlich schon heute durchführen. Vor seinem inneren Auge sah er förmlich, wie der sonst so ausgeglichene Professor seine geliebte Tabakpfeife durch die Luft schwang, während er ihm die knappen Anweisungen durchgab. Erst am Ende des Gesprächs nahm er einen Zug und blies den Rauch hastig ins Telefon. »Lennard, versprich mir, sofort aufzubrechen!«
Dann wurde die Leitung unterbrochen. Lennard wusste nicht, was er von der ganzen Geschichte halten sollte, doch für ihn stand außer Frage, dass er dem Wunsch seines Professors nachkommen würde. Sie arbeiteten schon sehr lange zusammen, und Foresight wusste, wann etwas dringend war. Also hatte Lennard sich ein Flugticket besorgt, die Analysegeräte eingepackt und es gerade noch rechtzeitig zum Flugzeug geschafft. Der Gedanke, Archaeen in den Tiefen eines mexikanischen Bergwerks zu suchen, war ihm nicht gerade angenehm, doch die Proben, die er für seine Forschung benötigte, waren nur in sehr großer Tiefe zu finden.
»Was möchten Sie trinken?«, fragte die freundliche Stimme einer Flugbegleiterin.
»Ein Wasser, bitte.« Unsicher strich sich Lennard die vereinzelten Strähnen seiner viel zu lang gewordenen Haare aus dem Gesicht.
»Alles in Ordnung?« Die junge Frau lächelte ihm aufmunternd zu. »Wir haben Glück. Der Kapitän konnte das Gewitter in einem großen Bogen umfliegen.«
Lennard blickte zu ihr hoch. An das Gewitter wollte er lieber nicht denken und eine passende Antwort fiel ihm auch nicht ein. Also nahm er stumm das Wasser entgegen und lächelte verlegen.
»Sie fliegen nach Chihuahua?«, fragte ihn sein Sitznachbar. Der Mann war äußerst korpulent und seine Stimme eindeutig zu hoch für seine Körperfülle. Ohne die offensichtliche Antwort abzuwarten, fuhr er fort:
»Chihuahua. Ein seltsamer Name für eine Stadt, finden Sie nicht?« Das Kichern des Mannes erinnerte Lennard an das rhythmische Quietschen seines Fahrrads, wenn er mit zu hohem Tempo von seiner Wohnung zur Universität hinunterfuhr. »Da muss ich immer an zu klein geratene, zitternde Hunde denken. Aber so harmlos wie die kleinen Hunde ist die Stadt nicht! Drogenkrieg, sag ich nur. Da geht es um richtig viel Geld. Und glauben Sie mir: Wenn es um viel Geld geht, haben amerikanische Konzerne die Fäden in der Hand.«
Lennard hörte kaum zu. Was interessierten ihn die politischen Verhältnisse in Nordmexiko! Ihn beschäftigten andere Dinge. Am Flughafen würde ihn ein gewisser Robin abholen und zur Mine bringen. Die wichtigsten Untersuchungen könnte Lennard gleich vor Ort durchführen. Allein schon der Gedanke, die lang gesuchte DNA zu finden, ließ sein Forscherherz höherschlagen. Er hatte lange auf eine solche Gelegenheit gewartet, und wenn sein Professor Recht behielt, war er tatsächlich kurz davor, eine der größten Entdeckungen dieses Jahrhunderts zu machen.
»Das MÜSSEN Sie sehen!« Unsanft riss ihn sein Nachbar wieder aus den Gedanken. »Als könnte man die Berge greifen!« Jedes Mal, wenn er seinen Kopf zur Seite drehte, quoll ihm eine Speckfalte aus dem Kragen. »Schauen Sie mal, hier!«
Lennard gab vor, in die Tiefe zu blicken. Er mochte die Höhe nicht. Abermals trieb es ihm den Schweiß ins Gesicht, und vor seinen Augen tanzten helle Lichtpunkte.
»Was denken Sie?«, fragte sein Nachbar. »Wie lange fällt man bis nach unten?«
»Etwa sieben Minuten. Aufgrund der Außentemperatur von minus 55 Grad und einem Luftdruck von nur 190 Hektopascal verliert man allerdings rasch das Bewusstsein.« Lennard hoffte, mit dieser Antwort seinen Nachbarn nun endlich zum Schweigen gebracht zu haben.
»Minus 55!«, wiederholte der Mann ungläubig und blickte ihn mit seinen Schweinsaugen an. »Das ist ja noch viel kälter als bei uns in North Dakota! Mein Cousin war letzten Winter in Alaska. Dort ist es kalt, sag ich Ihnen …«
Das Rütteln des Flugzeugs bei der Landung weckte Lennard wieder auf. Er wunderte sich, wie es ihm trotz des Sprechdurchfalls seines Nachbarn gelungen war, einzuschlafen. Es war Nacht geworden und vereinzelt blitzten die Lichter des Flughafens durch die kleinen Fenster der Maschine. Während das Flugzeug über das Vorfeld rollte, holte Lennard sein Telefon aus der Tasche und schaltete den Flugmodus aus. Die übliche Flut an unbedeutenden Nachrichten huschte über den Bildschirm, aber eine Antwort von seinem Professor war noch immer nicht dabei. Sicher war er wieder in seine Arbeit vertieft und vergaß alles um sich herum. Lennard griff nach seinem Handgepäck und drängte sich mit den anderen Passagieren nach draußen. Die frische Nachtluft half ihm, seine Gedanken zu ordnen, und kurz darauf fand er sich mit seinen Koffern vor der Zollkontrolle wieder.
Nur wenige Reisende warteten so spät am Abend noch mit ihm in der Schlange. Jeder musste auf einen Knopf drücken und ein Zufallsgenerator entschied, wessen Gepäck inspiziert wurde. Lennard mochte den Zufall nicht. Man konnte ihn nicht planen, und außerdem gewann er nie beim Glücksspiel. Nervös blickte er nach vorne und sah, wie das Gepäck der anderen Reisenden durchsucht wurde. Ein Forschungskollege aus seiner Abteilung hatte ihm einmal erzählt, wie lange die Zollformalitäten für Berufsausrüstung in Mexiko dauern konnten, selbst wenn man die offiziellen Papiere hatte. Er hatte keine.
Mit klopfendem Herzen trat Lennard einen Schritt nach vorne und drückte auf den Knopf des Generators. Eine Lampe leuchtete rot auf, begleitet von einem knarrenden Warnton. Der Zollbeamte wandte sich ihm zu und forderte ihn mit einer herablassenden Handbewegung auf, die Koffer zu öffnen. Nervös legte Lennard seine Hände an die Schlösser. Kurz bevor er sie entriegeln konnte, hallte eine Durchsage auf Spanisch aus den Lautsprechern. Der Zollbeamte sagte, er solle kurz warten, und verschwand.
»Sie sind doch Dr. Sanders«, sprach ihn ein Mann mit unangenehm lauter Stimme von hinten an. »Der Wissenschaftler aus dem Fernsehen! Ich hab Sie gesehen. Letzte Woche auf KJCT8.«
»Sie waren das?«, fragte Lennard verwundert. Er war davon überzeugt, dass das für die meisten sicherlich todlangweilige Fernsehinterview, das er für den Lokalsender gegeben hatte, und das irgendwann mitten in der Nacht ausgestrahlt worden war, von nur einem – höchstens zwei – Menschen bis zum Ende gesehen worden sein konnte. Offensichtlich hatte er diese Person gefunden.
»Dr. Sanders. Ich glaub es nicht!«
Andere Passagiere drehten sich zu ihnen um.
»Sander«, korrigierte ihn Lennard. Er war noch immer besorgt, wie die Sache mit dem Zoll für ihn wohl ausgehen würde.
»Ich wusste es! Dr. Sanders, der Erfinder des Bio-Computers!«
»Man nennt ihn DNA-Computer.« Lennard seufzte.
»Dr. Sanders, ich gebe Ihnen einen Tipp: Diesen Computer sollten Sie als Green Technology vermarkten. Er ist schließlich biologisch! Wenn er entsorgt werden muss, wirft man ihn einfach auf den Komposthaufen. Mit so einer Idee können Sie richtig Geld machen!« Der Mann strahlte ihn an und zeigte dann auf Lennards Koffer. »Worauf warten Sie?«
»Der Zollbeamte ist gerade weggegangen.«
»Sie müssen nur auf diesen Knopf hier drücken.«
Noch bevor Lennard etwas sagen konnte, betätigte der Mann den Knopf, und die Lampe leuchtete grün.
»Sehen Sie? Ganz einfach.«
Inzwischen war ein weiterer Zollbeamter auf Lennard aufmerksam geworden. Er betrachtete für einen Moment die grüne Lampe und dann Lennard. Mit einer winkenden Handbewegung machte er deutlich, endlich den Platz für den nächsten Reisenden freizumachen. Ebenso verunsichert wie erleichtert nahm Lennard seine Koffer und suchte den Weg nach draußen.
»Viel Erfolg mit Ihrem Computer«, rief ihm der Mann noch nach, doch Lennard sah sich bereits nach seinem Abholer um.
2
Flughafenhalle von Chihuahua, Mexiko
Roberta B'alam stand im Ankunftsbereich des Flughafens und wartete auf Dr. Sander, der mit dem Flug aus Dallas kommen sollte. Seinetwegen musste sie sich die Nacht um die Ohren schlagen. Dabei fielen ihr zig Sachen ein, die sie an diesem Abend lieber gemacht hätte. Aber wenn der Direktor sie schickte, konnte sie schlecht Nein sagen.
Nur wenige Reisende strömten an diesem Abend in die Halle. Überhaupt kamen immer weniger Menschen in die vom Drogenkrieg gequälte Stadt. Am Ende des Terminals fiel ihr ein junger Mann auf, der sich suchend umsah. Seine langen dunklen Haare hatte er zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden, was seinen Kopf noch schmaler erscheinen ließ. Er war schlank, fast hager, und die beiden unhandlichen Koffer wirkten viel zu schwer für ihn. Sie hob ihr Schild in die Höhe, das sie noch schnell auf die Rückseite eines weggeworfenen Plakats geschrieben hatte, und winkte ihm zu.
Lennard kam in den Ankunftsbereich und sah sich um. Jemand winkte und hielt ein schwer lesbares Schild mit seinem Namen hoch: »Dr. Lennard Sander«. Er ging darauf zu und stand bald vor einer attraktiven jungen Frau in enganliegenden Jeans und T-Shirt. Sie lächelte ihn selbstsicher an.
»Lennard Sander? Der Direktor von Naica schickt mich. Ich bin Robin.« Ohne auf eine Antwort zu warten, fügte sie hinzu: »Darf ich Len sagen?«
Das war nicht der Bergwerksarbeiter, den Lennard sich vorgestellt hatte. Überrumpelt von ihrem Aussehen und ihrer forschen Art war er einen Moment lang sprachlos.
»Sicher«, antwortete er zögerlich.
»Du bist also der Biologe, der die Proben im Bergwerk nehmen will?«
Noch immer war Lennard von dem lockeren Auftritt der jungen Frau überrascht. »Bringst du mich hin?«, fragte er und gab sich Mühe, sie dabei wie beiläufig anzusehen.
»Nicht nur das. Ich werde dich auch in die Höhle begleiten.«
Im nächsten Moment nahm sie ihm den Rucksack aus der Hand und ging voraus. Ihr Gang war geschmeidig, und ihre langen schwarzen Haare lagen trotz des schnellen Schrittes ruhig auf ihren Schultern.
Auf dem Weg zum Wagen erzählte Robin von der Stadt, den Drogengeschäften und der schlechten wirtschaftlichen Lage.
Kurz darauf fand Lennard sich in einem alten Jeep wieder, der so aussah, als hätte er den Zweiten Weltkrieg noch miterlebt. Das Verdeck bestand aus verschlissenem Stoff und die Folie der hinteren Seitenfenster war trüb und hatte Risse, durch die man ohne Probleme seinen Finger stecken konnte. Als der Wagen sich laut knatternd und ruckelnd in Bewegung setzte, zog die laue Nachtluft durch die Ritzen. Robin war damit beschäftigt, den richtigen Weg durch den nächtlichen Verkehr zu finden und schimpfte gelegentlich über langsame Fahrer oder die fehlenden Beschilderungen, während Lennard noch immer vergeblich nach einer angenehmen Sitzposition suchte.
Nachdem sie die Lichter des Flughafens und der Vororte überwiegend schweigend hinter sich gelassen hatten, fuhren sie auf eine einsame Landstraße. Die Landschaft lag im Dunkeln, und der Lärm des Motors und der Stollenreifen dröhnte in Lennards Ohren.
»Du bist nicht sehr gesprächig für einen Gringo«, sagte Robin plötzlich.
»Ich bin kein Gringo. Ich komme aus Deutschland.«
Diese Erklärung brachte das Gespräch auch nicht richtig in Gang. Für Lennard war alles Zwischenmenschliche von jeher ein Buch mit sieben Siegeln gewesen. Wie klar und einfach war dagegen seine Wissenschaft. Eine gesicherte Faktenlage und wohldefinierte Schlussfolgerungen. Er musste an eine Kollegin denken, der er einmal zu ihrer Schwangerschaft gratuliert hatte. Sie hatte danach drei Wochen nicht mehr mit ihm gesprochen. Wie konnte er auch wissen, dass sie Gewichtsprobleme hatte.
»Kennst du das Bergwerk in Naica?«, fragte Robin nach einer längeren Pause.
»Ich hab im Internet darüber gelesen. Es ist eine Erzmine. Zink, Blei und Silber.«
»Naica hat noch etwas ganz Besonderes«, sagte sie und sah kurz zu ihm hinüber. »Kennst du Marienglas?«
»Selenit. Klar kenn ich das. Die Römer haben es bereits für Fenster verwendet.« Jetzt war Lennard in seinem Element und zum ersten Mal drehte er sich beim Sprechen vollständig in ihre Richtung. »Früher habe ich Selenitkristalle in den Canyons von Utah gesucht. Meist fand ich nur kleinere Platten. Aber manche Stücke waren größer als meine Hand und so dick wie zwei Finger.«
Stolz streckte er die rechte Handfläche nach vorne, als hielte er darin seinen Fund. Robin warf ihm einen raschen Blick zu und schmunzelte.
»Nun stell dir einen Kristall vor – so groß wie die Säule eines ägyptischen Tempels. Dieser Riese wiegt so viel wie dreißig Autos. Davon nimmst du mehrere Dutzende und füllst damit eine gigantische Höhle auf. Das ist unsere Cueva de los Cristales. Wie klingt das für dich?«
»Du machst Witze.«
»Ganz und gar nicht. In zwei Stunden wirst du die Höhle mit eigenen Augen sehen.«
»Kaum zu glauben, dass ich davon noch nie etwas gehört habe. Und was hat das Selenit in dieser Höhle mit meinen Archaeen-Proben zu tun?«
»Weißt du, wie Selenit entsteht?«, fragte Robin.
»Es gibt mehrere Varianten«, begann Lennard wieder zu dozieren. »Ich vermute, in diesem Fall dringt in Wasser gelöster Gips in einen Hohlraum ein. In dem Hohlraum herrscht ein anderer pH-Wert, wahrscheinlich kommen eine niedrigere Temperatur und eine geringere Strömungsgeschwindigkeit dazu. In so einem Milieu kristallisiert der Gips in Form von Selenit aus.«
»Du kennst dich mit Geologie aus«, sagte Robin anerkennend.
»Du aber auch.«
»Ich studiere es. Die Temperatur des Grundwassers liegt im Bergwerk bei über fünfzig Grad. Unter diesen Bedingungen entstehen nicht nur die Kristalle. Dort leben auch besondere Bakterien oder so etwas.«
»Archaeen, keine Bakterien!«, verbesserte er sie.
»So hat Professor Foresight sie wohl genannt.«
»Und hat er dir auch gesagt, was an diesen Archaeen so besonders ist?«
»Er meinte etwas von einer neuen Ordnung. Was daran so dringend ist, dass wir heute noch ins Bergwerk müssen, ist mir allerdings schleierhaft. Außerdem sprach er noch vom Duplizieren von Erbinformation und der Synthese von Proteinen. DNA-Polymarase, glaube ich.«
»DNA-Polymerase!«, berichtigte er sie wieder.
»Ist dir eigentlich schon mal in den Sinn gekommen«, fuhr Robin ihn an, »dass ich noch anderes zu tun habe, als mir die Nacht um die Ohren zu schlagen und dabei auch noch belehrt zu werden?« Ihr Blick war wütend.
»Entschuldige«, sagte Lennard kleinlaut und wandte sich wieder seinem Fenster zu.
Mehrere Kilometer sprachen sie nicht. Doch sein Interesse an Robin wurde stärker als seine Unsicherheit.
»Woher kommt dein Name, ›Robin‹?«
»Kurzform für Roberta, wie du vermuten kannst.«
»Roberta ist doch okay, oder?«
»Na ja.«
»Robin gefällt mir. Und wie ist dein voller Name?«
Sie zögerte, dann sagte sie aber: »Roberta Huracan Itzel B'alam.«
»Wow, beeindruckend. Du bist eine Maya. B'alam ist der Jaguar?«
»Du kennst dich nicht nur mit Mineralien und irgendwelchen Zellen aus.«
»Und was hat dich hierher verschlagen? B'alam ist ein Maya-Wort aus der Gegend weit im Süden von Mexiko.«
»Jetzt beginnst du, mich zu beeindrucken. Ich komme aus dem Norden von Belize. Dort sprechen wir Màaya t'àan. Eine Sprache, die sich direkt von einer klassischen Maya-Sprache ableitet. Mein Name bedeutet Sturm, Regenbogen und, wie du gesagt hast, auch Jaguar.« Ihr Gesicht wurde wieder freundlicher.
»Huracan, der Sturm. Kann man sich leicht merken.«
»Sollte er wieder einmal ausbrechen, weißt du jetzt, wo es herkommt«, sagte Robin mit einem breiten Lächeln, während sie sich zu ihm hinüberdrehte. Seltsamerweise gefiel Lennard dieses energiegeladene Mädchen. Sie sagte, was sie fühlte, und es schien ihr egal zu sein, was die anderen über sie dachten.
»Und was machst du in Naica?«, fragte Lennard weiter.
»Ich schreibe an meiner Masterarbeit über die Cueva de los Cristales. Ich studiere in Puebla und bin für ein halbes Jahr hierhergekommen.«
Lennard musterte sie eine Weile von der Seite, doch anscheinend wollte sie es bei dieser kurzen Erklärung belassen. So fiel er abermals in sein Schweigen zurück und starrte hinaus in die Nacht. Nur die Scheinwerfer der entgegenkommenden Autos unterbrachen die Dunkelheit.
3
Landstraße vor Naica
»Len, aufwachen«, sagte Robin und berührte ihn an der Schulter.
»Wie spät ist es?«, fragte er und rieb sich über das Gesicht.
»Kurz nach Mitternacht. Wir sind bald da.«
»Ich muss eingeschlafen sein.«
»Ist mir gar nicht aufgefallen. Wusstest du, dass du schnarchst?«
»Hat mir bisher keiner gesagt.« Er grinste sie an.
»Blödmann.« Robin stupste ihn an die Schulter. »Es wird Zeit, den Direktor anzurufen. Er will von mir wissen, ob du gut angekommen bist.«
Sie sah zu Lennard hinüber und warf ihm einen vielsagenden Blick zu. »Deine Proben müssen ganz schön wichtig sein, wenn sich sogar der Chef darum kümmert.«
Sie zog ihr Handy aus der Hosentasche und nach kurzem Warten folgte ein Gespräch auf Spanisch. Lennard konnte etwas von »Höhle«, »Regelung« und »Pumpen« verstehen. Für mehr reichten seine wenigen Semester Spanisch nicht aus. Doch der Tonfall machte schnell klar, dass es Probleme gab. Kaum hatte Robin aufgelegt, brach es schon aus ihr heraus.
»Diese selbstherrlichen Idioten! Warum warten sie nicht wenigstens noch einen Tag? Erst schicken sie mich mitten in der Nacht los, um dich abzuholen, und dann stellen sie von jetzt auf gleich die Pumpen ab!« Sie redete laut und aufgebracht und hatte sich dabei zu ihm gedreht. Lennard konnte gerade noch in das Lenkrad greifen, um den Wagen auf der Straße zu halten.
»Achtung!«, rief er.
»Pseudo-Ökologen sind das! In alles mischen sie sich ein. Aber da, wo es richtige Probleme gibt, unternehmen sie nichts. Das war es dann mit deinen Proben. Und mit meiner Masterarbeit.«
»Was ist denn passiert?«
»Ich könnte sie alle …!« Robin atmete hörbar aus. »Also. Die Höhle, von der ich erzählt habe, steht von Natur aus unter Wasser. Um sie zu untersuchen, hat man das Wasser abgepumpt. Damit ergaben sich zwei Probleme: Zum einen liefen große Mengen des stark mineralischen Wassers in den Bach. Nicht unkritisch für die Vegetation flussabwärts, aber verglichen mit den anderen Umweltsünden ist das ein Klacks. Zum anderen wurden die Kristalle aufgrund des fehlenden Wassers langsam spröde und matt.«
Sie sah ihm kurz in die Augen, um sich zu vergewissern, dass er ihr auch folgen konnte. Dann fuhr sie fort.
»Man hat hin und her überlegt, welche Lösungen es gibt. Um es kurz zu machen: Die Höhle sollte geflutet werden, damit der ursprüngliche Zustand wiederhergestellt wird. Das wäre auch kein Problem, wenn man es, wie vereinbart, im nächsten Monat getan hätte. Bis dahin wären meine mineralogischen Untersuchungen abgeschlossen gewesen und der Schaden für die Natur bliebe noch immer überschaubar. Aber dann kommt heute Nacht eine Vorgabe von so einer amerikanischen Umweltorganisation, und prompt wird die Höhle geflutet.«
»Was hast du gegen Umweltorganisationen?«
»Was ich gegen die habe?« Robin sah ihn irritiert an. »Ich erzähl dir eine Geschichte! Vor ein paar Wochen war eine Gruppe von sogenannten ›Aktivisten‹ hier. Weil keiner sich mit ihnen abgeben wollte, haben sie es mir, der Studentin, aufs Auge gedrückt. Ich bin im Bus mit ihnen an die Stellen gefahren, die sie sehen wollten. Unterwegs lief ein Straßenhund vor unser Fahrzeug. Du hättest hören sollen, wie sie über den Busfahrer geschimpft haben, als sei er daran schuld gewesen. Einen Tierarzt wollten sie holen. Dabei war der Hund längst tot!«
Lennard war sich nicht sicher, was sie ihm damit sagen wollte.
»Du scheinst die Probleme der Menschen hier nicht zu kennen«, sagte sie gereizt. »Ich bin ein Freund von Tieren. Trotzdem sind die streunenden Hunde hier eine Plage. Sie töten manchmal sogar Menschen. Der Busfahrer hat verzweifelt vor seinem Wagen gestanden, denn den entstandenen Schaden musste er aus der eigenen Tasche bezahlen – und da ist nicht viel drin! Meinst du, die wären für seine Kosten aufgekommen? Die waren ausschließlich an dem armen Hund interessiert.« Sie sah Lennard ernst an. »Verstehst du, warum ich keine hohe Meinung von einigen Öko-Aktivisten habe? Und jetzt kommen solche realitätsfernen Weltverbesserer und schließen die ganze Höhle. Aus und vorbei! Meine Forschungsarbeit, genauso wie deine.« Sie schlug mit der Faust auf das Lenkrad.
Lennard wartete, bis sich ihre Wut ein wenig gelegt hatte.
»Gibt es keinen anderen Weg in die Höhle?«
»Einen anderen Weg? Len, die Höhle liegt dreihundert Meter unter der Oberfläche und steht jetzt unter Wasser. Da gibt es nicht einfach mal so einen anderen Weg.«
»Aber die Proben sind wichtig«, beharrte Lennard. »Ohne sie wäre meine gesamte Forschung der letzten Jahre sinnlos!«
Robin umklammerte das Lenkrad fester und nickte entschlossen. »Dann müssen wir uns etwas einfallen lassen.«
Wenige Minuten später fuhren sie durch ein offenes Tor auf das Werksgelände der Minengesellschaft. Auf dem Parkplatz stellte Robin den Motor ab und schaltete die Scheinwerfer aus. Um sie herum war es dunkel. Nur in ihrem Wagen brannte noch Licht. Eine Weile sagte niemand etwas. Dann drehte Robin sich in Lennards Richtung und fixierte ihn mit ihrem Blick.
»Hast du Höhenangst, Len? Wir werden mit einer Gondel in einen Schacht hinunterfahren.«
Lennard schluckte. »Wie tief ist er?«
»Knapp sechshundert Meter.«
»Oh!« Lennard spürte, wie ihm die Farbe aus dem Gesicht wich.
»Alles okay?«, fragte Robin.
»Jaja.«
»Du hast Höhenangst!«
»Erzähl weiter.« Er kämpfte gegen das dumpfe Gefühl in der Magengegend an. Er musste da rein, koste es, was es wolle.
»Sie haben einen neuen Schacht gebohrt, um die Lage von Erzadern zu untersuchen. Vor ein paar Tagen haben sie beim Einfahren in den Schacht einen Zugang zu einer weiteren Höhle entdeckt, in der es ebenfalls Kristalle gibt. Dort hätten wir gute Chancen, ähnliche Bedingungen vorzufinden.«
»Dürfen wir denn überhaupt in den Schacht fahren?«, fragte Lennard. »Du musst bestimmt vorher eine Genehmigung einholen.« Insgeheim hoffte er noch immer auf einen Weg zu den Kristallen, der ihm eine Fahrt mit der Gondel ersparen würde.
»Der Direktor hat mir die klare Anweisung gegeben, alles nach den Wünschen deines Professors zu arrangieren. Und wenn die Öko-Freaks die eine Höhle fluten lassen, ist die andere auch bald dran. Es bleibt uns also nicht viel Zeit.« Sie musterte ihn. »Oder ist dir das Ganze nicht wichtig genug?«
Lennard schüttelte den Kopf.
»Na, dann los«, sagte Robin.
Sie stiegen aus dem Jeep und liefen über den verlassenen Hof hinüber zu einer mehrstöckigen Halle. Es war eine kühle, wolkenverhangene Nacht. Der Hof und die umliegenden Gebäude lagen im Dunkeln, nur in der Ferne flackerten einige blasse Lichter. Nichts war zu hören, außer dem Knirschen des Kieses unter ihren Schuhen.
»Siehst du den Off-Roader da drüben?«, fragte Robin und deutete auf die andere Seite des Hofes. »Diese NGO-Typen scheinen sogar persönlich gekommen zu sein, um das Fluten der Höhle zu überwachen. Sieht ganz schön teuer aus, das Ding.« Im Dunkeln konnte Lennard die Silhouette eines Geländewagens erahnen. Autos interessierten ihn nicht.
Sie erreichten die Tür eines Gebäudes, dessen dunkle Wand hoch über ihnen aufragte. Robin hantierte eine Weile am Schloss herum, bis es ihr schließlich gelang, die schwere Metalltür zu öffnen. Sie murmelte etwas, und nach einer Weile ging das Licht an. Lennard kniff die Augen zusammen. Als er wieder etwas erkennen konnte, sah er, dass Robin ihm aufmunternd zulächelte.
»Da geht’s lang.« Sie zeigte auf einen geraden Weg durch die Halle. »In dem Raum auf der anderen Seite finden wir unsere Ausrüstung. Danach geht es zum Schacht.«
Sie gingen an riesigen Fräsen, Bohrmaschinen, Baggern und Kippladern vorbei. Über allem lag der intensive Geruch von altem Öl. Die Größe der Halle und was hinter den Maschinen lag, war nur zu erahnen.
»Ich hoffe, du magst Dampfbäder.«
Robin sah ihn mit ernster Miene an und Lennard stutzte einen Augenblick. Dann fing er an zu lachen. »Du meinst die Höhle?«
»Richtig. Da wird es unangenehm warm und feucht werden. Ein Dampfbad ist entspannend, wenn man sich still hinsetzt und dabei zusieht, wie einem der Schweiß am Körper hinunterläuft. Aber wenn du arbeitest, fühlt es sich ganz anders an. Praktisch heißt das: Man kann bei diesem Klima kaum zwanzig Minuten überleben – falls man fit ist.«
»Ist das eine Anspielung auf mein Äußeres?«, fragte Lennard, und sein Blick fiel unwillkürlich auf Robins sportliche Figur. »Ich geb’s ja zu, das sieht bei dir besser aus.«
»War das ein Kompliment?«
Lennard hätte sich eine selbstbewusste Antwort gewünscht, doch die fiel ihm wieder einmal nicht ein. Deshalb wechselte er das Thema.
»In so kurzer Zeit werden wir dort nicht hinunterkommen, eine passende Stelle für die Proben finden und wieder rechtzeitig hier oben sein.«
»Wir haben spezielle Anzüge, die uns kühl halten«, sagte Robin. »Trotzdem bleibt uns nur eine gute halbe Stunde. Und zu dieser Tageszeit ist hier oben niemand, der uns im Notfall helfen könnte.«
Durch eine Metalltür kamen sie in eine Art Umkleideraum. Dort stand eine Reihe von Spinden, und an einer breiten Garderobe hingen schwarze Anzüge, die nur den Kopf frei ließen. Der Geruch von gebrauchter, feuchter Wäsche lag in der Luft.
»Die erinnern mich an Raumanzüge«, sagte Lennard, während er die Ausrüstung betrachtete.
»Es sind Trockentauchanzüge mit einem eingebauten Kühlsystem. Eine Sonderentwicklung hier aus Naica. Die haben wir in den letzten Monaten für die Untersuchung der Cueva de los Cristales benutzt.«
Robin wählte einen Anzug für Lennard aus. Er nahm ihn entgegen und zog ihn über seine Kleidung.
»Das machst du ziemlich routiniert! Woher kennst du dich damit aus?«, fragte Robin.
»So ähnliche Anzüge hatten wir auch auf der Marsstation.«
»Du warst auf dem Mars?« Erstaunt zog Robin eine Augenbraue nach oben.
»Nicht auf dem Mars! Auf einer Marsstation. Davon gibt es drei – eine ist in Utah. Dort habe ich an einem Studienprojekt teilgenommen. Die Station liegt mitten in der Wüste und wird für Untersuchungen zum Leben auf dem Mars verwendet.«
»Das klingt nach großen Jungs, die Astronaut spielen wollen.«
»Na ja, ist es irgendwie auch. Man stellt mit einfachen Mitteln das Leben von Astronauten auf dem Mars nach. Wenn man zum Beispiel das Habitat verlässt, muss man so einen Anzug tragen. Eines Mittags war ich unterwegs und sammelte Bakterienproben. Extremophile. Es war der letzte Tag der Frühjahrssaison. Genau genommen hätte ich die Station gar nicht mehr verlassen dürfen. Es war viel zu heiß. Doch ich wollte noch einen bestimmten Bakterienstamm für meine Untersuchungen finden.«
»Das kommt mir bekannt vor.«
»Auf dem Rückweg bin ich ausgerutscht. Die Bänder am Knöchel waren gerissen. Bei dem Sturz hat sich der Verschlussmechanismus des Helmes verklemmt, und ich konnte ihn nicht mehr öffnen. Die anderen waren zu weit weg, um mich zu sehen oder zu hören. Also hab ich mich zur Station aufgemacht. Humpelnd. Für fünfhundert Meter habe ich eine halbe Stunde gebraucht. Dann konnte ich mich nicht mehr auf den Beinen halten und bin gekrochen.«
»Und, wie ging es aus?«, fragte Robin.
»Ich kam bis kurz vor das Habitat. Das haben jedenfalls die anderen erzählt, die mich ohnmächtig gefunden haben.«
Robin starrte Lennard an. Er vermied ihren Blick und streifte sich die Ärmel über. »Fertig.« Er griff nach Handschuhen und Helm. »Ich hoffe, eure Verschlüsse sind robuster.«
»Diesmal bist du nicht allein!«, sagte Robin und boxte ihm an die Schulter. Sie verschwand kurz in einem Nebenraum und kam mit den Kühlelementen für die Anzüge zurück. »Damit wirst du einen kühlen Kopf bewahren.«
Geschickt verstaute Robin die Elemente in extra dafür vorgesehene Taschen, die auf der Innenseite der Anzüge eingenäht waren. Schließlich verband sie die Elemente mit Schläuchen, die aus dem Futter des Anzugs herausragten.
»In dem Anzug ist ein Kreislaufsystem integriert. Mithilfe kleiner Pumpen wird die Kühlflüssigkeit gleichmäßig über den ganzen Anzug verteilt. Den Mechanismus werden wir aber erst einschalten, wenn wir die Kühlung brauchen. Hast du deine Probenbehälter?«
Lennard hob mit der rechten Hand seine Tasche, schüttelte sie und ließ die Metallbehälter darin klappern.
Robin lächelte ihn an. »Sehr gut. Wir könnten noch ein Team werden.« Dann wies sie auf die gegenüberliegende Tür. »Dort geht es raus.«
Bei ihren ersten Schritten holte Lennard die Erinnerung an die Marsstation wieder ein und ein kalter Schweißfilm legte sich auf seine Stirn. Der schwere Anzug nahm ihm den Atem. Bloß nicht reinsteigern!, dachte Lennard und konzentrierte sich auf die bevorstehende Aufgabe. Entschlossen stapfte er weiter.
Sie traten auf einen großen Hof auf der Rückseite der Halle. In der Dunkelheit waren die Umrisse schwerer Maschinen zu erkennen und es roch nach gemahlenem Gestein. Nur wenig später standen sie vor einem großen Dreibein, an dessen Tragseil ein Behälter befestigt war. Die Gondel sah aus wie ein überdimensionierter Wäschekorb aus Metall.
»Das nennst du eine Gondel?«, presste Lennard hervor und zeigte dabei auf das Dreibein. »Dagegen ist ein Heißluftballon ja ein Hochsicherheitstrakt!«
Der Korb hatte die Größe einer kreisrunden Riesenradgondel, nur war sein Rand kaum mehr als hüfthoch. Alles bestand aus Drahtgeflecht, durch das man seine Finger stecken konnte. Darüber befand sich der Antriebsmechanismus, bestehend aus Motor und Rolle, der über Metallstäbe mit dem Korb verbunden war. Es wirkte weder stabil noch vertrauenerweckend.
»Nun ja. Die eigentliche Gondel ist vor ein paar Tagen abgestürzt.«
»Abgestürzt?« Lennard riss die Augen auf.
»Nicht so richtig abgestürzt«, versuchte Robin ihn zu beruhigen. »Einer der Arbeiter hat bei Umbauten nicht aufgepasst. Da ist ihm das Ding in den Schacht gefallen. Hiermit wollen sie es am Montag wieder hochholen – zumindest das, was davon noch übrig ist. Schau, es ist total sicher.« Sie rüttelte an den Metallstäben und der Korb schlug laut scheppernd gegen die Schachtwand. »Alles stabil!«
»Bitte lehn dich nicht über den Schacht.« Lennard konnte kaum hinsehen.
»Okay, okay«, sagte Robin. »Da fällt mir ein, ich hab etwas vergessen.«
Sie ging zu einer Hütte und kam mit einer Tasche voller Thermosflaschen zurück.
»Über das kühle Wasser wirst du dich noch freuen, wenn wir wieder nach oben fahren.«
Wenn!, dachte Lennard.
Robin legte alles in die Gondel, fasste Lennard bei den Händen und drehte ihn so, dass er mit dem Rücken zum Schacht stand. »Du kommst als Erster dran.«
Der dunkle Abgrund zog ihn wie eine unsichtbare Hand in die Tiefe. Sobald er nur ein Bein anhob, fing das andere an zu zittern. Er wollte Luft holen, doch sein Brustkorb war plötzlich hart wie Stahl. Er ignorierte das Zittern und schob sein Bein schwer atmend nach hinten. Mit dem Fuß erspürte er die Kante und tastete sich weiter zum Rand der Gondel. Noch immer stand Lennard mit dem anderen Bein auf festem Boden. Als er vorsichtig das Gewicht auf die Gondel verlagerte, schlug ihm das Herz bis zum Hals. Sein ganzer Körper verkrampfte sich. Langsam zog er das zweite Bein nach. Die Gondel schwankte bedrohlich und Lennard klammerte sich noch immer an Robins Hände, doch er stand jetzt im Korb.
»Siehst du, gar kein Problem«, sagte Robin ruhig. »Setz dich auf den Boden. Du kannst dich gegen das Geländer lehnen.«
Der Schweiß lief ihm in die Augen und brannte darin wie Feuer. Lennard wischte ihn weg, doch es dauerte, bis er wieder klar sehen konnte. Robin stieg zu ihm in die Gondel, was diese erneut heftig schaukeln ließ.
»Jetzt sind wir fast startklar«, sagte Robin. Mit gekonnter Bewegung fuhr sie prüfend über den Verlauf des Seils: oben die Klemmsicherung, gleich darunter die Antriebsrolle, dann nach unten durch das Gitter am Boden und hinab in die Tiefe. Sie untersuchte die Geräte und sah auf alle Anzeigen.
»Weißt du, was du da tust?«, fragte Lennard.
»Ich gehe nur sicher, dass alles in Ordnung ist. Das hier ist ein autonomer Aufzug. Wir haben den Motor und alles, was wir brauchen, in unser Gefährt integriert. Damit können wir die Fahrt ohne Hilfe von oben steuern.«
Robin setzte sich Lennard gegenüber. Sie stellte ein Licht zwischen ihnen auf den Boden und sah ihn aufmunternd an. Dann schaltete sie den Motor ein, worauf sich die Gondel mit einem Ruck in Bewegung setzte. Ein Zucken durchfuhr Lennards Körper, und er krallte sich am Bodengitter fest, während die Gondel knirschend im Dunkel des Schachts verschwand.
4
Südöstliches Mittelmeer 4. Juni 248 n. Chr.
Der Geruch von Teer und Salz zog Gaius in die Nase. Tief atmete er diesen Vorboten der Fremde ein. In der Dunkelheit der Nacht konnte er seine Umgebung nur schemenhaft erkennen, doch mit jeder Faser seines Körpers spürte er das Zittern der Planken, die unter der Urgewalt der langen Wellen knarzend aneinanderrieben. Das große Segel stand voll gebläht und zog knirschend an den Schoten. Ein gleichmäßiger Wind von Achtern trieb sie ihrem Ziel entgegen und ließ die Bugwelle immer wieder rauschen, wenn das Schiff eine Welle hinunterglitt.
Gaius genoss das Auf und Ab des Schiffes. Er war froh, nicht seekrank geworden zu sein. Andere hatten ihm davon als eine große Qual berichtet, die über die ganze Reise hinweg andauern konnte.
Seine Augen hingen an dem Sternbild Argo Navis, dem Schiff des Iason, der das goldene Vlies erbeutet hatte. Hier im Süden konnte er es zum ersten Mal in seiner ganzen Pracht bewundern. In Puteoli, seiner Heimat südlich von Rom, fehlte ein Teil des Rumpfes. Claudius Ptolemäus, der Mathematiker aus Alexandria, hatte dieses riesige Sternbild eingeführt.
Alexandria! Gaius konnte noch immer nicht glauben, dass er zu der Stadt der Gelehrten reiste. Drei ganze Jahre hatte er warten müssen, bis die Zusage des großen Theologen eintraf. Nur eine begrenzte Anzahl von Schülern nahm der Gelehrte auf, und daran hatte auch die Stellung seines Vaters als Senator in Rom nichts ändern können. Dann endlich erreichte sie im vergangenen Herbst und nur wenige Tage vor der Vollendung seines fünfzehnten Lebensjahres die Nachricht eines frei gewordenen Platzes, und Gaius musste ungeduldig warten, bis die Handelsschiffe nach den Stürmen des Winters wieder in See stachen.
Außer Gaius waren nur drei Seeleute an Deck, die Wache hatten. Hinter sich hörte er ab und zu das Stöhnen des Steuermanns, wenn er seine ganze Kraft einsetzen musste, um das Schiff bei der hohen See auf Kurs zu halten.
Gaius stand auf, ging zu dem kleinen Vorsegel am Bug der Corbita und spähte über die Reling zum Horizont. In weiter Ferne war dort ein Licht zu erkennen. Es war so hell wie ein Stern, doch zu seiner Überraschung verdunkelte es sich in regelmäßigen Abständen, um dann erneut zu erstrahlen.
»Alexandria voraus!«, tönte es vom Ausguck herunter. »Ankunft zur zweiten Stunde.«
Seitdem stand Gaius an Deck. Die Sonne war inzwischen aufgegangen und gab den glitzernden Wellen die Farbe von Gold. Ehrfurchtgebietend prangte das Wahrzeichen Alexandrias über dem Meer: der gewaltige Pharos. Mit seinen vierhundert Fuß war er der höchste Turm der Welt. Auf seiner Spitze brannte das Leuchtfeuer, das Gaius in der Nacht bereits gesehen hatte, als ihr Schiff noch eine Fahrt von fünf Stunden, bei voller Geschwindigkeit, vor sich gehabt hatte.
Sein Vater hatte ihn einmal nach Ostia, dem Hafen von Rom, mitgenommen. Er erinnerte sich, wie sie zur Tibermündung gekommen waren und er den alles überragenden Leuchtturm erblickt hatte. Wie Spielzeuge sahen die Schiffe im Vergleich dazu aus. Jedem seiner Freunde hatte er davon erzählt, doch kaum einer wollte ihm glauben, dass es ein so hohes Gebäude überhaupt geben konnte. Und nun sah er hinauf zu diesem Koloss, dessen Höhe er nur erahnen konnte und neben dem der Leuchtturm von Ostia wie ein Zwerg erscheinen musste. Ein ehrfürchtiger Schauer ergriff ihn, als seine Augen Stockwerk für Stockwerk über die unzähligen Fensterreihen des Turms nach oben wanderten, bis er an dessen Spitze die Statue des Neptun erblickte, der mit goldenem Arm gebieterisch nach unten zeigte. Gaius konnte sich kaum vorstellen, dass es jemals gelingen würde, einen noch höheren Turm zu bauen.
»Siehst du die Inschrift auf dem Pharos?« Quintus, der Kapitän der Corbita, war neben ihn getreten und überwachte die Einfahrt in den Hafen. Mit seinem kräftigen, von Wind und Wetter gegerbten Arm zeigte er zur Mitte der Umrandungsmauer der Insel, die allein schon höher war als die Spitze ihres Mastes. »Sostratos der Knidier, Dexiphanes’ Sohn.«
Gaius betrachtete die dunklen Buchstaben, die selbst vom Schiff aus noch gut zu lesen waren.
»Sostratos war der Erbauer des Pharos«, erklärte Quintus.
»Warum durfte er seinen Namen hier verewigen?«, fragte Gaius. Noch immer lag sein Blick wie gebannt auf diesem Wunder menschlicher Baukunst.
»Durfte er nicht.« Quintus grinste und seine Augen formten schmale Schlitze. »Deshalb hatte er auch Putz darüber mörteln lassen, auf dem der Name von Ptolemaios dem Ersten, dem Begründer des Ptolemäerreiches und Auftraggeber des Leuchtturms, stand. Doch der Putz ist lange abgebröckelt und schon seit Jahrhunderten sieht nun jeder den Namen des Erbauers.«
Nachdem ihr Schiff den Pharos passiert hatte, erschallte vom Turm zwei Mal ein lauter Ton wie von einer römischen Tuba, zusammen mit einer hellen Glocke.
»Was war das?«, fragte Gaius.
»Es ist die zweite Stunde«, antwortete Quintus. »Wie du gerade gehört hast, hat der Navigator unsere Ankunft exakt vorhergesagt.«
Wenig später fuhr das Schiff um die Hafenmauer, und vor Gaius öffnete sich der Blick auf den Hafen von Alexandria. Die Morgensonne stand noch immer tief und beschien Dutzende von Schiffen, die sich zwischen den kleinen Inseln über den Hafen hinweg verteilten. Im westlichen Teil lagen vier gewaltige Triremen mit ihren drei Ruderreihen, doch nur wenige Soldaten waren an Bord zu sehen. Der östliche Teil des Hafens war mit einem Wald von Masten übersät. Einige Handelsschiffe ankerten im freien Wasser, die meisten jedoch hatten an den vielen Kais zum Löschen und Beladen festgemacht.
Gaius stieg auf das erhöhte Heck der Corbita. Von hier aus konnte er das ganze Geschehen überblicken, ohne jedoch die Seeleute zu stören, die mit den beiden Segeln und den vielen Leinen vollauf beschäftigt waren, das Schiff sicher durch den dichtbefahrenen Hafen zu manövrieren. Einige Schiffe kreuzten ihren Weg, die schwer beladen ihre Reise hinaus auf das Meer wagten. Laute Kommandos drangen über das Wasser zu ihnen herüber, und Gaius beobachtete, wie die Seeleute über das Deck liefen, um geschickt an Segeln und Leinen zu hantieren. Er kannte all dies von seiner Heimat, denn Puteoli war der alte Hafen von Rom. Doch hier liefen nicht nur Getreideschiffe ein, um die hungrigen Mägen in der Millionenstadt zu füllen. In diesem Hafen sah Gaius Handelsschiffe aus aller Welt.
»Alexandria ist das wichtigste Handelszentrum des östlichen Mittelmeers«, sagte der Kapitän. Er stand jetzt zwischen den beiden Steuermännern, die ihr Gewicht gegen die langen Steuerknüppel stemmten. »Von hier kommt ein Großteil des Weizens, der in den Hafen deiner Heimatstadt gebracht wird. Handel treibt man mit dem gesamten Mittelmeerraum, Persien, Arabien und sogar Indien. In den Schiffen findest du Elfenbein, Papyrus, Textilien, seltene Früchte, Salben, Weihrauch, duftende Öle, Gold, Edelsteine, Zedernholz, Wein und vieles mehr. Alle Schätze der Welt kommen in diesem Hafen zusammen.«
Quintus erteilte den Steuermännern den Befehl für einen Kurswechsel, dann wandte er sich wieder Gaius zu. »Sieh! Dort, auf der Spitze der Halbinsel, ist das Timonium, die ehemalige Villa von Marcus Antonius. Die beiden Obelisken hat Augustus hier aufstellen lassen, und dahinter – das dürfte dich wohl am meisten interessieren – liegt das Museion und weiter links die ehrwürdige Bibliothek.«
Gaius stellte sich auf seine Zehenspitzen und reckte den Kopf, um noch besser sehen zu können. Wie verzaubert bestaunte er die Pracht, die vor ihm lag. Doch außer ihm schien niemand sonst davon Notiz zu nehmen. Unter lauten Rufen manövrierten die Seeleute ihre Corbita an den anderen Schiffen vorbei und in eine Lücke am Kai.
Hier drängten sich Seeleute, Sklaven und Händler zwischen gewaltigen Bergen von Ladung hindurch, die entlang des Kais aufgetürmt standen. Große Ballen mit Stoffen, unzählige Amphoren, Säcke mit Weizen und Kisten mit zerbrechlichen Gefäßen fanden sich dort ebenso wie Bohlen kostbaren Holzes, getrocknete Früchte und rosafarbener Granit für den Bau der Statuen. Die frische Meeresbrise war hier erstorben und in der Hitze der Sonne vermischte sich der Geruch von Salz und Fisch mit dem schweren Duft von Gewürzen und frisch zubereiteten Gerichten, aber auch mit dem Gestank von Abfällen, vergorenem Obst und dem Urin und Kot von Tieren.
»Verzeiht bitte«, unterbrach Gaius den Kapitän, der die letzten Befehle für das Festmachen des Schiffes gab. »Ich möchte mich herzlich für die Fürsorge und die sichere Überfahrt bedanken.«
»Du bist mir ein lieber Gast gewesen«, sagte Quintus und klopfte ihm dabei auf die Schulter. »Ich wünsche dir viel Glück mit deinem neuen Lehrer. Sei ihm ein guter Schüler. Nun leb wohl.«
Nachdem sie sich mit einem kräftigen Händedruck verabschiedet hatten, nahm Gaius seine wenigen Habseligkeiten, überprüfte ein letztes Mal, ob der Brief, den sein Vater ihm am Vorabend der Abreise für seinen zukünftigen Lehrer mitgegeben hatte, noch immer in seinem Leinenbeutel zwischen den Kleidungsstücken sorgsam verwahrt lag, und machte sich dann auf, um das Schiff über die Planke zu verlassen.
Er freute sich auf Dionysius, den Bischof von Alexandria. Seine Gelehrsamkeit und seine große Weisheit waren weit über die Stadt hinaus bekannt.
5
Hafen von Alexandria
Ohne ihn jemals gesehen zu haben, wusste Gaius sofort, dass nur er es sein konnte. Der Mann hatte wache, dunkelbraune Augen, denen nichts zu entgehen schien, und er blickte Gaius direkt an. Er hatte einen graumelierten, kurzgeschnittenen Bart, doch nur wenige Haare waren am Rand seines kahlen Kopfes verblieben. Ein Lächeln, das die Offenheit eines Kindes und zugleich die Erfahrung von Jahrzehnten in sich trug, lag auf seinen Lippen.
»Gaius«, sagte der Bischof mit klarer, warmherziger Stimme. »Herzlich willkommen in Alexandria!«
Gaius hob die Hand zum Gruß und schob dann unsicher den Riemen seiner Tasche auf der Schulter zurecht. Doch Dionysius ging auf ihn zu, streckte ihm aufmunternd die Hände entgegen und half Gaius mit seinem Gepäck.
»Ehrwürdiger Vater, woher wusstet Ihr, dass ich an diesem Tag und genau zu dieser Stunde ankommen würde?«, fragte Gaius erstaunt, als sie die Planke verlassen und er seit langer Zeit wieder festen Boden unter den Füßen hatte.
Dionysius nahm eines der beiden Gepäckstücke, fasste Gaius an der Schulter und führte ihn durch das Menschengewirr.
»Viele Dinge liegen vor unseren Augen wie ein Buch, das wir nur öffnen müssen«, sagte er. »Sieh: Der Seehandel beginnt jedes Jahr sechs Tage vor den Kalendae des Iunius. Das war vor neun Tagen. Bei dem kräftigen Nordwestwind der letzten Woche braucht man für die Überfahrt von Puteoli nach Alexandria neun Tage. In deinem Brief stand, dass du mit dem ersten Schiff kommen wolltest. Euer Schiff hat also vor neun Tagen in Puteoli abgelegt?«
»Richtig, Vater«, sagte Gaius.
Dionysius zog ihn auf die Seite, da er in dem Gedränge ein entgegenkommendes Fuhrwerk übersehen hatte.
»Du siehst, wie weit man mit wenigen, einfachen Überlegungen kommt. Der Verstand kann ein mächtiges Werkzeug sein.«
»Ich dachte, der Glaube sei die Basis aller Erkenntnis, und unser Verstand kann trügerisch sein.«
»Wenn uns etwas täuscht, sind es eher unsere vorgefertigten Ansichten und fehlendes Wissen«, erwiderte Dionysius. »Wir können sehr vieles erkennen – mehr als die meisten ahnen –, auch wenn sich in dieser Welt nicht alles unserer Erkenntnis beugt. So auch deine genaue Ankunftszeit.« Lächelnd fügte er hinzu: »Deshalb habe ich meinen guten Freund Numerius, der auf dem Pharos arbeitet, gebeten, mich über die Ankunft deines Schiffes zu informieren.«
Gaius sah ihn verwundert an. Sein ganzes Leben hatte man ihn davor gewarnt, den Verstand zu überschätzen, denn er wäre kein zuverlässiger Ratgeber und würde einen zum Hochmut verführen. Doch Dionysius hatte sich in seinen Überlegungen nicht getäuscht. Und hochmütig schien er auch nicht zu sein. Schließlich konnte er sogar über sich selbst lachen.
Ein markerschütterndes Gebrüll erklang drohend nur wenige Schritte vor ihnen. Gaius schreckte unwillkürlich zurück. Er sah sich angsterfüllt in alle Richtungen nach einem angreifenden Ungeheuer um. Doch Dionysius fasste ihn am Arm und zog ihn weiter nach vorne.
»Eine neue Lieferung für die vergnügungssüchtigen Bürger Roms«, sagte er. Sie standen nun auf Armlänge von einem Käfig entfernt, in dem ein Löwe sie fauchend fixierte. Er versuchte seine mächtigen Pranken nach ihnen herauszustrecken, doch die Bronzestäbe standen dafür zu dicht. Er fletschte die Zähne und brüllte Gaius an. Obwohl Gaius wusste, dass der Käfig äußerst robust gebaut war, musste er allen Mut zusammennehmen, um nicht zurückzuweichen.
»Er scheint Hunger zu haben«, sagte Gaius, als er sich von seinem Schrecken erholt hatte.
»Sie versorgen die Tiere gut«, sagte Dionysius, »denn sie kosten ein Vermögen. Man fängt sie weit im Süden und muss sie dann über beschwerliche Wege bis hierher transportieren. Dabei sterben weit mehr Sklaven als Tiere.« Er schüttelte verständnislos den Kopf. »So viele müssen sterben, damit sich einige daran ergötzen, wie Menschen durch diese Tiere getötet werden.«
Dann drehte er sich zu Gaius. »Wie sieht es mit dir aus? Hast du Hunger?«
»Großen«, antworte Gaius und nickte hastig. Wie die anderen Passagiere hatte auch er bei der Überfahrt seinen Proviant selbst mitbringen müssen – und seine letzte Ration hatte er bereits am Vortag vertilgt.
Sie betraten eine der vielen kleinen Tabernae, die sich vor den Lagerhallen am Hafen befanden. Dicht gedrängt saßen die Seeleute und Händler an den kleinen Tischen, die kaum genügend Platz für Teller und Becher boten. Man wies ihnen einen Tisch zu, von dem aus sie das geschäftige Treiben am Hafen beobachten konnten, und es dauerte nicht lange, da brachte ihnen der Wirt einen deftigen Eintopf aus Getreide und Linsen, über den Gaius sich mit Heißhunger hermachte. Die Seeleute an den Nachbartischen erzählten von Gefahren, die sie überstanden hatten, und mit jedem Schluck Bier sprachen sie erregter über die Probleme, die ihnen bei der nächsten Reise noch bevorstanden.
»Nimm doch die Route über Spanien«, sagte ein braun gebrannter Mann mit geschorenem Kopf. »Die Erde ist rund, sagen die Gelehrten. Warum also sollte man nicht auf diesem Weg nach Indien fahren können?«
»Woher willst du das wissen?«, widersprach ein Zweiter mit syrischem Akzent. »Dann stürzt du am Ende des Meeres in den Hades!« Krachend schlug er mit seiner Hand auf den Tisch.
»Seneca schreibt, es wären nur einige Tagesreisen von Spanien nach Indien«, entgegnete der Erste und machte dabei eine ausladende Handbewegung, als wolle er eine Rede halten. »Ein so berühmter Schriftsteller muss doch wissen, worüber er spricht.«
Gaius hatte bemerkt, dass Dionysius dem Gespräch der beiden Männer aufmerksam folgte. Nach der letzten Bemerkung des Kahlköpfigen über Seneca drehte er sich zu den Seeleuten um und sagte: »Verzeiht mir, wenn ich mich einmische. Aber der Weg von Spanien nach Indien kann nicht nur wenige Tage betragen. Wir kennen die Ostroute und damit die Entfernung von Alexandria nach Indien. Ebenso wissen wir seit langem, wie groß der Umfang der Erde ist. Mit einer einfachen Rechnung sieht man sofort, dass eine Fahrt von Spanien nach Indien mehrere Monate dauert, selbst bei günstigen Winden. Wenn Ihr also etwas über die Natur dieser Welt erfahren wollt, fragt nicht die Schriftsteller, egal, wie berühmt sie sind, sondern die Mathematiker. Die wissen, worüber sie reden.«
Verdutzt starrten die Seeleute Dionysius an. Dank der Menge an Bier, die sie bereits getrunken hatten, dauerte es eine ganze Weile, bis sie begriffen, dass Dionysius ihnen beiden widersprochen hatte. Dionysius nickte den Männern zu und wandte sich dann wieder an Gaius.
»Du siehst, mein Sohn, es ist die Unwissenheit, die uns irreführt, nicht der Verstand.«
Noch immer diskutierten die Männer aufgeregt. Einer von ihnen legte seinen Daumen zwischen Zeige- und Mittelfinger der geballten Faust und deutete damit zu Dionysius herüber.
Gaius ärgerte sich über diesen Mann. Er hätte es verstanden, wenn sie Dionysius in seinen knappen Worten nicht folgen konnten, doch dass sie ihn mit dieser scheußlichen Geste beleidigten und hinter seiner Bemerkung etwas Teuflisches vermuteten, erboste ihn. Wieso klammerten sich Menschen lieber an Vermutungen und Althergebrachtes, als einer bestechend klaren und fundierten Argumentation zu folgen?
Gaius zögerte, als er merkte, wie er über die Männer urteilte. War ihm vorhin nicht der gleiche Fehler unterlaufen, als Dionysius ihm das Ankunftsdatum seines Schiffes erklärt hatte? Auch er hatte in der Benutzung des Verstandes einen Widerspruch zu seinem Glauben gesehen. Gaius schüttelte innerlich den Kopf und wandte sich dann wieder an Dionysius.
»Wohin seht Ihr, Vater?«, fragte er Dionysius, der mit großen Augen zum Hafen hinüberblickte.
»Das ist doch Silas!«, antwortete er freudig. »Silas!«, rief er ihm zu, »Silas!«, und schwenkte dabei den Arm.
Ein drahtiger junger Mann kam mit schnellen Schritten auf sie zu. Er wandte einmal kurz den Blick nach hinten, dann begrüßte er Dionysius mit einem freudigen Lächeln und die beiden Männer nahmen sich in die Arme.
»Dionysius, wie freut es mich, dich als Ersten in Alexandria zu treffen!«
»Hast du dein Ziel erreicht?«, fragte Dionysius.
Silas strahlte über das ganze Gesicht. »Ich war in Sinae!«
»Sinae?«, fragte Gaius.
»Verzeih, Silas«, sagte Dionysius. »Ich vergaß, dir meinen neuen Schüler, Gaius, vorzustellen. Gaius, das ist Silas, ein alter Freund von mir und Kapitän eines Schiffes, das offensichtlich gerade von Sinae zurückgekehrt ist – oder China, wie es einige nennen.«
Erwartungsvoll blickte er zu Silas und deutete auf den leeren Stuhl an ihrem Tisch.
»Setz dich zu uns, mein Freund. Du musst viel zu erzählen haben!«
Gaius sah Silas bewundernd an. Er hatte von Sinae wie von einem mythischen Land in weiter Ferne gehört. Und dieser Mann, der gerade einmal dreißig Jahre alt sein mochte, soll in dieses Land gereist sein?
»Es war eine wahrhaft bemerkenswerte Reise! Sie führte uns dreißigtausend Stadien weiter nach Osten, als Alexander der Große jemals gekommen war!«
»Entschuldigt«, unterbrach Gaius noch einmal, »aber draußen sind Soldaten – und sie kommen in die Taberna.«
Erschrocken drehte Silas sich um.
»Sie wollen meine Karte«, sagte er leise und hielt sich dabei die Hand vor sein Gesicht.
»Welche Karte?«, fragte Gaius.
Dionysius unterbrach Gaius mit der erhobenen Hand.
»Silas, gib mir die Karte, schnell. Komm in den nächsten Tagen in mein Haus.«
Silas zögerte. Doch als die Soldaten näher kamen, reichte er Dionysius unter dem Tisch eine Pergamentrolle. Der schob sie unter seine Toga, legte etwas Geld auf den Tisch und verließ mit Gaius die Taberna. Aus dem Augenwinkel konnte Gaius noch erkennen, wie die Soldaten Silas von seinem Hocker zogen. Erschrocken sah Gaius zu Dionysius, doch der fasste ihn nur am Arm und drängte ihn in das Menschengetümmel.
»Was ist mit dieser Karte?«, fragte Gaius atemlos.
Dionysius antwortete nicht, sondern zog ihn weiter durch die belebte Straße, vorbei an Ständen und großen Warenlagern. Schließlich blieb er stehen, stellte sich auf seine Zehenspitzen und sah in die Richtung, aus der sie gekommen waren.
»Sie verfolgen uns nicht«, sagte er schließlich und sie gingen langsam weiter. »Du hattest nach der Karte gefragt.«
Gaius nickte.
»Silas ist ein außergewöhnlicher Seemann. Deshalb bin ich sicher, dass er eine Karte sämtlicher Meere, Küsten, Städte und Flüsse seiner Reise gezeichnet hat. Eine solche Karte ist unbezahlbar.«
»Und die wollen sie ihm wegnehmen?«
»Du musst wissen, mein Sohn, dass es seit der Gründung der Bibliothek von Alexandria ein Gesetz gibt. Danach wird von allen Büchern und Karten, die nach Alexandria kommen, eine Kopie für die Bibliothek erstellt. Bei Büchern wird das Gesetz schon lange nicht mehr angewandt, bei Karten allerdings schon. Wenn es eine Kopie gibt, dann könnten die Römer, aber auch andere Seefahrer dieses Wissen nutzen, für das Silas sein Leben und sein Vermögen aufs Spiel gesetzt hat. Außerdem müsste Silas mitunter sehr lange auf seine Karte warten, denn das Erstellen einer Kopie nimmt viel Zeit in Anspruch. Aber das wirst du im Museion bald mit eigenen Augen sehen können. Und wo wir schon davon sprechen …« Dionysius blieb stehen, atmete tief durch und zeigte auf eine Mauer aus hellen Steinquadern, die sich nur wenige Schritte vor ihnen in die Höhe streckte. »Dies ist die Rückseite des Museions. Es war einmal das Herz von Alexandria. Die bedeutendste Forschungsstätte der bekannten Welt.«
Gaius hatte bisher nur außergewöhnliches über das Museion von Alexandria gehört.
»Was meint Ihr damit?«, fragte er vorsichtig. »Das Museion ist doch noch immer das Zentrum der Gelehrsamkeit.«
»Das ist wohl wahr. Zu seiner Gründungszeit hatten zunächst die Ptolemäer und später die römischen Kaiser die Wissenschaften in Alexandria überaus großzügig gefördert. Die Gelehrten lebten, lehrten und forschten hier im Tempel der Musen. Sie hatten Zeit, sich ganz den Wissenschaften zu widmen. Deshalb kamen viele berühmte Männer nach Alexandria: Aristarchus von Samos war der Erste, der erkannte, dass die Erde sich um die Sonne dreht. Eratosthenes war der Erste, der den Durchmesser der Erde genau berechnen konnte. Euclides, der Vater der Geometrie, Apollonios, der große Geometer, und Archimedes, der größte aller Mathematiker, lehrten hier.«
Beim Klang dieser Namen fingen seine Augen für einen kurzen Moment an zu leuchten.
»Doch dann brauchte Severus Antoninus vor etwa vierzig Jahren Geld für die Finanzierung seiner Therme in Rom. Da hat er kurzerhand die Gelder für das Museion gestrichen. Beliebt hat es ihn nicht gemacht – und die Wissenschaften haben dauerhaften Schaden genommen.«
Enttäuscht sah Gaius Dionysius an. Er spürte den Schmerz, der in seiner Stimme mitklang.
»Doch auch wenn die großen Zeiten vergangen sind«, sagte Dionysius, »Alexandria ist immer noch die bedeutendste Forschungsstätte. Wer Prunk sucht, geht nach Rom. Wenn du lernen willst, kommst du hierher.«
Plötzlich erklangen laute Rufe. Gaius blickte sich um und entdeckte einige Soldaten, die in ihre Richtung zeigten.
»Schnell!«, rief Dionysius, packte Gaius am Arm und lief mit ihm eine kleine Straße hinunter. Erstaunlich behände bahnte sich der Gelehrte seinen Weg durch die Menschenmenge, die sich träge zwischen den Marktständen bewegte. Doch die Gefahr war noch nicht gebannt. Die Rufe der Soldaten wurden lauter. Es würde nicht mehr lange dauern und die Soldaten hätten sie eingeholt.
Ihre Verfolger drängten sich an dem Obststand vorbei, über den Gaius noch vor wenigen Sekunden fast gestolpert wäre. Wieder zeigte ein Soldat auf sie und rief einen kurzen Befehl über die Menschenmenge hinweg. Gaius folgte seinem Blick und entdeckte einen weiteren Soldaten, der sich ihnen von der anderen Seite aus näherte.
»Vater, gleich haben sie uns!«
»Ruhig, mein Sohn. Sieh lieber nach vorne. Von hinten kommt die Angst, der Ausweg liegt vor dir.«
Dionysius zog Gaius in eine schmale Gasse. Es sah wie der ideale Fluchtweg aus. Hinter den vielen Ständen würden die Soldaten sie schon bald nicht mehr sehen können. Eilig suchten sie sich einen Weg zwischen den Passanten hindurch, bis die Straße eine Kurve machte.
Es war eine Sackgasse!
6
Settignano, Florenz
Ein lauer Wind wehte vom Tal her durch die Olivenhaine und schickte den Duft des frühen Sommers hinauf in die Hügel. Noch stand die Sonne ein Stück über dem Horizont. Später würde sie ihr Purpur in den Dunst der Hügel tauchen, die sich sanft hinter der Stadt erhoben. Die Kuppel von Santa Maria della Fiore ragte stolz aus dem Meer ehrwürdiger Gebäude hervor, und der Turm des Palazzo Vecchio erinnerte an die Zeiten alter Macht und großen Reichtums in Florenz.
Die ersten Gäste fuhren über die von stattlichen Zypressen gesäumte Allee hinauf zu dem Herrenhaus. Auf der großzügigen Terrasse liefen die Kellner und verteilten die Champagnerflaschen in die mit Eis gefüllten Sektkühler. Antipasti standen auf den Tischen und von der Küche her zog der verführerische Duft der nachfolgenden Gänge ins Freie.
Alessandro Gondi ging über die Terrasse und nahm die letzten Korrekturen an den Positionen von Gläsern und Stühlen vor. Dann stellte er sich in die Mitte der geschwungenen Stuhlreihe, auf der bald seine Gäste Platz nehmen würden, und überzeugte sich von der tadellosen Umsetzung seiner Anweisungen.
Gondis Haare waren kurz geschoren, wie sein Dreitagebart. Eine Nickelbrille mit runden Gläsern, schlicht und markant, aber sehr teuer, umrahmte seine wachsamen braunen Augen, denen nichts Wichtiges entging. Die lange Hakennase, die er stolz wie eine Auszeichnung zur Schau stellte, dominierte sein Gesicht. Für den Abend hatte er sich einen hellen Sommeranzug schneidern lassen, dessen Sakko er lässig geöffnet trug.
Als die ersten Gäste auf der Terrasse erschienen, lief Gondi mit ausgestreckten Armen auf sie zu.
»Herr Abgeordneter, welche Freude! Signora, es ist mir eine Ehre, Sie nun auch kennenlernen zu dürfen.«