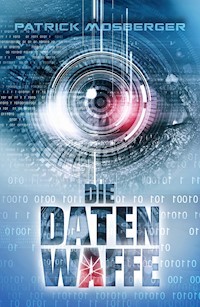
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Die zwei jungen Schweizer Kai und Philipp entwickeln eine Software, die vollkommen neue und enorm wertvolle Daten von Smartphone-Nutzern generiert. Diese Daten haben einerseits das Potenzial, die gesamte Online-Branche auf den Kopf zu stellen, andererseits sind sie so beschaffen, dass sie in den falschen Händen zu einer gefährlichen Waffe werden. Die revolutionären technischen Möglichkeiten sowie die Aussicht auf fette Gewinne ziehen das Interesse der Internet-Giganten, der Cybercrime-Szene aber auch der Datenschützer auf sich. Mehr und mehr geraten Kai und Philipp zwischen die Fronten unberechenbarer Mächte. Ganz plötzlich spielen die beiden Freunde in ein und derselben Liga mit großen, aber auch äußerst gefährlichen Namen und Organisationen. Der Programm-Quellcode wird zu Kapital, Bürde und Gefahr in einem. Und dann gibt es da noch Simona, die ganz andere Wertmaßstäbe hat als Philipp, der sich heillos in sie verliebt hat. Ihre leidenschaftliche Beziehung wird auf eine harte Bewährungsprobe gestellt. Ein Konflikt um Liebe, Moral und Geld entbrennt. Werden Kai und Philipp die richtige Entscheidung treffen? Können sie im Kampf gegen Gier und Macht in einer dunklen Welt bestehen?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 581
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Patrick Mosberger
Die Datenwaffe
Ein Wirtschaftskrimi
© 2017 Patrick Mosberger
Verlag und Druck: tredition GmbH, Grindelallee 188, 20144 Hamburg
ISBN
Paperback:
978-3-7439-2441-3
Hardcover:
978-3-7439-2442-0
e-Book:
978-3-7439-2443-7
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Die Datenwaffe
Patrick Mosberger
Kapitel 1: Simona
Im Oktober dieses Jahres fanden Wahlen statt. Tausende Selbstdarsteller und bekennende Volksversteher präsentierten sich im vermeintlich besten Licht in unzähligen Wahlveranstaltungen in den Schweizer Städten. Es gab kleine Menschen mit kleingeistigen Anliegen und große Denker, die mit bedeutenden Mienen wahrlich Gescheites von sich gaben. Ich saß in einem Straßencafé, in dessen unmittelbaren Nähe sich eine Partei auf einer improvisierten Bühne um Wählerstimmen bemühte. Es war die Rede von Zuwanderung und dessen Bedeutung für die Schweiz. Die Partei war dafür.
Ein paar Dutzend Menschen versammelten sich vor der kleinen Bühne und ein leicht untersetzter Politikanwärter gab seine Meinung zum Besten. Er wolle dafür sorgen, dass die Schweiz ein weltoffenes Land bleibe. Er werde denen in Bern beweisen, dass die Schweiz keine Insel sei, meinte er mit lauter Stimme und erhobenem Zeigefinger. Nach jeder seiner Parolen gab er dem Publikum die Chance, ihm zu applaudieren. Mit wichtiger Miene blickte er in die Runde und versuchte, so etwas wie Stimmung zu erzeugen. Die Zuhörer wechselten. Es kamen neue dazu; die hielten kurz inne und gingen wieder weiter. Nur wenige blieben einige Minuten stehen und zu diesen gehörte eine junge Frau mit schulterlangen, blonden Haaren.
Fast regungslos stand sie da und lauschte den Parolen des Untersetzten. Sie klatschte nie, aber ihre Mimik änderte sich laufend, so dass es nicht schwer war, ihre Zustimmung oder Ablehnung zum jeweils Gesagten zu erkennen. Viel bemerkenswerter aber war der Umstand, dass die Frau kaum ein paar Sekunden lang allein dastand. Es gesellten sich immerzu neue Menschen an ihre Seite. Fast schien es, als zöge sie eine Art magische Kraft zu ihr hin. Sie standen dann vielleicht einen halben Meter von ihr entfernt, hielten inne, hörten kurz zu und verschwanden wieder. Kaum war ein Platz in ihrer Nähe frei geworden, wurde dieser sogleich wieder von einem neuen Zuhörer eingenommen. Es war nicht so, dass da Platzmangel herrschte, keineswegs. Es gab mehr als genug andere Möglichkeiten, sich vor der Bühne zu platzieren.
Ich hatte längst meine Zeitung gesenkt und war der seltsamen Szenerie mit großem Interesse gefolgt. Der leicht Dickliche auf der Bühne hatte inzwischen einem Kollegen Platz gemacht. Die Stimmlage änderte sich, die Botschaften ähnelten sich.
Die blonde Frau blieb noch eine Weile stehen und ging dann langsam weiter. Sie trug schwarze Lederschuhe mit flachen Absätzen, blaue Jeans, eine etwas zu große rote Jacke und eine ziemlich voluminöse schwarze Handtasche, wie es sie wohl in jedem Warenhaus zu kaufen gab. Die Frau war alles andere als eine auffällige Person, zwar war sie durchaus attraktiv, von schlanker Statur, jedoch auf keine Art irgendwie optisch markant. So gab es keinen erkennbaren Grund, wieso sich wildfremde Menschen gerne in ihre Nähe begaben.
Ich legte Geld auf den Tisch, faltete meine Zeitung und ging ihr nach. Einige hundert Meter weiter blieb sie stehen und betrachtete die Auslage in einem Schaufenster. Es war nicht zu erkennen, was da ihre Aufmerksamkeit erregte, aber es vergingen kaum ein paar Sekunden, bis sich weitere Menschen neben sie stellten und ebenfalls in das Schaufenster blickten. Nach kurzer Zeit drehte sich die Frau um und ging weiter, worauf auch die anderen sich nach und nach wieder von der Auslage entfernten. Das gleiche Schauspiel wiederholte sich noch ein, zwei Mal, bis ich sie in einem Buchladen verschwinden sah. Einen Moment lang zögerte ich, dann entschloss ich mich, ihr zu folgen. Im Laden interessierte sie sich für eine autobiografische Neuerscheinung eines bekannten deutschen Politikers. Sie nahm ein Buch vom riesigen Stapel und las den Klappentext. Ich tat es ihr gleich, allerdings schnappte ich mir wahllos ein Buch von einem anderen Stapel. Es handelte sich um ein Kochbuch, was mir ausreichend unauffällig erschien. Neben ihr standen alsbald weitere Menschen, die sich für das Lebenswerk des Alt-Politikers zu interessieren schienen. Sie hatte inzwischen in der Mitte des Buches eine Seite aufgeschlagen und las einige Zeilen. Das war meine Chance. Ich näherte mich der kleinen Menschenansammlung, stellte mich genau neben die Frau und sprach sie an.
„Hat der alte Mann etwas zu sagen?“
Sie hob den Kopf und sah mir direkt in die Augen. Der Blick war sehr bestimmt, hatte etwas absolut Reines und gleichzeitig unerklärbar Vertrautes. Ich spürte, wie mein Puls hochging, wie mein Mund austrocknete und wie ich mit jeder Sekunde mehr bereute, dass ich sie angesprochen hatte. Sie legte das Buch zurück auf den Stapel und wandte sich mir zu.
„Ja, das hat er.“
Sprachs und drehte sich von mir weg. Mein Herz raste und vermutlich hatte meine Gesichtsfarbe etwas von Tomate. Hastig legte auch ich mein Exemplar zurück und folgte ihr.
„Hören Sie!“, rief ich ihr nach.
Sie drehte sich unerwartet rasch um und blickte mir wieder direkt in die Augen.
„Ja?“, meinte sie freundlich.
„Ich, ähh, meine, ähh, ich möchte ...“
Sie lächelte kurz und schickte sich schon an weiterzugehen, als ich stammelte: „Ich habe einen Job für Sie.“
Ihr Blick veränderte sich, sie schien nicht so recht zu wissen, wie sie darauf reagieren sollte. Keine zwei Sekunden später lachte sie mich an.
„Danke, ich habe schon einen Job.“
Mit diesen Worten drehte sie sich abermals von mir weg und ließ mich in der Buchhandlung zurück.
Als ich zu Hause angekommen war, rief ich Kai an.
„Kai, ich habe sie gefunden. Sie ist perfekt.“
„Wen hast du gefunden und für was ist sie perfekt?“, wollte Kai wissen.
„Ich habe dir doch erzählt, dass wir für MOM noch eine Person brauchen. Ich habe sie gefunden!“
Am anderen Ende des Telefons blieb es ruhig. Eine ganze Weile lang sagte niemand von uns etwas, dann meinte Kai: „Wer ist sie und was hat sie bisher gemacht?“
„Keine Ahnung, ich weiß weder ihren Namen noch sonst irgendwas von ihr.“ Noch während ich die Worte aussprach, merkte ich, wie dumm und naiv sich diese anhören mussten. Rasch fuhr ich fort: „Sie hat eine phantastische Aura, eine unglaubliche Anziehungskraft, sie scheint so rein und natürlich und sie wird MOM zum Durchbruch verhelfen. Glaube mir, sie ist die Richtige!“
Kai lachte mich aus: „Und woher kennst du sie? Aus der Kirche, wo sie den Armen hilft?“
„Nein, aber hör mir zu.“
Ich erzählte ihm die Geschichte, wie sie sich am Nachmittag zugetragen hatte, und Kai unterbrach mich nur, um gelegentlich eine Frage zu stellen. Wir redeten eine ganze Weile miteinander und ich versprach, die Frau zu finden und sie beim nächsten Mal für unsere Sache zu gewinnen. Nach dem Telefonat setzte ich mich an den Computer und blieb dort einige Stunden. Meine Motivation war nun noch größer. Ich wusste, dass wir an etwas ganz Großem dran waren.
Es vergingen mehrere Wochen, in denen Kai und ich MOM weiterentwickelten. Während er die mathematischen und technischen Berechnungen vorantrieb, kümmerte ich mich um die eher organisatorischen Belange. Wir kamen gut voran, aber wir wussten auch, dass wir da eine Software entwickelten, die nicht einfach zu verkaufen sein würde. Wir hatten es bisher vermieden, andere Leute ins Boot zu holen; unsere Idee schien uns einerseits zu gut, um anderen davon zu erzählen, bevor wir sicher waren, dass sie nicht kopiert werden konnte, andererseits wussten wir sehr wohl um die Brisanz des Projekts. Allerdings hatten wir einige Leute, die uns unterstützten, ohne konkret zu wissen, worum es ging.
Da war zum einen Raul, ein Programmierer in Barcelona, den wir noch nie in echt gesehen hatten. Wir verkehrten über Skype, über Chat oder per Telefon, aber er blieb stets in Spanien, während wir in Zürich arbeiteten. Raul war ein grob geschätzt vierundzwanzigjähriger Student, der sich bestens mit den meisten Handy-Betriebssystemen auskannte. Egal ob Apples iOS, Prideos oder Windows Mobile – er kannte sich damit aus. Raul wurde von uns bezahlt für Leistungen, die er wohl auch gratis gemacht hätte. Wir hatten uns in einem Forum kennengelernt, als er einem Applikationsentwickler erklärte, was dieser da alles für „rubbish“ programmiert hatte. In Rauls Augen waren die meisten Programme „rubbish“; er benutzte dieses Wort mehr als jedes andere.
Der Spanier war unglaublich schnell, wenn es darum ging, unseren Quellcode innerhalb der gängigen Betriebssysteme zu testen und Fehler zu eliminieren. Ich schickte ihm selbstverständlich nicht den ganzen MOM-Quellcode, sondern stets nur Fragmente. Er brauchte nie länger als ein paar Stunden, um mir diese zurückzuschicken, mit Korrekturen hier und da, Verbesserungen oder Hinweisen. Ich bezahlte ihn ohne Vertrag und ohne Tarifliste, je nachdem, wie wertvoll mir seine Arbeit erschien. Einmal überwies ich Raul achthundert Euro, worauf er sich bedankte, als hätte ich ihm ein Auto geschenkt. Ab jenem Zeitpunkt war er fast rund um die Uhr online. Da er sonst keiner mir bekannten bezahlten Arbeit nachging, hatte ich Rauls Support für vierundzwanzig Stunden am Tag, sieben Tage die Woche.
Dann war da noch Sergei, der irgendwo in Moskau lebte. Sergei machte im Internet Dinge, die wohl in die Kategorie „illegal“ gehörten. Ich wollte nie wissen, was er da genau trieb, aber er hatte Kenntnisse, die für uns von größtem Wert waren. Sergei und ich hatten uns erstmals bei einem Kongress in London zum Thema Cyberkriminalität getroffen.
Wir saßen nebeneinander in einem großen Saal und lauschten den Worten eines renommierten Sicherheitsspezialisten. Schnell kamen wir ins Gespräch und ich erkannte schon bald, dass er auf der „anderen Seite“ wirkte. Er machte auch nicht wirklich ein Geheimnis daraus, aber der Umstand, dass er sich offenbar seriös informierte und derartige Kongresse besuchte, machte großen Eindruck auf mich.
Er gab mir eine selbstgemachte Visitenkarte, auf der nur eine kryptische Skype-Adresse und der Name „Sergei“ standen. Ich bot ihm meine Karte an, aber er würdigte sie noch nicht einmal eines Blickes. Er meinte nur, er bräuchte sie nicht, denn ich würde ihn kontaktieren. Wir verabschiedeten uns höflich, und seither bin ich Sergei nie mehr gegenübergestanden. Aber er sollte Recht behalten: Es vergingen nur wenige Wochen, bis ich ihn kontaktierte.
Ich wusste eigentlich nichts über ihn, aber er half mir in einigen heiklen Angelegenheiten. Immer wenn ich das Gefühl hatte, mich zu sehr vom legalen Weg entfernen zu müssen, war er mein Mann. Er nahm die Aufträge entgegen und führte sie aus. Wir hatten nie über Bezahlung gesprochen; er hatte nie danach gefragt. Ich wünschte mir, wir hätten das geregelt, aber irgendwie war es wohl nun zu spät dafür.
Der letzte Mann in unserer speziellen „Familie“ war Felix. Er arbeitete als Game-Designer in einem kleinen Start-up-Unternehmen in Zürich. Felix hatte die Gabe, Dinge so einfach und so reduziert auf das Wesentliche zu gestalten, dass auch Puristen kaum etwas auszusetzen hatten. Da gab es nur wenige Farben, die man hätte verurteilen können, da gab es keine Schnörkel und keine überflüssigen Ecken und Kanten. Felix verband Funktion und Form auf das Perfekteste, aber Felix wusste leider auch um den Wert seiner Fähigkeiten. Er erhielt seine Aufträge von Kai, und das lief immer so ab, dass er einen Preis nannte, den Kai nicht zahlen wollte. Sie einigten sich nach einem schier endlosen Chatverkehr auf einen Betrag, wonach Felix dann endlich seine Arbeit aufnahm. Er brauchte in der Regel nicht allzu lange zur Fertigstellung, was Kai im Nachhinein noch viel mehr in Rage brachte, weil ihm so bewusst wurde, dass er wieder viel zu viel bezahlt hatte.
Felix trafen wir gelegentlich zu einem Meinungsaustausch; er war achtundzwanzig Jahre alt, groß und eher schlaksig. Er trug Kleidung, die so gar nicht zu seiner minimalistischen Arbeit passen wollten, und er lebte in einer Wohngemeinschaft mit mehreren Frauen.
Es war inzwischen Winter geworden. Meine Erinnerung an die Begegnung mit der Frau aus der Buchhandlung war hellwach, gleichzeitig war sie fast schon so etwas wie ein Mythos geworden. Längst glaubte ich nicht mehr an ein Wiedersehen. Ich besuchte diese Buchhandlung fast jeden Samstag in der Hoffnung, die blonde Frau dort anzutreffen – vergeblich. Wahlveranstaltungen gab es längst keine mehr, der leicht Untersetzte hatte es tatsächlich geschafft, genügend Wählerstimmen zu bekommen. Er residierte nun in Bern im Parlament, wo er versuchte, sich seiner Wahlversprechen zu erinnern.
Und dann, an einem kalten, regnerischen Tag, vollkommen unerwartet, sollte ich sie doch wiedersehen. Ich betrat ein Restaurant in Zürichs Altstadt, legte meinen Mantel ab, stellte den Schirm in den dafür vorgesehenen Ständer und wandte mich in den Raum. Es waren nur wenige Leute im Lokal, und an einem der Tische saß – sie.
Sie trug die blonden Haare ein wenig anders, aber nichtsdestotrotz erkannte ich sie sofort. Mit gesenktem Kopf saß sie vor einem Buch, neben ihr standen eine Flasche Wasser und ein halbvolles Glas. Ich setzte mich an einen Tisch in der Nähe und bestellte mir einen Kaffee. Nachdem mir dieser gebracht worden war, nahm ich all meinen Mut zusammen und sprach sie an.
„Hat Schröder nun wirklich etwas zu sagen?“
Sie hob den Kopf und sah zu mir hinüber. Den Blick genau in die Augen kannte ich schon, aber die Wirkung war wieder unerwartet.
„Er ist ein kluger Mann“, antwortete sie herausfordernd.
„Ja, das muss er wohl sein. Bundeskanzler ist auch nicht gerade ein einfacher Job.“
Sie lächelte und musterte mich gleichzeitig.
„Erinnern Sie sich an mich? Wir haben uns schon mal getroffen. In der Buchhandlung am Bellevue-Platz.“
„Ja, ich erinnere mich an Sie. Möchten Sie sich nicht zu mir setzen?“, fragte sie freundlich.
Ich brauchte keine fünf Sekunden, um den Tisch zu wechseln.
„Philipp“, sagte ich und streckte ihr die Hand entgegen.
Sie zögerte kurz, nahm sie dann und erwiderte: „Simona.“
Es herrschte eine eigenartige Stimmung zwischen uns beiden, irgendwie angespannt und doch sehr vertraut. Wenn ich sonst mit anderen Leuten an einem Tisch saß, hatte ich oft das Gefühl des Nicht-Dazugehörens, nicht aber bei ihr. Es war mir nicht klar, ob es an diesen unglaublich blauen Augen lag oder an der Ruhe, die sie ausstrahlte. Auf jeden Fall umgab sie eine Aura, die bewirkte, dass man sich in ihrer Gesellschaft sofort wohlfühlte.
„Na ja, Gerhard Schröder ist sicher ein interessanter Mann, aber muss man sein Buch wirklich lesen?“, gab ich zum Besten.
Sie sah mich mit ruhigem Blick an und fragte mit klarer Stimme: „Was ist das für ein Job, den Sie für mich haben?“
Kapitel 2: Das Agreement
Ich erzählte Simona von unserem Projekt, nannte ihr die Namen der anderen – Kai und Raul, nur Sergei ließ ich geflissentlich aus, das schien mir zu dem Zeitpunkt noch zu heikel – und erläuterte ihre jeweiligen Aufgaben. Ich erklärte ihr, was MOM dereinst werden sollte, welche Idee dahintersteckte und was die große Herausforderung war. Und ich versuchte, ihr zu veranschaulichen, was ihre Funktion dabei sein sollte. Sie hörte mir aufmerksam zu. Wir bestellten noch mehr Wasser und sprachen wenig über Software und viel über Ethik und Moral. Keiner von uns blickte auf die Uhr, aber es mussten bereits Stunden vergangen sein. Schließlich stand Simona auf und ging wortlos zum Kellner. Sie bezahlte und kam an meinen Tisch zurück, blieb aber stehen.
„Ich überlege es mir, ich rufe dich an. Gibst du mir deine Nummer?“
Hastig suchte ich in meinen Taschen nach einer Visitenkarte. „Natürlich, wenn man einmal eine Karte braucht ...“
„Sag mir nur deine Nummer, das ist alles, was ich brauche.“
“Ich nannte ihr meine Handynummer und sie verabschiedete sich.
„Sie heißt Simona“, berichtete ich Kai am nächsten Tag.
„Sie ist schätzungsweise fünfundzwanzig und arbeitet bei der Stadtverwaltung.“
„Bei der Stadt?“ Kai hob Stimme und Augenbrauen. „Sie hat nichts mit Marketing oder IT am Hut?“
„Ähh, nicht direkt.“
„Aha. Und indirekt?“
„Nun“, entgegnete ich, „sie ist studierte Physikerin und eine Art Botschafterin.“
„Eine Botschafterin?“
„Sie arbeitet beim Amt für Umweltschutz und treibt dort die Verwendung grüner Energie voran.“
„Grüne Energie?“
„Ja genau, das ist eine gute Sache, da versucht man, Strom aus Atomkraftwerken zu ...“
Kai unterbrach mich jäh: „Ich weiß, was grüne Energie ist! Bist du völlig durch den Wind? Wir können uns keine Person leisten, die keinen blassen Schimmer von dem hat, was wir hier machen!“
„Du unterschätzt sie. Sie versteht sehr wohl, was wir hier machen, sie ...“
Wieder unterbrach mich Kai, dieses Mal mit lauterer Stimme: „Du hast ihr von MOM erzählt?!“
„Nur ein wenig. Sie ist sauber, ich bin mir da ganz sicher.“
Kai war wütend und schrie, er sei enttäuscht von mir, ich sei leichtfertig und leichtgläubig und ich gefährde das ganze Projekt. Meine Versuche, ihn zu beruhigen, waren von wenig Erfolg gekrönt, ganz im Gegenteil.
„Du musst sie treffen!“, rief ich dazwischen.
Kai hielt in seiner Schimpftirade inne und blickte mich an.
„Ja, das muss ich in der Tat. Ich werde ihr sagen müssen, dass das alles nur ein Missverständnis sei, und ich werde mich bei ihr für dich entschuldigen.“
„Ja, tu das“, erwiderte ich. „Aber ich verlange von dir, dass du es ihr persönlich sagst. Schau ihr in die Augen, wenn du sie loswerden willst.“
Kai zögerte kurz, willigte dann aber ein.
„Das werde ich wohl müssen, nach all dem, was du ihr erzählt hast. Ich möchte mich versichern, dass sie dichthält. Hast du ihre Nummer?“
„Nein, sie wird mich anrufen. Ganz bestimmt.“ Kai verdrehte die Augen und schüttelte den Kopf.
Wir saßen noch eine Weile zusammen, besprachen dies und das und einigten uns über die nächsten Schritte. MOM war beinahe fertig, ein erster Prototyp lief sehr erfolgversprechend.
Es vergingen drei Tage, bis endlich der erlösende Anruf kam. Simonas Stimme klang durch das Telefon ungewohnt, aber sie hatte die gleiche Wirkung auf mich, als stünde sie neben mir.
„Hallo Simona, schön von dir zu hören!“
„Philipp, ich mache den Job, aber es gibt eine Bedingung.“
„Die da wäre?“
„Ich möchte die Ergebnisse für Non-Profit-Unternehmen nutzen können. Und ich werde nichts dafür zahlen. Ich nutze die Software und die gesammelten Daten so, wie ich das für richtig halte. Nur für Projekte, die ich auswähle, ganz allein. So viel ich will, so lange ich will. Ihr könnt die Daten verkaufen an wen ihr wollt, das ist euer Ding. Aber ich habe Zugang dazu, jederzeit.“
Ich überlegte einige Sekunden und antwortete: „Das scheint annehmbar, aber keine staatlichen Projekte, nur NGOs. Und du musst Kai überzeugen.“
Nun war sie es, die nachdenken musste.
„Was ist?“, hakte ich nach. „Was überlegst du?“
„Wer von euch beiden ist eigentlich der Boss? Kai oder du, Philipp?“
„Wir sind gleichwertige Partner, wir entscheiden gemeinsam, was uns wichtig ist.“
„Gut, dann möchte ich Kai sowieso treffen. Wann?“
„Wir sind immer donnerstagabends im Restaurant Viadukt bei der Josefswiese. Da kannst du uns beide treffen.“
„Okay, ich komme diesen Donnerstag hin, 19 Uhr?“
„In Ordnung, wir werden da sein.“
Wir legten auf und ich informierte Kai via Skype, dass uns Simona im Viadukt treffen wollte. Er willigte murrend ein.
Am Mittwoch rief mich mein Bankberater an.
„Guten Tag, Herr Wieland“, tönte es gar freundlich von der anderen Seite. „Wie geht es voran mit Ihrem Projekt?“
„Es geht voran.“
„Das freut uns! Wie Sie wissen, ist uns sehr daran gelegen, dass das Vorhaben ein Erfolg wird.“
„Ja, ich freue mich auch.“
„Nun, Herr Wieland, gemäß unserem Businessplan müssten ja ab Januar die ersten Umsätze kommen. Konnten Sie denn schon Kunden für Ihre Software gewinnen?“
„Nein, noch nicht, aber wir stehen kurz vor der Fertigstellung.“
„Oh, das ist ja wunderbar“, hallte es aus dem Hörer. „Dann wird es die App ja demnächst zu kaufen geben, oder?“
„Ja, vermutlich.“
„Wie heißt sie denn eigentlich?“
„Wer?“
„Na, die App.“
„Ah ja, sie heißt ...“ Ich zögerte einen Moment, weil mir nichts in den Sinn kam, was halbwegs plausibel klingen mochte. „Camme, die App wird wohl Cam-me heißen“, log ich.
„Das klingt sonderbar, aber Sie sind ja der Fachmann, Herr Wieland. Käm-mi, das tönt irgendwie schweizerisch.“
„Ist ja auch schweizerisch.“
„Nun gut, Herr Wieland, dann werde ich Sie mal wieder arbeiten lassen. Geben Sie mir Bescheid, wenn Sie Hilfe brauchen. Sie wissen ja, unsere Bank sorgt sich um Ihr Wohl.“
„Jaja, das werde ich. Einen schönen Tag noch, Herr ...“
„Nadeski, Herr Wieland, mein Name ist Nadeski, Petr Nadeski.“
Ich legte auf und öffnete meinen E-Banking-Account. Wenn dieser Schleimer anrief, musste das ja einen Grund haben. Schnell wurde mir klar, was die Ursache war. Der Kontostand war in den letzten Wochen bedrohlich ins Negative abgerutscht. Die Anschaffung der zwei Server für Kais Simulationsberechnungen hatte ein tiefes Loch in die Kasse gerissen. Wir mussten irgendwoher Geld auftreiben, sonst würde MOM eine Illusion bleiben.
„Kai, wir brauchen Geld!“, sagte ich in mein Headset.
Kai am anderen Ende lachte. „Ja, ich weiß, das ist ja nichts Neues.“
„Nein, diesmal ist es ernst. Wir haben keine 4.000 Franken Kreditlimite mehr.“
Kais Stimme wurde ernster. „Ja, das ist in der Tat nicht mehr viel. Und MOM ist noch lange nicht fertig.“
„Wie steht es mit Cam-me?“
„Womit?“
„Ich habe dem Banker eine kleine Notlüge aufgetischt. Wir werden demnächst eine App in den Verkauf bringen, die Camme heißt.“
„Ach, machen wir das? Und was kann diese App?“
„Keine Ahnung. Vielleicht kannst du ja die Kamerabilder auswerten und die Pupillenbewegungen verfolgen. Daraus lässt sich doch bestimmt was zaubern.“
Ich spürte förmlich, wie Kai überlegte.
„Hmm, gib mir einige Tage. Raul, Felix und ich werden das Ding schon schaukeln. Cam-me sagst du? Wie kommst du nur auf diesen beschissenen Namen?“
Am Donnerstagmorgen rief ich Sven Noermenn an. Er arbeitete bei Razzle in Zürichs Entwicklungszentrum. Razzle war weltweit die innovativste und bei Weitem einflussreichste Internet-Firma. Sie hatte die Zeichen der Zeit rechtzeitig erkannt und war vor rund zehn Jahren fast über Nacht entstanden. Seither wuchs die von Solomon Preston geführte Firma aus dem Silicon Valley in rasendem Tempo. Basis des Erfolgs war eine Internet-Suchmaschine, die sich zum Standard in der ganzen Welt gemausert hatte. Finanziert mit den unglaublichen Werbeeinnahmen aus dieser Suchmaschine hatte man auch ein erfolgreiches Betriebssystem, „Prideos“ für Smartphones, entwickelt, das sich in den letzten Jahren vor allem in den neuen Industrieländern immer weiter verbreitet hatte. Razzle konnte sich somit die größten Marktanteile sichern, und mittlerweile kam an dem Internet-Giganten und dessen Chef Preston niemand aus der Branche mehr vorbei. Es schien, als würde die erfolgsverwöhnte Firma schlicht alles zu Gold machen.
„Hallo Sven, how’s Razzle doing?“, rief ich locker in mein Phone.
„Philipp?! Hi, nice to hear from you. Wir können nicht klagen. Es läuft ganz gut.“
Sven und ich, wir hatten uns bereits während des Studiums kennengelernt. Er war eine echte Rakete in Sachen Softwareentwicklung, und soviel ich wusste, hatte er es bei Razzle schon zu einem gut dotierten Posten gebracht.
„Hör zu, Sven, ich bin da an was ganz Großem. Du kennst doch noch Kai Helstroem aus dem Studium. Er und ich, wir haben einen Code entwickelt, der für Razzle von großem Nutzen sein könnte.“
„Was für einen Code? Was kann das Teil?“, wollte Sven wissen.
„Das kann und will ich dir so auf die Schnelle nicht erklären, schon gar nicht, während ihr fleißigen Datensammler alles mitschneidet. Ich telefoniere mit Prideos, du weißt ja ...“
Sven lachte laut ins Telefon. „Philipp, wo denkst du hin! Also gut, was willst du von mir? Soll ich dich mit Raju Kandroharan zusammenbringen? Er ist unser Entwicklungsleiter für die nächste Prideos-Version in Europa.“
„Hat er was zu sagen bei euch? Ich meine, ist er eine große oder eine kleine Nummer?“
„Raju?“, rief Sven überrascht. „Du kennst Raju nicht? Er ist the one hier, ein Monument der Razzle-Geschichte, ein Titan! Er ist schon seit Jahren hier, er ist ...“
„Schon gut, schon gut“, unterbrach ich ihn. „Bring mich zusammen mit Raju. Er wird es nicht bereuen.“
„Okay, ich schau, was ich machen kann. Aber Philipp, wenn du mich hier verschaukelst, dann ...“
„Sven, ich garantiere dir, dass Raju Freude an unserem Code haben wird.“
„Gut, ich melde mich.“
„Danke, hast was gut bei mir.“
Dann kam der Donnerstagabend. Ich saß schon um 18:30 Uhr im Restaurant Viadukt. Um 18:55 Uhr traf Kai ein; er trug ein weißes Hemd zu seinen üblichen Jeans.
„Wow, Kai. Weißes Hemd! Gehst du nachher noch auf eine Hochzeit oder so?“, spottete ich.
Kai murmelte irgendetwas Unverständliches und setzte sich zu mir. „Wo ist deine Simona?“, fragte er sichtlich angespannt.
„Die wird schon kommen, ganz sicher. Komm, lass uns eine Flasche Wein bestellen.“
„Haben wir denn noch Geld für Wein?“, entgegnete Kai missmutig.
„Der geht auf mich, heute ist ein Tag zum Feiern. Du wirst schon sehen.“
Wir beugten uns gemeinsam über die Weinkarte und diskutierten über die eine oder andere mögliche Wahl. Als wir wieder hochsahen, erblickten wir beide gleichzeitig Simona, wie sie sich unserem Tisch näherte.
Ich konnte meine Freude kaum beherrschen; meine Mundwinkel zog es unweigerlich nach oben. Ich sah kurz rüber zu Kai und bemerkte, wie er Simona anstarrte. Sein Blick schweifte nicht über ihren Körper, so wie er das bei anderen Frauen zu tun pflegte. Nein, er schaute ihr unentwegt in die Augen, und sie erwiderte seinen Blick, ohne zu blinzeln, ohne wegzusehen. Das ganze Spiel dauerte nur einen kurzen Moment, aber ich wusste nur zu gut, was Kai da gerade passierte.
Simona begrüßte zunächst mich und reichte dann Kai die Hand. „Du musst Kai sein. Ich bin Simona.“
Mit einem eleganten Schwung entledigte sie sich ihrer roten Jacke und schon saß sie am Tisch. Kai hatte noch kein Wort gesagt, als sie mit einem Lächeln im Gesicht auf die Weinkarte deutete. „Ich bevorzuge einen spanischen. Da gibt es noch Weine, die ihr Geld wert sind.“
„Ja“, schloss ich mich an. „Nehmen wir einen Spanier. Einen Rioja oder so.“
Kai hatte sich inzwischen wieder einigermaßen gefangen und meinte trocken: „Jaja, einen Rioja. Soll mir recht sein.“
„Philipp hat mir viel über dich erzählt“, begann Simona. „Er hält viel von dir.“
„So, tut er das.“
„Ja, er denkt, dass MOM nur dank dir zu einem Erfolg werden wird.“
„Soso.“
„Ach, komm jetzt, mach es mir nicht so schwer, Kai. Ich beiße nicht, ich will euch helfen.“
„Wie willst du uns denn helfen? Hast du Erfahrung in der Softwareentwicklung?“, erwiderte Kai.
„Nein.“
„Hast du Ahnung davon, wie man eine Software verkaufen kann?“
„Nein.“
„Hast du ...“
Sie unterbrach ihn lachend. „Wird das hier ein Verhör? Ich weiß nicht genau, wie ich euch bei eurem Vorhaben helfen kann, aber Philipp hier ist der Meinung, ihr bräuchtet mich. Wenn du deinem Kollegen vertraust, dann werde ich euch sicher helfen können. Wenn du ihm nicht vertraust, und damit auch mir nicht, dann stehe ich jetzt auf und werde alles vergessen, was ich weiß. Ehrenwort.“
Einen Moment lang herrschte Stille.
„Bleib sitzen“, brummte Kai.
Ich atmete tief durch. Es war gekommen, wie ich es vermutet hatte: Simonas entwaffnende Art verfehlte auch bei Kai ihre Wirkung nicht.
„Dann also den Rioja!“, rief ich freudig und schlug die Weinkarte zu.
Kapitel 3: Der Köder
Am darauffolgenden Samstag trafen wir drei uns in meiner Wohnung, um uns auf das Meeting mit Raju, dem Entwicklungsleiter von Razzle, vorzubereiten. Ich schlug vor, ihm nicht nur die Idee von MOM, sondern auch erste Anwendungsmöglichkeiten vorzustellen. Kai wollte auf keinen Fall so weit gehen, solange wir diesen Raju nicht einschätzen konnten. Kais Absicht war es, nur eine vage Vision zu verkaufen, eine Idee, bei deren Realisierung uns Razzle unterstützen sollte.
Simona hörte unserer Diskussion aufmerksam zu, beteiligte sich aber nicht daran. Einig waren wir uns einzig darin, dass wir aufzeigen mussten, welchen Nutzen MOM bot, denn ein großer Fisch würde nun mal nur bei einem großen Köder anbeißen. Wir stellten also ein paar Präsentationsfolien zusammen und gaben uns Mühe, diese professionell aussehen zu lassen.
„Wir bräuchten dringend jemanden wie Felix hier“, bemerkte ich angesichts einer eher unglücklich gestalteten Seite.
„Er würde die Präsentation in null Komma nix auf Vordermann bringen!“, bestätigte Kai und warf dabei einen Seitenblick auf Simona, die sich auch bei diesem Thema bislang sehr zurückgehalten hatte.
„Ja, Wink verstanden“, sagte sie schmunzelnd und schnappte sich den Laptop. „Geht ihr zwei mal raus, holt euch ein Bier oder macht sonst was, was ihr Männer so tut. Lasst mich eine Stunde allein, dann sehe ich mal, was ich tun kann mit diesem Werk hier.“
Das ließen wir uns nicht zweimal sagen, schnappten unsere Winterjacken und waren aus der Tür. Wir beschlossen, dass die Idee mit dem Bier gar nicht so schlecht war.
Nach einer guten Stunde kehrten wir bester Stimmung in meine Wohnung zurück. Von Simona fehlte jede Spur.
„Verdammt, ich hab’s gewusst!“, brüllte Kai. „Sie hat MOM geklaut! Das war alles eine saublöde Idee. Wie konnten wir nur …“
In diesem Moment rammte mir jemand die Wohnungstür in den Rücken. Simona stand vor uns.
„Uii, sorry, das tut mir leid. Habe ich dir sehr wehgetan?“, fragte sie besorgt.
„Äh, nein“, grummelte ich und rieb meinen Rücken. „Wo warst du?“
„Ich war kurz unten, um die Parkscheibe an meinem Auto zu verstellen.“
Ich warf Kai einen raschen Blick zu. Der sah zwar noch immer erschrocken aus, aber seine Miene hellte sich deutlich auf, als er den Laptop auf dem Tisch sah.
„Zeig mal her, was du gemacht hast“, forderte er Simona auf und unterbrach so den unangenehmen Moment.
Simona führte uns durch die veränderte Präsentation. Sie hatte überall Dinge gelöscht, Details weggelassen und vereinfacht. Das Layout hatte sie ersetzt durch eines, das irgendwie recht „weiblich“ daherkam.
„Das ist weniger hart, weniger technisch“, meinte sie.
„Ja“, spottete Kai, „damit könntest du auch einen Wäschetrockner verkaufen“, was ihm prompt einen Boxhieb gegen die Schulter einbrachte.
„Hört her, ihr zwei Techies“, erklärte sie, „ihr verkauft keine Software, ihr verkauft keine Technologie, sondern ihr verkauft eine Vision, einen flüchtigen Blick in eine Welt, die bisher unsichtbar war. Es braucht keine technischen Details, es braucht nur eine Sekunde lang den Blick durch ein bisher verschlossenes Fenster. Gehen wir davon aus, dass dieser Raju ein waches Vorstellungsvermögen hat. Erklären wir ihm nicht die Technik, zeigen wir ihm stattdessen die Dinge, die er nicht zu träumen wagt. Er muss den Köder nicht schlucken, er muss nur daran riechen. Das reicht für das erste Treffen, nur riechen …“
Kai und ich waren skeptisch. „Und, wollen wir ihm zeigen, was wir schon haben?“, fragte Kai.
„Unbedingt!“, erwiderte Simona. „Aber nur andeuten. Fünf Minuten, keine Details. Gefühle, aber keine Technik. Lasst ihm seine Interpretation; er darf nicht alles sehen.“
Ich konnte dieser Frau ohnehin nichts abschlagen, und so war ich einverstanden.
„Okay, aber lasst uns noch kurz die Regie durchgehen: Wer sagt was, wer startet und so weiter.“
Die beiden anderen waren einverstanden und wir beendeten den Tag mit beschwingten Diskussionen und gemischten Gefühlen.
Am Montag rief mich Sven an. „Du kannst Raju morgen treffen“, sagte er nicht ohne Stolz.
„Wie hast du das denn so schnell hingekriegt“, wollte ich wissen. „Na ja, er kann eben priorisieren. Er weiß halt, dass es cool wird, wenn ich dahinterstehe“, erwiderte Sven lachend.
„Komm morgen um elf Uhr zu uns in die Turbinenstraße.“
„Danke, Sven, ich werde mich eines Tages revanchieren.“
„Yeah, Philipp, alles cool. Mach nur keinen Scheiß bei Raju. Ich hänge da mit drin, vergiss das nicht. Mach mir keine Schande!“
„Werde ich nicht, versprochen.“
Ich holte mir sofort meine Kollegen an den Schirm: „Macht euch parat, wir sind morgen um elf Uhr bei Razzle!“
Die beiden schwiegen einen Moment, um die Situation zu erfassen. Kai meldete sich zuerst: „Morgen? Aber ich muss noch meinen Anzug bei meiner Mutter abholen, ich muss noch zum Friseur und ich …“
„Vergiss es“, unterbrach ihn Simona. „Komm einfach pünktlich; deine Frisur wird Raju egal sein.“
Ich konnte mir ein Lachen nicht verkneifen und ergänzte: „Ja, Kai, deine Frisur sitzt.“
Kai strich sich über seine zwei Millimeter Haarpracht und wurde rot.
„Also, wir treffen uns um 10:30 Uhr bei mir, dann nehmen wir von hier aus die Straßenbahn. Wir werden rechtzeitig da sein und unterwegs können wir nochmals kurz die Dramaturgie durchgehen“, schlug ich vor.
„Ist gut“, meinte Simona. „Lieb auch von dir, dass du meine Agenda schon geprüft hast. Du erinnerst dich vielleicht: Ich habe noch einen anderen Job.“
„Tut mir leid“, entgegnete ich. „Das hatte ich total vergessen. Kannst du denn kommen?“
„Ja. Ich habe genügend Überstunden und mein Chef ist da ziemlich locker.“
Wir verabschiedeten uns mit dem Versprechen, pünktlich zu sein. Ich verwendete den restlichen Tag dazu, MOM auf meinem Handy nochmals in allen Einstellungen zu testen.
Wenn das nur gut geht, dachte ich mir. Was ist, wenn Raju die Sache nicht versteht? Und was erst, wenn er sie richtig versteht …
Am Dienstagmorgen wachte ich früh auf – sehr früh. Ich machte mir einen Kaffee und wartete, bis es hell wurde. Als Kai bei mir eintraf, hatte ich schon drei Tassen intus und war supernervös. Kai ging es ähnlich; er hatte seinen Laptop zu Hause liegen lassen und musste noch einmal zurückrennen. Jetzt sah er aus, als wäre er gerade einen Marathon gelaufen. Wir blickten alle naselang auf die Uhr und mutmaßten schon, dass Simona wohl doch nicht von der Arbeit loskam.
Dann war sie da. Und wie! Sie trug ein schwarzes Business-Kostüm, elegante Schuhe und einen Mantel, den sie locker über dem Arm trug. Ihre Haare hatte sie hochgesteckt und sie war dezent geschminkt. Kai und ich sahen sie eine gefühlte Ewigkeit an, bis einer von uns die Fassung wiederfand.
„Du siehst umwerfend aus“, konstatierte ich mit großer Bewunderung. Kai nickte zustimmend, ohne den Blick von ihr abwenden zu können.
„Nun aber los!“, sagte Simona. „Die Straßenbahn geht in ein paar Minuten.“
Wir packten unsere Sachen und liefen zur Haltestelle. Kurz vor elf Uhr standen wir vor dem Razzle-Gebäude. Sven erwartete uns beim Eingang.
„Ihr müsst euch registrieren. Ich rufe gleich Raju an; er wird euch dann in den Vorführraum bringen.“
Wir gehorchten schweigend und warteten nach der Registrierung im Foyer. Einige riesige Monitore wiesen auf die neuesten Razzle-Produkte hin. Ehrfurcht machte sich breit.
Dann kam Raju. Er war groß, schlank, indischer Abstammung, Ende dreißig. „Ich bin Raju.“ Er streckte uns einem nach dem anderen die Hand entgegen, zuerst Simona, dann uns. „Kommt rein“, meinte er freundlich.
Sven verabschiedete sich mit gerecktem Daumen und wir betraten die heiligen Hallen.
„Macht bitte keine Fotos“, bat uns Raju. „Wir versuchen hier, so einiges Neues auf den Markt zu bringen. Da wollen wir den Kunden die Überraschung doch nicht verderben.“
Wir nickten schweigend und folgten ihm durch die verschiedenen Räume. Überall saßen junge Leute; man hörte Sprachen aus aller Welt, vorwiegend aber Englisch. Raju führte uns in eine Art Kinosaal; es gab darin bestimmt dreißig Sessel, alle vollkommen unterschiedlich. Es gab rote Wangensessel, schwarze Ledersofas, braun gemusterte Stühle et cetera. Alle waren wie im Kino aufsteigend platziert, um von überall her beste Sicht auf einen gigantischen Monitor am Ende des Raums zu ermöglichen.
Raju setzte sich in die vorderste Reihe in einen alten abgewetzten Sessel und schlug die Beine übereinander.
„Na, dann legt mal los. Aber bevor ihr startet, erzählt mir etwas über euch.“
„Ich heiße Philipp Wieland, bin siebenundzwanzig Jahre alt. Ich habe zusammen mit Kai hier an der ETH einen Master in Informatik gemacht. Und nach einigen kleineren Arbeitseinsätzen habe ich mich ausgeklinkt und seither an der Entwicklung von MOM gearbeitet.“
Raju nickte kurz und wandte sich Kai zu.
„Mein Name ist Kai Helstroem, auch siebenundzwanzig Jahre alt und, wie Philipp schon erwähnt hat, ein Studienkollege. Ich jobbe nebenher in einer kleinen IT-Firma, wo ich mich auf mobile Betriebssysteme spezialisiert habe. Ist aber mehr so ein Hobby; den größten Teil meiner Zeit widme auch ich unserem Baby, MOM.“
„Danke, und wie heißen Sie?“ Damit wandte er sich an Simona, die bisher noch keinen Ton von sich gegeben hatte.
„Simona Meister“, gab sie zur Antwort. „Ich bin dreißig und habe einen Physik-Abschluss vom MIT.“
„MIT?“, raunte Raju mit großer Bewunderung in der Stimme. „Wow, was ist oder war Ihr Fachgebiet?“
„Meine Doktorarbeit befasst sich mit der Entwicklung einer neuartigen Ladetechnologie für Lithium-Polymer-Akkus.“
„Aha, spannend. Und ist die Technologie im produktiven Einsatz?“
„Ja, Patrick Sneider hat sich das Patent gesichert. Er will damit künftig seine BeeCars laden. Ist aber noch nicht serienreif, da fehlen noch ein paar Tests. Sicherheitsmechanismen und so.“
Kai und ich standen daneben und bekamen unseren Mund nicht mehr zu. Das hatte sie uns noch nicht erzählt!
Kai stupste mich leicht von der Seite an und flüsterte mir zu: „Sie ist schon dreißig?“ Ich zuckte mit den Schultern.
Raju stellte sich selbst auch vor, blieb dabei bescheiden und forderte uns schließlich auf, unsere Idee zu präsentieren.
„Gehen wir davon aus“, begann ich, „dass Razzle weiß, auf welche Links die Leute bei einer Suche klicken. Was gut ist, denn so funktionieren Keywords und die finanzierten Suchergebnisse. Was wäre nun aber, wenn jemand auch bei jeder beliebigen Internet-Seite wüsste, was die Menschen auf ihr genau machen? Ich meine damit nicht nur das Anklicken von Links, sondern schlicht jede Aktion, die einem Nutzer als Möglichkeit offensteht. Wäre das spannend für Razzle?“
„Ja, wäre es.“ Raju lachte. „Das wäre dann allerdings die totale Überwachung. Aber natürlich spannend, keine Frage.“
„Klar, man müsste die Klicks in Echtzeit mit dem gezeigten Inhalt der Screens koppeln – eine Mammutaufgabe. Das bräuchte viel Rechenleistung, sehr viel Rechenleistung …“
Raju biss an: „Sprechen Sie weiter, Philipp, fahren Sie fort.“
„Das wäre eine große Aufgabe im Sinne von Big Data. Nicht wahr, Kai?“ Bei diesen Worten wandte ich mich an meinen Kollegen.
„Grob gerechnet entstünden so rund siebzig Terabyte Daten – pro 100.000 User pro Tag.“
„Danke, Kai. Das ist eine große Menge Daten, die es da auszuwerten gäbe.“
„In der Tat, das nenne ich mal Big Data“, erwiderte Raju lachend.
„Aber der Lohn wäre beträchtlich. Was sich daraus ableiten ließe, wäre äußerst interessant. Welche Seite löst welche Reaktion bei den Menschen aus? Wer generiert mit was die meisten Klicks? Und so weiter. Das bräuchte viel Know-how in der Auswertung solcher Nutzungsdaten. Da gibt es nicht viele Firmen auf der Welt, die das beherrschen würden …“
„Wie bekommen Sie die Software auf das Gerät?“, unterbrach Raju.
„Nun, das kommt darauf an, wie weit die Verbreitung sein soll. Wenn es genügt, einige Tausend Menschen einer Zielgruppe zu tracken, dann am besten mittels einer eigenen App.“
„Und wenn es mehr sein sollen?“
„Dann könnte man den Code innerhalb einer anderen attraktiven App verpacken.“
„Das würde man dann einen Trojaner nennen, Herr Wieland“, wandte der Razzle-Entwicklungsleiter ein.
„So weit würde ich nicht gehen, aber ich gebe zu, dass eine gewisse Dehnung des moralisch Akzeptierten erforderlich wäre. Kai?“
„Es wäre nur dann illegal, wenn der Nutzer die Verwendung seiner Nutzungsdaten explizit untersagen würde. Das steht in den Regeln der AGB, die sowieso niemand liest.“
„Na, Sie sind gut! Eine Dehnung ist schön ausgedrückt. Das ist kaum zu vertreten!“, rief Raju.
„Es gäbe noch einen anderen Weg zur Verbreitung des Quellcodes“, warf ich ein. „Wir bauen ihn in ein Prideos-Update ein und packen eine äußerst nützliche Funktion darum herum.“
„Die da wäre?“
„Augensteuerung: Click what you see!“
Es dauerte eine Weile, bis die Worte ihre volle Wirkung entfalteten.
„Ihr steuert die Kamera an?“
„… und tracken die Pupillenbewegungen“, ergänzte Kai trocken.
„Raju, ist Ihnen das Potenzial dieser Technologie bewusst?“, fragte ich eindringlich.
Er schwieg.
„Lassen Sie mich noch eine Ergänzung machen“, fuhr ich fort. „Gehen wir davon aus, dass es jemandem gelingen würde, Seiteninhalte und Pupillensteuerung zeitlich zu verbinden, die Daten auszuwerten und zu vermarkten. Wäre es dann nicht auch möglich auszuwerten, wo der Nutzer eben nicht draufklickt? Dort, wo sie oder er eben nur draufblickt, ohne zu klicken? Kai?“
„Das ergäbe geschätzt weitere dreihundert Terabyte pro Tag, womit der Begriff Big Data dann fast schon untertrieben wäre. Ich glaube, nach Big Data spricht man von Huge Data.“
Raju wurde bleich. Man merkte, wie sehr er überlegte. Sicher, die Geschichte mochte unmoralisch sein, aber die Möglichkeiten waren unermesslich: die totale Kontrolle über die Nutzung der Mobiltelefone dieser Welt.
„Nun mal Klartext: Was davon könnt ihr Clowns wirklich?“, fragte er schließlich leicht genervt.
„Simona, dein Handy, bitte“, bat ich meine Kollegin. Sie stand auf, trat auf Raju zu und übergab ihm ihr Handy.
„Bitte, fühlen Sie sich wie zu Hause.“
Lässig drehte sie sich um und setzte sich wieder in ihren Sessel. Zweifellos hatte ihr Auftritt eine gewisse Wirkung auf den Manager; seine Augen wandten sich erst dann dem Smartphone zu, nachdem Simona wieder Platz genommen hatte.
Kai hatte inzwischen seinen Laptop an den Großmonitor gekoppelt und MOM gestartet. Sofort begann eine ungeheure Datenmenge über den Monitor zu flimmern. Immer wenn Raju seine Augen hob und vom Handy aufblickte, stoppte der Datenstrom. Er öffnete eine Internetseite und die Daten rauschten nur so vorbei. Er klickte mit dem Finger auf einen YouTube-Link und die Daten flossen wieder rasant.
Schließlich drehte Raju das Handy um, so dass das Display zum Boden zeigte und der Datenfluss stoppte.
„Gut, ich habe verstanden, dass ihr eine Menge Daten generieren könnt. Das kann Razzle auch“, sagte der Razzle-Manager scheinbar unbeeindruckt.
Kai öffnete ein weiteres Fenster, das den Augenverlauf und die gewählte Internetseite optisch genau anzeigte. Die Grafiken der Internetseite waren nur schemenhaft zu erkennen, hingegen wurde der Verlauf von Rajus Blicken millimetergenau dargestellt, mit Zeitverlauf. Der Kick auf YouTube war als roter Punkt zu erkennen.
Kai schwärmte: „Wir komprimieren die Bilder, damit können wir das Datenvolumen reduzieren. Ich bin noch dabei, einen Algorithmus zu entwickeln, der …“
Simona blickte ihn böse von der Seite an, und sofort bemerkte Kai seinen Fehler und verstummte.
„Wie bekommt ihr die Daten hoch?“, wollte Raju wissen.
„In Echtzeit. Wir schleusen sie am Datenvolumen der Provider vorbei, indem wir sie als Positionsdaten tarnen. Wir könnten auch darauf verzichten, aber dann müssten wir immer warten, bis ein WLAN zur Verfügung steht. Dadurch würden wir die Aktualität verlieren.“
„In Echtzeit?“, stammelte Raju.
„Nun, vorausgesetzt, wir finden einen Partner, der über entsprechende Rechenleistung verfügt. Wir können das bis zu einem bestimmten Grad auch ohne Partner, aber …“
Ich dachte an die beiden alten Server, die in Kais Schlafzimmer standen, ließ mir aber nichts anmerken. Der Razzle-Manager wirkte irgendwie abwesend, aber nach einer gewissen Zeit wandte er sich Simona zu.
„Und was ist Ihr Beitrag?“
„Ich bin das gute Gewissen bei all dem. Sehen Sie: Die Daten sind da, es braucht sie nur jemand zu pflücken. Es muss nicht Razzle sein; es muss überhaupt nicht sein. Aber wenn Sie einsteigen, dann lassen Sie uns die Welt verändern! Wenn Sie das nicht wollen, dann lassen Sie uns getrennte Wege gehen.“
Raju blickte ihr direkt in die Augen, und ich wusste, dass er es kaum länger als ein paar Sekunden aushalten würde, bis sie ihn geknackt hätte.
„Hier haben Sie Ihr Handy zurück. Ich möchte nun, dass Sie Razzle verlassen“, sprach er in ernsthaftem Ton.
Wir packten lautlos zusammen und folgten ihm auf dem gleichen Weg, wie wir gekommen waren. Er verabschiedete uns höflich und ließ uns allein im Foyer stehen. Wir gaben unsere Besucherbadges ab und verließen das Gebäude.
Mir war übel, als wir draußen waren. Der Abschied von Raju glich einem Rauswurf. Kai war ebenfalls bleich im Gesicht. Er schaute mich schweigend an; seine Wangenknochen schienen irgendetwas im Mund zu zermahlen. Nur Simona strahlte über das ganze Gesicht. Sie sprang freudig auf uns zu und umarmte uns.
„Den haben wir im Sack! Ihr wart wunderbar“, rief sie und drückte jedem von uns einen Kuss auf die Wange.
Kapitel 4: Der Fehler
Einige Tage waren seit unserem Treffen bei Razzle vergangen, als mich Sven anrief.
„Was habt ihr Raju eigentlich gezeigt?“, wollte er wissen.
Ich erzählte ihm etwas von irgendwelchen vagen Plänen, was ihm auszureichen schien, denn er stellte keine weiteren Fragen.
„Er hat nämlich gleich am nächsten Tag den Flieger bestiegen und ist nach Mountain View gereist. Da hatte er aber gar keinen Termin, soviel ich weiß; die ganze Woche hätte er eigentlich in Zürich sein müssen.“
Augenblicklich schoss mir Adrenalin ins Blut. Das konnte alles Mögliche bedeuten, aber auf jeden Fall hatte unser Besuch eine Wirkung hinterlassen. Mir erschienen wahnwitzige Bilder im Kopf, von US-Bundesagenten, die unsere Wohnung durchsuchten, ich sah Solomon Preston, der uns in sein Büro bat und …
„Hallo!?“, hörte ich Sven in sein Headset rufen. „Bist du noch on?“
„Ja, entschuldige, ich war kurz in Gedanken. Weißt du, wann er wieder zurück sein wollte?“
„Nein, shit, er hätte heute eine Kundenpräsentation gehabt und wir versuchen seit Stunden, den Mistkerl wenigstens ans Phone zu bekommen!“
„Tut mir leid“, log ich.
„Also, ich muss weiter, muss irgendein hohes Tier auftreiben, sonst springt der Kunde ab.“
Sven klinkte sich aus und es wurde ruhig in meiner Wohnung. Ich überlegte mir, was Raju wohl gerade tat, wo er war und was das alles zu bedeuten hatte, als mein Handy klingelte. Kai war dran.
„Bad news, Philipp“, begann er. „Wir haben einen Fehler im Quellcode. Ich suche schon seit Tagen, aber ich kann das Problem nicht finden.“
„Was für ein Fehler ist das denn?“, wollte ich wissen.
„Der Datenupload bricht plötzlich ab, dann dauert es eine Weile und er setzt wieder ein, als wäre nichts gewesen. Völlig strange! Ich habe alle Routinen gecheckt, habe die Sequenzen durchgespielt, aber ich kann den Scheißfehler nicht reproduzieren. Er taucht auf, und dann ist er wieder weg – wie ein verfluchtes Gespenst!“
Wir schwiegen eine Weile, bis ich vorschlug: „Ruf Sergei an, das ist ja seine Technologie, die da rumspinnt.“
„Ja, daran habe ich auch schon gedacht. Aber dann reicht es nicht mehr, ihm nur Fragen zu stellen oder Codefragmente zu schicken. Jetzt müsste er den gesamten Loader kennen, nur dann hat er vielleicht eine Chance, das Ding zu fixen.“
„Nein!“, entgegnete ich. „Sergei ist, wie du weißt, nicht wirklich vertrauenswürdig. Er steht womöglich mit der russischen Mafia in Kontakt und könnte die ganze Sache auffliegen lassen.“
„Du hörst dich an, als täten wir was Illegales hier“, bemerkte Kai.
„Na ja, seien wir ehrlich, der Datenupload steht so kaum im Lehrbuch. Wenn wir damit auffliegen, dann wird es keine Dankesschreiben der Telecom-Provider geben.“
„Dann lass uns das Ding auf WLAN beschränken, ist immer noch gut genug. Wer braucht das schon in Echtzeit? Wir laden die Daten zeitversetzt hoch und gut ist. Dann brauchen wir auch diesen Sergei nicht, der ist mir eh suspekt.“
„Das ist aber nicht mehr das, was wir Raju gezeigt haben“, entgegnete ich.
„Scheiß auf Raju, der wird MOM sowieso nie kaufen!“, rief Kai so laut, dass ich den Hörer vom Ohr weghalten musste.
„Raju ist gleich am Tag nach unserem Treffen ins Silicon Valley gereist – ungeplant – Hals über Kopf“, sagte ich ganz ruhig.
Ich wartete einen Moment, bis Kai die Nachricht verarbeitet hatte.
„Du weißt, was das heißen kann?“
„Ja, er verpfeift uns bei seinem Chef“, murmelte Kai.
„Vielleicht. Ich glaube aber eher, dass er den Köder geschluckt hat. Stell dir mal vor, wenn wir MOM tatsächlich bei Razzle unterbringen könnten! Hast du eine Vorstellung, was das für uns bedeuten würde? Vergiss deine Studentenbude und deine lausigen zwei Server! Dann spielen wir in der Champions League!“
„Gut, ich rufe Sergei an und versuche, ihm nicht zu viel zu erzählen. Wir werden sehen, wie schlau der Typ wirklich ist.“
„Ja, mach das. Und halte mich bitte auf dem Laufenden.“
Nach dem Gespräch mit Kai machte ich mir erst einmal eine große Tasse Kaffee und stellte mich anschließend unter die Dusche. Ich hielt meinen Kopf unter das warme Wasser und ließ meinen Gedanken freien Lauf.
Als ich das Wasser abstellte, hörte ich plötzlich ein Geräusch. In meiner Stadtwohnung war es nie leise, aber das, was ich gehört hatte, war zu nah – es klang, als wäre jemand in meiner Wohnung! Ich schnappte mir das Badetuch und wickelte es rasch um meinen Körper. Die Türklinke schon in der Hand hielt ich einen Moment inne. Was, wenn es wirklich ein Einbrecher war? Das kam ja immer mal wieder vor in Zürich. Am helllichten Tage stiegen diese Typen in Wohnungen ein.
Ich sah mich im Badezimmer um, aber eine Waffe oder Ähnliches ließ sich nicht finden. Ausgerüstet mit einem Deospray riss ich schließlich die Badezimmertür auf.
Vor mir stand eine völlig verdutzte Simona.
„Oh, entschuldige, die Wohnungstür war offen; du hast mein Klingeln wohl nicht gehört. Es tut mir leid, ich äh … Was willst du denn mit dem Deo?“
Ich ließ die Spraydose schnell hinter meinem Rücken verschwinden. „Ach, nichts, is’ nur ein Deo halt. Was macht du denn hier? Waren wir ... verabredet oder so?“, stammelte ich.
„Nein, aber ich habe gerade Mittagspause und dachte, ich schau mal rein. Vielleicht lade ich dich zum Essen ein. Aber nur, wenn du dir noch was anziehst“, womit sie auf mein Badetuch deutete.
Ich wurde rot. „Äh, ja, natürlich, bin gleich so weit. Gib mir ein paar Minuten.“
Ich drückte mich an ihr vorbei in mein Schlafzimmer. Wir vermieden es, uns dabei zu berühren, aber Simona genoss offenbar den Moment der Peinlichkeit. Sie schmunzelte und rief mir nach: „Hopphopp, eine alte Frau lässt man nicht warten!“
Beim Mittagessen sprachen wir über Geld, ein Thema, das mir nicht so wichtig schien. Seit aber dieser Nadeski von der Bank angerufen hatte, hatte es nun plötzlich an Bedeutung gewonnen.
„Sag mal“, begann Simona, „wie finanziert ihr eigentlich euer Leben?“
„Ich habe noch etwas Geld auf der hohen Kante; das habe ich mir während des Studiums mit einigen Jobs verdient. Dann haben wir noch einen Start-up-Bankkredit, der geht aber zur Neige.“
„Und dann?“
„Nichts und dann. Wenn kein Geld mehr da ist, ist der Traum ausgeträumt. Die Bank will, dass ich den Businessplan einhalte. Demnach müssten die ersten Umsätze ungefähr …“, ich blickte auf die Uhr, „… jetzt eintreffen.“
Simona lachte. „Und womit wolltet ihr diese Umsätze generieren?“
„Wir haben der Bank erzählt, wir wollten eine neue App auf den Markt bringen. Wir haben die Finanzheinis da mit irgendwelchem technischen Kram verwirrt. Plötzlich waren die dann ganz versessen darauf, uns das Geld zu leihen.“
„Und? Gibt es eine App?“
„Jein, ich habe letzte Woche erst einen Namen erfunden. Das Ding soll Cam-me heißen. Kai wollte aus dem Kamera-Pupillen-Modul etwas zusammenstricken, was wir als App lancieren könnten. Felix steuert das Design bei.“
„Aha, das klingt ja nach einer wahren Erfolgsstory.“
Ich wurde verlegen, konnte mir aber ein Lachen nicht ganz verkneifen. Wir aßen gemütlich zu Ende und Simona ging zurück an ihren Job. Ich machte mich auf den Heimweg und setzte mich für den Rest des Tages an den Computer.
Irgendwann musste ich dann wohl über der Tastatur eingeschlafen sein. Ich wurde geweckt, als plötzlich mein Handy surrte.
„Hallo?“, flüsterte ich noch ganz benommen in das Mikrofon.
„Philipp“, rief Kai, „geh online, aber hopp!“
Ich legte das Telefon zur Seite und weckte meinen Computer aus dem Schlaf. Der Skype-Klingelton erklang sofort und Kai war dran.
„Hallo, altes Haus! Warst du schon am Pennen?“
„Nein, bin nur kurz eingedöst.“
„Jaja, das Alter“, witzelte Kai. „Während du also deinen Schönheitsschlaf gemacht hast, waren Felix und ich aktiv. Felix, sag Hallo zu Papa Philipp!“
„Hallooo Papa.“
„Hi Felix.“
„Nun gut“, fuhr Kai fort, „wir haben da mal was zusammengebastelt. Nennen wir das Kind mal Cam-me.“
Er strahlte über das ganze Gesicht und wartete auf meine Reaktion. Ich rieb mir noch immer die Augen, saß aber inzwischen einigermaßen gerade auf meinem Stuhl.
„Na, dann lass mal sehen, ich bin gespannt.“
„Also, die App kann deine Pupillenbewegungen erfassen. Dann koppeln wir das mit dem aktuellen Bildschirminhalt. Aber nicht im Webbrowser, da lassen wir die Funktion einfach weg. Es funktioniert nur bei den Apps, die wir unterstützen, und auch nur dort, wo der Nutzer es einstellt. Funktioniert wie bei den Ortungsdiensten beim iPhone. Nun gut, ich stelle also zum Beispiel die Fotos-App ein. Daraufhin merkt sich Cam-me die Fotos, die der Nutzer offenbar sehr oft ansieht, und erstellt daraus eine Favoritenliste. Das Gleiche funktioniert zum Beispiel bei Mails oder bei Filmen. Wir können sogar die beliebtesten Apps herausfinden. Das sind halt auch die, auf deren Icon am meisten geschaut wird. Genial, oder?“
„Hmm, in der Tat, nicht schlecht. Wenn man bedenkt, dass es quasi ein Abfallprodukt ist.“
„Genau! Aber der Clou kommt erst noch: Wenn wir wollten, könnten wir die MOM-Funktion damit unter die Leute bringen. Also gesetzt den Fall, die App wird heruntergeladen. Wir könnten die Webbrowser einfach zuschalten, dann bekommt der User noch Internet-Favoriten frei Haus. Dass wir im Hintergrund noch viel weiter gehen könnten, muss ja niemand wissen.“
„Das lässt du schön bleiben, das wäre bestenfalls ein Update. Zu Beginn reicht die Grundfunktion aus. Das sollte genügen, um die Bank zufriedenzustellen. Wie generieren wir Umsatz damit?“
„Keine Ahnung, sag du es mir. Ich bin der Technische, du bist der Mac-Moneysack von uns beiden.“
„Gut, ich überlege mir was. Wann können wir damit live gehen?“
„Raul macht noch die letzten Tests und ich lade das Ding anschließend in die Apple-Qualitätssicherung. Wenn das alles reibungslos funktioniert, sind wir in einem Monat gelistet. Bei Prideos sind wir noch nicht ganz so weit, aber in zwei Monaten müsste das auch klappen. Willst du auch Windows-Phone?“, fragte Kai geradezu aufgekratzt.
„Nein, vergiss es. Aber iOS und Prideos müssen schon sein. Gut, schick mir doch bitte ein paar Bildschirm-Captures. Ich versuche, der Bank noch ein paar Kröten aus dem Kreuz zu leiern.“
„Ja, mach das. Wir spielen dann mal noch ein wenig mit dem Teil. Cam-me, beschissener Name, aber Felix wird das noch etwas aufpeppen, dann geht das schon.“
Wir beendeten das Gespräch und ich blickte auf die Uhr: 02:23 – der hat sie doch nicht alle!, dachte ich mir. Aber nachdem ich schon mal wach war, erstellte ich schnell ein paar Präsentations-Slides, die ich morgen der Bank vorstellen wollte.
Gleich am Morgen rief ich diesen Nadeski an.
„Hallo, Herr Wieland, das freut mich aber, von Ihnen zu hören!“, schleimte der Banker.
„Hören Sie, wir sind mit der App fast fertig, aber wir brauchen noch circa zwei Monate, bis wir Umsätze generieren werden. Ich sende Ihnen gleich ein paar Überlegungen, quasi ein Update zum Businessplan. Sind Sie online?“
Er war, also schickte ich ihm das Werk der letzten Nacht per Mail.
„Die App wird im Januar geschaltet; für die Vermarktung bräuchten wir allerdings noch etwas Geld …“
„Oh, Herr Wieland, Herr Wieland! Das wird nicht gehen, fürchte ich. Sie haben doch schon 100.000 Franken erhalten; das wird nicht gehen, Herr Wieland.“
„Herr Nadeski, es wäre doch sehr schade, wenn wir die letzten Meter nicht noch gemeinsam gehen würden. Wir sehen ja schon die Zielfahne. Meinen Sie nicht, dass wir da noch eine kleine Tranche drauflegen könnten?“
„Von welcher Summe sprechen wir denn, Herr Wieland?“
„30.000 Franken, gleiche Verzinsung wie bisher.“
Ich hörte den Banker, wie er hektisch auf einem Taschenrechner oder seiner Tastatur herumtippte. Einige Zeit blieb es ruhig, dann meldete er sich wieder.
„Na gut, ich sehe, was ich machen kann. Ist dieses Käm-mi denn erfolgversprechend?“
„Da machen Sie sich mal keine Gedanken, das wird einschlagen, ganz bestimmt!“, flunkerte ich.
Wir verabschiedeten uns höflich voneinander und Nadeski versicherte mir, mich morgen wieder anzurufen.
Ich holte mir ein Frühstück aus dem Shop nebenan und schaute auf dem Nachhauseweg wieder einmal in meinen Briefkasten. Ein Brief fiel mir gleich auf. Er war von der Hausverwaltung.
Ich öffnete ihn schon im Treppenhaus und der Inhalt entsprach leider dem, was ich schon länger erwartet hatte: Sie wollten die Wohnungen renovieren. Natürlich räumte man mir das Recht ein, sie nach der Gesamtsanierung wieder zu mieten. Zu einem „angepassten“ Mietzins von 2.800 Franken. Nicht schlecht, dachte ich mir. 2.800 Stutz für sechzig Quadratmeter. Das war mal ein Geschäftsmodell, das auch dem Herrn Nadeski gefallen würde …
Am Abend traf ich Simona. Wir wollten darüber sprechen, wie wir vielleicht bei Razzle nachhaken konnten. Dazu verabredeten wir uns in unserem Stammlokal, dem Viadukt.
„Mein Vermieter schmeißt mich quasi raus“, begann ich die Unterhaltung.
„Will heißen?“, fragte sie.
„Na ja, er verdoppelt meine Miete, das kann ich mir nie und nimmer leisten.“
„Das ist fies.“
„Eher normal. Wir leben in Zürich.“
„Was machst du jetzt?“
„Keine Ahnung, ich habe da neulich eine kuschelige Parkbank gesehen.“
„Ach was, das wird schon. Vielleicht habe ich da eine Lösung“, meinte sie verheißungsvoll, und ich merkte, wie sie fast platzte, um etwas loszuwerden. Ihre Augen funkelten und sahen mich erwartungsvoll an.
„Na, dann schieß mal los“, sagte ich.
„Du weißt ja, dass ich Patrick Sneider kenne.“
„Den BeeCar-Guy?“
„Ja, den BeeCar-Guy. Also, ich habe ihm ein wenig von MOM erzählt. Keine Angst, nur den Teil mit der Pupillensteuerung und der Bildschirmsynchro.“
„Aha“, erwiderte ich mit leicht zynischem Unterton.
„Nun hab dich nicht so. Patrick und ich sind Freunde. Wir reden oft miteinander. Er ist ein äußerst integrer Mann!“
„Aha, Freunde.“ Dafür kassierte ich einen freundlichen Boxhieb.
„Ja, Freunde. Willst du nun wissen, was er gesagt hat, oder willst du erst noch alle meine anderen Freunde kennenlernen? Also da wäre noch Plob, mein Frosch, er ist grün und …“
„Schon gut, erzähl einfach weiter.“
„Also, Patrick will euch kennenlernen. Er könnte sich vorstellen, die Technologie zur Steuerung seiner Touchscreens im Auto zu nutzen. Na ja, die Leute müssten dann nicht mehr mit dem Finger drauf rumrutschen. Er denkt halt immer etwas weiter.“
Jetzt boxte ich Simona leicht. „Du bist super! Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll …“
Wir sprachen und schwelgten in dem kleinen Lokal bis in die späten Stunden, und ich fühlte mich so leicht, als wären die ganzen Probleme plötzlich verschwunden. Erst spät in der Nacht verabschiedeten wir uns vor dem Restaurant und Simona drückte mir völlig unerwartet einen Kuss auf den Mund.
„Entschuldige“, meinte sie mit sanfter Stimme, „mir war grad danach. Schlaf gut.“
Sie ließ mich in der Kälte stehen und entschwand mit raschen Schritten. Meine Gedanken kreisten wild; ich versuchte, sie zu sortieren, aber es gelang mir nicht. Auf dem ganzen Weg nach Hause hatte ich ein Lächeln auf dem Gesicht.
In meiner Wohnung angekommen legte ich mich gleich Schlafen, oder zumindest versuchte ich es.
Früh am nächsten Morgen polterte es an meiner Wohnungstür. Kai war da.
„Wir müssen reden“, meinte er mit ernster Miene. „Ich habe dir ja von diesem Fehler im Datenupload erzählt und davon, dass ich Sergei kontaktieren wollte.“
„Ja, was ist damit?“, wollte ich wissen.
„Sergei ist gestern bei mir aufgetaucht! In meiner Wohnung!“
Kapitel 5: Ein neuer Partner
„Woher weiß Sergei überhaupt, wo du wohnst?“, fragte ich.
„Weiß der Henker, er weiß es auf jeden Fall! Er stand plötzlich vor meiner Wohnung. Ich habe ihm vor einigen Tagen den Fehler geschildert und ihm das entsprechende Modul geschickt. Er meinte nur, er wolle sich das mal ansehen, und gestern stand er dann plötzlich da. Er wollte reinkommen und ich war so baff, dass ich ihn reingelassen habe.“
„Du hast ihn in dein Appartement gelassen?!“, fragte ich mit lauter Stimme.
„Mach mir bloß keine Vorwürfe!“, rief Kai sofort. „Ich hätte dich sehen wollen. Sergei hat eine sehr überzeugende Art, du kennst ihn ja. Er hat meine Wohnung ausspioniert, hat in alle Ecken geschaut. Er hat auch einige ausgedruckte Unterlagen zu MOM und Cam-me gesehen. Philipp, ich habe Angst!“
„Beruhige dich, Sergei ist kein Gewalttäter. Was hat er denn genau gewollt?“
„Er meinte, er könne den Fehler beheben, aber dazu müsse er den ganzen Quellcode haben. Irgendwie hat er sogar recht, immerhin spinnt der Loader erst ab einem gewissen Datenvolumen.“
„Du hast ihm den Quellcode aber nicht gegeben, oder?“
„Nein, wo denkst du hin. Ich habe ihn damit vertröstet, dass das System nicht so leicht zu extrahieren sei. Ich müsse das erst zusammenstellen. Aber er ist in der Stadt, und er will heute Abend wiederkommen. Ich weiß nicht, was ich tun soll, Philipp.“
Wir saßen einige Zeit zusammen und ließen uns verschiedene Möglichkeiten durch den Kopf gehen. Sergei hatte wohl kaum ehrbare Absichten, so viel schien uns logisch. Als wir eine Art Schlachtplan entwickelt hatten, machten wir uns auf den Weg, um einige Besorgungen zu machen.
Am Abend trafen wir uns in Kais Wohnung und warteten auf Sergei. Wir schauten einige YouTube-Videos, schalteten den Fernseher an und wieder aus, redeten kaum und tranken viel Kaffee. Und wir beobachteten die Uhr in Kais Wohnzimmer, deren Zeiger ihre Runden drehten.
Um 21 Uhr war ich überzeugt, dass er nicht mehr kommen würde, aber wir wollten noch eine Weile warten. Um 21:33 Uhr klingelte es an der Tür. Wir erschraken fast zu Tode, obwohl wir ja den ganzen Abend darauf gewartet hatten. Wie wir verabredet hatten, verschwand ich im Badezimmer, während Kai dem ungebetenen Gast Einlass gewährte.





























