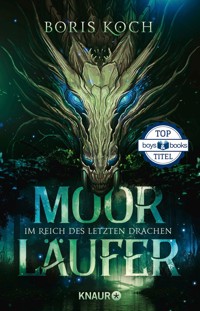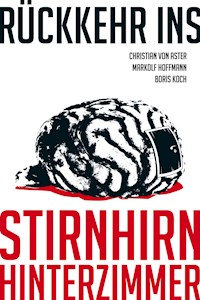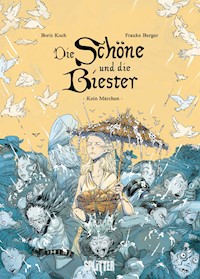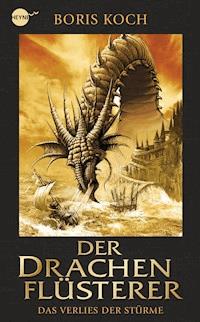12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Der 15-jährige Ben ist nach dem Tod seiner Eltern ganz allein. In seinem Dorf gilt er als Außenseiter, der sich mehr schlecht als recht durchschlägt und davon träumt, dem Orden der Drachenritter beizutreten. Als ein Verbrechen geschieht und Ben verdächtigt wird, muss er das Dorf für immer verlassen – und begegnet auf seiner Flucht einem Drachen. Für Ben wird ein Traum wahr. Allerdings hat er nicht damit gerechnet, dass der Drache offenbar leicht verhaltensauffällig ist. Und nicht gewillt scheint, jemals wieder von seiner Seite zu weichen …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1334
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Das Buch
In Bens Welt gelten Drachen als unberechenbar, und man setzt alles daran, sie zu jagen und zu zähmen – eine Aufgabe, der sich der angesehene Orden der Drachenritter verschrieben hat. Seit Ben denken kann, will er dem Orden angehören. Doch dann begegnet er seinem ersten wirklichen Drachen, und von einem Augenblick zum nächsten ist nichts mehr, wie es einmal war: Denn Ben ist ein Drachenflüsterer, er versteht, was die majestätischen Geschöpfe denken und fühlen. Und er begreift, dass sie nicht von Natur aus böse sind – zumindest auch nicht boshafter als die Menschen.
Gemeinsam mit seinen Freunden Yanko und Nica macht er sich auf, so viele Drachen wie möglich vor den Rittern zu retten. Doch ihre Unternehmung wird nicht gern gesehen, und es beginnt eine abenteuerliche Reise, während der sie immer auf der Flucht sind und einzig von den Drachen, den Herren der Lüfte, unterstützt werden …
Der Autor
Boris Koch, Jahrgang 1973, wuchs auf dem Land südlich von Augsburg auf und lebt heute als freier Autor in Berlin. Für seinen Krimi Feuer im Blut erhielt er den Hansjörg-Martin-Preis, der Roman Vier Beutel Asche wurde von der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendliteratur ausgezeichnet.
Boris Koch
Die Drachenflüsterer-Saga
Der Drachenflüsterer
Der Drachenflüsterer – Der Schwur der Geächteten
Der Drachenflüsterer – Das Verlies der Stürme
Drei Romane in einem Band
Für Mia, die inzwischen sogar alt genug ist, diese Geschichten zu lesen.
Für Nicki und Grobi und den geduldigen Süden.
Und für Claudia, die Drachen liebt.
Auch als Sammelband sind diese Romane noch immer für euch.
Erstes Buch – Der Drachenflüsterer
PROLOG
Ben war elf Jahre alt und erkältet, als er den Ordensritter auf dem befreiten Drachen durch Trollfurt reiten sah. Milde Herbstwinde wehten von den schneebedeckten Berggipfeln herunter, und die ersten bunten Blätter sammelten sich raschelnd im Rinnstein der grauen Hauptstraße.
Der Drache hatte kohlschwarze Schuppen und war bestimmt zehn Schritt lang, sein mit kantigen Hornsplittern übersäter Schwanz schrabbte zwischen den verdreckten Fahrrinnen über das Pflaster. Die Schulterknubbel hinter seinem kräftigen Hals waren frisch vernarbt; hier hatten ihn bis vor Kurzem Samoths fluchbeladene Flügel versklavt, nun war er flügellos und frei. Freundlich blickten die großen hellgrünen Augen über die lange Schnauze in die Welt, zugleich strahlte sein majestätischer Körper Stärke und Macht aus.
Voller Ehrfurcht und atemlosem Staunen lief Ben mit einer ganzen Horde Jungen neben dem Fremden her.
Hinter ihnen ritt eine schöne junge Frau mit golden schillerndem Kopfschmuck auf einem schwarzen Pferd und führte einen mit allerlei Gepäck beladenen Schimmel am Zügel, doch Ben beachtete sie nicht. Er hatte nur Augen für den Drachen und seinen Ritter.
Dieser trug keinen Helm, die langen dunklen Haare wehten im Wind, und das erschöpfte, kantige Gesicht war unrasiert. Sein Kettenhemd aus wertvollem, gedämpftem Blausilber schimmerte selbst an diesem bewölkten Tag hell und klar, auch wenn es nicht von selbst leuchtete wie reines Blausilber, das im tiefen Fels ruhte. Kein Rost, kein Schmutz, kein Schatten konnte den Glanz von Blausilber trüben. Die rote, ärmellose Tunika mit dem stilisierten gelben Drachenkopf, dem Symbol des Ordens, war von Reise und Kämpfen verdreckt, doch der Ritter lächelte und winkte den Kindern zu, und Ben war sicher, dass er gerade ihn besonders lange angesehen hatte.
Deshalb nahm Ben all seinen Mut zusammen und näherte sich dem Drachen im Lauf, berührte die schwarzen Schuppen, die sich ganz kühl und rauer anfühlten, als er gedacht hatte, nicht so glatt wie ein perfekter Flussstein oder gar ein Fingernagel. Fast wie die Hornhaut auf seiner Fußsohle, nur noch härter und unverletzbar. Die Berührung kribbelte, so aufgeregt war Ben, und er zog die Hand schnell wieder zurück. Dabei musste er niesen.
Die anderen Jungen hatten es gesehen und drängten ihn nun ab, um ihrerseits den Drachen zu berühren. Sie schoben ihn einfach zur Seite wie immer, wenn er ihnen im Weg war.
»Vorsicht, Kinder«, brummte der Ritter, als das Gedränge um ihn zu eng wurde. »Nicht, dass einer unter Nachthimmels Füße stürzt.«
Nachthimmel. Lautlos wiederholte Ben den Namen des Drachen, flüsterte ihn sich vor, während er von den zurückweichenden Jungen noch weiter abgedrängt wurde und sich ein trockener Husten seiner Kehle entrang. Neugierige Mädchen wurden von ihren besorgten Eltern zurückgehalten, welche ebenfalls auf die Straße geeilt waren, um den Ritter zu betrachten und ihm Grußworte zuzurufen, die er freundlich erwiderte. Viel zu lange war kein Mann des Ordens mehr hier gewesen.
Auf dem Marktplatz bog der Ritter in die alte Handelsstraße ein, die den rauschenden Dherrn hinabführte, hinaus aus der Stadt, vorbei an Weiden und Feldern und dann durch den Wald ins Landesinnere. Ohne anzuhalten, nicht einmal, um die Tiere zu tränken, verließ er die Stadt, noch immer lächelnd und grüßend. Die Erwachsenen tuschelten und schimpften, weil er nicht einmal auf ein Bier geblieben war, um Geschichten aus der Ferne zu erzählen. Mit verbitterten Gesichtern murmelten sie, dass der Orden der Drachenritter Trollfurt vergessen habe.
»Schlimme Zeiten brechen an«, brabbelte der weißhaarige Konaan, der nur noch einen einzigen Zahn im Mund hatte und jeden Herbst das Ende der Stadt kommen sah, an gewitterdunklen, stürmischen Abenden gar das Ende der Welt.
Doch Ben war dies alles egal. Er hatte einen Drachen gesehen!
Lachend lief er nach Hause, stürmte in das kleine Haus am linken Flussufer, in dem er mit seiner Mutter lebte, und rief: »Mama! Ich will Drachenritter werden! Ich …«
»Wo warst du?«, unterbrach sie ihn scharf. »Du bist krank.« Eine Strähne war dem ausgeblichenen Haarband entkommen und hing ihr ins ausgemergelte Gesicht mit den blassen, schmalen Lippen. Eine dünne Schicht Mehl bedeckte ihre bloßen Arme, und auch auf dem abgetragenen, ehemals nachtblauen Rock waren Flecken aus staubigem Weiß zu erkennen. Mit den Händen stützte sie sich auf der Tischplatte ab, bis eben hatte sie sauren Apfelkernbrotteig geknetet. Ihre trüben Augen glänzten.
»Auf der Straße, da war ein riesiger schwarzer Drache mit einem Ritter und … Ich will Drachenritter werden, weil …«
»Du wirst nie ein Drachenritter«, unterbrach sie ihn erneut und kam auf ihn zu. »Dein Vater war ein nichtsnutziger Rumtreiber, und du bist ein nichtsnutziger Rumtreiber!«, schrie sie plötzlich, und dann verpasste sie ihm einen Schlag auf den Hinterkopf.
Ben wurde von dem Schlag völlig überrascht. Doch dann roch er ihren säuerlichen Atem und sah den leeren Weinkrug auf dem Tisch stehen. Den zweiten Schlag sah er kommen, aber er wagte nicht, auszuweichen, das würde alles nur schlimmer machen.
»Der hohe Herr wird also ein Drachenritter! Dass ich nicht lache«, keifte seine Mutter noch einmal und stierte ihn an. »Schlimmer als der Vater, das Balg ist schlimmer als der Vater.«
Das wusste er nicht, denn an seinen Vater konnte er sich nicht erinnern. Mit einem Fußtritt schickte sie ihn ins Bett und wäre dabei beinahe gestolpert. Wenn sie zu viel getrunken hatte, nannte sie ihn immer das Balg und behandelte ihn wie einen Hund. Und sie trank oft, deshalb war er gern und viel auf den Straßen Trollfurts unterwegs.
Gehorsam und still ging Ben in das angrenzende Zimmer und rollte sich auf dem Strohsack zusammen, obwohl es draußen noch hell war. Er hustete, starrte aus dem Fenster und lauschte angespannt auf die Geräusche aus der Küche, wo seine Mutter weiter den Teig knetete und vor sich hinfluchte.
Egal, was sie auch sagte, er würde doch ein Drachenritter werden. Er würde eine Klinge aus Blausilber und eine Rüstung tragen, und er würde zahlreiche Drachen von Samoths Fluch befreien. Eines Tages würde er auf einem Drachenrücken sitzen, das schwor er sich. Und dann würde sie Augen machen.
Erst lange nach Sonnenuntergang schlief er ein, und er träumte davon, wie er auf einem großen, schwarzen Drachen durch ferne, schöne Länder ritt.
NÄCHTLICHER ZAUBER
Natürlich geht eine tote Ratte auch, aber eine Drachenschuppe wirkt viel besser.«
»Wenn ich eine Drachenschuppe hätte, würde ich die nicht wegen einer Warze verschwenden. Eine tote Ratte bekommt man viel leichter noch mal neu.«
»Nimm, was du willst, Hauptsache, du sagst den passenden Spruch dazu. Und zwar unbedingt um Mitternacht auf dem Friedhof.«
Ben nickte, in dem Punkt waren sich er und sein bester und einziger Freund Yanko einig. Ben war ein drahtiger Junge von fünfzehn Jahren mit unscheinbar graublauen Augen, schmalen Wangen, stets ungekämmtem braunem Haar und flinken Fingern. Die Risse in seiner dunklen Leinenhose waren mehrmals notdürftig genäht worden, überall prangten bunte, ausgefranste Flicken in unterschiedlichster Form und Größe. An den Beinen war die Hose bereits im letzten Jahr zu kurz gewesen, doch das scherte ihn nicht, nicht jetzt, im Sommer. Sein Hemdkragen stand offen, weil die obersten Knöpfe abgerissen waren und er noch keine neuen gefunden hatte.
Yanko dagegen hatte schalkhaft-unruhige dunkle Augen und war kräftiger gebaut, jedoch zwei Fingerbreit kleiner. Irgendwann werde er Ben noch überholen, sagte er immer, er sei ja schließlich auch hundert Tage jünger. Das dunkle Haar schnitt ihm seine Mutter jeden zweiten Samstag ganz kurz, damit er es sich in der Schmiede des Vaters nicht versengte. Sein helles Hemd knöpfte er stets anständig zu, bevor er nach Hause ging. Unter dem Hemd trug Yanko einen abgegriffenen Glücksgroschen an einem Lederband.
Vertieft in ihr Gespräch über Warzen, saßen sie auf dem blutroten Felsen, von dem vor vielen Jahren der grausame Raubritter Erkendahl in den Tod gestürzt war. Das war bereits so lange her, dass der Geist des Räubers seit ihrer Geburt nicht mehr gesichtet worden und der Platz nun gefahrlos war. Dennoch kamen nicht viele Menschen hier herauf, seit die Blausilbermine weiter oben geschlossen worden war.
»Zeig mal die Ratte«, verlangte Yanko, und Ben kramte sie aus der geräumigen Hosentasche heraus und gab sie ihm.
»Die ist ja ganz weiß, das ist gut. Das ist sehr gut.«
»Das wäre gut, wenn sie nicht den grauen Fleck auf der rechten Seite hätte.«
»Hm.« Kritisch drehte Yanko das tote Tier im hellen Sonnenlicht hin und her. Das Fell war zerzaust, ein Vorderfuß verdreht, doch sonst sah die Ratte noch ganz passabel aus. Prüfend roch Yanko an ihr und nickte. »Hat noch nicht angefangen zu stinken.«
»Hab sie heute früh ganz frisch gefunden.«
»Wo?«
»Hinter dem Haus des Schulmeisters.«
»Das passt«, sagte Yanko, auch wenn Ben nicht wusste, was daran passen sollte. Yanko gab ihm die Ratte zurück. »Das ist eine gute Ratte, deine Warze ist so gut wie weg.«
Ben schob sie wieder in die Tasche, ganz vorsichtig, nicht dass jetzt noch der Kopf oder der Schwanz abbrachen, dann wäre sie unbrauchbar. Wenn Yanko sagte, es war eine gute Ratte, dann stimmte das auch. Er musste gut auf sie aufpassen. Ben spuckte auf die dicke Warze auf dem oberen Gelenk seines linken Daumens und verrieb den Speichel langsam, während er ins Tal hinunterblickte.
Das Städtchen Trollfurt lag zu ihren baumelnden Füßen in der warmen Nachmittagssonne, geteilt durch den glitzernden Fluss Dherrn. An seinem rechten Ufer standen die meisten bewohnten Häuser, vor allem die der angesehenen Familien, der große weiße Tempel des Sonnengottes und der verwinkelte, vieleckige Tempel aus bemaltem Granit für die anderen Götter. Das Rathaus, die ehrbaren Geschäfte und das Spital des miesepetrigen Heilers Torreghast fanden sich dort ebenso wie die Gasthöfe, das Standbild des Trollbezwingers und Drachenreiters Dagwart, das Schulhaus und einfach alles Wichtige.
Ben selbst lebte auf der linken Seite des Flusses und sogar ein gutes Stück von der Brücke entfernt. Direkte Nachbarn hatte er keine, die meisten Häuser auf der linken Dherrnseite waren verlassen und mehr oder weniger verfallen. Dort hatten die Familien der Minenarbeiter gelebt, bevor die Mine geschlossen wurde und die Arbeiter weitergezogen waren, nach Graukuppe, Drakenthal und in andere Städte, wo nach Metallen oder Stein geschürft wurde. Ben hatte sich aus den verlassenen Gebäuden schon den einen oder anderen Ziegel geholt, um sein Dach auszubessern. Auch wenn ihm ein bisschen Regen eigentlich nichts ausmachte.
»Magst du heute Nacht mit auf den Friedhof kommen?«, fragte Ben, weil man ja nie wusste, ob nicht doch ein Geist auftauchte, selbst wenn nicht Freitag war.
»Spinnst du? Wenn der Zauber funktionieren soll, musst du allein sein.«
»Sicher?«
»Ganz sicher. Der alte Jorque hat einmal sogar drei Freunde auf den Friedhof mitgenommen, als er sich eine Warze von der Zehe weggezaubert hat, und sie alle haben zugesehen, und das hat den Zauber ins Gegenteil verwandelt. Drei Tage später sprossen ihm auf dem ganzen Fuß Warzen, eine direkt neben der anderen, und dann wuchsen Warzen auf den Warzen. Der Jorque hat in keinen Stiefel mehr gepasst! Bald war der Fuß doppelt so groß wie sein gesunder, und dann sogar dreimal so groß. Die Warzen haben derart gewuchert, du hast ihnen beim Wachsen richtig zusehen können. Was immer er fortan versucht hat, nichts hat geholfen, sie haben ihm den Fuß abnehmen müssen, und Jorque wurde zum Säufer, um das alles zu vergessen. Seine drei Freunde sind davongelaufen, weil sie es nicht mehr ausgehalten haben in Trollfurt. Es tut mir leid, Ben, aber du musst allein auf den Friedhof. Dich zu begleiten, ist viel zu riskant.«
Ben nickte dankbar. Dabei hatte er immer gedacht, Jorque hätte seinen Fuß vor Jahren in der Mine verloren, aber das sagte der alte Mann wohl nur, weil es besser klang und ihm die Leute so immer mal eine Münze zusteckten. Es war wirklich gut, dass Yanko so viel wusste. Ben wollte sich gar nicht ausmalen, wie sich ein wild wucherndes Warzengebirge über seine Hand ausbreitete.
Sie kletterten vom Raubritterfelsen und stiegen langsam wieder nach Trollfurt hinab, denn Yanko musste pünktlich zum Abendessen zu Hause sein. Am Stadttor verabschiedeten sie sich und verabredeten sich für den nächsten Morgen, um am oberen Fonksee zu fischen. Einen Moment lang sah Ben seinem Freund nach, der pfeifend und mit den Händen in den Taschen die Straße entlanglief, dann schlenderte er langsam in Richtung Brücke. Auf ihn wartete niemand mit dem Essen.
Seit dem Tod seiner Mutter lebte Ben allein und hielt sich mit dem Verkauf von Fischen und anderen Gelegenheitsarbeiten über Wasser oder klaute sich mal bei diesem, mal bei jenem Bauern einen Apfel oder einen Eimer Kartoffeln. Die Knechte drückten meist ein Auge zu und hetzten die Hunde nicht auf ihn, doch die meisten guten Familien verboten ihren Kindern, mit ihm zu reden oder – schlimmer noch – etwas zu unternehmen. Ben ging weder zur Schule noch arbeitete er; ein schlimmeres Vorbild konnten sich die besorgten Väter und Mütter nicht vorstellen. Und nur Yanko pfiff auf die Meinung seiner Eltern.
Eine gute Weile nachdem die Sonne untergegangen war, spuckte Ben noch einmal auf die Warze und machte sich auf den Weg zum Friedhof. Der Himmel war sternenklar, der Mond noch immer halb voll, darum war diese Nacht nicht stockfinster. Trotzdem war ihm nicht wohl bei dem Gedanken, allein auf den Friedhof zu gehen. Doch die Warze störte ihn zu sehr, sie juckte und schien zu wachsen, sie musste einfach weg. Vier- oder fünfmal hatte er sie bereits rausgeschnitten, doch sie war immer wieder nachgewachsen. Es war eine von den Warzen, die nur mit einem Zauber zu bezwingen waren. Er hoffte, dass die meisten Toten dort spukten, wo sie gestorben waren, nicht da, wo sie begraben lagen.
Ohne einen Menschen zu treffen, gelangte er bis zur Brücke und überquerte den Fluss. Aus dem Goldenen Stier drangen noch Licht, trunkenes Lallen und lautes Gelächter, sonst war es auch auf der rechten Seite des Dherrn ruhig. Ben schlich weiter, folgte der Hauptstraße zum Marktplatz und wäre fast über einen herausstehenden Pflasterstein gestolpert. So schlug er sich nur die Zehe an und fluchte leise vor sich hin. Kleine Pfoten eilten im Dunkeln davon, wahrscheinlich eine Ratte oder eine nachtaktive Echse, die er aufgescheucht hatte. Dann herrschte wieder Stille.
Auf dem Marktplatz ging er direkt zur Wasseruhr hinüber, die zwischen Rathaus und Tempel stand. Sie funktionierte wie eine Sanduhr; das klare Glas, aus dem sie gefertigt war, stammte aus Venzara, der hängenden Stadt an der Lagune der Zersplitterten Titanen, und sie war so hoch wie drei ausgewachsene Männer. Trotz ausgeklügelter Mechanik brauchte es auch drei ausgewachsene Männer, um sie jeden Mittag umzudrehen. In vierundzwanzig Stunden lief das Wasser aus dem oberen Zylinder durch die Gefäßverengung in der Mitte der Uhr in den unteren Zylinder. An der Strichskala auf den Zylindern konnte man ablesen, wie spät es war. Yanko hatte ihm einmal erklärt, warum Wasseruhren genauer gingen als Sonnenuhren, aber Ben hatte es wieder vergessen. Er machte sich nur selten etwas aus der genauen Uhrzeit.
Das brackige Wasser stand irgendwo zwischen der elften und zwölften Stunde, er hatte also noch genug Zeit; der Friedhof war nicht weit. Ben drehte sich um und schlenderte zu Dagwarts Standbild, das in der Mitte des Marktplatzes thronte.
Der Held Dagwart hatte vor drei oder vier Jahrhunderten die damals zahlreichen Trolle in die Berge zurückgeschlagen. In einer letzten großen Schlacht im Tal waren die grauen, menschenfressenden Kreaturen auf der Flucht durch den Dherrn so zahlreich gefallen, dass ihre steinernen Leiber den Fluss beinahe aufgestaut hatten. Und als sie nach ihrem Tod wieder zu Fels wurden, ihr Blut und ihre Tränen zu Sand, bildeten sie im Dherrn am Fuß der Berge eine Furt. An dieser Stelle gründete Dagwart eine Siedlung und nannte sie im Gedenken an seinen großen Sieg Trollfurt. Von hier aus unternahm er zahlreiche Streifzüge in die Berge, um die letzten Trolle zu jagen und sie endgültig zu vertreiben.
»Heute gibt es keine Helden wie Dagwart mehr«, sagten die Leute in Trollfurt, und dann klangen immer Respekt und zugleich Tadel für die Nachfahren des oft besungenen Stadtgründers in ihren Stimmen mit.
Das Standbild war noch ein Stückchen größer als die Wasseruhr. Der imposante Trolltöter hatte sein Schwert erhoben und ritt auf einem flügellosen Drachen, der dreimal so groß wie ein Pferd war und sich angriffslustig auf die Hinterbeine erhoben hatte, die vorderen Klauen hochgereckt. Ben klammerte sich an Dagwarts linkes Knie, setzte den Fuß auf den Stiefel des Helden und zog sich hoch. Die Bronze war überall kühl, und die geschuppte Haut des Drachen fühlte sich rau an. Ben kletterte vor Dagwart in den Sattel und plumpste hinein, dann rieb er mit den Händen über die Schulterknubbel des Drachen. Das brachte bei lebenden Drachen Glück und konnte hier sicher nicht schaden. Daran glaubten die meisten Kinder in Trollfurt fest, deshalb war die Bronze an den Knubbeln ganz glatt gerieben.
Eine Weile ließ er die Hände auf den Knubbeln liegen und blieb einfach sitzen. Irgendwann würde er auf einem echten, lebendigen Drachen reiten, nicht immer nur nachts auf diesem Standbild. Er hatte nie vergessen, was er sich vor Jahren geschworen hatte, als er den Drachenritter gesehen hatte. Zweimal schon hatte er seine Sachen gepackt gehabt, doch das nächste Ordenskloster war weit, und plötzlich waren Zweifel in ihm erwacht. Weshalb sollte der Orden einen zerlumpten Jungen wie ihn überhaupt aufnehmen? Er gehörte nicht zu den unfreien Knechten, doch eine angesehene Familie hatte er auch nicht vorzuweisen. Er hatte gar keine, und er wusste nicht, ob man den Orden belügen konnte wie einen normalen Menschen. Wieso sollte der mächtige Orden ihn aufnehmen, wenn er nicht einmal in seiner unbedeutenden Heimatstadt akzeptiert wurde? Betrübt hatte er seine spärliche Habe wieder aus dem Rucksack genommen und auf die Bretter geräumt. Noch hatte er hier ein Dach über dem Kopf und einen Freund. Außerdem wusste er, wie er ohne Schule, Arbeit und größere Scherereien durchkam. Hatte er gerade keinen Ärger am Hals, war er frei wie ein Vogel. Also war er geblieben, um auf den nächsten Drachenritter zu warten. Ihn würde er fragen, wie er das Ritterwerden anstellen sollte, doch seit fast drei Jahren war keiner mehr in Trollfurt gewesen, nicht einmal hindurchgeritten. Trollfurt lag einfach am vergessenen Ende der Welt.
Ben rieb noch einmal über die Knubbel, um ganz bestimmt keinen Geistern zu begegnen, glitt wieder vom Standbild hinunter und schlich zum Friedhof am Stadtrand.
Das alte eiserne Tor war abgesperrt. Bei dem gespaltenen Olivenbaum stieg Ben über die Mauer und landete auf der anderen Seite zwischen zwei alten Grabsteinen. Sie waren klein und schief, und einer hatte eine abgeschlagene Ecke.
»Bleib aber bloß nicht am Rand, der Zauber ist stärker, je weiter du zur Mitte des Friedhofs kommst«, hatte Yanko gesagt, und so schlich Ben zwischen den Gräbern und Bäumen entlang zum Brunnen im Zentrum, der unweit der Toteneiche stand.
Das Mondlicht fand nur selten den Weg bis zum Boden, die Schatten unter den zahlreichen Baumkronen waren tief und für seine Augen kaum zu durchdringen. Ein Mondhäher stieß sein klagendes Krächzen aus, dann war weiter nichts zu hören als Bens vorsichtige Schritte.
Die Grabsteine wirkten in der Nacht viel massiger und dunkler. Hier und da schimmerte ein Stein sanft im Mondlicht, doch die meisten schienen selbst die kleinste Helligkeit aufzusaugen. Immer wieder sah sich Ben um, aber Geister konnte er keine entdecken. Doch hatte sich dort, unter den drei ausufernden Weidenbäumen um das gedrungene, breite Grab, nicht etwas bewegt? War das überhaupt ein Grab, oder kauerte dort irgendetwas? Ben vernahm kein Geräusch, aber das hatte nichts zu bedeuten. Geister bewegten sich schließlich lautlos, sie machten nur Lärm, wenn sie es wollten.
Ein gutes Stück links von ihm raschelte etwas.
Ben wich nach rechts und wurde mit jedem Schritt schneller, sah nach links und rechts und wieder nach links, dann nach rechts. Doch was in den dunklen Schatten steckte, konnte er nicht erkennen. Das letzte Stück zum Brunnen rannte er beinahe. Verflucht, hoffentlich erschien ihm nicht seine Mutter!
Ben schielte hinüber zur Toteneiche, deren Blätter jedoch schwiegen. Sie war bei der Stadtgründung mit Hellwahs Segen gepflanzt worden, bevor der erste Tote hier begraben wurde; so, wie es sich gehörte. Seither hatte sie mit ihren weit verzweigten magischen Wurzeln einen Teil der Seele eines jeden aufgenommen, der hier begraben lag. Nicht viel, den Toten sollte es im Nachleben an nichts mangeln, sie sog nur eine winzige Ahnung von ihnen aus der Erde, auf dass sie nicht vergessen wurden und der Stadtgemeinschaft zugehörig blieben, und formte Blätter nach den Gesichtern der Verstorbenen aus. Die Blätter wisperten im Wind – hörte man ihnen lange genug zu, konnte man deutlich Worte verstehen, hörte, was die Toten einem zuraunten. Manch einer fragte vor wichtigen Entscheidungen hier seine Ahnen um Rat, allerdings nie nachts. In der Nacht verbargen sich oft Schattenkrähen zwischen den Ästen und mischten ihre dämonischen, falschen Ratschläge unter das Wispern der Toten, um die Lebenden zu Untaten zu verleiten. Ben hatte noch keine Frage an seine Mutter gerichtet, er hatte noch nicht einmal nach ihrem Blatt gesucht. Auch jetzt hatte er nicht mehr als einen flüchtigen Blick für die Toteneiche übrig, sie war ihm unheimlich.
Es musste längst Mitternacht sein. Hastig zerrte er die Ratte aus der Hosentasche, legte das tote Tier auf den Brunnenrand und beruhigte sich. Hier war nichts, nichts und niemand. Es gab keinen Grund zur Panik, und er durfte jetzt keinen Fehler machen.
Noch einmal atmete er aus, dann holte er von tief unten Speichel hoch. Dreimal spuckte er auf die Warze, dreimal rieb er mit der Ratte über sie hinweg und murmelte die Beschwörung, die er von der alten Magd Irbanij gelernt hatte:
»Speichelfluss und Rattenzahn,
die Warze muss ins Jenseits fahr’n.
Bei Toten ruh’n in Ewigkeit,
Für mich ist sie Vergangenheit.«
Dann packte er die Ratte am Schwanz, stellte sich mit dem Rücken zum Mond und wirbelte sie dreimal über dem Kopf, um mit einem zweiten Zauber auf Nummer sicher zu gehen.
»Flieg hinfort, du Rattenvieh,
mit dir mit die Warze zieh.
Halt sie fest am fremden Ort,
Nimm sie von mei’m Daumen fort.«
Er ließ das Tier los, so dass es über seine linke Schulter geschleudert wurde, und hörte, wie es durch das Laub rauschte und dann irgendwo aufschlug. Erleichtert atmete er durch. Das wäre geschafft, die Warze war er los.
In diesem Moment der Erleichterung entdeckte er plötzlich ein schwaches Licht am östlichen Ende des Friedhofs, dort, wo auch seine Mutter lag, gleich neben den Opfern des großen Minenunglücks, das dreißig Jahre zurücklag. Langsam und ruckelnd schwebte es herbei. Ben stand starr vor Angst. War das ein Irrlicht? Oder doch eine verdammte Seele?
Da nahm er leises Murmeln und schlurfende Schritte wahr und wollte schon erleichtert aufatmen, weil es wohl doch ein lebender Mensch war, oder auch mehrere, die mit einer Laterne unterwegs waren. Aber dann fragte er sich, was jemand um Mitternacht auf dem Friedhof tat, wenn er nicht gerade eine Warze loswerden wollte? Konnte der Zauber jetzt schon wirken, oder würde seine Warze auch dann zu wuchern beginnen, wenn ihn nur jemand sah, solange er noch auf dem Friedhof war? Das wollte er nicht riskieren, und so huschte er möglichst leise und rasch davon. Einmal noch drehte er sich kurz um, aber das Licht war entweder hinter den Bäumen verschwunden, oder der Besitzer hatte es gelöscht, weil er Ben gehört hatte. Er rannte noch schneller, immer nah an großen Gräbern und Bäumen entlang, um nicht gesehen zu werden. Er wollte schließlich keine riesige Warzenhand bekommen!
Keuchend erreichte er die Mauer, kletterte über einen alten, verwitterten Grabstein am Rand des Friedhofs auf sie hinauf und sprang auf der anderen Seite in den Olivenbaum, hangelte sich dort hinab und hetzte davon. Niemand folgte ihm.
EIN NEUES GESICHT
Und du hast keine Ahnung, wer das auf dem Friedhof war?«, fragte Yanko am nächsten Tag, als Ben ihm sein nächtliches Abenteuer erzählt hatte.
»Nicht die geringste.«
Sie saßen in der heißen Mittagssonne auf dem kurzen, alten Steg des oberen Fonksees und hatten die Angeln ausgeworfen, der Friedhof war fern.
Der See war nicht groß, maß vielleicht hundert, höchstens hundertfünfzig Schritt im Durchmesser, doch sein Grund fiel rasch und steil ab, er musste ungeheuer tief sein. An seinem anderen Ufer erhob sich das Wolkengebirge, dessen kahle Gipfel mit Schnee bedeckt waren, selbst im Sommer. Ben konnte sich nicht vorstellen, dass die Trolle nun dort oben in der Kälte lebten, vielleicht waren sie ja weitergezogen, in die Länder nördlich davon. Fahrende Händler hatten erzählt, dass die Menschen jenseits der Berge selbst fast wie Trolle aussahen, in primitiven Holzhütten ohne Fenster lebten und grob und laut feierten.
Mehrere Bäche und Rinnsale von den Gipfeln ringsum flossen in den Fonksee, der beinahe reglos dalag. Nur manchmal kräuselte sich die Oberfläche, wenn ein Fisch in ihrer Nähe nach einem Insekt oder anderem Futter schnappte. Ein sanftes Plätschern war über das leise Rauschen der Schleierfälle hinweg kaum zu hören.
Das Wasser aus den Bergen verließ den Fonksee nur wenige Schritte neben dem Steg, es floss hinüber zu dem bestimmt dreihundert Schritt hohen Abhang in ihrem Rücken und stürzte als Schleierfälle über mehrere Stufen hinab ins Tal, wo es sich mit dem Dherrn vereinte und durch Trollfurt hindurch weiter in den Süden floss. Wenn seine Mutter ihn früher schlimm geschlagen hatte, hatte Ben unterhalb der schimmernden Schleierfälle kleine Holzboote ins Wasser gelassen und sich gewünscht, er würde selbst an Bord sein und nach Süden getragen werden. Das hatte er sich bis zu dem Tag gewünscht, an dem er ein Boot in den Wellen hatte kentern sehen, danach hatte er sich vorgestellt, seine Mutter wäre an Bord.
Seine Mutter hatte nie ein Boot betreten, doch sie war tatsächlich im Dherrn gestorben. Eines Nachts vor über zwei Jahren, nachdem sie Ben wieder einmal als Nichtsnutz beschimpft und geschlagen hatte und er sich mit Zornestränen auf dem Strohsack hin und her gewälzt und geschworen hatte, eines Tages würde er sich rächen, irgendwie, war sie im Suff von der Brücke gefallen oder gesprungen. Eigentlich glaubte er nicht, dass seine Wünsche ihr den Tod gebracht hatten, aber seitdem war er dennoch vorsichtig mit den Gedanken gewesen, die er den kleinen Holzbooten mitsandte.
Die wenigen Trollfurter, die zur Beerdigung gekommen waren, hatten ihm kondoliert, doch in den meisten Gesichtern war so wenig Bedauern zu lesen gewesen wie in seinem eigenen.
»So ganz ohne Eltern wird es schwer für dich«, hatten sie ohne viel Mitleid gesagt, eine einfache Feststellung, und seither behandelten sie ihn so, dass dieser Satz auch wirklich zutraf. Auch nach ihrem Tod blieb er für alle der Sohn der verachteten, verlassenen Säuferin. Seitdem schlug er sich allein durch.
Immer wieder schielte Ben auf seine Warze. Über Nacht war sie zwar nicht verschwunden, aber immerhin auch nicht gewachsen. Er würde das im Auge behalten.
»Bist du sicher, dass es kein Geist gewesen ist?«
»Ich weiß nicht. Hauptsache, mich hat niemand gesehen.« Wer wusste schon, was Warzen anstellten, wenn der Zauber nicht von einem Menschen, sondern einem Toten beobachtet wurde? Oder gar mehreren Toten? Würde die Warze dann nicht nur wuchern, sondern sogar vor sich hinfaulen, so wie das lebende Tote taten? Ben mochte gar nicht daran denken.
»Und das Licht ist aufgetaucht, direkt nachdem du die Ratte fortgeschleudert hast?«
»Ja, zumindest habe ich es erst dann gesehen.«
»Und du bist sicher, dass du die richtigen Worte gesagt hast?«
»Ja, Yanko. Ganz sicher!« Oder hatte er nicht? Er konnte doch gar keinen Zauber wirken, der Geister herbeirief. Außerdem war das Licht kein Geist gewesen.
»Aber was, wenn …«, setzte Yanko noch einmal an, dann riss etwas an seiner Angelrute. Er hielt dagegen und holte die Schnur langsam ein. Es war ein fetter Regenbogenflächler, ein wirklich dicker Brocken. Der wog sicher ein Dutzend Pfund, und als sie ihn aus dem See gezogen hatten und zu den zwei kleinen Lyngelen in den Eimer warfen, war dort kein Platz mehr für weitere Fische. Yanko beharrte darauf, dass das der größte Regenbogenflächler war, den er je gesehen hatte, und Ben musste zugeben, dass er selbst nie einen größeren gefangen hatte.
Der Friedhof war vergessen.
Sie legten sich auf den Steg, sahen in den klaren blauen Himmel und sprachen über die größten Fische Trollfurts, und dann über die größten Fische der Welt. Obwohl sie dazu natürlich auf Gehörtes zurückgreifen mussten und nur Vermutungen anstellen konnten, denn viel hatten sie von der Welt noch nicht gesehen.
»Lass uns zur Mine rübergehen«, schlug Yanko, der nie lange ruhig sitzen konnte, schon bald vor.
»Aber was willst du denn da? Da ist der alte Eingang zugenagelt.«
»Ich will doch auch nicht hinein, ich bin ja nicht verrückt. Ich will nur an den Brettern lauschen, ob man was hören kann.«
»Was soll man da hören können?«, wollte Ben wissen. Wenn Yanko ein solches Gesicht zog, fragte man besser nach.
»Ich weiß nicht. Deshalb will ich doch lauschen, ob man was hören kann. Wenn wir einen Höhlenalb lachen hören, dann wissen wir, dass die Mine wirklich wegen eines Höhlenalbs geschlossen wurde.«
»Aber ich will keinen Höhlenalb lachen hören«, erwiderte Ben. Das konnte selbst einen gestandenen Mann um den Verstand bringen.
»Deshalb müssen wir ja mittags hin. Wenn man in der Sonne steht und auf frischem Gras kaut, dann kann einem nichts passieren. Das bricht den Zauber des Albs.«
»Das ist gut. Aber woher weißt du, wie das Lachen eines Höhlenalbs klingt?«
Yanko wusste es nicht, doch er sagte, sie würden das schon erkennen. Er würde nur gern wissen, warum die Mine vor gut zehn Jahren geschlossen worden war. Damals waren Ben und Yanko noch zu klein gewesen, beide konnten sich nicht erinnern. Ben war fünf gewesen, und sein Vater schon verschollen. Mit der Mine hatte Ben nichts zu schaffen gehabt.
»Ich schätze, sie war einfach erschöpft«, sagte er, weil ihm das seine Mutter erzählt hatte, und sie konnte schließlich nicht immer gelogen haben.
»Ja, aber warum? Warum war sie erschöpft?« Yanko zählte die möglichen Gründe an den Fingern ab. »Der Müller-Taque sagt, es wäre der Fluch eines rachedurstigen Trollschamanen gewesen, der die Mine erschöpft hätte. Der alte Hender hat mir einmal erzählt, immer, wenn sie auf eine vielversprechende Stelle gestoßen waren, hätte diese kein Erz mehr hergegeben, sondern begonnen zu bluten. Manche behaupten sogar, es wäre so viel Blut geflossen, dass sieben Arbeiter ertrunken wären, bevor sie die Mine geschlossen hätten. Taques Vater glaubt, ein Höhlenalb hat die Arbeiter verwirrt, und sie haben fortan an den falschen Stellen gegraben, und die Mine ist gar nicht erschöpft, sondern noch immer voller Blausilber. Und Yhmas hat gehört, die Mine wurde geschlossen, weil dort Kristallwasser gefunden wurde, und jeder Ort mit Kristallwasser geht automatisch in den Besitz eines geheimen Ordens im Dienste des Königs über. Aber Yhmas redet ja die meiste Zeit Unsinn.«
»Was ist Kristallwasser?«, fragte Ben, der davon noch nie gehört hatte.
»Siehst du? Das meine ich. Yhmas redet den ganzen Tag Unsinn.« Yanko stand auf. Er warf sich die Angel über die Schulter und griff sich den Eimer.
Ben stapfte ihm hinterher. Zur Mine war es nicht weit, zehn oder fünfzehn Minuten Weg, der kaum bergauf führte. Schon von Weitem sahen sie den riesigen Eingang zur Mine. Er war übermannshoch, doppelt so breit, lag nach Süden hin und wurde somit von der Sonne direkt angestrahlt. Der Eingang war nicht einfach nachlässig mit ein paar Brettern vernagelt worden, vielmehr hatte man eine massive Konstruktion aus schweren Bolzen und Balken in die Felswand und den Boden versenkt. Nicht einmal eine Eidechse konnte sich dort durchzwängen. Inmitten der Konstruktion befand sich eine eisenbeschlagene Tür mit einem schweren Schloss. Ziemlich viel Aufwand für eine Mine, in der nichts mehr zu holen war. Zudem hatte man ein bürgermeisterlich besiegeltes und inzwischen von zahlreichen Tieren zerkratztes Eisenschild an das Holz genagelt, auf dem stand:
P R I V A T B E S I T Z !
BETRETENBEISTRAFEVERBOTEN!
Interessierte Käufer wenden sich bitte an den Bürgermeister Trollfurts oder direkt an eine Niederlassung der Kaufmannsfamilie Vestapan.
Sie rissen ein paar Büschel Gras aus, stopften sie sich in die Münder und näherten sich kauend der Tür. Ben spuckte einen kleinen blauen Wurm aus, der versehentlich mit hineingelangt war. Dann legten sie die Ohren an das warme Holz. Ben hielt die Luft an und kaute nur noch langsam und leise, doch er konnte nichts hören. Nur ein paar Vögel zwitscherten, Wind ging nicht. Er hielt sich das andere Ohr zu, doch es half nichts, nicht das geringste Geräusch drang aus der Mine heraus.
Yanko ging in die Knie und lauschte am Schlüsselloch, dann roch er daran, schließlich schüttelte er den Kopf.
»Wir holen uns den Schlüssel von Byasso.«
Byasso war der Sohn des Bürgermeisters und ein eher ängstlicher Junge. Sagte man ihm das jedoch ins Gesicht, ließ er sich zu allen möglichen Abenteuern reizen, nur damit man »das Maul hielt«. Seitdem Yanko das herausgefunden hatte, verbrachte er ziemlich viel Zeit mit Byasso.
Wenn Ben und Byasso in Yankos Beisein aufeinandertrafen, beschimpften sie einander meist als Gassenkind und Hosenscheißer, Byasso nannte Bens Mutter eine tote Schnapsflasche und Ben Byassos Vater eine leere Irgendwas-Flasche, und dann schubsten sie sich herum, bis Yanko eingriff. War Yanko nicht in der Nähe, ignorierten sie sich, schließlich wurde Ben ja häufig ignoriert. Dagegen hatte er nichts, das war besser, als verkloppt zu werden, weil irgendwer der Meinung war, es sei mal wieder nötig, es diesem Ben zu zeigen.
Während sie ins Tal hinabstiegen, dachte Ben über neue Beschimpfungen nach, die er Byasso an den Kopf werfen konnte, und als sie schließlich in Trollfurt ankamen, quoll sein eigener vor neuen Schimpfwörtern und Beleidigungen förmlich über.
Zuerst wollte Yanko jedoch den Fisch und die Angelruten nach Hause bringen, bevor sie dann mit dem Schlüssel wieder den Berg hinauf wollten. Ben wartete an der Dherrnbrücke auf seine Rückkehr.
Während er auf der steinernen Brückenmauer in der Sonne saß und sich die Erde zwischen den Zehen rauspulte, kam ein schrecklich vornehm gekleideter Junge die Straße hinunter, sein Hemd wies mehr Rüschen auf als alle Sonntagshemden, die Ben je gesehen hatte, sogar zusammengenommen. Er trug auch noch blank gewienerte Schuhe mit einer verschnörkelten silbernen Schnalle. Er war Ben vollkommen fremd, und die meisten in seinem Alter kannte er wenigstens vom Sehen, auch wenn die Kinder aus den besseren Familien kaum mehr als Schimpfworte mit ihm wechselten. Der fremde Junge war ein bisschen größer als Ben, kräftig, und sein Gesicht mit der schmalen Nase und dem vorspringenden Kinn trug einen ungemein blasierten Ausdruck zur Schau. Das helle, dünne Haar war frisch gekämmt, und auf Oberlippe und Kinn zeigte sich ein erster, spärlicher Bartflaum, den er anscheinend mit Kohle gefärbt hatte, um ihn zu betonen. Zielstrebig schritt er auf die Brücke zu und ließ den Blick über die kleinen, heruntergekommenen Häuser im linksseitigen Trollfurt schweifen.
»Was für ein erbärmlicher Anblick«, sagte er mit näselnder Stimme und musterte dann Ben ebenso abschätzig. »Wirklich ganz und gar erbärmlich.«
Ben starrte ihn voller Abneigung an. Und weil er nicht sicher war, ob der Junge vielleicht sogar ihn meinte, fragte er mit kalter Stimme: »Sprichst du etwa mit mir?«
»Mit dir? Sehe ich aus, als würde ich mit jemandem wie dir reden?« Irritiert maß der blasierte Junge Ben von oben bis unten.
Ben sprang auf die Füße. Er hatte sich so viele neue Beschimpfungen für Byasso überlegt, sie kreisten in seinem Kopf, warteten ungeduldig darauf, ausgesprochen zu werden, da kam ihm dieser aufgeblasene Wicht gerade recht. Was hatte der überhaupt auf der Brücke zu suchen? Er sah wirklich nicht aus, als gehörte er auf die linke Dherrnseite. Wenn er nur hergekommen war, um Ärger zu machen – den konnte er haben. Natürlich waren die kleinen, heruntergekommenen Häuser schäbig, doch ein Fremder von der rechten Seite hatte kein Recht, das zu sagen.
»Nein«, sagte Ben also, und begann ganz langsam: »Du siehst eher aus wie jemand, der überhaupt nicht reden kann. Eine von diesen kleinen niedlichen Kinderpüppchen, mit denen die vornehmen kleinen Mädchen aber nicht mehr spielen wollen, wenn sie merken, dass es auch echte Menschen gibt.«
Erstaunt öffnete der fremde Junge den Mund und starrte ihn an.
»Mach die Klappe wieder zu, es stinkt«, fuhr Ben fort, weil der andere nichts sagte. »Was hast du heute gefrühstückt? Einen Schweinestall? Oder läuft es bei dir alles andersrum, und du schiebst dir das Essen in den Hintern und verdaust mit dem Kopf?«
»Wo ich herkomme, werden die Bälger von Knechten für so etwas ausgepeitscht.« Der Junge war blass geworden, sein Kinn zitterte.
»Und wo soll das sein? Im Darm eines Drachen, der Durchfall hat?«
»Halt’s Maul, du Missgeburt einer Trollin, oder ich verpass dir eine!«
»Du mir? Noch so ’n Spruch, Nasenbruch!«
»Missgeburt!«
»Warzenkopf!«
»Missgeburt!«
»Nisten in dem Hohlraum zwischen deinen Ohren eigentlich Vögel oder eher Fledermäuse?«
»Missgeburt! Missgeburt! Missgeburt einer Trollin!«
»Sag mal, musst du dich immer wiederholen? Oder kennst du auch noch andere Wörter?«, grinste Ben überlegen. Das lief ja bestens. Die Wortgefechte mit Byasso gewann er nie so leicht.
»Ich schlag dich zu Brei!«
»Na also, geht doch«, sagte Ben, und der Fremde schlug tatsächlich zu.
Ben wich aus und packte den anderen am Kragen. Der trat ihm gegen das Schienbein. Ben stieß ihn zurück und sprang hinterher. Er traf ihn mit der Schulter an der Brust und warf ihn zu Boden, taumelte selbst und kam auf ihm zu liegen. Ineinander verkeilt rollten sie auf der Brücke hin und her. Der Warzenkopf versuchte tatsächlich, ihn zwischen die Beine zu treten, aber Ben konnte den Tritt abblocken.
»Schneckenschleim«, presste er hervor, stieß den anderen gegen die Mauer und wälzte sich weg. Er sprang als Erster auf die Beine und spuckte ein bisschen Blut. Nicht wild, er hatte sich wohl auf die Lippe gebissen. »Was ist? Wo ist meine Abreibung? Ich dachte, du wolltest mir eine verpassen.«
Der andere Junge rappelte sich mühsam auf und hielt sich den Hinterkopf. In seinen Augen glitzerten Tränen. »Dafür wirst du büßen!«
»Sind das Abschiedstränen? Kriechst du wieder in deinen Drachendarm zurück?«
»Missgeburt!« Schniefend rannte der Junge davon.
»Oder rennst du heim zu deiner Mami?« Was für ein hochnäsiger Jammerlappen. Fing nach ein paar Beleidigungen eine harmlose Rauferei an, versuchte dann aber feige, ihm das Knie zwischen die Beine zu rammen. Und heulte rum, wenn er trotzdem verlor. Wenn jeder so flennen würde, der eine kleine Rauferei verliert, dann gäbe es ständig Hochwasser in Trollfurt. Ben bückte sich und hob einen hellen Messingknopf auf, der vom Hemd des anderen abgerissen sein musste. Zufrieden steckte er ihn ein.
Als Yanko kam, war er enttäuscht, dass er die Rauferei verpasst hatte. Ben beschrieb den Jungen, aber auch Yanko kannte ihn nicht. Also wandten sie sich wieder wichtigeren Dingen zu und suchten Byasso.
Sie fanden ihn außerhalb der Stadtmauer, direkt bei den Schleierfällen, wo er Steine über den Fluss flitzen ließ. Er war gut darin, trotz der Wellen. Byasso hatte die Ärmel des weißen Hemds akkurat hochgekrempelt, sein kurzes dunkles Haar war wie stets sauber gescheitelt. Seine Eltern waren der Meinung, dass er als Sohn des Bürgermeisters jederzeit einen guten Eindruck machen musste, denn er repräsentierte die Familie sogar beim Steineflitzen. Dennoch hatte Byasso die Schuhe ausgezogen und stand barfuß am Ufer.
Als sie ihn ansprachen, nickte er ihnen zu und vergaß ganz, Ben zu beschimpfen. Der war darüber nicht traurig, er hatte seine kleine Auseinandersetzung heute ja schon gehabt.
»Ich hab gehört, du traust dich nicht in die alte Mine«, sagte Yanko.
»Wer behauptet das?«, fragte Byasso empört.
»Ich weiß es nicht mehr, es waren ein paar Jungs. Ich hab es hier und da aufgeschnappt und wollte wissen, ob das stimmt.«
»Natürlich stimmt es nicht!« Byassos Kopf war knallrot geworden.
»Dann beweis es.«
»Und wie? Die Mine ist verschlossen, falls du das noch nicht mitbekommen hast.«
»Das weiß ich«, sagte Yanko. »Aber ich weiß auch, dass dein Vater den Schlüssel hat, und du könntest uns Zugang verschaffen.«
»Mein Vater hatte den Schlüssel mal. Jetzt hat ihn der neue Besitzer der Mine.«
»Der neue Besitzer?« Ben und Yanko starrten Byasso an.
»Sag mal, wo seid ihr gewesen? Bei den Trollen? Der Neue ist heute Morgen mit viel Tamtam und fünf voll beladenen Kutschen angekommen.« Byasso zuckte mit den Schultern. »Mein Vater wusste natürlich schon länger Bescheid, aber er durfte nichts sagen.«
Die Mine hatte einen neuen Besitzer. Hieß das, sie war noch gar nicht erschöpft? Oder hatte der Vorbesitzer den Mann ausgetrickst und ihm ein wertloses Stück Land angedreht? Ben und Yanko löcherten Byasso und fluchten darüber, dass sie die Ankunft des Mannes verpasst hatten. Wenn sich einmal etwas in Trollfurt ereignete, dann waren sie angeln.
»Ich weiß auch nicht mehr als ihr. Mein Vater sagt mir ja nichts. Aber der Mann hat einen Sohn in unserem Alter. Fragt doch am besten ihn nach dem Schlüssel. Wenn ihr noch mal in die Mine wollt, bevor sie wieder in Betrieb genommen wird, solltet ihr euch aber beeilen. Wollen wir rübergehen, und ich stell euch vor?«
»Hm«, brummte Ben. Er hatte das dumme Gefühl, den Jungen gerade eben kennengelernt zu haben, und verspürte nicht das geringste Bedürfnis, ihn gleich wieder zu treffen. »Geht mal lieber allein. Ich glaube nicht, dass er mich sehen will.«
Yanko stutzte kurz, dann nickte er. »Ich befürchte, da hast du recht.«
Byasso sah die beiden verständnislos an.
»Wir sehen uns dann später«, sagte Yanko und zog mit Byasso ab.
Ben blieb am Fluss zurück, um selbst ein paar flache Steine über das Wasser flitzen zu lassen.
VON GÖTTERN UND DRACHEN
Als Ben am nächsten Morgen erwachte, schien ihm die Sonne direkt ins Gesicht. Brummend kletterte er von seinem Strohsack, schlüpfte in die geflickte Hose und setzte sich an den kleinen Holztisch in der Wohnküche. Über die Jahre hatte er alle Wände mit schwarzer, blauer und grüner Kohle bemalt, überall rannten, kämpften und posierten große und kleine Drachen. Die Wand am Tisch wurde ganz von einem großen, schwarzen Drachen eingenommen, den er aus der Erinnerung gezeichnet hatte; jede einzelne Schuppe hatte er sorgfältig schraffiert, und die großen Augen hatte er sicher hundert Mal weggewischt und neu gemacht. Jetzt sah es fast so gut aus wie das Drachenbild über dem Eingang des Hellwahtempels, fand Ben.
Bevor er sich ans Frühstück machte, begutachtete er misstrauisch seine Warze. Sie schien sich nicht verändert zu haben. Zur Sicherheit rieb er sie noch mal mit Speichel ein. Dann aß er die Fischreste von gestern, die Yanko ihm abends noch gebracht hatte, und trank einen großen Krug Wasser. Den letzten Kanten Brot, den er vorgestern stibitzt hatte, hob er sich für Mittag auf. Um ein Abendessen würde er sich noch kümmern müssen.
Geschirr und Besteck ließ er stehen, nur das Messer steckte er ein, als er kurz darauf das Haus verließ. Mit seiner Mutter hatte er zwei Straßen weiter gewohnt, aber nachdem sie gestorben war, hatte er seine Habe gepackt und in dieses verlassene Haus gebracht. Hier wohnten keine bösen Erinnerungen.
Vor der Tür machte er rasch das Zeichen der ewigen Sonne und lief dann die Straße hinunter.
Es war Sonntag, und die älteren Jungen und Mädchen der besseren Familien wurden im Tempel unterrichtet, die Kinder der Knechte, Mägde und Diener kamen nur selten. Als Kind galt in Trollfurt jeder, der noch nicht siebzehn Jahre zählte und noch keine Flasche heiligen Schnees vom Gipfel des zerklüfteten Torregg geholt hatte, ihn in der Sonne geschmolzen und rituell mit dem Bürgermeister und Priester getrunken hatte. Ben wurde im Herbst sechzehn, nächstes Jahr also würde er endlich zum Erwachsenen werden. Den Torregg hatte er schon mehrmals erklommen, obwohl es Kindern eigentlich untersagt war.
Fein rausgeputzt in Feiertagskleidung und sauber gekämmt saßen die Kinder Trollfurts auf den harten Bänken in der vorderen Halle und ließen die Worte des Priesters Habemaas über sich ergehen. Ben war schon vor dem Tod seiner Mutter nur unregelmäßig zum Sonntagsunterricht gegangen, und dann in den letzten zwei Jahren überhaupt nicht mehr. Er hatte weder das nötige Schulgeld noch die Lust dazu.
Viel lieber legte er sich neben dem Tempel ins Gras, ließ sich die Sonne auf den Bauch scheinen und lauschte auf die Worte, die aus den hohen Fenstern nach draußen drangen. Langweilte ihn das Gerede des Priesters, dachte er an etwas anderes oder zog ein paar Würmer aus der Erde, um sie später als Köder zu verwenden. Doch die meisten Sagen gefielen ihm, und er hörte gern zu. Von hier draußen, wo ihm niemand sagte, er solle gerade sitzen und sich nicht am Hintern kratzen und dergleichen, und wo er auch keine Fragen beantworten musste. Das hasste er, ihn interessierten oft andere Dinge an einer Geschichte als den Priester, und er wusste nie, worauf dieser mit seinen Fragen hinauswollte. Außerdem war es schön zu wissen, dass alle Kinder im Tempel neidisch zu ihm hinaussahen. Auch wenn sie ihn sonst verlachten und auf ihn herabsahen, in diesem Moment wären sie alle gern an seiner Stelle.
Ben lag im Gras und hatte die Arme hinter dem Kopf verschränkt. Im Tempel wurde eben noch das Opfergeld eingesammelt, und der Priester stellte allen die drei neuen Geschwister in der Stadt vor: die beiden Söhne und die Tochter des neuen Minenbesitzers Yirkhenbarg. Die Namen der Kinder vergaß Ben sofort wieder, er merkte sich nur, dass es demnach nicht nur einen von dieser hochnäsigen Brut gab.
»Heute erzähle ich euch, wie der dunkle Samoth die Drachen verdarb«, sagte der Priester kurz darauf mit seiner tiefen, weichen Stimme, »und wie ein mutiger Mann den Fluch wieder von ihnen nahm.«
Diese Sage mochte Ben besonders, und egal, wie gut er sie schon kannte, er konnte sie immer wieder hören. Von Geschichten über Drachen bekam er einfach nie genug.
Der Priester begann:
In den Tagen, als Hellwah, der Sonnengott und höchste aller Götter, die Menschen und Drachen und alle Tiere der Erde geschaffen hatte, da lebten die Götter noch mitten unter ihren Kreaturen. Und sie sprachen offen und freundlich mit allen Menschen. Manche der Götter wohnten sogar dem einen oder anderen Menschen bei, denn die ersten Menschen waren schön und stark und langlebig.
Hatte Hellwah auch alle Kreaturen geschaffen, die auf der Erde wandelten, so waren die Vögel das Werk seiner Göttergattin Aphra, der Mondgöttin. Sie hatte die Vögel ihrem Gemahl an ihrem Hochzeitstag zum Geschenk gemacht, denn es waren Wesen, die nicht einfach auf Erden wandelten, sondern sich in die Lüfte erhoben, in Richtung Sonne, um Hellwah näher zu sein und um ihn mit ihrem Flug zu erfreuen. Und weil sie für ihn gemacht waren, sangen die Vögel ihre frohen Lieder am Tag, solange sein Gestirn am Himmel schwebte, während in der Nacht nur jene Vögel ihre Stimme erhoben, die klagten.
Im Flug der Vögel konnte man die Launen und den Willen Hellwahs lesen, doch die wenigsten Menschen lernten diese Kunst, denn Hellwah und die anderen Götter lebten ja mitten unter ihnen. Wer seinen Willen erforschen wollte, konnte den höchsten der Götter einfach fragen, es brauchte keinen Vogelflug, um Antworten zu erhalten. Es waren gute Tage in jener Zeit.
Doch da kroch Samoth, der Gott der Orte, die nie von Sonne oder Mond beschienen wurden, der Herr der Würmer und aller Kreaturen, die in der Erde und in den Tiefen der Meere leben, aus seinem unterirdischen Reich herauf. Er hatte Freude an der Zwietracht, und so nahm er die Gestalt eines schönen Mannes an, ging zu dem Menschenkönig Daliath und umschmeichelte ihn, lobte seine Größe und seinen Verstand und die Kraft der Menschen, bis der König ihn seinen besten Freund nannte.
Da offenbarte Samoth dem König, Hellwah würde der Königin nachsteigen und ihr in Daliaths Gestalt beiwohnen. Der König kochte vor Wut und ließ seine Frau in den tiefsten Kerker sperren, obwohl sie flehte und ihre Unschuld beteuerte. Sie wäre immer nur ihm treu gewesen, wie hätte sie die List eines Gottes denn durchschauen sollen? Doch der König ließ sich nicht erweichen, sein Zorn und Stolz waren zu groß. Doch wagte er es nicht, Hellwah zur Rede zu stellen, der Gott war zu mächtig, und Samoth sagte, er würde König Daliath einfach zermalmen.
Daliath verstieß auch seine drei Söhne und seine drei Töchter, denn er wusste nicht, welches der Kinder von ihm war, und er ertrug es nicht, sie anzusehen, um in ihren Gesichtern nach Merkmalen zu suchen, die ihre wahre Herkunft verrieten.
»Soll ich dir helfen, Rache an Hellwah zu nehmen?«, fragte Samoth ihn.
Und König Daliath sagte: »Ja.« Denn Rache war alles, an das er noch denken konnte. Der Palast war ohne seine Kinder so schrecklich leer und still, und die Diener wagten nicht zu reden, nur manchmal hörte man die Schreie der Königin aus der Tiefe des Kerkers.
Samoth sagte also zum König: »Gehe zur Mondgöttin und stiehl von ihr das Geheimnis der Flügel, die sie den Vögeln gemacht hat. Damit können wir deine verdiente Rache in die Tat umsetzen.«
Samoth hatte schon zahlreiche Vögel gefangen und ihnen die Flügel ausgerissen, um hinter ihr Geheimnis zu kommen, doch er hatte selbst keine Flügel erschaffen können.
Weil Aphra, die Mondgöttin, König Daliath vertraute, verriet sie ihm, wie sie aus den Blättern des Lebensbaums Federn gemacht hatte, indem sie die stärksten Winde aus allen vier Himmelsrichtungen eingeatmet und mit einem magischen Wort auf die Blätter gehaucht hatte. Diese Federn band sie dann zu Flügeln zusammen. Doch das magische Wort wollte Aphra König Daliath nicht verraten, denn sie sagte, es sei nicht für die Ohren eines Menschen bestimmt.
Damit gab sich Daliath nicht zufrieden, und so versteckte er sich im Haus der Göttin und wartete, bis sie einen weiteren Vogel erschuf. Und sie besprach die Blattfedern mit dem Wort, und der König hörte es, und es brannte sich ihm ein.
Und von König Daliath erfuhr Samoth das Wort.
Und der Gott der Tiefe erschuf nun Flügel von seiner Hand. Jedoch fertigte er sie nicht aus Federn, gewonnen aus den Blättern des Lebensbaums, sondern er spannte sie über große schwarze Knochen aus den Netzen der giftigsten Spinnen aus den tiefsten Höhlen, und er hauchte über sie die eingeatmeten Wirbelwinde des Herbstes, wilde Stürme, die keiner Richtung folgten.
Er erschuf neun Flügelpaare und nähte sie neun großen Drachen an die Schultern.
»Wozu soll das gut sein?«, fragte König Daliath.
Und Samoth offenbarte ihm, dass die Drachen nun fliegen konnten und fortan die Vögel im Himmel fressen würden, welche die besonderen Tiere Hellwahs waren, das Hochzeitsgeschenk seiner geliebten Gemahlin. Denn Hellwah sollte seine Tiere verlieren, so wie der König seine Kinder verloren hatte.
Der König griff sich eine beinerne Nadel und nähte voller Eifer mit, und er wollte sich nicht erinnern, dass er es doch selbst gewesen war, der seine Kinder fortgeschickt hatte.
Damals lebten die Drachen als treue Gefährten der Menschen unter ihnen, und sie waren von freundlichem Wesen und klug. Doch mit Samoths Flügeln kam auch Samoths Bosheit über sie, und so wurden sie zu Geschöpfen der Finsternis. Sie jagten Hellwahs Vögel, so wie Samoth es vorausgesagt hatte, doch sie fraßen zudem weiterhin die Tiere des Landes, sie fraßen alle flügellosen Drachen, und von jenem Tag an fraßen sie auch Menschen.
Hellwahs Zorn über Daliaths Verrat war so groß, dass er die Berge Feuer speien ließ, und Asche und Glut regnete auf die Stadt des Königs herab. Und Daliath verbrannte mit seinem Palast, und der Zugang zu den Kerkern wurde verschüttet, so dass die Königin in der finsteren Tiefe eingesperrt wurde.
Aphras Trauer war ebenso groß wie Hellwahs Zorn, und ihre Tränen flossen so zahlreich ins Meer, dass es salzig wurde und drohte, das ganze Land zu überschwemmen. Sie und Hellwah und die anderen Götter zogen sich auf den höchsten Berg der Welt zurück, auf den steilen Gipfel, den kein Mensch erklimmen konnte.
Und Samoth zog sich unter die Erde zurück, denn er hatte erreicht, was er wollte. Und er nahm die Königin aus dem Kerker mit sich, und sie gebar ihm acht unmenschliche Kinder der Finsternis, die sie im Hass auf alle Menschen erzog.
Die Menschen lebten in Angst vor Überschwemmungen, Feuerregen und den menschenfressenden Drachen, nur der verstoßene Chillos, der älteste der Königssöhne, wollte sich nicht mit dem Schicksal abfinden. Er schmiedete im Feuer, welches Hellwah vom Berg herabgesandt hatte, ein Schwert aus hartem Stahl, und er kühlte es in den Tränen Aphras.
»Ich werde die schlimme Tat meines Vaters ungeschehen machen«, sagte Chillos und zog los, um sich den Drachen zu stellen. Sie wüteten, zerstörten Häuser und verzehrten Jungfrauen und Kinder, ein jeder Drache für sich. Einen nach dem anderen zwang Chillos in einen Zweikampf, und einen jeden besiegte er mit seinem mächtigen Schwert. Er tötete sie nicht, sondern schlug einem jeden von ihnen die Flügel ab, und so wich Samoths Bosheit wieder aus ihnen.
Als Chillos alle neun Drachen von Samoths Geißel befreit hatte, ritt er auf dem größten von ihnen zum Berg der Götter und rief hinauf: »Ich habe die Untaten meines Vaters gesühnt, und so bitte ich euch, Hellwah und Aphra und ihr anderen Götter, lasst kein Feuer mehr regnen, nehmt die Fluten von unserem Land und lasst uns wieder gemeinsam leben.«
Aphra hörte auf zu weinen, denn es gab keine geflügelten Drachen mehr, die ihre Geschöpfe, die Vögel, fraßen. Und Hellwah befahl den Bergen, kein Feuer mehr zu speien. Doch die Götter blieben auf ihrem Berg, sie wollten nun nicht mehr unter den Menschen leben. Aber sie versprachen dem Helden Chillos, dass sie die Gebete der Menschen von nun an wieder erhören und auch dargebotene Opfer annehmen wollten.
»Doch auf den Drachen lastet fortan der Fluch von Daliaths Flügel«, sagte Hellwah. »Ein jeder Drache soll geflügelt und als Geschöpf der Finsternis geboren werden. Findet sich jedoch ein Held unter den Menschen, der dem Drachen seine Flügel abschlägt, so soll der Drache dadurch aus der Finsternis befreit werden und wieder ein treuer Gefährte des Menschen sein. Was euch vor Daliaths Verrat in den Schoß gefallen ist, das müsst ihr euch nun mit Heldenmut und einem starken Arm erkämpfen.«
Das waren die Worte Hellwahs, und Chillos brachte sie zu den Menschen und gründete den Orden der Drachenritter.
Damit endete die Sage von Chillos’ erster Heldentat, und der Priester fügte an: »Seit diesen frühen Tagen schützt der Orden die Menschen und befreit die Drachen von ihrem Fluch.«
»Wie wird man ein Drachenritter?«, rief ein Junge, noch bevor der Priester selbst eine Frage an die Kinder stellen konnte.
Überrascht hob Ben den Kopf und schielte zum Fenster hinein. Warum war er nie auf den Gedanken gekommen, den Priester zu fragen? Seit seine Mutter seinen Wunsch verlacht hatte, hatte er ihn in sich vergraben gehabt, und nun sprach ein anderer ihn aus. Sein Herz schlug schneller, während er der Antwort lauschte.
Der Priester lächelte milde und verschränkte seine Finger über dem runden Bäuchlein, das sich in den letzten Jahren immer deutlicher unter der bodenlangen, tiefblauen Schultoga abzeichnete. Dabei achtete er penibel darauf, nicht Hellwahs rote, zwölfstrahlige Sonne auf seiner Brust zu verdecken. »Nun, das ist nicht ganz leicht. Ihr wisst um die Bedeutung des Ordens. Er ist der weltliche Arm Hellwahs, und neben seinen ursprünglichen Aufgaben steht er den Herrschenden mit Rat und Tat zur Seite. Er schützt die einfachen Bürger und entscheidet gemeinsam mit Hellwahs Priesterschaft, welchem Adligen und welchem Kaufherrn der Titel eines Drachenreiters verliehen wird, wer mit einem befreiten Drachen geehrt wird. In fast allen großen Städten unterhalten sie ein Kloster oder wenigstens einen kleinen Ordenssitz, auch Trollfurt hatte bis zur Schließung der Mine einen eigenen Drachenritter. Nun, es ist also offensichtlich, dass der Orden seine Mitglieder sehr sorgfältig auswählen muss. Nur die tapfersten und stärksten jungen Männer werden im Orden aufgenommen, um dort drei Jahre zu dienen und zu lernen. Dann müssen sie drei schwere Prüfungen bestehen, was nicht vielen gelingt, bevor sie drei Jahre als Drachenknappe mit einem Ritter reisen. Bürgt dieser schließlich für den Mut und die Tatkraft seines Knappen, so wird er vom Großmeister des Ordens mit Hellwahs Segen zum Ritter geschlagen.«
»Müssen Drachenritter von Adel sein?«, hakte ein anderer Junge nach.
»Nein. Es gab schon einige Drachenritter aus angesehenen bürgerlichen Familien. Mir ist zwar nicht bekannt, dass jemals der Sohn eines Knechts zu einem Drachenritter geschlagen wurde, aber ausdrücklich verboten ist selbst dies nach den Regeln des Ordens nicht.«
Jetzt erhob sich ein Getöse im Tempel, denn jeder der Jungen brüstete sich mit seinen Heldentaten, seinem Geschick bei der Jagd und allerlei bestandenen Mutproben und versicherte, er wolle Drachenritter werden, und er würde die Prüfungen schon bestehen. Tischnachbarn gaben sich Kopfnüsse oder nahmen einander in den Schwitzkasten, um zu beweisen, wer der Stärkere war, und jeder hielt einem anderen vor, dass dieser sich dieses oder jenes nicht trauen würde.
»Und ob ich mich traue, von der unteren Klippe der Schleierfälle zu springen! Und zwar auf der Stelle!«, schrie Byasso.
»Setz dich wieder hin!«, rief Priester Habemaas.
»Aber …«
»Byasso! Du wirst jetzt nicht von einer Klippe springen! Und zieh dein Hemd wieder an. Das hier ist ein Tempel, kein Bordell!«
Ben grinste. Und mit einem Mal durchströmte ihn die Hoffnung, dass sein Wunsch, Drachen zu befreien, vielleicht doch in Erfüllung gehen konnte. Oft hatte er mit einer schartigen, gebrochenen Klinge, die Yanko ihm vom Alteisen aus der Schmiede seines Vaters stibitzt hatte, im Wald kämpfen geübt, hatte mächtigen Bäumen aus der Drehung schwungvoll die Äste abgeschlagen wie einem Drachen die verfluchten Flügel. Aber nicht oft genug – ab heute würde er viel regelmäßiger üben. Natürlich war ihm klar, dass seine Chancen nicht allzu groß waren, aber er konnte es schaffen. Er musste es einfach versuchen. Den Sommer über würde er noch üben, dann wollte er sein Glück versuchen. Dem weiter anschwellenden Lärm im Tempel nach war er nicht der Einzige, der solche Pläne gefasst hatte. Priester Habemaas konnte seine Schüler nur mühsam beruhigen.
»Mein Vater hat einen Drachen«, sagte plötzlich der Junge, den Ben am Tag zuvor verdroschen hatte, ganz nebensächlich, und schon war die Ruhe im Tempel wieder dahin. Alle schrien durcheinander und wollten wissen, wie groß der Drache sei, was für einer es wäre und welcher Ritter ihn vom Fluch der Flügel befreit habe. Die meisten Kinder fragten, ob man ihn anschauen könne.
»Natürlich«, antwortete der Junge, und an Unterricht war nicht mehr zu denken.
Also seufzte der Priester schwer und sagte: »Wenn deinem Vater das wirklich recht ist, Sidhy, dann führ uns doch bitte hin.«