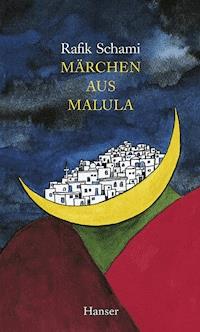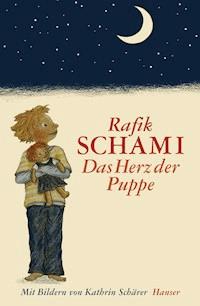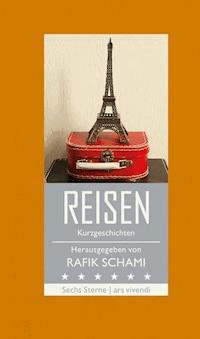Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Rafik Schami erzählt die dramatische Geschichte der Liebe zwischen Farid Muschtak und Rana Schahin, die in Damaskus von Verfolgung und Mord bedroht wird. Er spannt einen weiten Bogen über ein Jahrhundert syrischer Geschichte, in dem Politik und Religionen ein Volk nicht zur Ruhe kommen lassen. Ein Roman von ungeheurer Wucht und zugleich eine Liebeserklärung an seine Heimatstadt Damaskus.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1427
Veröffentlichungsjahr: 2004
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dem Tor der Pauluskapelle in Damaskus hängt eines Morgens ein Toter. Der Ermordete war ein muslimischer Offizier. Gerade als Kommissar Barudi die undurchsichtige Witwe verhören will, wird ihm der Fall vom Geheimdienst entzogen. Heimlich recherchiert er weiter und stößt auf das Tatmotiv: Es geht um eine Blutfehde zwischen den Clans der Muschtaks und der Schahins, die zum Beginn des 20. Jahrhunderts zurückreicht. Und es geht um eine Liebe, die nicht sein darf, weil Versöhnung nicht vorkommt in den alten Familienstrukturen.
Rafik Schami spannt einen großen, schillernden Erzählbogen über ein Jahrhundert syrischer Geschichte, in dem Politik und Religionen ein Volk nicht zur Ruhe kommen lassen. In tausend Facetten schildert er den eskalierenden Wahnsinn von Hass und Gewalt und die akute Bedrohung für den, der sich dem Diktat der Sippe nicht beugt. Zugleich erzählt Schami in poetischen Geschichten aus drei Generationen vom Mut der Liebenden, denen der Tod droht und die dennoch die Unterdrückung ihrer Leidenschaft nicht zulassen wollen.
Rafik Schami hat einen Roman von ungeheurer Wucht geschrieben, der auch die dunklen Seiten der Geschichte seines Landes nicht ausblendet. Und eine Liebeserklärung an seine Heimatstadt Damaskus, die zugleich ein großes und fesselndes Epos über die Liebe ist.
Hanser E-Book
RAFIK SCHAMI
Die dunkle Seite der Liebe
Roman
Carl Hanser Verlag
Für zwei große Frauen,
Hanne Joakim und Root Leeb
BUCH DER LIEBE 1
Olivenbäume und Antworten brauchen Zeit.
DAMASKUS, FRÜHJAHR 1960
1. Die Frage
»Und du glaubst wirklich, dass unsere Liebe eine Chance hat?«
Farid fragte nicht, um Rana an die Blutfehde zwischen ihren beiden Familien zu erinnern, sondern weil er sich elend fühlte und keine Hoffnung sah.
Sein Freund Amin war vor drei Tagen beim Verlassen des Hauses von der Geheimpolizei überfallen und verschleppt worden. Seit dem Zusammenschluss Syriens und Ägyptens im Frühjahr 1958 hatte eine Hetzjagd auf Kommunisten eingesetzt. 1959 war besonders schlimm gewesen. Staatspräsident Satlan hatte wütende Hetzreden gegen das Regime des Diktators Damian im Irak und die Kommunisten gehalten. Auch als das Jahr zu Ende ging, hatte es kein Aufatmen gegeben, selbst in der Nacht rasten die Jeeps des Geheimdienstes mit ihren Opfern durch die Straßen der Hauptstadt. Die Familien blieben unter Tränen der Angst zurück. Man sprach von der blutigen Silvesternacht. Ein Geflüster wanderte von Mund zu Mund und schuf noch mehr Angst vor dem Geheimdienst, der sich mit seinen Spitzeln in jeder Wohnung niederzulassen schien.
Liebe kam Farid an jenem Tag wie ein Luxus vor. Er hatte ein paar ungestörte Stunden mit Rana im Haus seiner verstorbenen Großmutter verbracht. Hier in Damaskus war jede Begegnung mit ihr eine Oase inmitten der Wüste seiner Einsamkeit. Ganz anders als die Wochen in Beirut, wo sie sich vor acht Jahren versteckt hatten. Dort hatte jeder Tag in Ranas Armen begonnen und geendet. Dort war die Liebe eine sanfte, weite Flusslandschaft gewesen.
Das Haus seiner Großmutter war noch nicht verkauft. Claire, seine Mutter, hatte ihm am Vormittag den Schlüssel gegeben. »Aber die Unterhose bleibt an«, hatte sie gescherzt.
Die Sonne schien, doch es war ein eiskalter Tag. Eine muffige Feuchte war ihm entgegengeschlagen, als er das Haus betrat. Er öffnete die Fenster, lud die Frische ein und machte schließlich Feuer in den Öfen der Küche und des Schlafzimmers. Nichts auf der Welt hasste Farid mehr als den Geruch abgestandener, feuchter Kälte.
Als Rana kurz vor zwölf Uhr kam, glühten die Öfen bereits. Sie scherzte: »Wollten wir uns im Hammam treffen oder im Haus deiner Großmutter?«
Sie war wie immer hinreißend schön, doch er wurde das Gefühl einer drohenden Gefahr nicht los. Während er sie küsste, dachte er an den Inder, der bei einer Überschwemmung hilflos auf einem Dach Rettung suchte und langsam in den nassen Tod sank. Farid hielt seine Freundin wie ein Ertrinkender fest. Ihr Herz schlug gegen seine Brust.
Er fror trotz der Hitze und nur für Sekunden befreite ihn ihr Lachen von seiner Angst. Immer wieder brach es aus ihr heraus und hüpfte ungebändigt zu ihm.
»Du bist ja heute ein Vorbild des Anstands«, stichelte sie, als sie das Haus nach einigen Stunden wieder verließen. »Gerade so, als hätte meine Mutter dich beauftragt, auf mich aufzupassen. Nicht einmal die Hose hast du …« Und sie lachte hell.
»Das hat mit deiner Mutter nichts zu tun«, sagte er und wollte es ihr erklären, aber die Worte stellten sich quer. Schweigend ging er neben ihr her durch die Gassen zum Sufanije-Park nahe Bab Tuma. Jeder Jeep schreckte ihn auf.
Aus den Radios der Cafés kamen die Worte des Präsidenten, der den Feinden der Republik den erbitterten Kampf ansagte. Satlan besaß eine schöne männliche Stimme. Wenn er redete, berauschte er die Araber. Das Radio war sein Zauberkasten. Bei über achtzig Prozent Analphabeten hatte die Opposition keine Chance. Wer den Radiosender in seiner Gewalt hat, hat das Volk auf seiner Seite.
Und das Volk liebte Satlan, nur eine winzige verzweifelte Opposition fürchtete ihn und nach der erbarmungslosen Verhaftungswelle umzingelte eine seltsame Angst die Stadt. Aber schon bald werden die Damaszener alles vergessen haben und wieder lachend ihren Geschäften nachgehen, dachte Farid, als sie den Park erreichten.
Seine Angst war ein Raubtier, das an seiner Ruhe fraß. Er dachte immer wieder an Amin, den Fliesenleger, der jetzt die Qualen der Folter ertragen musste. Amin war nicht nur sein Freund. Er war auch Kontaktmann zwischen dem kommunistischen Jugendverband, dem Farid seit ein paar Monaten vorstand, und der Parteileitung in Damaskus gewesen. Noch vor Tagen hatte er ihm versichert, er habe sich eingeigelt und alle Fäden, die zu ihm führten, abgeschnitten. Amin war ein erfahrener Untergrundkämpfer.
Vor ein paar Wochen hatte Farids Mutter auf einmal beim Morgenkaffee gesagt, der Tod ihrer Eltern, Tanten und Onkel mache sie traurig und nackt zugleich, die schützende Mauer der Älteren falle nun weg und man rücke dem Abgrund näher. Jetzt blickte er selbst nackt in den Abgrund. Alles schien zu wanken. Sein Freund Josef stellte sich blind hinter Satlan und schimpfte auf die »Moskau-Agenten«, wie der Präsident die Kommunisten nannte. Farid sei in der falschen Partei, er sei der einzige Mensch unter lauter Herzlosen und es werde Zeit, dass er austrete. Wie konnte Josef nur so reden?
Rana war für Farid das große Glück. Er liebte sie so sehr, dass er fast wünschte, sie würden sich trennen und so der Gefahr einer Verfolgung entgehen. Er schaute ihr Ohr an. Allein dafür, für dieses unschuldige Ohr, musste er sie lieben.
Rana schwieg lange, sie schien die spielenden Kinder im Park zu beobachten, doch nur ein Mädchen zog ihren Blick an, das abseits einer Gruppe ein Schauspiel aufführte. Es tanzte und drehte sich im Kreis, um dann plötzlich zu erstarren und zu Boden zu sinken, als wäre es von einer Kugel getroffen. Einige Augenblicke später richtete es sich wieder auf und tanzte von neuem, um sich bald darauf wieder fallen zu lassen.
Schon lange hatte Damaskus solch ein Wetter nicht mehr erlebt: den Segen, den der Winterregen gebracht hatte, vernichtete die Frühjahrskälte. Die Blüten und Knospen erfroren.
Es war der erste sonnige Tag nach einer feuchten Ewigkeit. Die Bewohner der Altstadt strömten blass und hustend aus ihren Lehmhäusern, die der Kälte nicht gewachsen waren, und suchten die Gärten und Parks außerhalb der Stadtmauer auf. Die Erwachsenen grillten, tranken Tee, spielten Karten, erzählten oder rauchten, still vor sich hin stierend, ihre Wasserpfeife. Ihre Kinder spielten lärmend, die Jungen mit Bällen, die Mädchen mit Hula-Hoop-Reifen, die ganz neu aus Amerika kamen und im Nu Damaskus erobert hatten. Mit Hüftschwüngen versuchten die Mädchen den Plastikreifen in kreisender Bewegung zu halten. Die meisten waren noch unbeholfen, aber einige konnten den Reifen bereits minutenlang schwingen lassen.
Die Kälte schien dem abseits tanzenden Mädchen nichts auszumachen. Ihre Bewegungen hatten eine seltsame sommerliche Gelassenheit. Rana beobachtete den Hals des Mädchens und fragte sich, was für Zeichen das Blut in der Luft malen würde, wenn tatsächlich eine Kugel die Kleine träfe. Bei ihrer Tante Jasmin hatte der Blutstrahl das Symbol der Unendlichkeit, eine horizontal liegende Acht, an die Wand gezeichnet. Zehn Jahre war das her. Jasmin, die jüngste Schwester von Ranas Vater, war aus Beirut zurückgekehrt, wo sie sich mit ihrem muslimischen Ehemann lange vor dem Zorn ihrer Familie versteckt hatte. Sie sehnte sich nach Damaskus, ihrer Stadt, und nach ihrer Mutter. Für Sekunden erschien ein Lächeln auf Ranas Lippen, doch nur, um sich sofort wieder zu verlieren. Sie dachte: Es liegt wohl in der Familie, dass alle Verliebten nach Beirut fliehen.
Eines Sommertags hatte Tante Jasmin sie in den berühmten Bakdasch-Eissalon in Suk al Hamidije eingeladen. Dort sagte sie ganz beiläufig und heiter: »Das Leben in Arabien bewegt sich seit ewigen Zeiten zwischen zwei unversöhnlichen Feinden – Liebe und Tod – und ich habe mich für die Liebe entschieden.« Doch der Tod nahm ihre Entscheidung nicht hin.
Samuel, Jasmins Neffe, erschoss sie vor einem Kinoeingang, ihr Begleiter floh unversehrt. Auf ihn gab Samuel keinen Schuss ab, sondern blieb über seiner blutenden Tante stehen und rief den Passanten fast schreiend zu: »Ich habe die Ehre meiner christlichen Familie gerettet, weil meine Tante sie durch die Ehe mit einem Muslim in den Dreck gezogen hat.« Viele Passanten hatten Beifall geklatscht.
Samuel, Tante Amiras verzogener Sohn, war damals sechzehn gewesen und galt nicht als volljährig. Nach einem Jahr Haft wurde er wieder entlassen. Die Verwandten trugen ihn triumphierend und laut singend auf den Schultern durch die Straßen zum Haus seiner Eltern. Dort feierten bis zum Morgengrauen mehr als hundert Leute seine Heldentat. Nur Basil, Ranas Vater, blieb der Feierlichkeit fern. Sie war ihm zu primitiv, doch auch er hatte Verständnis für die Erschießung seiner eigenen Schwester. Sie habe der Familie Schande zugefügt.
Einzig Samia, die Großmutter, ließ Samuel und seine Mutter wissen, sie verfluche ihn jeden Tag, wenn sie aufstehe, und jede Nacht, bevor sie einschlafe. Jasmin war ihre Lieblingstochter gewesen. Wohl deshalb munkelte man, dass Samuel – in wessen Auftrag auch immer – seine Tante mit dem Hass seiner Mutter getötet habe, die sich immer benachteiligt fühlte.
Rana sprach seitdem kein Wort mehr mit ihrem Cousin. Immer wenn er zu Besuch bei ihrem Bruder Jack war, schloss sie sich in ihrem Zimmer ein. Auch das Haus ihrer Tante Amira betrat sie nie wieder. Das Foto von Tante Jasmin hängte sie dagegen in ihrem kleinen Zimmer neben das Bild der heiligen Maria.
Rana schwieg lange an diesem kalten Märztag und drückte fest Farids warme Hände.
Das Mädchen fiel noch einmal, diesmal höchst elegant, und blieb eine Weile still liegen, bevor ihre Hände anfingen, wie ein Schmetterling zu flattern, als Zeichen, dass in den liegenden Körper das Leben zurückgekehrt sei.
In der Ferne sang jemand vergnügt die von Melancholie und Verzweiflung getränkten Verse: »Ich zwang mich zur Trennung / um dich zu vergessen.« Es waren Verse aus dem neuesten Lied der ägyptischen Sängerin Um Kulthum. Ahmad Rami, der schüchterne, sensible Dichter der Verse, hatte in den fünfzig Jahren seiner Liebe zu ihr über dreihundert Lieder für Um Kulthum geschrieben, ohne dass seine Liebe je erfüllt worden wäre.
»Ich brauche Zeit«, sagte Rana, »um eine Antwort zu finden.«
BUCH DES TODES 1
Die Frage ist ein Kind der Freiheit.
DAMASKUS, HERBST 1969 – FRÜHJAHR 1970
2. Eine Leiche im Korb
Ein warmer Wind fegte von Süden über die Ibn-Assaker-Straße. Der Tag hatte seine graue Maske noch nicht abgestreift. Hinter der Altstadtmauer erwachte Damaskus unwillig wie ein verwöhntes Mädchen.
Die ersten Busse und kleinen Transporter fuhren mit höllischem Lärm über die lange Straße. Sie transportierten Hilfsarbeiter aus den umliegenden Dörfern zu den vielen Baustellen im neuen Stadtviertel. Einer der Bauarbeiter, ein Mann von kleiner Statur, lief am Straßenrand auf und ab, von Bab Kisan, dem Eingang der Buloskapelle, ein Stück Richtung Osttor und wieder zurück. Er wartete auf seinen Bus. In der linken Hand trug er wie alle Arbeiter aus dem bäuerlichen Umland sein Proviantbündel aus verblichenem blauem Stoff. Mit der rechten gestikulierte er heftig, als ob er auf einen unsichtbaren Gesprächspartner einreden würde. Die Schleife, die er ging, wurde immer länger, als wünschte er, dass der Bus bei der nächsten Kehrtwende auftauchte.
Gerade als die Sonne die oberste Kante der alten Stadtmauer golden erleuchtete, drehte er sich wieder um. Dabei richtete er die Augen kurz nach Süden. Sein Blick fiel auf den großen Korb, der über dem Eingang der Buloskapelle hing, dem Ort, wo der Legende nach der geläuterte Kirchengründer Bulos nach seinem Damaskus-Erlebnis in einem Korb seinen Häschern über die Mauer entkam.
Aus dem immer noch im Schatten hängenden Korb reckte sich eine Hand, als gehörte sie einem Ertrinkenden. Noch im selben Moment wusste der Bauarbeiter, dass der Mann, dem diese Hand gehörte, tot war. Auf einmal wurde ihm alles andere gleichgültig: der Bus, die Fliesen, die er auf seinem Rücken drei Treppen hoch schleppen musste, und sogar der Streit mit seinem geizigen Meister.
»Da ist ein Toter im Korb!«, schrie er vor Aufregung, und als endlich ein Polizist vorbeikam, der verschlafen zu seinem Revier am Osttor radelte, wandte er sich so heftig an ihn, dass der beleibte Beamte nur mühsam das Gleichgewicht hielt. Entsetzen überzog das Gesicht des Polizisten, als der kleine Mann wie von Sinnen an seiner Lenkstange rüttelte und unentwegt wiederholte: »Ein Toter! Ein Toter!«
Ein Verrückter, dachte der Polizist. Widerwillig wandte er den Blick zu der Stelle, auf die der Arbeiter ständig deutete, und sah den inzwischen ganz ins Morgenlicht getauchten großen Korb.
»Was für ein Toter? Sind Sie verrückt geworden? Lassen Sie mein Rad los!« Er hatte in seinen dreißig Dienstjahren überall Tote gesehen: im Bett, im Kanal und sogar erhängt auf einer Toilette, aber noch nie in einem Korb über der Stadtmauer. »Beruhigen Sie sich!«, versuchte er auf den Mann einzureden. »Da ist kein Toter. Die Christen feiern nur die Erinnerung an ihren Apostel Bulos, der hier an dieser Stelle floh.« Und er beäugte noch einmal den Korb, der schon seit Wochen über dem Tor hing.
Doch statt in den Bus einzusteigen, der endlich kam, ereiferte sich der Bauarbeiter weiter. Er klammerte sich an das Fahrrad des Polizisten. »Und ich sage Ihnen, da liegt ein Toter drin«, brüllte er heiser.
Der Busfahrer, der neugierig geworden war, schaltete den Motor ab und stieg aus dem Wagen. Ihm folgten mehrere Fahrgäste. Alle umringten den Polizisten und bestärkten ihren Kollegen in seiner Vermutung.
Endlich lenkte der Polizist ein und versprach, die Kriminalpolizei zu verständigen, doch zugleich bestand er darauf, den Mann, der ihm den Morgen verdorben hatte, als Zeugen zu benennen. Er schrieb die Personalien auf und ermahnte ihn, sich jederzeit zur Verfügung zu halten. Dann radelte er weiter. Auch der Busfahrer setzte seine Fahrt gen Norden fort.
3. Kommissar Barudi
Die Spezialisten der Kriminalpolizei fanden im Korb einen Mann mit gebrochenem Genick. Ein gefaltetes grauweißes Stück Papier steckte in der Brusttasche seines Schlafanzugs, darauf stand: Bulos hat unseren Geheimbund verraten.
Der junge Kommissar Barudi schaute den Zettel an. Die Schrift war zwar krakelig, aber bemüht leserlich. Das Stück Papier war von einem großen Bogen abgerissen worden, wie man sie in den vielen Souvenirläden der Altstadt zum Verpacken von Glasvasen oder teuren Holzschachteln mit empfindlichen Intarsien verwendete. Der Schreiber hatte sich um einigermaßen glatte Seitenränder bemüht.
Gegen zehn Uhr führte ein Polizist den alten, sichtlich erschrockenen Hausmeister der Buloskapelle zum Tor. Der Korb sei nicht seine Idee gewesen, erklärte der Mann, sondern die des jungen Pfarrers Michael, der unbedingt die vorbeifahrenden Menschen an die Flucht des Kirchengründers erinnern wollte. Verzweifelt erzählte er, dass er seit zwei Wochen täglich den Unrat wegschaffen müsse, den Jugendliche in den Korb warfen: Flaschen, tote Ratten und Katzen.
Der Tote, ein Mann Ende dreißig, trug einen hellblauen Pyjama. Die Gerichtsmediziner stellten fest, dass der Tod gegen Mitternacht eingetreten war und die Leiche in Haaren und Kleidern jede Menge Fasern von einem Jutesack aufwies, in dem sie wahrscheinlich an den Fundort transportiert worden war.
Drei Tage später wurde der Tote identifiziert und damit das nächste Rätsel aufgeworfen: Er hieß Major Mahdi Said. Wer war dann der auf dem Zettel erwähnte Bulos?
Kommissar Barudi führte ein erstes Gespräch mit der jungen, schönen Witwe. Sie war gefasst und sprach unterkühlt und einsilbig. Entweder wusste sie wirklich nichts oder aber zu viel über ihren Mann. Auf die Frage, ob sie ihn nicht vermisst habe, reagierte sie kalt und ironisch: »Bei ihm war es normal, Tage und Wochen fortzubleiben. Seine Geliebte war der Beruf. Mit mir war er nur verheiratet.«
Der Kommissar war überzeugt, dass die Frau des Toten eine Schutzmauer aus Kälte und Gleichgültigkeit aufgebaut hatte, um entweder ihren Schmerz oder ihren brennenden Hass zu verbergen. Er fand sie sehr erotisch und hätte gern einen Blick hinter ihre Fassade geworfen. Schließlich war er Junggeselle und einsam.
Er wies die Leute von der Spurensicherung an, in der Mansarde zu suchen, die über der Wohnung lag. Dort war der Major in seinem Bett ermordet worden. Er musste sich noch gegen seinen oder seine Mörder gewehrt haben. Die Witwe hatte jedoch angeblich nichts gehört, weil sie am anderen Ende der Wohnung ein Stockwerk tiefer schlief. Ihr Mann hatte manchmal bis in die frühen Morgenstunden direkt über dem Schlafzimmer rumort, Musik gemacht, telefoniert und seinen Stuhl hin und her geschoben. Sie hatte lange darunter gelitten, weil sie von jedem geringsten Geräusch aufwachte. Deshalb hatte sie vor etwa einem Jahr notgedrungen das helle Schlafzimmer mit Balkon gegen ein hinteres dunkles, aber ruhiges Zimmer getauscht.
Die Mansarde ihres Mannes besaß einen eigenen Eingang. Eine kleine Treppe führte vom großen Balkon im zweiten Stock zum Dach eine Etage höher. Dort waren zwei karg eingerichtete Zimmer mit schlichtem Bad das Reich des Majors. Ein Raum hatte zum Schlafen gedient, der andere, kleinere, als Büro mit Schreibtisch und einem Metallschrank.
»Der Mörder muss von der Straße gekommen sein«, sagte Oberleutnant Ismail, der das Team der Spurensicherung leitete, als der Kommissar ihn nach seinem ersten Eindruck fragte. Barudi und Ismail verstanden sich gut. Sie waren beide fremd in Damaskus und gingen nicht selten abends zu später Stunde gemeinsam essen.
Sie standen auf dem Balkon vor der Treppe, die zur Mansarde führte. »Am alten Efeu haben wir deutliche Spuren gefunden. Der Mörder ist von der Straße über den Efeu hinauf zum Balkon und von dort ganz einfach über die Treppe zur Mansarde«, erläuterte Ismail und zeigte mit seiner rechten Hand den Weg. »Mit der Leiche«, fuhr er fort und lehnte sich an das Geländer, »muss er dann durch das Balkonzimmer und weiter hinten durch die Wohnungstür gegangen sein. An der scharfen Metallkante des Sicherheitsschlosses haben wir Spuren vom Jutesack gefunden. Über das Treppenhaus ist er auf die Straße gelangt.«
»Und warum sagst du: der Mörder? Bist du sicher, es war ein Mann? Und dass er es ganz allein gemacht hat?«, fragte Barudi und verfolgte dabei mit den Augen den Weg zurück von der Straße bis zum Balkon.
»Der Genickbruch ist eindeutig das Werk eines Mannes, nicht einer Frau, aber es könnten natürlich auch mehrere Männer gewesen sein«, erwiderte Ismail.
»Und wieso nicht ein Mann und eine Frau?«
Der Fachmann lächelte. »Wäre nahe liegend, aber der Mörder, der der Frau hätte zur Hand gehen sollen, müsste ein Dummkopf gewesen sein. Es ist doch viel zu riskant, über den Efeu in die Wohnung zu klettern, wenn man unauffällig durch die Wohnungstür gehen kann.« Er machte eine kleine Pause. »Nein, ich habe das Gefühl, der Mörder hätte alles in Kauf genommen, auch seine Festnahme, um den Major umzubringen. Das riecht nach bitterer Rache und nicht nach kalter Beseitigung durch den Geliebten der Ehefrau.«
»Und was, wenn das Ganze von langer Hand geplant wäre? Der Mann hatte angeblich einen gefährlichen Posten beim Geheimdienst. Ich weiß noch nichts Genaues, aber er war immerhin Major und solche Leute leben gefährlich«, sagte Barudi.
»Das kann man nicht ausschließen. Das Klettern selbst ist für einen Profi eine Sache von zwei, drei Minuten«, antwortete er und ging dann bedächtig die Treppe zur Mansarde hinauf, gerade als die Witwe dem Kommissar mitteilte, sein Adjutant Mansur verlange ihn am Telefon.
Es war bereits nach elf, als er ihre Wohnung verließ. Er musste an die Witwe denken. »Major Mahdi, mein Mann, besaß viele Feinde«, hatte sie bereits nach einer Viertelstunde und ohne Umschweife erzählt. Und Barudi hatte den Eindruck gehabt, dass auch sie ihren Mann nicht sonderlich mochte. Sie bemühte sich nicht einmal, so zu tun als ob. Vielmehr nannte sie ihn stets Major Mahdi, wie einen Fremden, und fügte dann fast beschämt und leise die Erklärung »mein Mann« hinzu.
Was für ein Geheimnis hat die Frau? Wie innerlich tot muss ein Mensch sein, dass er einsam in einer schäbigen Mansarde statt in den weichen Armen dieser Schönheit schläft?, fragte sich der Kommissar immer wieder und fand keine Antwort.
Ein Heißhunger nach Brot zerriss ihm fast den Magen. Die Witwe hatte ihm fünfmal Kaffee und dazu Bonbons serviert. Er fuhr mit seinem klapprigen Ford zum Lebensmittelhändler Iskander auf der Geraden Straße nahe der Abbara-Gasse und ließ sich wie immer ein Fladenbrot mit hauchdünn geschnittenem Pasturma füllen. Der edle luftgetrocknete Rinderschinken mit seiner pikanten Hülle aus scharfen Gewürzen war seine Lieblingsspeise. Iskander wusste das. Trotzdem fragte er jeden Tag höflich: »Wie immer?« Und wie immer erhielt der Kommissar ein Sandwich und ein Glas kaltes Wasser. Das machte zusammen eine Lira, und während der Kommissar sein Sandwich genoss, kochte Iskander eilig zwei Kaffee in der Hoffnung, irgendeine Geschichte über die Niederungen der Menschheit zu hören. Nicht selten wurde ihm dieser Wunsch auch erfüllt. Oberleutnant Barudi erzählte dem kleinen Mann gern, allerdings unter der Bedingung, dass er niemals nach Namen fragte.
An diesem Tag erwiderte der Kommissar: »Heute keinen Kaffee. Ich habe bereits fünf getrunken, mir ist ganz schwindelig.«
Der Mann wusste, dass der Kommissar nichts erzählen wollte. Also schwieg er und hoffte, dass das Netz des Schweigens bald einen dicken Fisch ans Licht bringen würde.
Omar, der Bügler, war kurz aus seinem kleinen Laden gegenüber dem Lebensmittelgeschäft getreten, um frische Luft zu schnappen. Als Barudi ihn sah, erinnerte er sich an seine Wäsche, die er ihm bringen wollte. Was für eine Höllenarbeit hatte Omar, der nur aus Haut und Knochen zu bestehen schien? Sein Laden war klein und stickig. Er stand den ganzen Tag ausgemergelt und verschwitzt hinter seinem Brett und glättete mit schwerem heißem Bügeleisen die Wäsche. Und alles für ein paar lächerliche Piaster.
Kommissar Barudi zahlte, trank den letzten Schluck Wasser aus und eilte in seine kleine Wohnung. An solchen Tagen war er verzweifelt. Er hatte das Gefühl, alles falsch zu machen. Ohne Frau in die Hauptstadt überzusiedeln, war ein Fehler gewesen, den er sich jeden Morgen von neuem übel nahm. Niemand kümmerte sich hier um sein Wohl. Sogar die Wäsche musste er selber waschen und nun, statt im Büro über den Mordfall nachzudenken, auch noch zum Bügler bringen. Jeden Morgen kochte er sich Kaffee und trank ihn allein in der Küche mit Blick auf einen uralten vergilbten Kalender. Was sollte er machen? Nadia hatte sich für den Dorflehrer entschieden. »Er steigt nicht auf, aber er stürzt auch nicht ab«, hatte sie ihm gesagt, als der seine Zukunft als hoher Polizeioffizier gegen die des armen Volksschullehrers in die Waagschale warf. Die Aussicht auf ein stolzes Leben hatte jedoch keine Wirkung gezeigt. Mehr konnte Barudi nicht bieten. Der Lehrer war ein schöner Mann mit betörender Stimme.
An dieser Stelle seiner morgendlichen Klage schaute er jedes Mal sein Gesicht in einem alten Spiegel an, der abgeblättert und halb blind über dem Tisch an der Wand hing. Er hatte sich noch nie schön gefunden. Sein Schöpfer musste besoffen oder kurzsichtig gewesen sein, dachte er jeden Tag wieder und lächelte.
Vier Jahre hatte er bei der Kriminalpolizei in der nördlichen Metropole Aleppo verbracht. Sein Chef hatte ihn gemocht und, als die Stelle bei der Damaszener Mordkommission frei wurde, seine Beziehungen spielen lassen. Inzwischen war Barudi schon ein Jahr auf diesem Posten. Er fand seine Aufgabe in der Hauptstadt groß, manchmal zu groß für einen jungen Oberleutnant. Aber er bemühte sich zu lernen und er war fleißig. Sein Tag endete nach zwölf, manchmal auch vierzehn Stunden. Doch er jammerte nicht über die Arbeit. Meist war er dankbar, im Polizeipräsidium zu sitzen und etwas zu tun. Die Aktenberge machten ihn mit der Stadt vertraut, die ihm, einem Bauernsohn aus dem Süden, immer noch rätselhaft vorkam. Der einzige Schönheitsfehler an seiner Arbeit war sein Chef, Oberst Kuga, ein eitler, kalter Diplomat. »In der Hauptstadt weht ein anderer Wind«, hatte ihm sein gütiger Chef in Aleppo mit auf den Weg gegeben, »aber mit deinem Fleiß wirst du schon alle überzeugen.«
Barudi hatte das Gefühl, Kuga übersah absichtlich seine Leistungen, deshalb hoffte er endlich auf einen schwierigen Fall, bei dem er vielleicht mit der Aufklärung glänzen könnte.
Die Haustür stand wie immer offen, die Leute lebten im christlichen Viertel von Damaskus noch so gelassen, als hätten ihre Gassen wie im vergangenen Jahrhundert ein Tor, das man abends abschloss. Aus der Sicht eines modernen Kriminologen war eine offene Haustür der pure Leichtsinn.
Seine alte Hauswirtin hatte nur ihn als Untermieter. Zwei kleine Zimmer und eine Küche im ersten Stock, keine schlechte Wohnung. Toilette und Bad musste er allerdings mit ihr teilen. Er wusste, hier konnte er als Junggeselle leben, die alte Witwe reinigte ihm die Wohnung aus purem Mitleid. Er war für sie ein braver, gut erzogener Junge aus einem christlichen Dorf, der nie Besuch bekam, seine Miete im Voraus bezahlte und weder rauchte noch trank. Stets war er höflich und ernst. Frauen interessierten ihn nicht und es schien sich auch keine Frau für ihn zu interessieren. Er war klein von Gestalt, trug eine dicke Brille und war viel zu früh ergraut, das bremste die Damaszenerinnen gleich dreifach.
Die Hauswirtin hatte nur eines an ihm auszusetzen. Er war zwar katholisch getauft wie sie, aber er ließ sich nie in der Kirche blicken. Als sie ihn deswegen tadelte, hatte er geantwortet, er sündige nicht. Und dann hatte er gelacht und hinzugefügt, er habe gar keine Zeit dazu.
Er grüßte sie an jenem Tag hastig. Sie schaute nur kurz von dem alten Kleid, das sie gerade stopfte, auf. Bald verließ er die Wohnung wieder mit den gewaschenen Hemden und Hosen, die er in eine große Tüte gestopft hatte.
»Sie sind doch eben erst heimgekommen«, meinte die Witwe.
»Ich wollte nur schnell die Wäsche holen. Es ist viel los zur Zeit. Bestimmt haben Sie schon von dem Mord an der Buloskapelle gehört«, erwiderte er mit der Gewissheit, dass der Alten im Umkreis von zwei Kilometern nichts, aber auch gar nichts entging. Ihr Haus in der Ananias-Gasse war wirklich nicht weit vom Eingang der Buloskapelle entfernt.
»Die Leute fürchten Gott nicht mehr. Ein Mord in der Kirche! Wem fällt denn so etwas ein?«
»Wenn ich das wüsste«, seufzte der Kommissar.
4. Im Dschungel
Als sich Kommissar Barudi an seinen Schreibtisch setzte, erinnerte er sich wieder an den Zettel, der bei dem Toten gelegen hatte. Er nahm ihn aus der Schutzhülle und betrachtete die Worte, sog sie ein, schloss die Augen und wiederholte sie. »Als wollte der Mörder einen Hinweis geben«, sagte er dann leise und erinnerte sich an einen Fall, der zu seiner Zeit an der Akademie als Lehrstoff diskutiert worden war: Ein Mörder kehrte immer wieder zum Tatort zurück und bot der Polizei sogar seine Hilfe an. Die Polizisten scheuchten ihn fort, weil er die Untersuchungen störte. Bis ein kluger Kommissar aufmerksam wurde. Er nahm das Hilfsangebot des Mannes an und schon bald verhaspelte sich der Mörder und verriet seine Tat. Er war nicht einmal entsetzt über seine Verhaftung, sondern einfach fertig mit dem Leben und hatte nichts als seine Ruhe gewollt.
Barudis Freund, Oberleutnant Ismail, hatte ihm beim Abschied scherzend gesagt: »Cherchez la femme.« Geistesabwesend roch der Kommissar an dem Papier. Der Geruch war dezent, aber er erinnerte ihn ein wenig an Holzpolitur, oder war es doch ein Parfüm?
»Dieses Papier könnte uns auf die richtige Fährte bringen«, sagte er zu sich selbst, aber so laut, als wollte er seine Zuversicht Unteroffizier Mansur mitteilen.
Der verdrehte jedoch die Augen: »Irgendetwas stimmt nicht an diesem Fall. Ein Muslim, dazu ein Major der Staatssicherheit oder des Wasweißich-Dienstes, hängt im Korb an der Buloskapelle und in seiner Tasche liegt ein Zettel mit einem falschen Namen? Das stinkt doch, sagt mir meine Nase. Ereifern Sie sich bloß nicht. Warten Sie ab, sonst verbrennen Sie sich noch die Finger an diesem Fall.«
Barudi war dieser dauernden Skepsis und Vorsicht seines Adjutanten nach einem Jahr restlos überdrüssig. Er wartete nur auf einen günstigen Augenblick, den alten Widersacher aus seinem Dienstzimmer zu entfernen und einen jungen Mitarbeiter an seine Stelle zu setzen, der optimistischer dachte. Mansur ärgerte ihn nicht bloß, er war ihm auch eklig. Sein Herz war genauso verfault wie seine Zähne. Der Mann war besessen von der Idee, alle Mäuse dieser Welt zu vernichten. Bereits am ersten Arbeitstag hatte er Kommissar Barudi seine sämtlichen Fangtheorien erklärt und auch die Teufelsmaschinen gezeigt, die er im Lauf der Jahre entwickelt hatte und jeden Abend aufstellte. Barudi musste aufpassen, dass er nicht an einer dieser grausamen Fallen hängen blieb.
Er kam sich vor wie in einem Irrenhaus. Alle waren von Mansurs Maschinen begeistert. Sogar Oberst Kuga, der Chef, dem die kürzliche Aufklärung eines fast perfekt getarnten Mordes an einer wohlhabenden Witwe nicht einmal ein müdes Lächeln entlockt hatte, wieherte beim Anblick der hingerichteten Mäuse.
Kommissar Barudi hatte schon viel versucht, Mansur rauszuschmeißen. Doch das alte Aas hatte über dreißig Dienstjahre hinter sich und war mit allen Wassern gewaschen. Er bot keine Angriffsfläche, denn er führte jede Aufgabe lustlos, aber nach Vorschrift aus.
Um siebzehn Uhr, acht Stunden nach der Identifizierung der Leiche, saß der Kommissar vor Oberst Badran. Der jüngste Bruder von Präsident Amran, Chef des Staatsicherheitsdienstes, entzog ihm die Kompetenz, im Fall Major Mahdi Said weiter zu ermitteln. Es handele sich um einen politischen Mord und der sei nicht Sache der Kriminalpolizei. Er redete leise und ohne jede Regung, so als ginge es um nichts als einen Schluck Wasser. Major Mahdi Said sei sein bester Mitarbeiter gewesen und er werde den Mörder aufspüren und vernichten. Oberst Kuga nickte unentwegt wie eine aufgezogene Puppe. Barudi wunderte sich nicht nur über die Härte und Eitelkeit des Staatsicherheitsoffiziers, sondern auch über seinen hohen Rang, doch er hatte gelernt, alle zu achten, die zu jung für ihren Dienstgrad waren. Das waren in der Regel Angehörige des inneren Zirkels der Macht, Putschisten der ersten Stunde oder deren Söhne, die alles auf eine Karte setzten und mit dreißig entweder am Galgen oder in einer Führungsposition der Regierung landeten. Allein in den letzten fünf Jahren hatte es elf Revolten gegeben, vier gelungene und sieben gescheiterte, Putsche, Aufstiege, Stürze, Sieger und eilig hingerichtete junge Offiziere.
Aber auch die Rangordnung der Behörden zwang den jungen Kommissar, die Zähne zusammenzubeißen. Der Geheimdienst stand auf der Pyramide der Macht direkt unter dem Staatspräsidenten, manche flüsterten sogar hinter vorgehaltener Hand, der Präsident dürfe nur mit der Gnade des Geheimdienstes regieren. Auf einer sehr tiefen Stufe der Macht stand die Kriminalpolizei. Sie durfte sich mit den Verbrechern befassen, solange diese nicht den obersten Schichten, der Militärkaste oder der herrschenden Baathpartei angehörten.
»Nur die Nachtwächter sind noch ohnmächtiger«, sagte der Zyniker Mansur.
Barudi musste nicht bloß seine Leute zurückpfeifen, sondern gedemütigt auch dem Oberst versichern, dass der Tote für ihn nicht existiere. Binnen vierundzwanzig Stunden sollte Barudi dem Geheimdienstchef Badran alle Untersuchungsergebnisse persönlich vorbeibringen. Die Betonung war als Drohung nicht zu überhören.
5. Mansur
»Das Wissen«, behauptete Unteroffizier Mansur, »ist ein Schloss, dessen Schlüssel eine Frage ist, aber in diesem Land darf man nicht fragen. Deshalb, mein lieber Barudi«, fügte er bedeutungsvoll hinzu, »gibt es hier zu Lande keinen einzigen anständigen Kriminalroman. Kriminalromane leben vom Fragen.« Und er grinste. »Erinnern Sie sich an die Kampagne gegen die Korruption, die unser Staatspräsident Amran im Frühjahr 1969 verkündete? Er gründete damals eine Antikorruptionskommission aus angesehenen Gelehrten und Richtern, die jedem die Frage stellen durften: ›Woher hast du das?‹ Der Präsident rief der Kommission noch lachend vor der Fernsehkamera zu: ›Meine Herren, fangen Sie bei mir an‹, doch die Kommission entschied sich, bei dem korruptesten Syrer aller Zeiten anzufangen: Schaftan, dem Bruder des Präsidenten. Sie suchte ihn auf und stellte höflich ihre Woher-Frage. Schaftan war damals noch der zweite Mann im Staat und Kommandeur der gefürchteten Spezialeinheiten. Sofort steckte er alle Mitglieder der Kommission ins Gefängnis, und zwar so lange, bis sie in aller Öffentlichkeit erklärte: ›Allah gibt dem, den er mag, grenzenlosen Reichtum.‹ Erst dann wurden die Männer freigelassen.«
Der Kommissar hatte zwar schon von dem korrupten Bruder des Präsidenten gehört, aber er verstand nicht den Zusammenhang mit dem aktuellen Mordfall. Er durchbohrte seinen Untergebenen mit einem zornigen Blick.
»Noch ein Wort und Sie kriegen ein Verfahren wegen Beleidigung des Staatspräsidenten an den Hals. Und in Zukunft bin ich nicht Ihr lieber Barudi, sondern Oberleutnant Barudi, haben Sie das verstanden, Adjutant Mansur?«
Der Unteroffizier nickte schweigend. Er kannte nur zu gut all diese jungen Burschen, die sich nach ein paar Monaten in der Polizeiakademie wie Generäle aufführten. Er hätte diesem Grünschnabel gern noch erzählt, dass er seine Kenntnisse über den fehlenden Kriminalroman und die nie gestellten Fragen von Agatha Christie wusste, die er einmal durch Syrien begleitet hatte. Ihr Mann, Max Mallowan, war als Archäologe Anfang der Vierzigerjahre im Nordosten des Landes zu Ausgrabungen unterwegs gewesen.
Damals war Mansur fast vor Hunger gestorben. Die Dürre und eine noch nie da gewesene Mäuseplage hatten alle Vorräte seines Dorfes vernichtet. Agatha Christie mochte den Jungen und beschäftigte ihn trotz der Abneigung ihres Mannes als Boy. Später war er sogar Chefboy geworden. Und Agatha Christie hatte ihn in ihren Memoiren »Erinnerung an glückliche Tage« unsere Nummer 1 genannt. Er umsorgte sie und kümmerte sich um ihre Behausung und Verpflegung. Sie war eine herzerfrischende Erscheinung gewesen. Sie war vierzehn Jahre älter, aber weitaus humorvoller als ihr Mann und machte sich über jeden lustig, vor allem über sich selbst. Nicht selten musste Mansur dann ihre komischen Bemerkungen übersetzen. »Ich rate dir, meine Liebe«, hatte sie seiner Schwester Nahla gesagt, als die das englische Paar zum Essen einlud, »heirate einen Archäologen, denn je älter du wirst, desto interessanter findet er dich.«
Kurz vor der Abreise des Paars hatte Mansur eine Anstellung bei der Polizei bekommen, die damals gerade im Aufbau war. Zum Abschied war er bereits in Uniform erschienen.
Das war nun einunddreißig Jahre her.
Mansur schluckte aber sein Wissen über den Kriminalroman, der seit der Begegnung mit Agatha Christie zu seiner zweiten Leidenschaft geworden war, vorsichtshalber herunter. Er hatte in diesem Dienstzimmer sechzehn Offizieren gedient, die an ihm wie Sommerwolken spurlos vorübergezogen waren, und dabei gelernt, zur rechten Zeit zu schweigen. Drei Jahre trennten ihn noch von seiner Rente und eine Versetzung in irgendein verlaustes Dorf im Süden wäre eine Katastrophe gewesen. Aber genau das war die übliche Strafe bei einem Krach mit einem Polizeioffizier.
Zum ersten Mal seit Jahren spürte er plötzlich Angst. Noch kein Vorgesetzter hatte ihm wegen eines Witzes gedroht, eine Beleidigung des Staatspräsidenten daraus zu drehen. Damit hätte er sich glatt eine Haftstrafe eingehandelt und sich vielleicht sogar um die Rente gebracht. Dieser Oberleutnant war ihm aber von Anfang an zu ehrgeizig gewesen und deshalb gefährlich.
6. Oberst Badran und der Lauf der Dinge
Der Fall war für Oberst Badran klar. Der Mord an Major Mahdi Said hatte einen politischen Hintergrund. Den Satz auf dem Zettel sah er als Beweis, dass der Major sterben musste, weil er zu viel über einen Geheimbund wusste und die Verschwörer einen Verrat fürchteten oder Mahdi bereits als Verräter verurteilten. Der Oberst nahm an, Bulos, wie auf dem Zettel stand, war ein Deckname. Wahrscheinlich, weil der Major früher ein Christ gewesen war und bis zu seinem Tod im christlichen Viertel gewohnt hatte. Badran wusste, der Ermordete hieß Said Bustani, und da dieser als Kind unter seinem Stiefvater gelitten hatte, wollte er in seinem neuen Leben als Muslim diesen Familiennamen nicht weiter tragen. Er hatte sich deshalb seit seinem Übertritt zum Islam Mahdi Said, der glückliche recht Geleitete, genannt.
Badran, der unmittelbare Vorgesetzte des toten Majors, zeigte sich im ersten Augenblick über den gewaltsamen Tod seines besten Offiziers entsetzt. Mahdi Said war ehrgeizig, zuverlässig und hart wie Stahl gewesen. Er war der einzige Vertraute, auf den er hatte bauen können, als es einmal bedrohlich eng wurde.
Als das Entsetzen wich, tauchte eine Vermutung auf, die den Oberst beunruhigte. Was, wenn der ehrgeizige Mahdi Said ihn betrogen und hinter seinem Rücken Kontakte zu Verschwörerkreisen gehabt hatte? Der Gedanke machte Badran schlaflos. Er war von der Vorstellung derart besessen, dass er zwei Tage später eine ganze Truppe seiner besten Männer ausschickte, um sämtliche Informationen über Mahdi Said einzuholen. Die kleine Sondereinheit, die das Haus des Toten unter die Lupe nahm, leitete er selbst.
Tag für Tag saß er im Salon der jungen Witwe, ließ sich mit Limonade, Kaffee und Süßigkeiten bedienen und versuchte mit Charme durch geschickte Fragen hinter den Schleier der Gleichgültigkeit zu blicken, mit dem sich die Frau umgab. Seine Leute nahmen die Mansarde auseinander, Zentimeter für Zentimeter durchsuchten sie die kleine Dachwohnung des Majors.
Schon bald schien sich die Vermutung, die Oberst Badran hegte, zu bestätigen: Im Metallschrank des Toten lag ein unauffälliges kleines Heft mit chiffrierten Namen. Die Verschlüsselung folgte brav den Anleitungen, die die ostdeutschen und russischen Offiziere bei diversen Kursen den syrischen Geheimdienstlern beigebracht hatten. Die sechs Personen, deren Namen entschlüsselt wurden, gehörten den höchsten Rängen der Armee und des Geheimdienstes an. Sich selbst hatte Mahdi mit dem Namen Bulos eingetragen. Badran triumphierte, dass seine Ahnung prophetisch gewesen war.
Nach Verhör und Folter gab ein General zu, dass er und fünf andere Offiziere daran gearbeitet hätten, einen »Geheimbund freier Offiziere« zu gründen, der für das Vaterland kämpfen sollte.
»Das heißt putschen, du Hurensohn!«, schrie der Oberst den General an und dieser flüsterte niedergeschlagen und ängstlich: »Wie Ihr meint, mein Herr.«
Der todgeweihte General hängte an das kaum gebräuchliche »Ihr« seine winzige Hoffnung, der Oberst möge sich königlich geehrt fühlen und deshalb über den kleinen Fehltritt, den sich der Gefolterte geleistet hatte, der aber für den Staat gänzlich folgenlos geblieben war, großzügig hinwegsehen.
Badran, dessen Dienstgrad weit unter dem des Generals lag, war aber durch das untertänige »Ihr« erst recht überzeugt, dass der Mann ein aalglatter Heuchler war.
Der Kontakt zu Mahdi Said, erzählte der General nun mit leiser Stimme, sei vor einem Jahr hergestellt worden, weil er und die anderen Offiziere der Meinung waren, zu viele Russen und zu viele deutsche Kommunisten agierten in ihrem stolzen Land Syrien. Die Männer hätten das Vaterland retten wollen. An Mahdi Said bewunderten sie seinen absoluten Hass auf den Kommunismus sowie seine Klugheit und Härte. Der Major sei auch der Rettungsidee anfangs nicht abgeneigt gewesen, doch vor drei Monaten habe er plötzlich einen Rückzieher gemacht. Er wollte nichts mehr mit den Offizieren des Geheimbundes zu tun haben.
»Und dafür habt ihr ihm das Genick gebrochen!«, sagte der Oberst etwas ruhiger, fast leise, weil er sich jetzt auf einer sicheren Fährte wusste. Zugleich spürte er eine hämische Genugtuung gegenüber dem Toten. Denn genau in diesem Augenblick erkannte Badran, dass Major Mahdi Said ein Verräter gewesen war. Eine solche Verschwörung hätte er ihm niemals verschweigen dürfen. Für die Aufdeckung wäre ihm ein Orden in Gold sicher gewesen, nun aber war er mit Genickbruch entlohnt worden. Der Oberst lächelte bei diesem Gedanken und dachte an die weichen Knie der Witwe. Sie trug wie alle modernen Frauen in jenem Jahr Minirock.
Der General fing erbärmlich an zu weinen. Nie im Leben hätten sie daran gedacht, dem Major auch nur ein Haar zu krümmen, denn bald seien auch er und die anderen zu der Erkenntnis gekommen, dass die ganze Idee des Putsches absurd und die neue Regierung unter den Brüdern Amran und Badran absolut patriotisch sei. Spätestens seit er, Oberst Badran, Russen wie Ostdeutsche in die Schranken gewiesen habe, seien sie alle der Meinung gewesen, Mahdi Said habe sie mit seinem Rückzieher schließlich aufgeweckt und aus der Hand des Teufels befreit. Und deshalb …
Der Oberst stand auf und ging. Er achtete weder auf das Lob noch darauf, was der General weiter erzählte. Draußen gab er dem Diensthabenden den Befehl, die Gruppe der hohen Offiziere so lange zu foltern, bis sie alle den Mord an Mahdi gestanden und schriftlich bestätigten.
»Und wie weit darf ich gehen?«, fragte der Diensthabende und hielt seinem Herrn die Wagentür auf.
»Bis zum Tod«, antwortete der Oberst, stieg in seine Limousine und fuhr zur Witwe des Majors Said.
Eine Woche später wurde den sechs hohen Offizieren der Prozess gemacht. Sie wurden für schuldig befunden, einen Putsch gegen die Regierung geplant und einen ehemaligen Mitverschwörer, der aus Reue und Liebe zum Vaterland nicht mehr mitmachen wollte, heimtückisch umgebracht zu haben. Der Prozess fand geheim in einer verlassenen Kaserne bei Damaskus statt. Die Verurteilten wurden am selben Tag erschossen.
Badran nahm die Verschwörung zum Anlass, den Geheimdienst zu säubern und neu zu ordnen. Eine Verhaftungswelle rollte über das gesamte Netzwerk hinweg und Männer, die einen Tag zuvor noch mächtig gewesen waren, mussten auf einmal mit ihren Feinden die schäbigen Gefangenenlager teilen. Sämtliche Verbindungen des Geheimdienstes wurden genauestens überprüft. Im ganzen Apparat wurde von nun an absoluter Gehorsam verlangt.
Auch die ostdeutschen und russischen Militär-, Folter- und Geheimdienstberater mussten sich mit harten Einschnitten ihrer Befugnisse unter Oberst Badran arrangieren. Ausdrücklich verbot er ihnen jeden abfälligen Ton im Umgang mit den syrischen Offizieren, den sich die Experten seit der verheerenden Niederlage der Araber im Krieg von 1967 gegen Israel erlaubten. Die Russen hatten die syrischen Offiziere nur noch wie dumme Schüler behandelt.
Auch jedwede direkte Einmischung in die Angelegenheiten des Militärs und des Geheimdienstes verbot der Oberst mit dem erklärten Ziel der Wahrung von Staatsgeheimnissen. Seine Argumente waren logisch und überzeugten die politische Führung. Die Experten, argumentierte Badran, seien nach Damaskus gekommen, um Fragen zu beantworten, die technische Details beträfen, und nicht, um Fragen zu stellen, und schon gar nicht, um sich politisch zu äußern. Ihre familiär und politisch weit verzweigte Verstrickung sei nicht durchschaubar und berge daher die Gefahr, dass an irgendeiner Stelle Informationen nach Israel durchsickern könnten. Der Oberst stand in einem kleinen Zimmer vor einer Tafel. Um einen Tisch saßen drei Zuhörer: sein ältester Bruder Amran, der Staatspräsident, sein Cousin General Sadan, der Verteidigungsminister, und dessen Schwiegersohn Oberst Hardan, der Innenminister. Kurz darauf gaben die drei mächtigsten Männer grünes Licht für alle Maßnahmen, die Badran für notwendig hielt.
Die russischen Experten, die diesen Aufsteiger belächelt hatten, als er sie vor einem Jahr in einem Rundschreiben höflich bat, freundschaftlichen Ton im Umgang mit den syrischen Offizieren zu pflegen, mussten nun zusehen, wie einer ihrer Generäle nachts aus seiner Villa im feinen Viertel Abu Rummana geholt und in demütigender Weise im Pyjama nach Moskau geflogen wurde, weil er eine Stunde zuvor betrunken einen jungen syrischen Offizier beleidigt hatte. Und als die Russen kuschten, krochen auch die ostdeutschen, die bulgarischen und rumänischen Experten vor dem entschlossenen Oberst. Er aber quittierte das Einlenken nicht mit Zufriedenheit, sondern mit noch größerem Misstrauen. Die Offiziere der syrischen Armee und des Geheimdienstes hatten jedoch an diesem Tag einen Helden gefunden, der ihnen die im Krieg gegen Israel verlorene Ehre zurückgab.
Im christlichen Viertel aber flüsterte man hinter vorgehaltener Hand, dass die Witwe und Oberst Badran selbst hinter dem Mord steckten. Mahdi Said habe das Verhältnis seiner Frau mit seinem Vorgesetzten eines Tages entdeckt. Angeekelt, so berichteten die Nachbarn, habe er sich von seiner Frau entfernt und lieber allein in der Mansarde geschlafen. Aber er habe nicht geschäumt und seine Frau auch nicht geschlagen, wie das sonst üblich war, doch heimlich habe er Badrans Ermordung vorbereitet. Erst danach wollte er sich an ihr rächen, aber dabei sei ihm ein tödlicher Fehler unterlaufen. Seine Frau, so hieß es, entdeckte im Papierkorb einen Zettel, der die Schritte seines Plans minuziös, sogar mit Datum festhielt. Sie alarmierte ihren Geliebten. Der Oberst habe sich daraufhin bei der Frau versteckt. In der Nacht seien beide zu der Mansarde hochgegangen und hätten den Mann gemeinsam im Bett erwürgt. Ein Nachbar, der Goldschmied Butros Asmi, wollte gesehen haben, wie in der Nacht eine kleine, gedrungene Gestalt einen Sack schulternd die Treppe hinunterging. Er könne den Mann nicht identifizieren, da es dunkel gewesen sei, sagte er, aber Badran war schließlich auch klein und von sportlich muskulöser Gestalt.
Als Beweis für diese makabre These führten die Nachbarn an, dass bereits eine Woche nach dem Tod des Majors Oberst Badran schamlos bei der Witwe übernachtete. Sein Leibwächter stand vor dem Gebäude und filzte jeden, der in dem Mehrfamilienhaus ein und aus ging.
Als aber der einzige Zeuge, eben der erwähnte Goldschmied Butros Asmi, durch einen merkwürdigen Unfall ums Leben kam, verwandelte sich das Gebäude des getöteten Majors in der Marcel-Karameh-Straße mitten im christlichen Viertel schlagartig in eine ferne Insel, die durch einen Ozean der Angst von der übrigen Welt abgeschnitten war.
Der Mordfall Mahdi Said wurde am 19. März 1970 offiziell abgeschlossen und die drei dicken Ordner mit Verhörprotokollen, Beweisstücken, Zeugenaussagen sowie der Anklageschrift und dem Gerichtsurteil gegen die hohen Offiziere wanderten in das Archiv des Geheimdienstes. Der kleine Zettel mit der krakeligen Schrift lag unbeachtet im ersten Ordner in einer Klarsichtfolie.
Kommissar Barudi erfuhr über seine Kontaktmänner von der christlichen Vergangenheit des ermordeten Majors. Er war nun sicher, dass der Name Bulos und die Aussage auf dem Zettel den Kompass darstellten, nach dem seine Schritte sich hätten richten müssen, um auf der richtigen Fährte des Mörders zu bleiben. Noch bevor er die dünne Mappe des Mordfalls dem Oberst aushändigte, hatte er alle Untersuchungsergebnisse fotokopiert und einen fingerbreiten und etwa zwanzig Zentimeter langen Streifen von dem Zettel abgeschnitten, der bei dem Ermordeten gefunden wurde. Alles versteckte er sorgfältig in einem Geheimfach, das er zu nächtlicher Stunde in seinem Schreibtisch einbaute.
Barudi glaubte, die Kindheit des Ermordeten würde ihn zum Täter führen. Er war überzeugt, dass er, wenn er behutsam vorginge, den Fall aufklären würde.
Und er ging wahrlich behutsam vor. Die Fährte sollte sich schließlich als richtig erweisen, aber er ahnte nicht, wohin ihn seine Neugier sechs Monate später noch bringen würde.
BUCH DER LIEBE 2
Liebe ist Armut, die reich macht.
DAMASKUS, MALA, FRÜHJAHR 1953
7. Der Brand
Claire weckte ihn. In ihrer Stimme lag Angst. Als sich Farid im Bett aufrichtete, hörte er die Schreie im Dorf. Er rannte auf den Balkon, seine Mutter folgte ihm barfuß in ihrem Nachthemd.
Er ahnte sofort, dass sein Vater schon unter den Leuten an der Dorfquelle war, und er wusste auch in seinem Innern, warum. Er schaute erstaunt nach der brennenden Ulme auf dem fernen Hügel.
Der eiskalte Wind ließ ihn zittern und nur langsam begriff er, dass er selbst für das Feuer verantwortlich war. Die Flammen in der Ferne leuchteten wie eine gewaltige Fackel und tauchten das Dorf in ein teuflisches Licht.
Einige Bauern eilten über den Dorfplatz, am Haus der Muschtaks vorbei. Ein junger Bursche blieb einen Augenblick gegenüber dem Balkon stehen und starrte zu ihm hinauf, schüttelte den Kopf vor Wut, spuckte dann auf den Boden und hastete weiter. Die Bewohner von Mala waren bekannt für ihre düstere Verschwiegenheit. Farid wusste, dass das Spucken ihm galt.
Die kalte Hand seiner Mutter ließ ihn zusammenzucken. Claire fror ihr Leben lang wie seine Freundin Rana. Er führte seine Mutter zurück ins Bett und legte sich zu ihr. Sie schlief sofort ein und bald hörte er ihren rhythmischen Atem. Ihr Gesicht wirkte fein: schwarze, glatte Haare, kleine zarte Nase, große, mandelförmige Augen unter den geschlossenen Lidern und schneeweiße Haut. Farid streichelte seiner Mutter übers Gesicht.
Er lag wach und starrte die Zimmerdecke an.
8. Fremdheit
Der Muschtak-Clan war mächtig, aber immer noch fremd in Mala. Georg, der Gründer der Familie, hatte vor fünfundvierzig Jahren in dem christlichen Bergdorf Zuflucht gefunden, Farid und seine vielen Vettern bildeten erst die dritte Generation. In dem Dorf gehörte man aber frühestens ab der siebten richtig dazu. So lange brauchte es angeblich, um den Dialekt des Dorfes akzentfrei zu sprechen und den eigentümlichen Stolz zu empfinden, der noch dem ärmsten Teufel in Mala tief in der Brust saß.
Farid war in Damaskus aufgewachsen, und da seine Mutter Damaszenerin war, hatte er stets lieber Arabisch gesprochen als diesen scharfen Dialekt Malas, den er zwar verstand, aber nie fehlerfrei sprechen konnte. Auch war er keine Sekunde stolz auf das Dorf. Weshalb sollte er stolz sein? Nur weil die Vorfahren der jetzigen Bewohner angeblich Jesus persönlich gekannt hatten. Sie waren nach seiner Kreuzigung aus Galiläa geflohen. Und wie von einer geheimen Mission besessen, hatten die Bauern Malas in der Folge ihre Religion mit ihrem Leben verteidigt, als hinge das Schicksal des Weltchristentums von der Kampfbereitschaft des kleinen Dorfs ab.
Farid fühlte sich eher fremd in der Dorfkirche. Fremd waren ihm auch die schweigsamen raubeinigen Bewohner, die in ihren schwarzen Bauernkleidern immer zu trauern schienen, nur selten einmal lächelten, aber ständig Anlässe fanden zu saufen und sich zu raufen. Noch weniger verstand er den fanatischen Hass zwischen den beiden stärksten Familien im Dorf, den Muschtaks und den Schahins. Und am allerwenigsten begriff er, warum es in Mala einen tief verwurzelten Hass zwischen der orthodoxen und der katholischen Kirche gab. Nicht selten vermittelten Muslime zwischen den streitenden Christen.
Ein Ereignis hatte Farid besonders tief erschüttert. Ein pensionierter Lehrer hatte mit zehn oder zwölf Jugendlichen einen heruntergekommenen, doch schönen Stall renoviert, neue Fenster, Türen und Regale eingebaut und elektrisches Licht gelegt. Der Stall gehörte dem orthodoxen Kloster der heiligen Takla. Die Äbtissin hatte dem Mann den Stall kostenlos überlassen. Der Lehrer, der selbst keine Kinder hatte, war ein großer Buchliebhaber. Er schenkte der Dorfbücherei, die er im renovierten Stall einrichtete, seine sämtlichen siebentausend Bände als Grundstock und ging danach auch noch monatelang bei Damaszener Verlagen und Buchhandlungen betteln. Am Ende kam er mit einem Lastwagen voller Bücher zurück. Bei der Eröffnung im Sommer 1950 hatte er zwanzigtausend Bände zusammen.
Doch nach einem Monat wurde die Bibliothek wieder geschlossen, der Lehrer hatte nämlich zwei Dinge nicht beachtet. Er war ein Schwager der Familie Schahin und ein Orthodoxer dazu. Schnell waren die Muschtaks und ihre katholischen Anhänger auf dem Plan. Der Lehrer sei in seiner Jugend ein Kommunist gewesen, er würde den Kindern Bonbons schenken und ihnen zuflüstern, die habe Onkel Stalin geschickt. Er würde auch häufig schöne Kinder auf den Schoß nehmen und sich an ihnen vergehen.
Außer dass der Lehrer wirklich drei Jahre Mitglied der Kommunistischen Partei gewesen war, stimmte nichts. Nur boshafte Lügen, aber sie wirkten rasant, weil die Hälfte des Dorfes dahinter stand. Die Äbtissin ließ den Lehrer nach kurzer Unterredung mit Leutnant Marwan, dem neuen Leiter der Polizeistation, fallen. Die Muschtaks und mit ihnen viele Katholiken feierten die Schließung der Bibliothek mit Tanz, Musik und Wein.
An diesem Tag war in Farid der Rest an Sympathie für das staubige Dorf gestorben.
Der alte Lehrer zog sich verbittert in sein Häuschen zurück und kam nach sechs Jahren zum ersten und letzten Mal wieder heraus – in einem Sarg. Hinter ihm lief nur seine Frau. Das war der ausdrückliche Wunsch ihres Mannes gewesen. Er wollte weder Verwandte noch Freunde beim letzten Geleit.
Farids Familie suchte Mala nicht nur im Sommer auf, um der stickigen Hauptstadt Damaskus zu entkommen und in den Bergen die Nächte durchzuschlafen, sondern man kam auch zu Ostern für eine ganze Woche, um die Erinnerung an den Familiengründer Jahr für Jahr neu zu beleben. Nicht nur während des Gottesdienstes am Ostersonntag, sondern sieben Tage lang durften Verwandte wie Fremde mit der Familie für die Seele des ersten Muschtak beten, damit er im Schoße Gottes den Frieden fände, den er zu Lebzeiten nicht hatte finden können. Vor allem aber wurden die Gäste, Fremde wie Freunde, sieben Tage lang bestens bewirtet. Das ganze Leben im Dorf schien nur noch aus einer einzigen Fressorgie zu bestehen. Kolonnen von Bauern zogen aus der ganzen Umgebung nach Mala. Bettler und Gaukler, Zigeuner und Handwerker kamen, um die Woche dort mitzuerleben.
Die Osterwoche stand ganz im Zeichen der Herrschaft dieser Familie. Weihnachten dagegen lag fest in der Hand der Schahin-Sippe, die mit den Muschtaks in Blutfehde lag. Das Dorf war gespalten: Zur Hälfte folgten die Bewohner der römisch-griechischen Orthodoxie und mit ihr der reichen Familie Schahin und zur anderen Hälfte der römisch-katholischen Kirche, die in Mala fast ausschließlich von den Muschtaks finanziert wurde.
Da beide Kirchen nach verschiedenen Kalendern feierten, war Ostern nicht selten ein äußerst makabres Schauspiel. Kaum hatte Jesus nach dem westlichen, gregorianischen Kalender der Katholiken sein Grab verlassen und fuhr zum Himmel auf, ließen ihn die Orthodoxen verhaften, machten ihm den Prozess und kreuzigten ihn am Karfreitag des östlichen, julianischen Kalenders. Die Muslime hatten jedes Jahr etwas zu lachen.
Weihnachten aber strahlten die Fenster und die Kirche im orthodoxen Viertel und die Familie Schahin feierte die ganze Woche lang bis zum 2. Januar. Ihre Verwandten reisten zu diesem Fest sogar extra aus Amerika an. Bei den Muschtaks dagegen blieben zu Weihnachten die Häuser dunkel und die katholische Kirche feierte den Tag so bescheiden, als wäre Jesus irgendein Heiliger dritter Klasse.
Farids Mutter, eine typische Städterin, betrachtete das Ganze, auch das Benehmen ihres Mannes, eher belustigt als derbe Folklore von Bauern. Sie hatte in all den Jahren nicht den geringsten Zugang zum Innern der Seele Malas gefunden. Aber sie wollte es auch gar nicht. Vielmehr erzwang sie sich durch Großzügigkeit Respekt und sonderte sich ansonsten von den Muschtaks ab. Sie war die einzige Frau des Clans, die überall mit ihrem Vornamen bekannt war – als »Madame Claire«.
Sie fand weder Geschmack an den Gerichten Malas, die immer nach dem Urin der Hammel oder Ziegenböcke rochen, noch am ärmlichen Kuchen und schon gar nicht an den trockenen Früchten, die die Bewohner des Dorfs den Besuchern vorsetzten. Von ihrem Balkon aus amüsierte sie sich über das bunte Treiben auf den Straßen und dem Dorfplatz, als wäre sie im Theater. Claire liebte Boulevardtheater.
Die österliche Jahreszeit war neben dem Herbst die schönste in Mala. Es gab schon sommerliche Sonne, jedoch ohne die lästige Hitze. Eine frische Brise wehte von den Libanonbergen, die zu dieser Zeit immer noch schneebedeckt waren. Die Natur stand bereits in voller Blüte und das zarte Grün säumte die malerischen Felsen am Rande des Dorfs.
Farid schämte sich jedoch seines Vaters, der jedes Mal eine Metamorphose durchlebte. Der Mann, der in der Stadt den hochnäsigen eleganten Städter gab und sein Arabisch mit französischen Wörtern schmückte, zog sich bei seiner Ankunft in Mala um und wurde zum grunzenden, grölenden und streitsüchtigen Bauernburschen, der Nacht für Nacht am Rande einer Alkoholvergiftung nach Hause taumelte. Er, der zu Hause selten lachte, wurde auf der Dorfstraße zum Clown und lästigen sentimentalen Tätschler.
Farid genierte sich, unter die Leute zu gehen, weil sie, vor allem wenn sie betrunken waren, mit Kommentaren und Sticheleien nicht sparten, die immer nur ein Thema hatten: die Frauenaffären seines Vaters und das überdimensionale Ding, das Elias zwischen den Beinen trug. Die versammelten Männer machten sich oft lustig über den schüchternen Sohn. Nur Sadik, der schwerhörige Müller des Dorfs, ärgerte und stichelte nie. Aber mit ihm zu reden war mühsam. Man musste dauernd schreien. Sadik wirkte komisch, wenn er Geheimnisse flüsterte. Er gebärdete sich zwar wie ein Flüsterer, doch er brüllte die angeblich vertrauliche Botschaft so laut, dass selbst die Toten im fernen Friedhof aufmerksam wurden.
»Die Lautesten unter den Lachern sind die, deren Frauen dein Vater bereits gefickt hat«, hatte Sadik vor einem Jahr beim Friseur gebrüllt. Farid war rot geworden und hasste das Dorf, dessen Leben nur darin zu bestehen schien, zu ackern, zu fressen, zu saufen und überall hinzukacken. Ansonsten schlugen sie sich stolz auf die Brust, dass sie angeblich Jesus Christus vor dem Untergang gerettet hatten.
»Wenn ich Jesus wäre«, hatte Farid bereits mit zehn Jahren zu seiner Mutter gesagt, »ich würde – und sei es nur für eine Minute – am Sonntag über dem Altar erscheinen und den Heuchlern ins Gesicht brüllen: ›Ihr könnt mich alle am Arsch lecken mit eurem versauten Christentum!‹«
9. Annäherung
Im Sommer konnte Farid immer wieder interessante Kinder in Mala treffen, die hier mit ihren Eltern die Ferien verbrachten. Es waren wohlhabende Städter. Mit ihnen ließ sich das Dorf doch noch abenteuerlich finden. Sie verwandelten die Felsen in Westernlandschaften und spielten den ganzen Tag Cowboy und Indianer oder Räuber und Gendarm, nicht selten sogar mit richtigen Pferden und Eseln.
Aber zu Ostern ödete ihn Mala an. Er war gerade neun, als seine Mutter eines Tages bemerkte, wie er in der Wohnung herumhing und die Stunden zählte, bis sie nach Damaskus zurückfuhren. Sie empfahl ihm, er solle sich einen deftigen Proviant nehmen und eine lange Wanderung mit ein paar Kindern aus dem Dorf machen, die ihm die Gegend und die Spuren der Vorfahren zeigen könnten.
Erst wollte er nicht, aber dann ging er doch zu ihnen. Und bald wanderten sie täglich durch die Berge. Von den Vorfahren oder der Geschichte hatten die Dorfjungen zwar nicht die blasseste Ahnung, aber Farid, der in Damaskus zu den Schnellsten und Ausdauerndsten zählte, musste einsehen, dass er hier draußen in der Wildnis beim besten Willen nicht mithalten konnte. Sie, die auf dem Dorfplatz so behäbig wirkten, wurden auf einmal flink und geschmeidig, wenn sie die Wildnis schnupperten. Sie rannten wie junge Gazellen, kletterten wie Eidechsen die glatten, steilen Baumstämme hoch und stellten wie Jagdhunde Hasen und Steinhühnern nach. Der dreizehnjährige Abdullah konnte mit einer Schleuder und einem Kieselstein jedes noch so schnelle Tier tödlich treffen. Seine erste Beute, als Farid dabei war, wurde ein Steinhuhn. Bald darauf erlegte er einen Hasen. Die Jungen stürzten sich auf die Beute und innerhalb kürzester Zeit waren Steinhuhn wie Hase gerupft, gehäutet, sauber ausgenommen und gewaschen. Sie grillten das Fleisch über einem Feuer nahe der alten Ulme. Immer wieder warfen sie Thymian und andere Kräuter hinein und ein angenehmer Duft machte sich breit. Farid hatte noch nie so würziges Fleisch gegessen.
Matta, ein merkwürdig einsilbiger und einfältiger Junge, war bärenstark. Er konnte es ganz allein gegen die anderen vier aufnehmen, warf sie aufs Kreuz und hielt sie alle zusammen am Boden. Auch Steinbrocken von über fünfzig Kilo hob er ohne sichtliche Anstrengung über den Kopf. Das Wundersame aber war, dass er auch jeden Baum mit Leichtigkeit hochklettern konnte – genau wie ein Bär. Als hätten seine Hände und Füße alle Stämme, alle Äste und Zweige verinnerlicht, passten sie sich jedem Baum an. Er schien geradezu nach oben zu gleiten. Dort schwang er sich dann von Ast zu Ast und von Baum zu Baum, als wäre er ein Affe.
Matta himmelte Farid an und er war glücklich, sich zu den Freunden des blassen Jungen aus der Stadt zählen zu dürfen. Er ahnte nicht, dass auch Farid ihn wie ein seltsames Wesen bestaunte.
Claire beschenkte die Freunde ihres Sohnes reichlich. Jeder von ihnen bekam nun Jahr um Jahr etwas zu Ostern: teure Taschenmesser, raffiniertes Werkzeug, Geschirr für Ausflüge und dazu Unmengen Schokolade. Seither warteten sie zur Osterzeit und im Sommer sehn-süchtig auf Farids Ankunft. Sie spürten eine seltsame Anziehung durch den bleichen Städter, der zwar nicht einmal einen Berg mit einem Stein treffen konnte, aber dafür nie um ein Wort verlegen war. Sein Mundwerk erschien ihnen geradezu wundersam. Er sprudelte nicht nur unentwegt witzige Kommentare hervor, sondern konnte auch seine Zunge satteln und davonreiten, dass die anderen atemlos wurden. Farid erzählte derart gut, dass man alles genau vor Augen sah. Darin lag das Wunder, denn die Jungen waren solche Geschichten nicht gewohnt. Zu Hause hörten sie selten welche und die trieften dann von Moral, so dass sie sich bald langweilten. Seine Worte kamen dagegen bunt und leichtfüßig daher und kitzelten ihr Herz.
Mit Worten entführte er sie in eine fremde Welt, in der es schöne Frauen gab und noch etwas anderes wichtig war als bloß das tägliche Überleben. Das Jahr hatte nicht nur Saat- und Erntezeit, sondern dreihundertfünfundsechzig Tage und Nächte, in denen ständig etwas Aufregendes passierte.
Und komischerweise, so fremde Dinge er ihnen auch auftischte, sie hatten ein Urvertrauen zu ihm und glaubten ihm jedes Wort. Das, was Madame Claire als Proviant mitgab, schien ihnen allerdings noch märchenhafter. Sie genossen die Speisen beim Zuhören und wussten bald nicht mehr, ob nun die Worte oder die Wegzehrung sie mehr entführten.