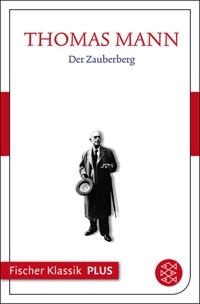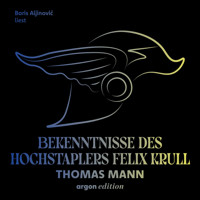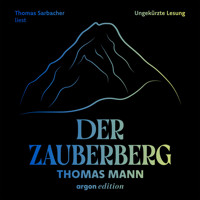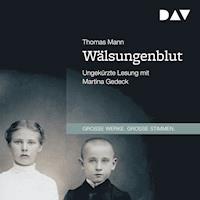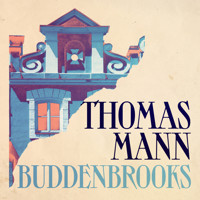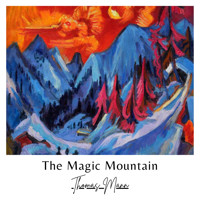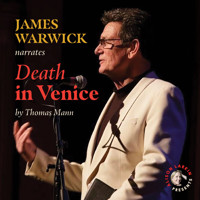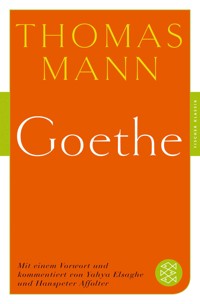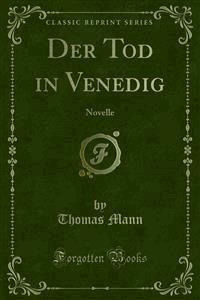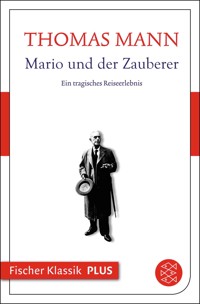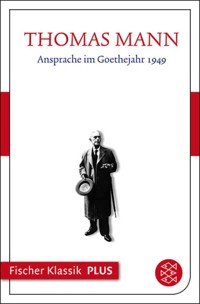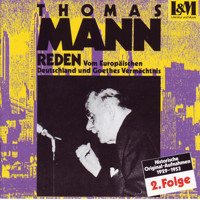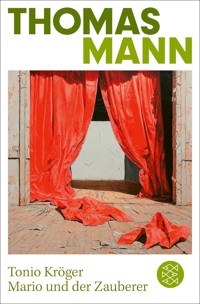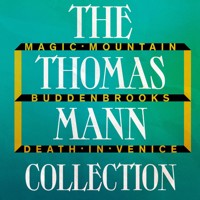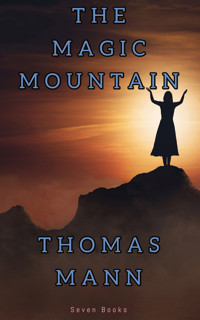1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Fischer Klassik Plus
- Sprache: Deutsch
Mit Hermann Graf Keyserling war Mann bereits auf verschiedene Weise in Kontakt gekommen, so hatte er sich beispielsweise 1920 unter dem Titel ›Klärungen‹ in einem offenen Brief an den baltischen Privatphilosophen gewandt. Keyserling, dessen Familie nach dem Ersten Weltkrieg enteignet worden war, vertrat recht konservative Ansichten und insbesondere in den Jahren 1918/19 hatte Mann sich darin noch teilweise wiedergefunden. Im Mittelpunkt dieser Arbeit steht die Homosexualität, ein Thema, das für Mann, wie wir heute wissen, von besonderer Bedeutung war. Hier äußert er gar: »Die Ehe also – ein Problem. Problematisch geworden in der Zeit, wie alles.« Allgemein wurde in jenen Jahren die Theorie der sogenannten »Männerbünde« als eines zweiten Gesellschaftsprinzips neben der traditionellen Familie in intellektuellen Kreises durchaus ernsthaft diskutiert. Der Text entstand als Beitrag zu einem von Keyserling herausgegebenen Werk, ›Das Ehe-Buch. Eine neue Sinngebung im Zusammenklang der Stimmen führender Zeitgenossen‹ (1925). Er wurde außerdem in gekürzter Form in Zeitungen abgedruckt und in Werkausgaben aufgenommen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 30
Veröffentlichungsjahr: 2009
Ähnliche
Thomas Mann
Die Ehe im Übergang. Brief an den Grafen Hermann Keyserling
Essay/s
Fischer e-books
In der Textfassung derGroßen kommentierten Frankfurter Ausgabe(GKFA)Mit Daten zu Leben und Werk
{1026}Die Ehe im Übergang
BRIEF AN DEN GRAFEN HERMANN KEYSERLING
Werter Graf Keyserling!
Die Leute aufs Glatteis zu führen, ist eine wenig humane Liebhaberei, die seit des Sokrates Tagen als typischer Zug im Charakterbilde des Philosophen bekannt ist. Daß Sie einer seien, habe ich immer schon sagen hören, und ich zweifle nicht länger daran, seitdem Sie uns zu schriftstellerischer Betreuung ein Thema zu unterbreiten die Gewogenheit hatten, das man wohl als glättestes Glatteis ansprechen darf – als so glatt und tükkisch in der Tat, daß man viel Tänzermut und –lust in sich verspüren muß, um es, in Erinnerung an ein Nietzsche-Verschen, als »Paradeis« zu empfinden. Die stille Zuziehung eines kleinen Kommandos rotbekreuzter Sanitätspersonen wird sich empfehlen bei Abhaltung des prekären Eisfestes, als dessen Veranstalter Sie zeichnen; denn daß sich allerlei pflegebedürftige Zwischenfälle dabei ereignen werden, ist leider vorauszusehen, und niemand kann sagen, ob er nicht einen dieser »Fälle« bilden wird. Immerhin, beiseitezustehen wird nicht angängig sein. Man hätte keine Entschuldigung als die der Furchtsamkeit. Man ist Ehemann, man hat nicht das Recht, zu sagen: Die Sache, die freilich hinlänglich problematische Sache, schiert mich den Teufel. Die Aufforderung hat etwas persönlich und zeitlich Verpflichtendes. Hic Rhodos, hic salta.
Die Ehe also – ein Problem. Problematisch geworden in der Zeit, wie alles. Unsere Großeltern, wohl ihnen, hätten es nicht verstanden. Es sind schlimme Zeiten, in denen das Notwendige, die Urordnung, unmöglich zu werden scheint, von innen heraus, aus dem Menschen heraus, der an und für sich ein {1027}problematisches Wesen ist, der Natur verbunden, dem Geiste verpflichtet, ein vom Gewissen geplagtes, zum Idealistischen und Absurden gezwungenes Geschöpf, mit dem Hange, beständig den Zweig abzusägen, auf dem es sitzt. Nehmen Sie das Dienstbotenwesen, eine der sozialen Grundlagen des Verhältnisses, der Urordnung, wovon wir reden. Denn die Ehe ist zwar keine »bürgerliche« Einrichtung, es sei denn, wir nähmen dies Wort in seinem höchsten Verstande, dem der Lebensbürgerlichkeit; aber sie hat bürgerliche, soziale Grundlagen, – die erschüttert sind. Das haustierhafte Knechts- und Magdverhältnis, das Gesindewesen, nach seinem primitiven und epischen Ursinn kaum auf dem Lande noch leidlich erhalten, ist in den Städten vollends der Zersetzung verfallen, in die Sphäre sozialer Gewissenskritik, Emanzipation und Auflösung gerissen. Jedermann sieht, daß der Dienstbotenstand, als patriarchalisches Rudiment in die Zeit hineinragend, dank jener generösen Unklugheit des Menschen längst innerlich unmöglich geworden ist, und niemand sieht ab, wie es damit werden und enden soll; denn der epische Begriff des »Hauswesens«, wie noch Kant ihn handhabte, und dessen Zubehör Mann, Weib, Kind und Gesinde bildeten, ist schon damit gesprengt. – Ich sagte, die Ehe sei keine »bürgerliche« Einrichtung. Ich wollte sie damit sicherstellen gegen das zermalmendste Schimpfwort der Zeit und gegen die Verwechslung, die bei seinem revolutionären Gebrauch so leicht und unbeachtet sich einschleicht: die Verwechslung des eigentlich Bürgerlichen mit dem Urgegebenen und menschlich Ewigen, dem Zeit- und Alterslosen. Ich weiß nicht, ob es Konservatismus ist, an dergleichen zu glauben, aber ich glaube daran. Zum Beispiel glaube ich an die Zeitlosigkeit, die Vor- wie Nachbürgerlichkeit, die menschliche Ewigkeit der künstlerischen Grundformen und –seelen, an den Geist der Epik etwa, der heute mit Hilfe jener Verwechslung {1028}